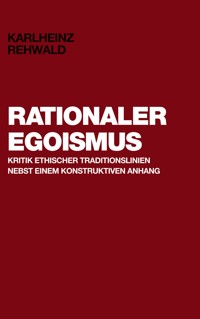
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Buch wendet sich vorderhand an Lehrende und Lernende des Fachs Ethik, des Weiteren an alle Interessierte moderner Wertedebatten. Es kommt also moralphilosophisch daher, beinhaltet aber reichlich kritischen, insbesondere ideologiekritischen Bezug zu unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit. Schwerpunkt ist eine Durchsicht relevanter historischer wie zeitgenössischer ethischer Argumentationslinien. Im letzten Teil wird versucht, Wertvolles der philosophischen Debatte zu retten, nämlich im Wesentlichen den Kantschen "Kategorischen Imperativ" (in der diskursethischen Fassung), aber freilich nicht im Gegensatz, sondern gerade im Einklang mit einem wohlverstandenen Eigeninteresse. "Egoismus" wird also nicht im verbreiteten Sinne verwendet, ist das Gegenteil von borniertem (Konkurrenz-)Egozentrismus und "rational" wird zweimal unterstrichen! An diesem humanistischen Ethikkonzept blamiert sich dann das kapitalistische Geldvermehrungsprinzip und stellt sich als damit unverträglich heraus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
0. Vorwort
1. Worum’s geht:
Normative Ethik als Problem
2. Wie’s nicht geht, zeitgenössisch
Axel Honneths Kritik an normativer Ethik: „Das Recht der Freiheit“ – Protokoll einer kritischen Lektüre
2.1. „Gerechtigkeitstheorie als Gesellschaftsanalyse“
2.2. „Historische Vergegenwärtigung: Das Recht der Freiheit“
2.3. „Die Idee der demokratischen Sittlichkeit“
2.3.1. „Rechtliche Freiheit“
2.3.2. „Moralische Freiheit“
2.3.3. „Soziale Freiheit“
2.4. Fazit
2.5. Ein Blick zurück hilft – vielleicht
3. Wie’s (nicht) geht, historisch
3.1. Das Schwergewicht: Kants deontologische Ethik
3.2. Kontraktualismus: Thomas Hobbes & Co
3.3. Der Appell ans Gefühl
3.3.1. Humes „Prinzipien der Moral“
3.3.2. Schopenhauers „Grundlage der Moral“
3.4. Der utilitaristische Konsequentialismus
3.5. Tugend- und Glücksethik bei Aristoteles
3.6. Einschub: Religiöse Moralbegründung
4. Was zeitgenössisch (nicht) hilft
4.1. Alasdair MacIntyres „Verlust der Tugend“
4.2. John Rawls „Theorie der Gerechtigkeit“
4.3. Jürgen Habermas‘ Diskursethik
5. Wie’s konsistent geht:
ein konstruktiver Anhang
5.1. Die Ethik E des rationalen Egoismus
5.2 Die Ethik E als Ideal
5.3. Zum Egoismus-Begriff; Precht; Russell; Stirner; Frankena; Ayn Rand
5.4. Eine „Minimalmoral“ nach N. Hoerster
5.5. Das gute Leben und seine notwendigen Voraussetzungen
5.6. „Was tun?“
5.7. Die Geburt der Utopie aus dem Geiste der Kritik
5.8. E und Stichworte aktueller Ethik-Debatten: Würde; Forschung an embryonalen Stammzellen; Tierethik; Präimplantationsdiagnostik; Sterbehilfe; Hirnforschung/freier Wille/ Verantwortung; Ökologie
5.9. Aufklärung und Kritik!
6. Verwendete Literatur
0. Vorwort
„Eine Erklärung, wie sie in einer Schrift in einer Vorrede nach der Gewohnheit vorausgeschickt wird, – über den Zweck, den der Verfasser sich in ihr vorgesetzt, sowie über die Veranlassungen und das Verhältnis, worin er sie zu anderen früheren oder gleichzeitigen Behandlungen des Gegenstandes zu stehen glaubt –, scheint bei einer philosophischen Schrift nicht nur überflüssig, sondern um der Natur der Sache willen sogar unpassend und zweckwidrig zu sein. Denn wie und was von Philosophie in einer Vorrede zu sagen schicklich wäre – etwa eine historische Angabe der Tendenz und des Standpunkts, des allgemeinen Inhalts und der Resultate, eine Verbindung von hin und her sprechenden Behauptungen und Versicherungen über das Wahre – kann nicht für die Art und Weise gelten, in der die philosophische Wahrheit darzustellen sei.“1
G.W.F. Hegel hat ja Recht, wenn er betont, dass „die Sache … nicht in ihrem Zwecke erschöpft (ist), sondern in ihrer Ausführung“, das hindert ihn aber nicht, sich in seiner Vorrede zur „Phänomenologie des Geistes“, bei Meiner immerhin knapp 60 Seiten, zwar nicht über Inhalt und Resultate, aber sehr wohl über den Zweck, durchaus über Veranlassung und vor allem seine Methode auszulassen. Darin möchte ich ihm gerne folgen.
Zweck der Veranstaltung ist unmittelbar ein, während meiner Dienstzeit sukzessiv entwickeltes, Interesse an kritischer Durchsicht relevanter – in Unterricht und Studium – normativ-ethischer Traditionslinien nebst einem daraus zu ziehenden Schluss.
Methode soll ein rationales Filterverfahren sein, das Spreu von Weizen trennt: „Drum prüfet alles, das Gute aber behaltet“(Paulus). Um’s Eigeninteresse kommt man dabei nicht herum, fragt sich eben nur, wie es sich fasst! Eine eliminativ gewonnene Synthesis sollte sich als Schluss dann schon ergeben, eine Ethik des rationalen Egoismus mit weitreichenden Konsequenzen. Anlass aber war die Kenntnisnahme einer spannenden Variante ganz freien Philosophierens in Gestalt von Axel Honneths „Das Recht der Freiheit“. Zunehmende Faszination dieser modernen Sinndeutung von gesellschaftlicher Wirklichkeit führte zu einer sorgfältigen Lektüre, die ihren Niederschlag in einem länglichen kritischen Protokoll fand. Dieses 2.Kapitel fungiert als Klammer für den gesamten kritischen Teil (Kap.2 bis 4), ist zwar ein „Sprung ins kalte Wasser“, aber als belebender Einstieg geeignet, da es eine Fülle von Problemfeldern eröffnet. Wer sich eher für die Kapitel 3 und 4 interessiert, möge das Fazit 2.4. mitnehmen und somit ins Wärmere sich flüchten.
„Leere Breite“2 bei der Auswahl der besprochenen Werke und normativen Linien habe ich versucht zu vermeiden, bin hoffentlich dabei nicht in „leere(r) Tiefe“ versunken. Erfahrungen in Studium und Oberstufenunterricht waren Anstöße, oberflächliches Drüber- und Wegwischen zu bannen. Statt dem Resultat des Belesenen: „Ich weiß, dass ich nichts weiß“, der sich nach der Lektüre des n-ten Buchs endlich Erkenntnis vom (n+1)-ten verspricht, lieber das „Viel, aber nicht Vieles“. Letzteres eine Maßregel, die Ernst zu nehmen ich meinem geschätzten Mathematiklehrer Prof. Dr. Burde verdanke.
Auch wer mit den Darlegungen nicht vollständig einverstanden ist, kann sich an einer Fülle kritischer Anregungen erfreuen.
Klärung vorweg: Der Begriff „Ethik“ steht, im Unterschied zu „Moral“/„Moralität“ (mores: Sitten, Charakter) als gelebtem normativen „Grundrahmen für das Verhalten“ (O. Höffe, Lexikon der Ethik), für die reflexive Theorie moralischer Sachverhalte. Ethik fällt also mit „praktischer Philosophie“ bzw. „Moralphilosophie“ oder – antiquiert – einer Theorie „guten Lebens“ zusammen.
Für die freundliche Durchsicht des Manuskripts danke ich B. Asamoa.
K. Rehwald, im März des 250sten Geburtsjahrs von G.W.F. Hegel
1 Hegel, Phänomenologie des Geistes, Verlag Meiner, S.9
2 Hegel, Vorrede …, S.15
[non vitae, sed scholae discimus, Seneca]
1. Worum’s geht:
Normative Ethik als Problem
Mündliche ABI-Prüfung Ethik. Kandidat MM. Im reproduktiven Teil den zeitgenössischen Text korrekt-bündig gefasst, im zweiten, „Reorganisation und Transfer“, den obligaten Bezug zur Deontologie nach Kant elegant hergestellt: der „gute Wille“, „Pflicht, du erhabener, großer Name, …“, der „Kategorische Imperativ, Erste Formel“ in Differenz zur „Goldenen Regel“ mit gelungenem Bezug zum „Würde“-Begriff des GG, des weiteren clevere Gegenüberstellungen zu mitleidsethischen bzw. utilitaristischen Positionen. „Reflexion und Problemlösen“ im letzten Teil mit persönlicher überzeugendaffirmativer Stellungnahme zur kantischen „Vernunft“-Ethik, insonderheit mit gelungenem Verweis auf Kants Rigorismus „Über ein vermeintliches Recht aus Menschenliebe zu lügen“. 15 Punkte.
Nachmittags treffe ich MM wieder in der Cafeteria, glücklich, locker. Es reizt mich doch sehr, nochmals auf den überaus glatten Prüfungsverlauf zurückzukommen und ich frage also leicht provokativ, ob er denn bei dem emphatisch Vorgetragenen mit sich selbst im Reinen sei?! … … Längere Gesprächspause, freundlicher Augenaufschlag: „Ach, Herr Rehwald, ……“!!!
Hatte ich einen „Klügling“(Kant) vor mir, der der „Theorie“ „ihren Wert in der Schule … einräumt, dabei aber zugleich behauptet: daß es in der Praxis ganz anders laute; daß, wenn man aus der Schule sich in die Welt begibt, man inne werde, leeren Idealen und philosophischen Träumen nach gegangen zu sein; mit einem Wort, daß, was in der Theorie sich gut hören lässt, für die Praxis von keiner Gültigkeit sei.“1?
Kann es nun ernsthaft sein, dass der Ethik-Unterricht – normativ – oder zumindest etliche Ethiken aus dem normativen Traditionsbestand sich an der Wirklichkeit restlos blamieren? Oder vielleicht doch eher umgekehrt?? Wobei letzteres unseren Kandidaten vermutlich ebenso wenig gestört hätte …
Nach dem „Kerncurriculum Ethik“/Hessen2 „kann Bildung Lernende dazu befähigen, selbstbestimmt und in sozialer Verantwortung, …, ihr Leben zu gestalten und wirtschaftlich zu sichern.“
Aber nicht zuletzt F. Fellmann3 stellt einen „Vorbehalt gegenüber dem Fach“ fest:
„Nicht wenige Schüler und Eltern betrachten Ethik als überflüssiges Fach, da es den Anschein folgenlosen Geredes über unerfüllbare Normen und weltfremde Gebote erweckt. … Wie kann er (der Lehrer; d.V.) beispielsweise Kants „Kategorischen Imperativ“ Schülern nahe bringen, von denen die meisten die Gesellschaft als moralisch verkehrte Welt erleben?“
So doch reichlich genau das vom anderen verlangt wird, was man selbst nicht ganz so genau einzuhalten gewillt ist, in Familie und Schule, am Arbeitsplatz und im Straßenverkehr!
Niccolo Machiavelli macht sich’s da leicht: „Denn die Art, wie man lebt, ist so verschieden von der Art, wie man leben sollte, daß, wer sich nach dieser richtet statt nach jener, sich eher ins Verderben stürzt, als für seine Erhaltung sorgt; denn ein Mensch, der in allen Dingen nur das Gute will, muß unter so vielen, die das Schlechte tun, notwendig zugrunde gehen.“4
F. Fellmann gibt nicht so leicht auf und fordert eine „Einheit von Theorie und Praxis“, so dass „moralische Verpflichtungen … von den Menschen als angemessene Antworten auf die Lebensumstände erlebt werden“5 müssen.
Oder verstößt man hier gegen das „Humesche Gesetz“, wenn allzu flott aus dem Sein ein Sollen wird? Richtet hier der „Weisheitsdünkel“(Kant) „den größten Schaden an.“? „Denn hier ist es um den Kanon der Vernunft … zu tun, wo der Wert der Praxis gänzlich auf ihrer Angemessenheit zu der ihr untergelegten Theorie beruht, und alles verloren ist, wenn die empirischen und daher zufälligen Bedingungen der Ausführung des Gesetzes zu Bedingungen des Gesetzes selbst gemacht“6werden.
Übereinstimmend mit Art.4/GG (Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses) findet sich z.B. im „Kerncurriculum Ethik“/Hessen kein Hinweis auf irgendeinen normativen Geltungsanspruch im Fache Ethik, indem man dem Unterricht7 lediglich eine „deskriptiv-exploratorische Begegnung und Auseinandersetzung mit existentiellen Fragen der Weltdeutung und Sinnfindung“ zuordnet und expressis verbis bei den Bereichen Geschichte, Politik, Ökonomie und Recht auf die „normativ-evaluative Auseinandersetzung“ verweist!
Ausschließlich Normativismus des politökonomisch Faktischen?
Knicken Kants übergeordnete „Vernunft“-Gründe knieweich ein vor der „Anmaßung, die Vernunft selbst … durch Erfahrung reformieren zu wollen“? Im allgemeinen …, oder eher im besonderen, da „nicht genug Theorie da war“8?
Oder gilt es eben, die normativen Ansprüche rechtfertigenderweise mit der Realität zu versöhnen, indem man sich bemüht, die „ „konstruktiv“ gewonnenen Prinzipien zugleich als Ausdruck der gegebenen Wertorientierungen darzustellen“9?
Fragen über Fragen …
Ein Frankfurter Sozialphilosoph widmet sich dem alten Problem und macht sich ans Werk einer „normativen Rekonstruktion“ als prinzipielle Kritik an konstruktiv-normativer Ethik.
1 Kant, Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis, Werkausgabe Suhrkamp, Bd. XI, S.128
2 Hess. Kultusministerium, Kerncurriculum Ethik, Gymnasiale Oberstufe, S.4
3 Ferdinand Fellmann, Die Angst des Ethik-Lehrers vor der Klasse, Reclam, S.10
4 N. Machiavelli, Der Fürst, Insel-Verlag, 1990, S.7
5 Fellmann, a.a.O., S.10
6 Kant, a.a.O., S.129
7 a.a.O., S.5
8 Kant, a.a.O., S.129/127
9 Axel Honneth, Das Recht der Freiheit, suhrkamp 2011, S.21
[Man sollte doch gefälligst die Grenzwerte nach der Wirklichkeit richten und nicht dauernd umgekehrt, woran man sich nicht hält; Frank M. Barwasser alias Erwin Pelzig zum „Dieselskandal“]
2. Wie’s nicht geht, zeitgenössisch:
Kritik an normativer Ethik: Verklärung! A.Honneth1 und „Das Recht der Freiheit“ – Protokoll einer kritischen Lektüre
2.1. Axel Honneth treibt ein Ungenügen, mehr noch, er sieht die ganze „politische Philosophie der Gegenwart“ leiden: am „Siegeszug“ einer Traditionslinie nach Kant (Rawls, Habermas), die normative Prinzipien „vernünftig“ zu begründen sucht, angeblich „zumeist in Isolation von der Sittlichkeit gegebener Praktiken und Institutionen“, was ihm eine „philosophische Herabsetzung der moralischen Faktizität“2 ist.
Prompt erinnert Honneth den alten Kant-Überwinder Hegel: den störte schon damals, dass „die sittliche Welt …, der Staat, … nicht des Glücks genießen soll, „daß es die Vernunft ist, welche in der Tat in diesem Elemente sich zur Kraft und Gewalt gebracht habe“, der den „Brei des Herzens“ und die „Rabulisterei der Willkür“ geißelte, die an die an sich vernünftige Wirklichkeit3 herangetragen werden, hochmütig und sogar „gottverlassen“. So käme es also bei Hegel darauf an, „daß die Philosophie, weil sie das Ergründen des Vernünftigen ist, eben damit das Erfassen des Gegenwärtigen und Wirklichen, nicht das Aufstellen eines Jenseitigen ist, das Gott weiß wo sein sollte“, kurz „den Staat als ein in sich Vernünftiges zu begreifen und darzustellen.“
Rechtfertigungsphilosophie als ideelle Rationalisierung der Welt, die’s eh gibt!
Aber Halt!! Solch „primitive Vorstellung, den gegebenen Institutionen die Aura moralischer Legitimität zu verleihen“4 ist Honneths Sache nicht! Nein, er „wollte“ doch nur, aber immerhin, „dem Vorbild der Hegelschen „Rechtsphilosophie“ in der Idee folgen, die Prinzipien sozialer Gerechtigkeit direkt in Form einer Gesellschaftsanalyse zu entwickeln“5.Kritisch soll’s schon zugehen, am besten nach dem beliebten Verfahren „immanenter Kritik“ der Frankfurter Schule: eine „normative Rekonstruktion“ soll’s sein, „um im typisierenden Nachvollzug der historischen Entwicklung der einzelnen Sphären zu prüfen, bis zu welchem Grade die hier jeweils institutionalisierten Freiheitsverständnisse inzwischen bereits zur sozialen Verwirklichung gelangt sind.“6
Dieser Satz verblüfft, genauso jedoch zunächst der Buchtitel: „Das Recht der Freiheit“ – nicht etwa „Das Recht auf Freiheit“! Es sind doch empirisch allemal staatliche Gewalten , die, nach wie auch immer gestalteten historischen Kämpfen, die Freiheits“sphären“ lizensieren und ins positive Recht setzen!
Weht hier, wirklich ganz hegelianisch, der Wind einer selbst machtvollen, daseinsgestaltenden „Idee“ als „Freiheit“(Hegel7), die einzulösende „Versprechen“(Honneth8) in die Welt setzt, an der sich letztere zu bewähren hat? Honneth konzediert, dass sein Unterfangen „nur gelingen“ konnte, „wenn die konstitutiven Sphären unserer Gesellschaft als institutionelle Verkörperungen bestimmter Werte (die sich für Honneth auf Freiheitswerte zusammenkürzen, d.V.) begriffen werden, deren immanenter Anspruch auf Verwirklichung als Hinweis auf die jeweils sphärenspezifischen Gerechtigkeitsprinzipien dienen kann.“9
Eine „Gesellschaftsanalyse“, die von der Prämisse lebt, den Gegenstand vorweg wert-idealistisch, als Realisierung einer „Grundidee“ „begreifen“ zu müssen, um sich ihm zu widmen? „Wie der Mensch die Welt anblickt, so blickt sie ihn an“(Hegel10)? Und das als dezidierte Absage an idealistischen Normativismus? Man ist auf diese Analyse gespannt.
Denkt man dabei begrifflich-redlich an eine unvoreingenommene systematische Untersuchung des Gegenstands („Gesellschaft“), so wird man wieder überrascht: um die „Hegelsche Absicht … aufzugreifen, eine Theorie der Gerechtigkeit aus den Strukturvoraussetzungen der gegenwärtigen Gesellschaften selbst zu entwerfen“11, bedarf es zunächst, voranalytisch, weiterer Prämissen – die vorab sich gar „nicht“ „begründen“ lassen –, um diese „Voraussetzungen“ unter die „Idee der Freiheit“12 stellen zu können.
Irgendwie sind es nicht gesellschaftliche Reproduktionsprozesse mit ökonomischen Interessen, mehr oder weniger dominant, unter staatlicher Ägide, die Normen – als positives Recht (Verfassungen, Straf- Zivilrecht) – generieren bzw. traditionelle, z.B. religiöse, relativieren, sondern in einem quid pro quo „muss in einer ersten Prämisse … vorausgesetzt werden, daß die jeweilige Form der sozialen Reproduktion einer Gesellschaft durch gemeinsam geteilte, allgemeine Werte und Ideale bestimmt ist“13. Im Anschluss an Parsons, bei dem „die ethischen Werte … die „letzte Realität“ jeder Gesellschaft bilden“ erkennt Honneth hier, allerdings nur in einem „schwachen Sinn“ eine „Verkörperung des objektiven Geistes“14 und ist mit obigem „gemeinsam“ schon mal vorweg überzeugt, dass die „Mitglieder“ moderner Gesellschaften sich nicht in staatlich regulierten, mehr oder minder komplexen, Interessengegensätzen15 mit deutlich disparitärer Schaden-Nutzen-Verteilung, sondern eher in einem ethisch-normativ fundierten „Kooperations-Zusammenhang“ befinden.
Wenn Hegel in seiner affirmativen Lobhudelei nur „knapp über den Horizont der existierenden Sittlichkeit hinwegschaut“16, so beansprucht der kritische Frankfurter jedoch in einer vierten Prämisse, dass „das Verfahren der normativen Rekonstruktion stets auch die Chance einer kritischen Anwendung bietet“! Die „Werte“, „Ideale“, „Maßstäbe“, nach denen sich die gesellschaftliche Reproduktion angeblich richtet, können dann freilich „auch herangezogen werden, jene gegebenen Praktiken als noch nicht angemessen“, als noch „mangelhafte, noch unvollständige Verkörperungen“17 derselben zu kritisieren! „Pathologien“/“Anomien“ werden großen Raum einnehmen. … …
Wird das die philosophische Fassung eines bekannten Ideologiegeschäfts, nämlich soziale Realität gar nicht als solche erklären zu wollen, also darzulegen, warum sie – nicht zufällig! – so ist, wie sie ist, sondern lieber sie nur an fiktiv-allgemeinen Idealen zu blamieren und so immerhin sie potentiell in eigentlichem, helleren Licht erscheinen zu lassen?
Apropos „Idee der Freiheit“: Der Autor ist auf den Seiten 35-43 bemüht, den Freiheitsdrang – geschichtsmächtig – als „Autonomie des Einzelnen“ zum Leitfaden für sich zu reklamieren, so es ihm doch, widersprüchlich dazu, im weiteren Verlauf der theoretischen Entwicklung gerade nicht um das Nomos des bloßen Selbst, sondern um Verwirklichung des letzteren als Einbettung und Erfüllung in der „Sittlichkeit gegebener Praktiken und Institutionen“ zu tun ist! Hegel hilft da vielleicht, wenn Honneth meint, dass dessen „Begriff des Rechts … der allgemeinen Ermöglichung und Verwirklichung der individuellen Freiheit dient“18. Aber: Hegel macht doch wirklich überdeutlich, wie letztere einzuordnen ist: „Allein der Staat ist überhaupt nicht ein Vertrag, noch ist der Schutz und die Sicherung des Lebens und Eigentums der Individuen als einzelner so unbedingt sein substantielles Wesen, vielmehr ist er das Höhere, welches dieses Leben und Eigentum selbst auch in Anspruch nimmt und die Aufopferung desselben fordert.“19; oder, im Verhältnis des Staats nach außen, ist ihm selbstverständlich „das Interesse und das Recht des einzelnen als ein verschwindendes Moment gesetzt“, als „Pflicht, durch Gefahr und Aufopferung ihres Eigentums und Lebens … diese substantielle Individualität, die Unabhängigkeit und Souveränität des Staats zu erhalten.“20
Der Autor weist hier zur Vertiefung der historischen Autonomie- und Freiheitstriebkraft sicher zu Recht auf so manche „Sozialbewegungen“ und deren Losungen hin. Nur: die „Arbeiterbewegung“ zumindest hatte und hat sicherlich nicht ihren Grund in „Mißachtung, die sie als unvereinbar mit Ansprüchen auf Selbstachtung und individuelle Autonomie erlebten“21, sondern wohl eher in materieller Not, Sorge und Ausnutzung. An anderer Stelle, in einem anderen Buch, interpretiert er die Marxsche Vorstellung vom „Klassenkampf“ als einen Versuch „bislang ausgeschlossener Gruppen“, „Anerkennung“ und „Würde“ in „der jeweils herrschenden Gemeinschaft“ zu finden! So was „Ähnliches“ habe jedenfalls angeblich Marx „vorgeschwebt“22. Hm …
2.2. Bevor Honneth jetzt richtig loslegt beim Entfalten seiner „Idee“, versichert er sich im Bildungsrekurs noch historischer Freiheits-Konzeptionen (negativ/reflexiv/sozial-positiv), nicht ohne – partiell – sie sich leicht unkritisch, jedenfalls interessiert zurecht zu legen.
Hobbes z.B. ordnet er rein dem Begriff negativer Freiheit zu, insofern dieser Denker der englischen Bürgerkriegszeit in einer spekulativen, sachlich unbegründeten negativen Anthropologie dem reinen Egozentrismus als „natürliche“ Rücksichtslosigkeit das Wort redet. Doch widersprüchlich dazu verlangt Hobbes dem „Menschen“ auch einen positiven, durchaus reflexiven Akt der zustimmenden Unterwerfung mittels fiktivem „Gesellschaftsvertrag“ unter den „Leviathan“ ab. (Rätselhaft bleibt übrigens bei Hobbes, wie diese Minimal-„Vernunft“ auf Grundlage seiner eigenen lupus-Anthropologie eigentlich möglich sein soll und verdankt sich sicher einfach seinem Willen an Befriedung gesellschaftlicher Verhältnisse; siehe 3.2.1.) Zweitens darf mit der Eigentums- und Vertragsgarantie des absoluten Staats auch nicht die positive Freiheit übersehen werden, mit Geld bzw. Produktionsmitteln gesellschaftlichen Reichtum mit Hilfe und auf Kosten eigentumsbefreiter Arbeit sich privat zu sichern und zu vermehren, so sehr diese positive Funktion auch Honneths „Kooperations“-Idee verweigern mag.
Bei Kant erkennt der Autor in der sog. „Zweckformel“ des Kategorischen Imperativs23, dass hier „eine Einstellung der universellen Achtung zum Ausdruck gelangt, sobald ich mich nämlich frage, ob die von mir auserkorene Handlungsmaxime (Kategorischer Imperativ, 1.Fassung, d.V.) die Zustimmung aller Mitsubjekte finden könnte, respektiere ich diese dadurch in ihrer Vernünftigkeit und behandle sie als Zwecke in sich selbst“.24 Genau betrachtet ist aber Subjekt der kantischen Formel gar nicht das Einzelsubjekt, sondern die „Menschheit“, noch dazu eingeschränkt als Summe von „Personen“, die bei Kant je schon „moralische Persönlichkeiten … unter moralischen Gesetzen“25 sind. Kant macht z.B. im „Lügenverbot“26 nur allzu klar, dass zur angeblichen Rettung der „Menschheit“ das Einzelsubjekt sehr wohl, sogar existenz-vollständig, zur Disposition steht! Zweitens verrät die Kantsche Formulierung selbst eine harte Skepsis bzgl. allzu großer Achtung der „Person“ als „Zweck in sich selbst“, sie soll ja nur „zugleich“ als Zweck und „niemals bloß“, also eventuell durchaus reichlich als Mittel gebraucht werden. So ein Realist der frühbürgerlichen Benutzungsverhältnisse war der aufgeklärte Königsberger doch allemal, dass die Würde des Einzelnen, als Zweck an sich zu gelten, sich ablöst von einer Perspektive gelungenen Lebens und durchaus verträglich ist mit so mancher Elendsexistenzweise!27 In diesem Realismus unterscheidet sich Kant von unserem Autor, der, wie man andeutungsweise am „Kooperations“gedanken schon merkt, eher zu gesellschaftlichen Harmonie-Vorstellungen neigt!
Deswegen stören Honneth hier auch die Theorien „reflexiver Freiheit“ von Rawls bis Habermas, da ihnen angeblich ein offener, allzu „unbestimmt“er28 Horizont zukünftiger „kollektiver Willensbildung“29 eignet. Das ist für ihn, in Hegel-Optik als bloße Gewissheit des „Sollens“, unbefriedigend, so es doch darauf ankommt, mutig zur „Wahrheit der Gewissheit“ voran zu schreiten, also die „sozialen Bedingungen … selbst schon als Bestandteile von Freiheit gedeutet“30 werden müssen und das vorhandene gesellschaftliche Gefüge „institutioneller Formen“ als Apriori der Realisierung in die „Freiheits“-Konzeption aufzunehmen ist: „soziale Freiheit“.
Honneth erwärmt sich an Hegels Phantasie, dass „die äußere, soziale Realität soll so vorgestellt werden können, daß sie frei von aller Heteronomie und jedem Zwang ist“, was aber auch „schwierig“ sein dürfte“31. Schwierigkeiten sind dazu da, nicht das Anliegen infrage zu stellen, sondern sie zu überwinden. In unserem Fall hilft ihm vermeintlich das „Bei-sich-selbst-Sein im Anderen“, was Hegel zu Recht den Idealen von Freundschaft und Liebe zuordnet.32 Hegels „ingeniöse Lösung“ bestünde nun darin, so ein Verhältnis ausgerechnet im „ökonomischen Markt“ als der Zentralsphäre „sozialer Freiheit“ zu entdecken, den Markt als „neue, indirekte Form des „Bei-sich-selbst-Sein(s) im Anderen“ aufzufassen“ und so ein „Anerkennungsverhältnis“ zu schaffen, „durch welches die Individuen ihre Freiheit erweitern können.“33 Wenn nun Hegel wechselseitige Anerkennung korrekt im „Vertrag“34 festmacht, so liegt aber – trotz Anerkennung der Partner – z.B. schon am einfachen Warentausch-Modell gerade kein „Bei-sichselbst-Sein im Anderen“ vor, denn das Gebrauchswert-Bedürfnis des Einen ist gerade nicht das Bedürfnis des Anderen, sondern umgekehrt wird die materielle Abhängigkeit bzw. Not der Partner jeweils als Mittel genutzt, um die Tauschrelation für sich günstig zu gestalten. Unter Einbeziehung der Geldform ergibt sich bei Kauf bzw. Verkauf derselbe prinzipielle Zusammenhang, insofern das materielle Interesse des Einen Erpressungsmittel für den Anderen zur Preismaximierung wird. Sofern die Nachfrage überhaupt sich als zahlungsfähige zeigt, was nochmals sehr nachdrücklich auf das Schräge der Vorstellung „komplementäre(r) Zielsetzungen“35 verweist – trotz wechselseitiger Anerkennungsrelation. Besonders virulent erscheint das Ganze freilich als Verhältnis Kapital/Lohnarbeit im Arbeitskontrakt.
In der Tat ist der frühidealistische Hegel als Quelle idyllischer Bilder vom „Anerkanntsein“ dienlich, so er in der „Jenaer Realphilosophie“ das System der „Begierde“ als „Arbeit Aller für Alle“ auffasst, wo „Jeder … dem Anderen (dient) und leistet Hilfe“36. Die Idylle verschwindet aber beim späten Hegel, wenn er in HR§244 „das Herabsinken einer großen Masse unter das Maß einer gewissen Subsistenzweise“ und die „Erzeugung des Pöbels“ beklagt – allerdings ohne dessen Notwendigkeit freilich zu erklären37 und konsequent sich in regulierende Konstruktionen von „allgemeine(r) Macht“/ „Polizei“ bzw. „Korporationen“ zu flüchten, die hilflos sind gegenüber den Ursachen.
Entgegen kommt Honneths Harmonie-Wollen aber nicht nur der frühe und vermeintlich der späte Hegel, sondern auch die etwas anders-hegelnde, „Geist“ mit „Arbeit“ vertauschende, Selbstverständigung des jungen Marx in seinen „ökonomisch-philosophische(n) Manuskripte(n)“ und den „J.Mill-Auszügen“, beide von 1844. Dessen abstrakte Negation der Hegelschen Geist-Metaphysik als Mystik des in „gegenständlicher Arbeit“ sich realisierenden „Gattungswesen(s)“38 gestattet ihm eine affirmative Brücke zu seinem „Kooperations“-Gedanken der sich wechselseitig Ergänzenden39.
Bearbeitet wird nicht zuletzt der späte Marx, um ihn der „Freiheit(s)“-Perspektive kompatibel zu machen: „ … in der vollendeten Kritik der politischen Ökonomie, dem Kapital, wird die kapitalistische Gesellschaftsformation vor allem deswegen kritisiert, weil sie den materialen Schein von nur noch sachlich vermittelten Sozialbeziehungen erzeugt, die die intersubjektive Struktur der Freiheit aus den Blick geraten lassen“40. Nicht die Kritik an Ausbeutung im Verhältnis Lohnarbeit/Kapital und der zugeordneten Schaden/Nutzen-Verteilung gerade auf Grundlage von Eigentums- und Vertrags-Freiheit, sondern ausgerechnet seine demystifizierenden Hinweise auf den „Fetischcharakter“41 von Ware bzw. Wertform sollen den späten Marx charakterisieren. Als ob der nicht gerade vernünftig geplante sachliche „Sozialbeziehungen“ im Kopf hatte, wenn er dort und später der Reduktion des „Reichs der Notwendigkeit“ zugunsten des privaten „Reichs der Freiheit“ das Wort redet42. Honneth hält an seinem idealistischen „Bei-sich-selbst-Sein im Anderen“-Modell als „Selbstverwirklichung“ fest und unterschiebt Marx ein solches, wenn er ihn auf den „Einwand“43 gegen eine „Vertragskonstruktion“ verpflichtet, „die daraus resultierende Gesellschaftsordnung (kann) auf nichts anderes hinauslaufen als ein wohlgeordnetes System des privaten Egoismus“. Als wär’s, jedenfalls dem alten Marx, nicht genau darum – utopisch – zu tun, ein „wohlgeordnetes“, also ein vernünftig geplantes System gesellschaftlicher Arbeit auf Basis der rationalen Nutzenrechnung der Einzelnen zu etablieren! Was soll denn „Kommunismus“ als „freie Assoziation freier Individuen“44 bei ihm schon anderes sein?
Zurück zu Hegel interpretiert er ihn jetzt so – und widerlegt sich selbst dabei –, dass er seiner „kritischen“ „normativen Rekonstruktion“ korrespondiert. Hegel „rundet“ angeblich „den methodischen Aufbau seiner Gerechtigkeitskonzeption dadurch ab, daß er den Individuen auf der Basis ihrer sozialen Freiheit das Recht einräumt, je individuell zu prüfen, ob die gegebenen Institutionen den eigenen Maßstäben genügen“, um dann zu Recht festzustellen, dass „… Freiheiten … von Hegel aber nur soweit zugelassen (werden), wie sie das institutionelle Gefüge der eigentlichen, der sozialen Freiheit nicht gefährden können; … nicht aber zur Quelle von Ordnungssetzungen werden.“!45 Denn schließlich ist für Hegel „der Staat überhaupt vielmehr das Erste“, der als „Endzweck das höchste Recht gegen die Einzelnen“46 hat.
Unser Autor möchte irgendwie das Hegelsche Verfahren der „freiheits“-legitimatorischen Ein- und Unterordnung der Individuen unter gegebene Machtstrukturen reklamieren und gleichzeitig den Geruch des bloß rechtfertigenden Inhalts „kritisch“ loswerden. Ein widerspruchsvolles Vorhaben, dessen Auflösung in den eher von Hegel intendierten Inhalt sich schon ankündigt, wenn er eine modernisierte Version des „wirklich=vernünftig“ ansteuert: „Solange die Subjekte die freiheitsverbürgenden Institutionen in ihrem Handeln aktiv aufrechterhalten und reproduzieren, darf das als theoretischer Beleg für ihren geschichtlichen Wert gelten.“47 Schieres Dasein als Wert an sich, egal was es ist, wie es zustande kommt bzw. bewusstseinsbildend und/oder gewaltförmig aufrechterhalten wird?!
Abschließend, vor der endgültigen Darstellung seiner „Gerechtigkeitstheorie als Gesellschaftsanalyse“, versichert sich der Autor nochmals seines methodischen Credo. Statt gesellschaftliche Realität an, unabhängig gewonnener, normativer Theorie zu messen, die möglicherweise auf eine „widerspenstige Realität“ trifft, sich dadurch aber für ihn als „vollkommen haltlos“ erweist, wie auch immer sie begründet sein mag, gilt es, die „Gerechtigkeitskonzeption“ direkt auf dem Weg einer normativ angeleiteten“, also idealisch-erhöhten „Rekonstruktion der gesellschaftlichen Entwicklung“ durchzuführen – im „immanenten Verfahren“. Das hätte dann den „großen Vorteil“, „die Prinzipien und Normen als Maßstäbe mit sozialer Geltungskraft präsentieren zu können“48. Das spricht schon mal widerspruchslos für sie.
2.3. Nach diesen umfangreichen Prämissen- und Rückversicherungspräliminarien nimmt der moderne Staatsphilosoph wiederum Maß am alten preußischen und entfaltet seine „Freiheits“-Idee analog der Hegelschen Trias AnSich-FürSich-AnundFürSich als „Rechtliche“, „Moralische“ und „Soziale Freiheit“.
2.3.1. Vorurteilsfrei analytisch moderne, demokratisch-staatlich organisierte Gesellschaftsformationen betrachtet, würde man das jeweils gültige Recht zunächst zur Kenntnis nehmen als Summe machtvoll durchgesetzter, institutionalisierter Verfahrensregeln. Einerseits positiv, als verfassungsrechtliche Lizenz zur freien Betätigung zivilgesellschaftlicher Interessen: Eigentumsgebrauch und Erbrecht – damit ist eine ganzes ökonomisches System kapitalistisch impliziert –, Glaubens-, Meinungsäußerungs-, Versammlungs-, Vereinigungs-, Presse-, Berufswahlfreiheit und mehr, im limitierten Rahmen. Aber auch Parteigründungs- und Wahlfreiheit – damit ist wiederum ein ganzes System politischer Führungsbestellung definiert –, Verwaltungsorganisation plus staatlich organisierte Fürsorge im sozialen Notfall gehören hierher. Andererseits negativ als Schutz im Verhältnis der Bürger untereinander (Straf- und Zivilrecht) und dann als Schutz der gesamtstaatlichen Verfasstheit durch Judikative und Exekutive.
Nicht so beim Neuhegelianer. Der Hegelschen Rechtsphilosophie und ihrer Systematik ergeben49, bemüht sich Honneth kontrafaktisch „liberale Freiheitsrechte“ ganz der negativen Seite staatlicher Tätigkeit zuzuordnen, wobei diese lediglich als Schutz und gar nicht als gestaltender Lizenzgeber erscheint. „Die Summe der subjektiven Rechte“ ließe sich „als Resultat einer Anstrengung begreifen, dem einzelnen Subjekt eine vor äußeren, staatlichen wie nichtstaatlichen Eingriffen geschützte Sphäre zu schaffen …“ und „das Recht … auf eine rein private Erschließung seines eigenen Willens“ zu gewährleisten50.
Mehr noch, diese „geschützte Sphäre“ sei eine, „innerhalb der es entlastet von kommunikativen Zumutungen seine eigene Vorstellung des Guten erkunden und erproben kann.“51 „Subjektive Rechte“ dienen „letztlich stets der Ermöglichung einer ethischen Selbstbefragung“, was ihm irgendwie selber komisch vorkommt, freilich nur „auf den ersten Blick“, denn „was damit doch viel eher geschützt zu sein scheint, ist die Äußerung und Praktizierung einer bereits gefestigten Überzeugung, nicht aber deren vorauslaufende Überprüfung und Erkundung.“52 Tja!
Besonders eigenwillig mutet seine Interpretationsidee der angeblich „wechselseitig eingeräumten Rechte“ bezogen auf das „Recht auf Eigentum“ an. Marx irre, wenn er „in den liberalen Grundrechten nichts anderes zu erblicken vermochte als … Instrumente“53, die ökonomischen Eigentumsverhältnisse und deren rege Nutzung als ausschließende Produktionsmittel festzuschreiben. Nein, mit Hegel und seiner zündenden „Idee“, beim Eigentum vom Genuss desselben als Produktionsmittel erst mal großzügig abzusehen, sieht Honneth eine „vernünftige Begründung … vielmehr“ darin, „daß es jedem einzelnen die Chance gewährt, sich … der Eigenheit seines Willens äußerlich zu versichern“54. So gelingt es ihm, „die ethische Bedeutung des Rechts auf Eigentum zu durchschauen“. Die Person erhält so nämlich „die Chance, all jene Bindungen, Beziehungen und Verpflichtungen einer Überprüfung zu unterziehen, auf die sie sich lebensgeschichtlich eingelassen hat“55. … Fragt sich nur, auf welche Welt man sich da philosophisch einlässt.
Moment, „soziale Rechte“ und „politische Rechte“ gibt’s ja auch noch. Aber „für die Aufgabe einer „normativen Rekonstruktion“
…, wie sie hier geleistet werden soll ist die Frage nach den historischen Umständen und der sequentiellen Abfolge der Etablierung jener verschiedenen Klassen von Rechten von nur geringer Bedeutung“! Der wirkliche Gang der Dinge und deren Zweckbezüge sind belanglos, so dass unter Liquidierung materieller Zweckbelange nicht „liberale Rechte“(Meinungsäußerung, Versammlung, Vereinigung, …) Mittel zur Erkämpfung „sozialer Rechte“ sind, sondern logisch-umgekehrt sind letztere als „Versuch zu verstehen, dem einzelnen die materiellen Voraussetzungen zu gewährleisten, unter denen er seine liberalen Freiheitsrechte effektiver wahrnehmen kann.“56 „Politische Rechte“, die logisch und historisch den liberalen und sozialen Rechten zuzuordnen sind, passen dem Autor hier gar nicht in seine Systematik, weil „positiv“! Sie verweisen „auf eine Tätigkeit, die nur in Kooperation oder zumindest im Austausch mit allen(?) anderen Rechtsgenossen auszuüben ist“57 – und werden demzufolge auf später verschoben.
So leicht geht das bei einer „normativen Rekonstruktion“, die sich hier als gar keine Rekonstruktion, sondern eher als ahistorische und alogische Konstruktion erweist.
Zurück zur Lebenswirklichkeit, nach Honneth eine reichlich „pathologische“ Veranstaltung! Pathologien sollen hier „Verselbständigung(en)“ sein, „Überstrapazierung der rechtlichen Freiheit“58, eine „Justizialisierung kommunikativer Lebensbereiche“59. Belegmaterial sind zunächst Kunstprodukte(„Michael Kohlhaas“, der Film „Kramer vs. Kramer“), aber handfester dann leicht vage Hinweise auf „Verrechtlichung“ in „Familie, Schule und Freizeit“.
Anstatt zu erklären, warum und wie gesellschaftliche Interessengegensätze die rechtsstaatlich-juristische Form annehmen – z.B. in der Schule als Selektions- Konkurrenzdruck wegen starker Hierarchisierung der Verdienstquellen oder in der Ehe als schutzwürdig-geregelter Institution wegen des staatlichen Interesses an wechselseitiger Versorgung und Erziehung der Kinder –, entkleidet der Harmonie-Idealismus die „Konflikte“ ihrer notwendig staatlich- rechtsförmigen Substanz und vermisst „alternative Wege der Konfliktbereinigung“60. Die Handelnden würden sich „lebensweltlichen Verpflichtungen“ verweigern und sollten lieber „das eigene Tun und Lassen an Gründen ... orientieren, die von den Interaktionspartnern potentiell geteilt werden können“61 – wo es doch gerade darum geht, wie der Autor an anderer Stelle weiß, „gefährdete Interessen durchzusetzen“62.
Hier wird nicht erklärt, was gesellschaftlich-rechtlich der Fall ist, sondern lediglich beklagt, was nicht ist, gemessen am Ideal gesellschaftlicher Harmonie, das man als Regulativ kontrafaktisch unterstellt, um dann prompt „Pathologien“, also bloße Ausartungsformen des recht Eigentlichen ideell zu integrieren!
2.3.2. „Moralische Freiheit“ ist für moderne Staatsräson ein korrekter Titel für gewährte Glaubens- Gewissens- Weltanschauungs-Freiheit, also einem Bereich, der dem staatlichen Ordnungswillen erst mal gleichgültig ist. Somit ist logo „die Vorstellung moralischer Autonomie nicht mit staatlich kontrollierbarer Verbindlichkeit ausgestattet“63, denn von staatlicher Relevanz ist lediglich das (un)gesetzestreue faktische Handeln der Bürger, nicht aber die individuelle Motivations- bzw. Begründungsorientierung – auch im privaten Bereich.
Honneth bespricht, nach einer Kant-Korsgaard-Habermas-Diskussion des Universalisierungsprinzips64 das Thema unter dem Titel „Daseinsgrund der moralischen Freiheit“ als „Möglichkeit ..., beim Auftreten von Handlungskonflikten uns aus allen existierenden Bindungen und Verpflichtungen herauszulösen, um im Lichte von verallgemeinerungsfähigen Erwägungen unser Verhalten von Grund auf neu zu bestimmen.“65 Letzteres meint der Autor vermutlich nicht so ganz Ernst, denn auf der nächsten Seite weiß er schon, dass „Die Handlungssphäre, auf die sich diese Art von Freiheit erstreckt, … all die sozialen Lebensbereiche“ umfasst, „für die die Willensbildung des politischen Gesetzgebers keine bindenden Regeln oder Normen erlassen hat.“66 Aber – wichtiger –, der „einzelne … wird“ angeblich irgendwie „mit der Gedankenfigur der moralischen Selbstgesetzgebung im Namen der Freiheit dazu ermächtigt“67. Daseinsgrund ist jedoch allemal die eingeräumte Möglichkeit auf Basis der modern-staatlichen Konzentration lediglich auf die staatsrelevanten Bereiche des faktischen Bürgerhandelns!
Gemäß Honneths „Grundidee“, den Gang der Dinge lieber als sich verwirklichende „Freiheit“s-„Versprechen“ von Menschen für Menschen aufzufassen, wird von ihm die Rolle von Staaten als Herrschafts-Subjekten mit wirkmächtigen Organisations- und Genehmigungsbefugnissen auf Basis ökonomischer Interessen tendenziell eskamotiert und durch Prozesse interagierender Menschen ersetzt. Seine Welt ist die der Kooperierenden.
Kontrastierend, aber durchaus ergänzend dazu, sind ihm die eingerichteten Bedingungsverhältnisse moderner Staaten wiederum eine solche Selbstverständlichkeit, dass z.B. „die Normen einer Verfassung … institutionelle Tatsachen“ sind, „denen gegenüber auch die moralische Diskursgemeinschaft trotz vereinigter Anstrengung nicht einfach auf Distanz gehen kann“. Mehr noch, nicht nur faktisch respektiert, sondern sie dürfen nicht mal mehr „weiter hinterfragt“68 werden.
„Pathologien“ als Verselbständigungen sind ihm jetzt zwei Phänomene, nämlich a) der „unverbundene Moralist“ und b) der „Terrorismus“69, vorgestellt am Beispiel der RAF, speziell der Ulrike Meinhof.
Rigider Moralismus (a)) erscheint in der Tat gefährlich, vorgeführt an Beispielen, die Honneth wieder Kunstprodukten entnimmt. Sicher, aus gutem Willen ist schon viel Übles hervorgegangen. Das ist generelles Problem jeder puren Gesinnungsethik, die sich stur bzw. ignorant stellt gegenüber dem vollen Handlungsumfang, also der eingesetzten Mittel und der absehbaren Folgen. Warum aber das „unverbunden“-Sein, also die Lösung vom „Kontext, in den wir sozial eingebunden sind“70 grundsätzlich kritikabel sein soll, leuchtet nur einem Opportunisten ein, dem sogar gute Begründungen egal sind angesichts seiner Sehnsucht nach dabeiseiender Harmonie, die vielleicht gerade bei näherem Betracht dem dann Unverbundenen als gar nicht so harmonisch sich erweist! Der Übergang zum rigiden Moralisten ist klugerweise dem begründet Mahnenden kein notwendiger, ganz im Gegenteil! Warum er sich dennoch manchmal ergibt, wird von Honneth wieder nicht erklärt, man „mißversteh(t)“ halt einfach die „institutionelle Form von Praxis“71. Er könnte aber vermutlich doch durch Hinweise z.B. auf das allgegenwärtige Konkurrenzgebaren, dem anderen vorzuwerfen, was man selbst gern treibt bzw. woran man selber sich nicht hält, zwar nicht entschuldigt, aber unter Bedingungen entsprechend-individuellen Drucks hinreichend erklärt werden.
Im Falle b) des RAF-Terrorismus in Gestalt der Ulrike Meinhof ist der moralische Rigorismus nur das eine, erklärt aber nicht den Übergang zum Terrorismus, der für Honneth sich „nur erahnen“ lässt und ihr „aus moralischen Gründen plötzlich(!) gerechtfertigt erscheint.“72 Das entscheidend andere ist nämlich eine damals gepflegte falsche theoretische Vorstellung, die vage benannten „Unterdrückten aller Länder“ wären je schon, allerdings eingeschüchterte, Gegner der als „faschistisch“ denunzierten Staatsgewalten und es bedürfe nur „exemplarische(r) Tat“en, um die Staatsmacht erstens als den behaupteten Polizeiterrorapparat zu entlarven und zweitens als überwindbar vorzuführen!
2.3.3. Mutig voran jetzt zum Hegelschen einzigwahren AnundFürsich, einer philosophischen Konstruktion der „Wirklichkeit der Freiheit“(Honneth): „Soziale Freiheit“. So, als wären die zuvor diskutierten „Freiheiten“ unwirklich, nämlich bloße „Möglichkeit“73.
Folglich steht angesichts des menschelnden Fetischs „eingespielter Interaktionspraktiken der Lebenswelt“, dessen Konstitutionssubjekt als Staat verschwunden ist, jetzt alles auf dem Kopf: „Nur weil die Subjekte vorgängig bereits in ihrem Alltag Handlungsverpflichtungen eingegangen sind, soziale Bindungen aufgenommen haben … bedürfen sie der rechtlichen oder moralischen Freiheit“74! „Verpflichtungen“ ergeben sich alogisch dem staatlichen Handeln vorgeordnet, welches aber Pflichten faktisch definiert! „Soziale Bindungen“ analog dem Staat prioritär, der sie aber faktisch, jedenfalls großenteils, organisiert.
Honneths „normative Rekonstruktion“ lässt sich halt gern von einer „Prämisse“ leiten, dass nämlich „die individuelle Freiheit nur in institutionellen Komplexen mit komplementären Rollenverpflichtungen zu sozial erfahrbarer und gelebter Wirklichkeit gelangt, während sie in den „offiziell“ für sie vorgesehenen Sphären des Rechts und der Moral nur den Charakter der bloßen Distanznahme oder reflexiven Überprüfung besitzt.“75
Es geht also um Handlungssphären, in denen die Mitglieder sich „wechselseitig ergänzen und daher komplementär aufeinander bezogen sind“76, namentlich die der persönlichen Beziehungen (Freundschaft, Familie/Ehe), des marktwirtschaftlichen Handelns(!) und der politischen Öffentlichkeit.
Daher ist die „normative Rekonstruktion“ auch ein „schwierige(s) Geschäft“77, da sie „weder nur … die Analyse faktischer Verhältnisse“ noch „die Herleitung idealer Grundsätze“ ist. Also von wegen „Gerechtigkeitstheorie als Gesellschaftsanalyse“. Weder empirische Wissenschaft noch ordentlich-rationale normative Ethik soll’s sein, sondern eher Interpretation von Empirie als realisierter bzw. sich realisierender Gemeinschafts-Idealismus – mit Mängeln, die zukünftig „Anomien“ heißen.
Ab jetzt also nur noch das große „WIR“!
2.3.3.1. Das „Wir“ „persönlicher Beziehungen“.
[Selig, wer sich vor der Welt ohne Hass verschließt, einen Freund am Busen hält und mit dem genießt; Goethe, An den Mond]
a) In moderner „Freundschaft“ erkennt Axel Honneth eine wachsende „Realisierung des normativen Grundmusters“, in dem „jegliche nutzenorientierte Erwägungen fehlen und sie statt dessen durch das wechselseitige Interesse am Wohlergehen des anderen geprägt ist.“ Eine „interesselose“ Angelegenheit soll dieses wechselseitige Interesse am anderen sein, einerseits. Andererseits existiert in dieser „Form vorreflexiver Gemeinsamkeit“ aber auch noch ein Interesse als „Wunsch beider Seiten …, die jeweils eigenen Gefühle und Einstellungen einander vorbehaltlos zu offenbaren“, so dass „Vertrauen und Sicherheit darüber bestehen, selbst noch in den idiosynkratischsten oder abwegigsten Wünschen ernst genommen und nicht verraten zu werden.“ Vermutet sei, dass dieser interessenwidersprüchliche Idealismus privater Freiheit als „Bei-sich-selbst-Sein im Anderen“(Hegel) nicht allzu lange vorreflexiv sich hält, sondern als belastend empfunden wird und man sich in eher gängige Formen der Freundschaft als „Beistand(s) in existentiellen Randsituationen, der Ratsuche bei privaten Entscheidungsproblemen oder nur des Vergnügens an gemeinsam geteilten Interessenlagen“ rettet, die auch „eine viel stärkere Rolle spielen“, wie konzediert wird78. Es seien nämlich „gewisse Tendenzen erkennbar, Freundschaften wieder(?) verstärkt zur Knüpfung vorteilhafter Beziehungen zu nutzen“79. Die Suche nach Gründen der Skepsis am Freundschaftsideal, etwa von der inneren Problematik des Ideals her oder von gesellschaftlicher Bedingungsart (Konkurrenz, Leistungsdruck, Flexibilisierung in der Arbeitswelt) als Quelle des Privatismus – parallel zu socialmedia-Offenbarungen – wird für kaum beachtenswert gehalten, denn „insgesamt besteht … wenig Anlaß, an der Stabilität der modernen Institution der Freundschaft zu zweifeln“80.
[You’re nobody, ‚til somebody loves you; Dinah Washington]
b) “Intimbeziehungen” stellen in modernen Gesellschaften einen weiteren, weitgehend den Individuen überlassenen Freiraum in der Tat dar. Hier wird aber das freie Spiel der Bedürftigkeit allgemein eingebettet in ein verbreitetes Ideal von „Freundschaft bis hin zur Liebe“ als Bereichen, „in denen der eine im anderen die Chance und Bedingung seiner Selbstverwirklichung erblicken kann“81. Dazu wird das „Wir“ einer „Intim- oder Liebesbeziehung“ noch bezogen auf das traditionelle Eheversprechen als „Zukunftsdimension der Liebe“, „auch dann noch die Persönlichkeitsentwicklung des Gegenübers mit unterstützendem Wohlwollen zu begleiten, wenn sie eine Richtung nimmt, die vom jetzigen Zeitpunkt aus nicht zu antizipieren ist“82. Analog wieder zu Hegel, bei dem „das erste Moment in der Liebe ist, daß ich keine selbständige Person für mich sein will und … daß ich mich in einer anderen Person gewinne …“(HR/§158/Zusatz). Naiv spricht sich eine idealisierende Überfrachtung der Intimbeziehungen aus, die als informelles Verpflichtungs-„Wir“ Anfang, aber auch Ende der trauten Zweisamkeit bedeuten kann. Das gängige „Du bist für mein Glück zuständig“ ist vor allem, aber nicht nur, als kompensatorisches Ideal andernorts gesellschaftlich erfahrener Unbill höchst gefährlich, insofern man wirklich ausgerechnet den geliebten Anderen dann alleinig in die Pflicht nimmt, für die eigene positive Befindlichkeit (wieder) zu sorgen. Zudem man selbst sich noch das Korsett anschnürt, etwaige zukünftige Macken des Gegenübers wohlwollend zu tolerieren. Beide Gesichtspunkte können überfordern und gefährlich enden!
Die weniger gefährlichen Konsequenzen wie zunehmende Scheidungsraten und Single-Haushalte werden zur Kenntnis genommen, auch Karrierismus, wachsender Egozentrismus und „Entgrenzung der Arbeit“ in der „kapitalistischen Formierung von Subjektivität“83. Einerseits dreht es sich halt um „die ganz normalen Lernschwierigkeiten, die mit der sozialen Generalisierung eines institutionellen Prinzips einhergehen“84





























