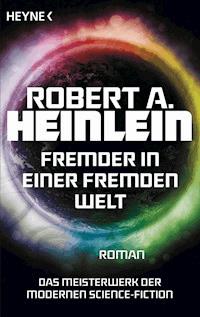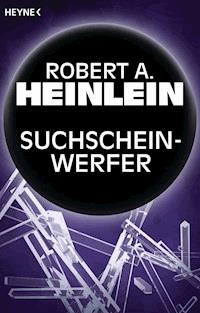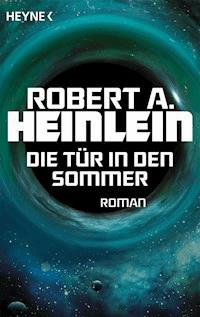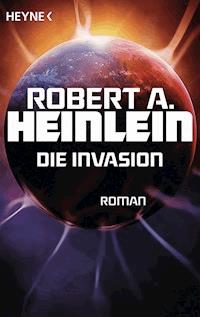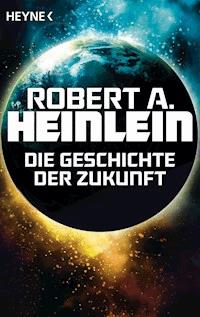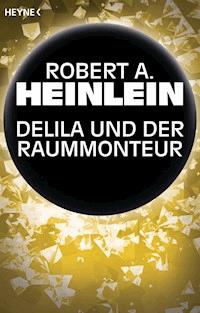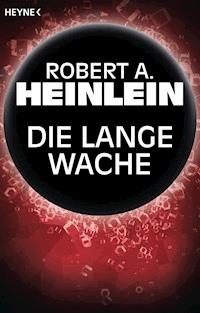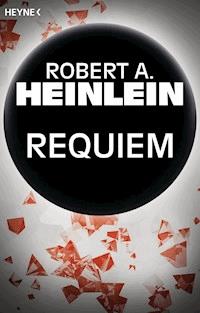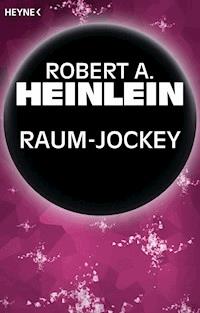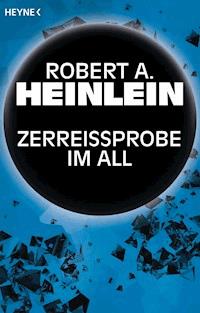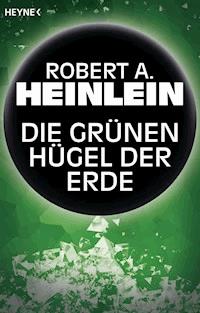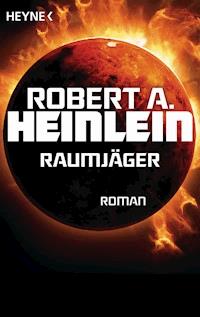
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Abenteuerliche Reise durchs Universum
Kip Russell träumt von einer Reise ins All, seit er denken kann. Bei einem Wettbewerb verpasst er knapp den ersten Preis – eine Reise zum Mond. Stattdessen gewinnt er den Trostpreis, einen Astronautenanzug. Als er dann das erste Mal in den fremdartig schimmernden Anzug schlüpft, wird sein Traum plötzlich wahr, allerdings ganz anders, als Kip es sich ausgemalt hatte: Er wird mitten ins Universum katapultiert und findet sich an Bord eines Raumschiffs wieder – als Gefangener von Piraten, die Böses im Sinn haben und keinen Heller auf sein Leben geben …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
DAS BUCH
Einmal ins All zu fliegen, das war schon immer Kip Russells großer Traum. Die Chance seines Lebens bietet sich ihm, als die Seifenfirma Skyway eine Reise zum Mond verlost. Kip gewinnt zwar nicht den ersten Preis, dafür aber einen alten, abgetragenen Raumanzug. Zunächst wenig begeistert, bringt er den Raumanzug wieder in Schuss, um ihn zu verkaufen. Doch dann beschließt er, wenigstens ein einziges Mal reinzuschlüpfen … und wird prompt mitten ins Universum katapultiert. Allerdings hat die Reise ins All wenig mit Kips träumerischen Vorstellungen zu tun: Er findet sich, zusammen mit der genialen Peewee und einem merkwürdigen Alien namens Mütterchen, an Bord eines Raumschiffs wieder – als Gefangener von Piraten! Für Kip ist das der Beginn eines atemberaubenden Abenteuers, bei dem nicht nur sein eigenes Schicksal, sondern das der gesamten Menschheit auf dem Spiel steht …
DER AUTOR
Robert A. Heinlein wurde 1907 in Missouri geboren. Er studierte Mathematik und Physik und verlegte sich schon bald auf das Schreiben von Science-Fiction-Romanen. Neben Isaac Asimov und Arthur C. Clarke gilt Heinlein als einer der drei Gründerväter des Genres im 20. Jahrhundert. Sein umfangreiches Werk hat sich millionenfach verkauft, und seine Ideen und Figuren haben Eingang in die Weltliteratur gefunden. Die Romane Fremder in einer fremden Welt und Mondspuren gelten als seine absoluten Meisterwerke. Heinlein starb 1988 in Kalifornien.
Mehr über Robert A. Heinlein und seine Romane auf:
ROBERT A. HEINLEIN
ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Titel der amerikanischen Originalausgabe
HAVE SPACE SUIT – WILL TRAVEL
Deutsche Übersetzung von Heinz Nagel
Neuausgabe: 12/2014
Copyright © 1958, 1986 by The Robert A. Heinlein
and Virginia Heinlein Prize Trust
Copyright © 2014 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: DAS ILLUSTRAT, München
Satz: Schaber Datentechnik, Wels
ISBN: 978-3-641-14433-3
www.diezukunft.de
1
Ich hatte also diesen Raumanzug.
Und das kam so:
»Dad«, sagte ich, »ich will zum Mond.«
»Gewiss«, antwortete er und vertiefte sich wieder in sein Buch. Es war Jerome K. Jeromes Drei Mann in einem Boot,das er wahrscheinlich auswendig kannte.
Ich sagte: »Dad, bitte! Es ist mir ernst.«
Diesmal klappte er das Buch über dem Finger zu und sagte mit sanfter Stimme: »Ich hab doch gesagt, dass es mir recht ist. Nur zu.«
»Ja … aber wie?«
»Hm?« Jetzt wirkte er leicht überrascht. »Aber das ist doch dein Problem, Clifford.«
So war Dad. Als ich einmal zu ihm sagte, dass ich mir ein Fahrrad kaufen wolle, sagte er »Nur zu«, ohne auch nur aufzublicken – also war ich zur Sparbüchse im Esszimmer gegangen, um dort Geld für ein Fahrrad zu holen. Aber in der Sparbüchse waren nur acht Dollar und dreiundvierzig Cent gewesen, also kaufte ich mir das Fahrrad erst nach etwa tausend Kilometern gemähten Rasens. Ich hatte zu Dad nichts mehr gesagt, denn wenn kein Geld in der Büchse war, dann war nirgends welches; Dad hielt nichts von Banken – er hatte zwei Sparbüchsen. Auf der einen stand »STEUER« und deren Inhalt tat er einmal im Jahr in einen großen Umschlag und schickte ihn an die Regierung. Das bereitete der Steuerbehörde natürlich beträchtliche Kopfschmerzen, und dann schickten sie einen Mann, der ihm ins Gewissen reden sollte.
Zuerst forderte der Mann, dann bettelte er. »Aber Dr. Russell, wir kennen doch Ihren Beruf. Es gibt für Sie keine Entschuldigung, keine ordentlichen Akten zu führen.«
»Aber das tue ich doch«, erklärte ihm Dad. »Hier oben.« Er tippte sich auf die Stirn.
»Aber das Gesetz verlangt schriftliche Akten.«
»Da würde ich noch mal nachsehen«, riet Dad. »Das Gesetz kann nicht einmal verlangen, dass jemand lesen und schreiben können muss. Noch eine Tasse Kaffee?«
Der Mann versuchte, Dad dazu zu bewegen, mit Scheck oder Bankanweisung zu bezahlen. Dad las ihm das Kleingedruckte auf einer Dollarnote vor, das, wo steht, es handle sich um ein »gesetzliches Zahlungsmittel für alle öffentlichen und privaten Verbindlichkeiten«.
In dem verzweifelten Versuch, wenigstens das Minimum eines Erfolgserlebnisses mit nach Hause zu bringen, bat er Dad, bitte an der Stelle auf dem Formular, wo nach dem »Beruf« gefragt wird, nicht »Spion« einzusetzen.
»Warum nicht?«
»Was? Nun, weil Sie keiner sind – und es die Leute ärgert.«
»Haben Sie beim FBI nachgefragt?«
»Wie? Nein.«
»Die würden Ihnen auch wahrscheinlich keine Antwort geben. Aber Sie sind sehr höflich gewesen. Ich werde also hinschreiben: ›arbeitsloser Spion‹. Einverstanden?«
Der Steuerbeamte hätte fast seine Aktentasche vergessen. Aber so war Dad eben. Nichts konnte ihn aus der Ruhe bringen; er meinte, was er sagte; er war nicht bereit, sich mit jemandem zu streiten, und er gab nie nach. Als er mir also sagte, ich könne zum Mond fliegen, es liege aber bei mir, die dafür nötigen Mittel zu beschaffen, meinte er genau das. Ich hätte morgen reisen können – vorausgesetzt, dass ich ein Ticket für ein Raumschiff ergattern konnte.
Aber dann fügte er nachdenklich hinzu: »Es muss eine ganze Anzahl Möglichkeiten geben, um zum Mond zu fliegen, Junge. Am besten überprüfst du sie alle. Das erinnert mich an die Stelle, die ich gerade lese. Sie versuchen, eine Dose Ananas zu öffnen, und Harris hat den Dosenöffner in London gelassen. Also versuchen sie es mit verschiedenen Methoden.« Er fing an, laut zu lesen, und ich schlich mich hinaus – diese Stelle hatte ich schon fünfhundertmal gehört. Nun – sagen wir dreihundertmal.
Ich ging in meine Werkstatt in der Scheune und dachte über Mittel und Wege nach. Eine Möglichkeit bestand darin, die Luftwaffenakademie in Colorado Springs zu besuchen – wenn man mir einen Studienplatz gab, wenn ich die Abschlussprüfung in der Schule bestand, wenn es mir gelang, für das Raumkorps der Föderation ausgewählt zu werden, dann bestand die Chance, dass ich eines Tages zum Luna-Stützpunkt versetzt würde, oder wenigstens auf eine der Satellitenstationen.
Eine weitere Möglichkeit bestand darin, ein Ingenieurstudium zu machen, mich dann mit Triebwerksbau zu befassen und zu hoffen, dass meine Firma mich zum Mond schickte. Dutzende, wenn nicht Hunderte von Ingenieuren waren auf dem Mond gewesen oder befanden sich noch dort – für alle möglichen Tätigkeiten: Elektronik, Kältetechnik, Metallurgie, Keramik, Klimatechnik und Triebwerksbau.
O ja! Von einer Million Ingenieuren wurde eine Handvoll zum Mond geschickt. Und mich wählten sie nicht einmal zum Klassensprecher.
Man konnte natürlich auch Arzt oder Rechtsanwalt oder Geologe oder Werkzeugmacher sein und auf dem Mond ein fettes Gehalt einstreichen – vorausgesetzt, die wollten einen haben und sonst keinen. Das Gehalt interessierte mich gar nicht – die Frage war nur, wie schaffte man es, in seinem Fach zur Nummer eins zu werden?
Und dann gab es natürlich noch die ganz normale Methode: einen Schubkarren voll Geld hinrollen und ein Ticket kaufen.
Aber das kam für mich nicht infrage – ich besaß in diesem Augenblick siebenundachtzig Cent –, aber es hatte mich dazu veranlasst, darüber nachzudenken. Die Hälfte der Jungs in unserer Schule gaben zu, in den Weltraum zu wollen, und die andere Hälfte tat so, als interessierte es sie nicht, weil sie wussten, wie gering die Chancen waren – und dann gab es da ein paar Jammerlappen, die die Erde um keinen Preis verlassen würden. Aber wir redeten darüber, und einige von uns waren entschlossen, eines Tages die Reise zu machen. Und als dann American Express sogar organisierte Reisen anbot, drehte ich völlig durch.
Ich sah die Anzeige im National Geographic,während ich im Wartezimmer unseres Zahnarztes saß. Und von diesem Augenblick an war ich nicht mehr derselbe Mensch.
Die Vorstellung, dass jeder reiche Mann einfach Geld auf den Tisch legen und fliegen konnte, war einfach mehr, als ich zu ertragen vermochte. Ich musste hin. Ich würde mir das nie leisten können – oder das lag zumindest so weit in der Zukunft, dass es gar keinen Sinn hatte, darüber nachzudenken. Was konnte ich also tun, um hingeschickt zu werden?
Man liest da immer Geschichten von armen, aber ehrlichen jungen Leuten, die es zu etwas bringen, weil sie schlauer sind als alle anderen in ihrem ganzen Bezirk, vielleicht sogar im ganzen Staat. Aber diese Geschichten beziehen sich nicht auf mich. Ich gehörte zwar, was meine Schulleistung anging, zum oberen Viertel meiner Klasse, aber dafür bekommt man noch kein Stipendium – nicht, wenn man in Centerville auf die Schule geht. Das ist einfach Tatsache; unsere Oberschule taugt nicht viel. Sie macht mächtigen Spaß – wir liegen im Basketball an der Spitze der Liga, und unsere Volkstanzgruppe hat die Provinzmeisterschaft gewonnen. Prima Schulgeist.
Aber nicht viel Studium.
Die Betonung liegt auf dem, was unser Schulleiter, Mr. Hanley, die »Vorbereitung auf das Leben« nennt, und nicht auf Trigonometrie. Vielleicht bereitet einen das sogar auf das Leben vor; aber nicht für die Technische Hochschule.
Ich war nicht selbst draufgekommen. In meinem Kollegstufenjahr brachte ich einen Fragebogen mit nach Hause, den sich unsere Arbeitsgruppe »Familienleben« im Fach »Sozialkunde« ausgedacht hatte. Eine der Fragen darin lautete: »Wie ist dein Familienrat organisiert?«
Beim Abendessen sagte ich: »Dad, wie ist unser Familienrat organisiert?«
Mutter sagte: »Störe Dad nicht, Junge.«
Und Dad sagte: »Wie? Lass mal sehen?«
Er las den Fragebogen und forderte mich dann auf, meine Schulbücher zu holen. Ich hatte sie nicht mit nach Hause gebracht, und so schickte er mich in die Schule, um sie zu holen. Zum Glück war das Gebäude offen. Dad erteilte nur selten Befehle, aber wenn er es einmal tat, dann erwartete er, dass sie schnell und auf den Buchstaben genau erfüllt wurden.
Ich hatte mir in diesem Semester einen prima Kurs zusammengestellt – Sozialkunde, kaufmännisches Rechnen, angewandtes Englisch (die Klasse hatte sich »Slogan-Schreiben« ausgesucht, was riesigen Spaß machte), Werken und Leibeserziehung – was für mich Basketballtraining bedeutete; für die erste Mannschaft war ich nicht groß genug, aber ein guter Ersatzmann kriegt auf diese Weise auch seine Buchstaben. Insgesamt war ich ganz gut auf der Schule und wusste das auch.
Dad las an jenem Abend meine sämtlichen Bücher; er ist ein schneller Leser. In der Sozialkundestunde berichtete ich, dass unsere Familie eine informelle Demokratie sei; das ging durch – die Klasse diskutierte darüber, ob der Vorsitz eines Familienrates reihum gehen oder durch Wahl festgelegt werden sollte, und ob mit der Familie zusammenlebende Großeltern wählbar wären. Wir entschieden, dass Großeltern Ratsmitglieder, aber nicht Vorsitzende sein dürften, und bildeten dann Ausschüsse, um eine Verfassung für eine ideale Familienorganisation zu schreiben, die wir unseren Familien als Ergebnis der Gruppenarbeit vorlegen wollten.
Dad war in der nächsten Zeit ziemlich oft in der Schule, was mich beunruhigte – wenn Eltern überaktiv werden, führen die immer etwas im Schilde.
Am folgenden Samstagabend rief Dad mich in sein Arbeitszimmer. Er hatte einen Stapel Schulbücher auf seinem Schreibtisch und dazu eine Liste der Lehrfächer unserer Oberschule, angefangen bei amerikanischen Volkstänzen bis zu den Realienfächern. Meine Fächer waren auf dem Plan markiert. Nicht nur die für das laufende Semester, sondern auch für die beiden folgenden Jahre in der Kollegstufe, so wie mein Kollegstufenberater und ich sie geplant hatten.
Dad starrte mich an wie ein großer Grashüpfer und fragte mit milder Stimme: »Kip, hast du vor, auf die Universität zu gehen?«
»Wie? Aber natürlich, Dad!«
»Womit denn?«
Ich zögerte. Ich wusste, dass es Geld kostete. Es hatte zwar Zeiten gegeben, wo die Büchse mit Dollarscheinen bis zum Rand gefüllt war, aber gewöhnlich dauerte es nicht besonders lange, ihren Inhalt abzuzählen. »Äh, vielleicht bekomme ich ein Stipendium. Oder ich könnte arbeiten.«
Er nickte. »Bestimmt … wenn du das vorhast. Geldprobleme lassen sich immer lösen, wenn man keine Angst vor ihnen hat. Aber als ich fragte: ›Womit?‹, habe ich über hier oben gesprochen.« Er tippte sich an die Stirn.
Ich starrte ihn an. »Aber, ich werde eben die Oberschule abschließen und auf die Uni gehen, Dad.«
»Sicher. Auf die staatliche Universität oder so etwas. Aber Kip, weißt du, dass die vierzig Prozent jeder Klasse durchfallen lassen?«
»Ich falle nicht durch.«
»Mag schon sein. Aber wenn du irgendein ernsthaftes Studium ergreifst, fällst du durch. Ingenieurwissenschaften oder Physik oder Medizin. Das heißt, das würdest du, wenn deine Vorbereitung darauf beruht.«
Er deutete auf meinen Lehrplan.
Ich war schockiert. »Aber Dad, Center ist doch eine gute Schule.« Ich erinnerte mich an das, was sie uns bei der letzten Schulversammlung gesagt hatten. »Es wird nach den modernsten wissenschaftlichen Erkenntnissen geführt, von Psychologen beraten und …«
»Und zahlt ausgezeichnete Gehälter«, unterbrach er, »für eine Lehrerschaft mit der bestmöglichen Ausbildung in moderner Pädagogik. Studienprojekte betonen die praktischen menschlichen Probleme, um das Kind in demokratischem Leben in der Gesellschaft zu orientieren und es auf das Erwachsenenleben in unserer komplizierten modernen Zivilisation vorzubereiten. Entschuldige, Junge, ich habe mit Mr. Hanley gesprochen. Mr. Hanley meint es gut – aber: Warum ist Van Buren nicht wiedergewählt worden? Wie ziehst du die Kubikwurzel aus siebenundachtzig?«
Van Buren war Präsident gewesen, das war alles, woran ich mich erinnerte. Aber die andere Frage konnte ich beantworten. »Wenn du eine Kubikwurzel willst, dann siehst du in der Tabelle im Buch nach.«
Dad seufzte. »Kip, glaubst du, diese Tabelle ist von einem Erzengel vom Himmel gebracht worden?« Er schüttelte traurig den Kopf. »Es ist meine Schuld, nicht deine. Ich hätte mich schon vor Jahren darum kümmern müssen – aber ich hatte angenommen, einfach weil du gerne liest und gut mit Zahlen umgehen kannst und auch mit den Händen geschickt bist, dass du eine Ausbildung bekommen würdest.«
»Und du glaubst, die bekomme ich nicht?«
»Das glaube ich nicht, das weiß ich. Junge, die Oberschule von Centerville ist reizend, gut ausgestattet, ordentlich verwaltet, herrlich gepflegt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es euch dort gefällt. Aber das …« Dad schlug ärgerlich auf meinen Lehrplan. »Unfug! Verhaltenstherapie für Schwachsinnige!«
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Dad saß da und brütete. Schließlich meinte er: »Im Gesetz steht, dass du bis zu deinem achtzehnten Jahr oder dem Abschluss der Oberschule schulpflichtig bist.«
»Ja.«
»Die Schule, auf der du bist, ist Zeitverschwendung. Selbst die schwierigsten Kurse sind für dich keine geistige Herausforderung. Aber wir haben nur die Wahl entweder diese Schule oder ein Internat.«
»Kostet das nicht viel Geld?«
Die Frage ignorierte er. »Ich halte nicht viel von Internaten. Ein junger Mensch gehört zu seiner Familie. Oh, es gibt da genügend harte Vorbereitungsschulen im Osten, die dich so in Form bringen, dass du die Aufnahmeprüfung nach Stanford oder Yale oder sonst eine der besten Schulen im Lande schaffst – aber dort besteht auch die Gefahr, dass du dir falsche Maßstäbe zulegst – verrückte Vorstellungen von Geld und gesellschaftlicher Position und den richtigen Schneidern. Ich habe Jahre gebraucht, um all das wieder loszuwerden. Deine Mutter und ich haben uns nicht ohne Absicht eine Kleinstadt für deine Jugendjahre ausgesucht. Du bleibst also in Centerville.«
Ich blickte erleichtert.
»Dennoch hast du vor, auf die Universität zu gehen. Hast du vor, einmal einen akademischen Beruf zu ergreifen? Oder suchst du bloß eine Möglichkeit, schnell bessere Wachskerzen zu machen und die für teures Geld zu verkaufen? Dann kannst du mit deinen Kursen in Werken und Gemeinschaftskunde weitermachen. Junge, das ist dein Leben, und du kannst damit anfangen, was du willst. Aber, wenn du vorhast, eine gute Universität zu besuchen, und irgendetwas Wichtiges zu studieren, dann müssen wir jetzt darüber nachdenken, wie wir die nächsten drei Jahre besser nutzen.«
»Aber, Dad, natürlich möchte ich auf eine gute …«
»Komm wieder zu mir, wenn du darüber nachgedacht hast. Gute Nacht.«
Das tat ich eine Woche lang. Und dabei wurde mir klar, dass Dad recht hatte. In unserer Schule wurde wirklich viel Unsinn gelehrt. Unser Projekt in »Familienleben« war Unfug. Was verstanden denn meine Mitschüler und ich davon, wie man eine Familie führte? Oder Miss Finchley? Unverheiratet und ohne Kinder. Die Klasse entschied einstimmig, dass jedes Kind sein eigenes Zimmer haben und ein Taschengeld bekommen sollte, »damit es lernt, mit Geld umzugehen«. Großartig … Aber wie sollten die Quinlans damit klarkommen? Neun Kinder in einem Haus mit fünf Zimmern? Unsinn!
Und kaufmännisches Rechnen war zwar nicht dumm, aber Zeitverschwendung. Ich las das Buch in der ersten Woche; nachher langweilte es mich.
Dad brachte mich dazu, Algebra, Spanisch, Naturwissenschaft, englische Grammatik und Aufsatzkunde zu belegen; das Einzige, was unverändert blieb, war Turnen. Es bereitete mir keine großen Schwierigkeiten aufzuholen; selbst diese Kurse waren ziemlich dünn. Trotzdem fing ich zu lernen an, denn Dad warf mir eine Menge Bücher hin und sagte: »Clifford, wenn du nicht in deinem Kindergarten wärst, würdest du jetzt das hier studieren. Wenn du das alles kannst, solltest du eigentlich die Aufnahmeprüfung auf eine Uni schaffen. Vielleicht.«
Und dann ließ er mich allein; wenn er sagte, dass ich eine Wahl treffen musste, dann meinte er das auch. Beinahe hätte ich aufgegeben – diese Bücher waren trocken, nicht das vorverdaute Zeug, das man uns in der Schule vorsetzte. Und wenn jemand glaubt, dass es ein Vergnügen ist, Latein zu lernen, dann sollte er es einmal versuchen.
Ich wurde entmutigt und hätte beinahe aufgegeben – und dann wurde ich wütend und kniete mich hinein. Nach einer Weile stellte ich fest, dass Latein mir das Spanisch leichter machte und umgekehrt. Und als Miss Hernandez, meine Spanischlehrerin, erfuhr, dass ich Latein lernte, gab sie mir Extra-Unterricht. Ich arbeitete mich nicht nur durch Vergil hindurch, sondern lernte Spanisch zu sprechen wie ein Mexikaner.
Algebra und Geometrie waren alles, was unsere Schule an Mathematik bot; ich machte auf eigene Faust mit höherer Algebra und Trigonometrie weiter, und das hätte für die Aufnahmeprüfung gereicht – aber Mathematik ist schlimmer als Erdnüsse. Analytische Geometrie kommt einem wie ein Buch mit sieben Siegeln vor, bis man begreift, auf was die hinauswollen – und dann, wenn man ein bisschen Algebra kann, wird einem plötzlich alles klar. Großartig!
Dann begann ich mich für Elektronik zu interessieren und brauchte Vektoranalyse. In naturwissenschaftlicher Hinsicht bot unsere Schule nicht viel, aber wenn man einmal anfängt, über Chemie und Physik nachzulesen, möchte man sich auch praktisch betätigen. Die Scheune gehörte mir, und ich bekam ein Chemielabor und eine Dunkelkammer und eine Elektronikbank, und eine Weile betrieb ich sogar eine Amateurfunkstation. Mutter war beunruhigt, als ich die Fenster hinaussprengte und die Scheune in Brand steckte – nur ein kleines Feuer –, aber Dad war das nicht. Er gab mir nur den Rat, in einem Holzhaus keine Explosivstoffe herzustellen.
Und als ich mich dann zur Aufnahmeprüfung meldete, bestand ich.
Es war Anfang März im letzten Schuljahr, als ich Dad sagte, dass ich zum Mond wollte. Wie gesagt, die Idee war dadurch akut geworden, dass kommerzielle Flüge angekündigt wurden, aber ich war schon »weltraumverrückt«, seitdem bekannt gegeben worden war, dass das Weltraumkorps der Föderation einen Mondstützpunkt errichtet hatte. Vielleicht auch schon früher. Ich teilte Dad meinen Entschluss mit, weil ich glaubte, dass er einen Rat für mich hätte. Sie müssen nämlich wissen, dass Dad immer Mittel und Wege fand, alles zu tun, was ihm Spaß machte.
Als ich noch ein kleiner Junge war, haben wir an allen möglichen Orten gelebt – Washington, New York, Los Angeles, ich weiß nicht wo –, gewöhnlich in Hotelapartments. Dad flog immer irgendwohin, und wenn er zu Hause war, hatten wir eine Menge Besucher; ich hab ihn eigentlich nie viel zu Gesicht bekommen. Dann zogen wir nach Centerville, und er war immer zu Hause und hatte die Nase entweder in einem Buch oder arbeitete am Schreibtisch. Wenn jemand ihn sprechen wollte, musste der Betreffende zu ihm kommen. Ich erinnere mich einmal, dass Dad, als die Sparbüchse leer war, Mutter sagte, dass »bald eine Lizenz kommen müsste«. Ich hatte keine Ahnung, was eine »Lizenz« war (ich war damals sieben), und wartete daher den ganzen Tag voll Spannung und war höchst enttäuscht, als der nächste Besucher ganz normal aussah. Am nächsten Tag war wieder Geld in der Büchse, aber es verging noch mindestens ein Jahr, bis ich erfuhr, dass es Lizenzen entweder für ein Patent oder ein Buch oder sonst etwas gab, und mein Leben verlor viel von seinem Glanz. Aber dieser Besucher dachte offensichtlich, er könne Dad dazu bringen, das zu tun, was er wollte, anstatt das, was Dad wollte:
»Dr. Russell, ich räume ein, dass Washington ein unerträgliches Klima hat. Aber Sie bekommen selbstverständlich klimatisierte Büros.«
»Mit einer Uhr ohne Zweifel. Und Sekretärinnen. Und schalldicht.«
»Was Sie wollen, Dr. Russell.«
»Sie verstehen mich nicht, Herr Minister. Die will ich alle gar nicht. In diesem Haushalt gibt es keine Uhren. Auch keine Kalender. Früher einmal hatte ich ein großes Einkommen und ein großes Magengeschwür; jetzt habe ich ein kleines Einkommen und gar kein Magengeschwür. Ich bleibe hier.«
»Aber wir brauchen Sie.«
»Was für ein Glück für mich, dass das nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Nehmen Sie bitte noch ein Stück Fleischpastete.«
Aber da Dad nicht zum Mond wollte, blieb das Problem mir. Ich beschaffte mir also Universitätslehrpläne und fing an, die Hochschulen anzukreuzen, die Ingenieurwissenschaften lehrten.
Ich hatte keine Ahnung, wie ich mein Studiengeld bezahlen sollte – aber das hatte Zeit; zuerst brauchte ich eine gute Uni mit entsprechendem Ruf, die mich haben wollte.
Wenn nicht, konnte ich mich immer noch zur Air Force melden und versuchen, dass die mich zum Mond versetzten. Und wenn das auch nicht gelang, konnte ich mich als Elektronikspezialist beim Militär melden. Auf dem Luna-Stützpunkt gab es eine Anzahl Radartechniker. So oder so, ich würde jedenfalls zum Mond fliegen.
Am nächsten Morgen beim Frühstück sah mich Dad über seine Zeitung hinweg an. »Clifford, hier ist etwas für dich.« Er reichte mir das Blatt. Es war eine Anzeige für Seife.
Eine ganz abgedroschene alte Sache, ein »gigantischer, superkolossaler« Wettbewerb. Und der hier versprach tausend Preise, wovon die letzten hundert aus einer Gratis-Skyway-Seifen-Ration für ein ganzes Jahr bestanden. Und dann schüttete ich mir die Cornflakes über den Schoß. Der erste Preis war …
EINE REISE ZUM MOND
ALL INCLUSIVE!!!
So stand es dort, mit drei Ausrufungszeichen – nur für mich waren es ein Dutzend, mit platzenden Bomben und einem himmlischen Chor.
Man brauchte nur einen Satz mit fünfundzwanzig oder weniger Worten zu vollenden: »Ich benutze Skyway-Seife, weil …«
(… und dazu wie üblich die Schachtel einzuschicken.)
Darunter stand in Kleindruck noch eine ganze Menge von »… gemeinsame Betreuung durch American Express und Thomas D. Cook …« und »… und mithilfe der United States Air Force …« und eine Liste der kleineren Preise. Aber alles, was ich sah, war:
REISE ZUM MOND!!!
2
Zuerst war ich vor Erregung himmelhoch jauchzend … und dann zu Tode betrübt. Ich gewann keine Preisausschreiben – nein, wenn ich mir eine Packung Kaugummi kaufte, war es bestimmt eine, in der der übliche Gutschein fehlte. Das Knobeln hatte ich auch aufgegeben. Wenn ich je …
»Hör auf!«, sagte Dad.
Ich hielt den Mund.
»So etwas wie Glück gibt es nicht. Es gibt nur ausreichende oder nicht ausreichende Vorbereitung, um in einem statistischen Universum zu bestehen. Hast du vor mitzumachen?«
»Und ob!«
»Ich nehme an, das soll Ja heißen. Also gut, dann streng dich systematisch an.«
Das tat ich, und Dad half mir dabei – er bot mir nicht nur frische Cornflakes an. Er sorgte dafür, dass mein Leben nicht aus den Fugen geriet; ich machte die Schule fertig und schickte Bewerbungen an verschiedene Universitäten und behielt meinen Job. Ich arbeitete damals jeweils nach der Schule in Chartons Apotheke und Drugstore – am Eisstand, aber ich lernte zugleich etwas vom Apothekengeschäft. Mr. Charton war ein zu gewissenhafter Mann, um mich irgendetwas außer verpackten Arzneimitteln anfassen zu lassen, aber ich lernte trotzdem – medizinische Dinge und wozu verschiedene Antibiotika benutzt werden und weshalb man dabei aufpassen muss. Das führte mich zur organischen Chemie und Biochemie.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!