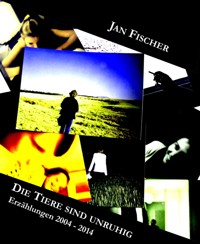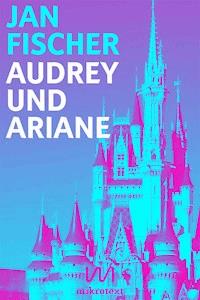Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Was machen eigentlich die ganzen Erwachsenen, die in der U-Bahn auf dem Handy spielen? Was wurde aus den ersten Kindern, die ganz selbstverständlich mit Computern aufwuchsen? Und warum reden wir nie über das Gefühl des schweren Gameboys in der Hand, obwohl so viele von uns sich so gut daran erinnern? Jan Fischer hat nicht einfach eine Biographie seiner Generation geschrieben. Sondern einen Essay, der die großen Fragen stellt: Nach Arbeit und Zeit, die wirklich frei von allem ist, nach dem richtigen Lebensweg und dem Dahintreiben durch unendliche Spielwelten, nach Tetris, Zelda und uns.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 68
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jan Fischer
Ready.
Wie ich mit digitalen Spielen erwachsen wurde
»Stelle sicher, dass du während des Spielens über ausreichend Platz verfügst.«Nintendo Wii
Ich trage einen mittelmäßig sitzenden blauen Anzug und kauere in einer Sandgrube am Atlantik. Es ist frühmorgens. Ich tippe die Asche meiner Zigarette in den gelb-orangenen Sand. Die Wellen rauschen heran, vielleicht kommt gerade die Flut. Die Luft riecht nach Pinien. Es wird immer heller. Die Sonne geht nicht über dem Meer auf, sie steigt hinter mir auf, über den Dünen, über den Wäldern dahinter.
Ich bin ein Rest, das, was übrig geblieben ist nach der Hochzeitsfeier eines Schulfreundes. Ein übermüdetes Wrack, voller Essen, Wein, Musik, hochsuppender Erinnerungen.
Es waren nicht alle von uns da, von unserer kleinen Gruppe, die sich vor Jahren in den Kellern eines Vorortes zusammenfand und die Stunden wegspielte. Einige haben Kinder bekommen, andere hatten keine Zeit, zu viel Arbeit, zu wenig Urlaubstage. Die Erwachsenendinge, mit denen wir es jetzt zu tun haben.
Ich stecke den Zigarettenstummel in den Sand, buddele ihn ein, der bewölkte graue Morgenhimmel spiegelt sich im Meer.
Ich denke über Wege nach. Wege, die den verfeierten Resten von mir unendlich lang vorkommen. Wege in unsere Gruppe und wieder hinaus, Wege, die zusammenliefen und wieder auseinander, Wege, auf denen ich mich verlaufen habe, und Wege, auf denen ich gelernt habe. Manchmal alles gleichzeitig.
Der Wind ist kalt. Ich klappe den Kragen des blauen Anzugs hoch und überlege, aufzustehen, zurück zu den anderen zu gehen, die Wege Wege sein zu lassen und einfach zu feiern.
Wir waren so jung, manchmal, denke ich. Aber oft waren wir auch einfach nicht ganz da, weil wir schnell noch zwei, drei Welten retten mussten.
Zwei dickliche Jungen
»Als du 13 warst«, sagte meine Mutter einmal, »hast du dich in deinem Zimmer eingeschlossen, und als du 18 warst, bist du wieder rausgekommen.«
Meine Erinnerung an die Zeit ist eine andere und hängt davon ab, in welcher Stimmung ich mich erinnere.
Manchmal sehe ich einen dicklichen Jungen, der tagelang vor seinem Computer sitzt, einen höhlenartigen, mit Iron-Maiden-Postern und geklauten Straßenschildern verzierten Raum hinter sich. Einen dicklichen Jungen, der dem Chaos der unaufhaltbaren Erwachsenenwelt auf der anderen Seite seiner Tür dadurch trotzen will, dass er die perfekte Linie bei Mario Kart findet, immer und immer wieder dieselben Strecken fährt, ein, zwei Hundertstelsekunden in den Kurven herausholt. Der jeden Level in Wolfenstein 3D mit 100 % abschließt, der Doom zuerst im God-Mode und dann verwundbar spielt, aber immer mit der Kettensäge, so lange, bis er selbst Jahre später noch die ersten paar Level ausschließlich nach Körpergedächtnis absolvieren kann.
Manchmal sehe ich auch einen Jungen, der schlicht und einfach noch nicht fertig ist. Nicht fertig sein will. Der sich die Zeit vertreibt, bis es richtig losgeht, wartet, dass alles irgendwie besser oder anders wird, sich in seinem eigenen Urschlamm unfertiger Ideen und pubertären Größenwahns wälzt, während er in das einzige Fenster starrt, dessen Inhalt er kontrollieren kann. Jemand, dem ich viel verdanke, der kluge Entscheidungen für eine Zukunft traf, die er noch nicht kannte.
Man muss dazu wissen, dass meine Eltern – beziehungsweise meine Mutter und mein Stiefvater, es ist kompliziert – sich zu der Zeit gerade getrennt hatten. Wir mussten in eine kleinere Wohnung umziehen, die ein Kakerlakenproblem hatte, das wir erst nach und nach in den Griff bekamen, der Alkoholiker im Stockwerk über uns wurde einmal so wütend, dass er sämtliche Möbel auf die Straße warf. Niemandem ging es gut. Meiner Mutter nicht, mir nicht.
Der Computer – ein 486er – hatte, was mir heute unmöglich vorkommt, keine Lautsprecher, nur die quäkenden Piepser der PC-Onboard-Lautsprecher, die ich schnell abstellte: Die Höhle der beiden Jungen, die ich war, war von nichts als dem Bildschirm erleuchtet, und sie war geräuschlos. Beide Jungen schlossen die Tür hinter sich, weil ihnen die Welt vor der Tür nicht besonders gefiel. Beide Jungen begannen, intensiver zu spielen als zuvor, weil alles andere noch unüberschaubarer war, chaotisch, voller eigenartig undefinierter Aufgaben, die nicht zu meistern waren. Beide Jungen arbeiteten daran, erst einmal alleine klarzukommen.
Ich würde diesen beiden Jungen, diesen stimmungsabhängigen Erinnerungen, gerne sagen, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Dass jeder, der bei Mario Kart in tagelanger Wiederholung die perfekte Linie findet, bestens gerüstet ist für alles, was ihn da draußen noch erwartet. Dass jeder, der irgendwann den God-Mode bei Doom abstellt und den Laden immer noch mit der Kettensäge aufmischen kann, dass jeder, der in Wolfenstein 3D die Hartnäckigkeit aufbringt, auch noch die letzte Wand nach geheimen Türen abzusuchen und am Ende auch alle Türen findet, ausreichend Wahnsinn für die nächsten zwanzig, dreißig Jahre in sich hat.
Load"*", 8, 1
Ich muss weiter zurückgehen, um tatsächlich zu beginnen. Noch vor dem Computer ohne Lautsprecher ist da das strahlende Himmelblau auf dem Bildschirm des Röhrenfernsehers. Das verlockende Ready., das in weißer Schrift darauf steht, der blinkende Block darunter, der Befehle erwartet. Der dickliche Junge, ein paar Jahre jünger, der auf der klobigen Tastatur langsam Buchstaben und Zahlen zusammensucht, die ersten Worte einer nur bruchstückhaft beherrschten Syntax zusammenbaut.
Es muss 1994 oder 1995 gewesen sein, als wir einen C64 bekamen. Die Trennung meiner Eltern hatte gerade begonnen, sie lebten noch zusammen, wir waren noch nicht umgezogen, es war die Zeit der aggressiv geflüsterten Gespräche hinter verschlossenen Türen.
Der C64 war keine Offenbarung für mich, dafür bin ich zu jung. Ich kenne diese Faszination, dass da plötzlich etwas auf dem Bildschirm ist, das man steuern kann, diesen plötzlichen Übergang des Fernsehens ins Interaktive, nur aus Erzählungen. Für mich war es immer normal, dass das so funktionierte. Nur nicht zu Hause, damals noch nicht. Wir waren viel zu spät dran mit dem C64, denn mit Technik waren meine Eltern immer langsam: Videorekorder, CD-Player, alle diese Dinge hatten wir erst, als klar war, dass sie nicht mehr weggehen würden. Tatsächlich gab es sogar eine Zeit, in der meine Eltern das Antennenkabel des Fernsehers versteckten, wenn sie nicht da waren, damit ich mir nichts unkontrolliert ansehen konnte.
Der C64 kam von einem Onkel, der ihn, gut zehn Jahre nach Einführung des Gerätes, nicht mehr brauchte. Es gab einen Stapel wabbliger 5¼-Zoll Disketten dazu, und eine Gebrauchsanleitung voller Zauberworte, aus der ich mir mühsam die eigenartige Beschwörungsformel zusammenklaubte, mit der ich das brotkastenartige Ding dazu bringen konnte, die Spiele auf den Disketten zu starten.
Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon andere Systeme gesehen. Meine eigener Game Boy war noch den nächsten Geburtstag oder das nächste Weihnachten entfernt, ich hatte aber natürlich schon einen andächtig in der Hand gehalten. Ich hatte bereits einen Sega Mega Drive und einen Super Nintendo benutzt. Aber das waren die Geräte anderer Leute. Der C64 war das erste Gerät, das fast nur mir gehörte, das ich benutzen konnte, wann ich wollte, wie ich wollte. Als das erste Spiel auf der ersten Diskette endlich geladen war – Air Hockey von einer Spielesammlung namens Indoor Sports – und ich versuchte, die Joysticksteuerung zu begreifen, war ich zwar wenig begeistert, aber bereits verfallen. Das Diskettenlaufwerk röhrte von jetzt an immer häufiger durch das Wohnzimmer. Die piepsigen Sounds von Bowling, Blackjack und Air Hockey mischten sich mit dem bedrohlichen Flüstern um mich herum.
Sicherlich hatten die begrenzten, sicheren, beherrschbaren Spielwelten des C64 etwas damit zu tun, dass ich immer wieder in sie zurückkehrte. Wenige Pixel, klare Regeln, der Joystick mit seinen zwei Knöpfen: Das alles war unheimlich einfach. Kontrollierbar. Ich gewann beim Air Hockey immer. Ich knackte die Highscores beim Bowling. Ich bin immer noch ziemlich gut im Blackjack.
Aber der C64 war auch fundamental anders als alle Geräte, die ich davor kennengelernt hatte. Man musste seine Sprache sprechen, ihm erst einmal gut zureden, damit er etwas tat. Beim Game Boy, beim Mega Drive hatte man nur die Steuerung verstehen müssen, das jeweilige Spiel spielen und irgendwann gewinnen. Beim C64 dagegen musste man das Gerät selbst erobern.