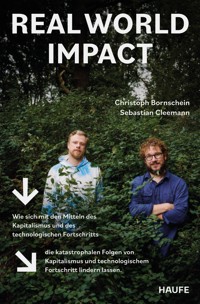
22,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haufe Lexware
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Eigentlich ist der Kapitalismus eine Erfolgsgeschichte. Er hat Wohlstand gebracht, Armut verringert, Innovationen und den Siegeszug neuer Technologien befördert. Er hat den globalen Handel beschleunigt und intensiviert und dabei neue Bündnisse und Verbindungen ermöglicht. Doch der Preis dafür ist hoch. Staaten und Gesellschaften versuchen, die Folgen des Kapitalismus - Klimaerwärmung, Meeresverschmutzung, Artensterben, Naturkatastrophen, Raubbau an natürlichen Ressourcen - in den Griff zu bekommen. Doch wo die freie Wirtschaft Rendite abwirft, tut man sich mit Verboten schwer. Taxonomien, Berichtspflichten, Regulierung sind die Instrumente moderner Nachhaltigkeitspolitik. Ob sie wirklich helfen, ist fraglich. Christoph Bornschein und Sebastian Cleemann befürchten, dass die aktuellen Maßnahmen zur Sicherung unserer Existenz nicht ausreichen und dem hehren Ziel sogar eher schaden. Unterstützt durch die Meinungen von Expert:innen und Stakeholder:innen im Bereich "Nachhaltiges Wirtschaften" prüfen sie in ihrem Buch das bestehende System auf seine tatsächliche Wirksamkeit und Schwachstellen. Sie benennen die Probleme, suchen nach wirksamen Alternativen und entwerfen einen wirklich nachhaltigen Kapitalismus. Dieses Buch ist: - Eine kritische Würdigung deutscher und europäischer Nachhaltigkeitsregulatorik - Ein besorgter Blick auf eine brennende Welt, mit der sich noch viel zu gut Geld verdienen lässt - Ein Entwurf eines neuen, nachhaltigen Kapitalismus, der Wohlstand und Existenz nicht gegeneinander ausspielt Wie tragfähige Modelle der Zukunft aussehen und wie sie die aktuellen Folgen unseres Nichthandelns kompensieren "Real World Impact" ist ein Buch für alle, die wirtschaften und produzieren, die sich von Regeln und Pflichten betroffen fühlen und sie besser verstehen wollen. Für alle, die nach Wegen suchen, um Wohlstand und Fortschritt zu sichern, ohne den Planeten anzuzünden. Es ist ein Buch für Entscheider:innen, Unternehmer:innen, Politiker:innen und Menschen mit auch nur einem Funken Interesse für unsere Existenz auf diesem Planeten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
[5]Inhalt
Hinweis zum UrheberrechtIns Tal der Tränen und zurück. Von zweien, die auszogen, ein launiges ESG-Handbuch zu schreiben, und sich auf einer epochalen Lernreise wiederfanden1 Der Preis des Erfolges. Wie uns Wirtschaft, Konsum und Technologie Wohlstand und Glück brachten und den Planeten an den Rand des Zusammenbruchs trieben1.1 Wait, what happened? Aufstieg und Aufstieg und weiterer Aufstieg des Kapitalismus1.2 Die zerstörerische Kraft des ungehemmten Wirtschaftens1.3 Die gestaltende Kraft des Staates1.4 Mutter Erde ächzt2 Das Gegenteil von gut. Wie die regulierenden Kräfte am Problem vorbeiarbeiten und damit echte Veränderung erschweren2.1 Immerhin gut gemeint. Eine sehr kurze Geschichte europäischer Nachhaltigkeitsregulierung2.2 Bericht für Bericht zu einer besseren Welt?2.3 Zukunft wird mit Geld gemacht. Die Rolle der Finanzbranche als Nachhaltigkeitsexekutive2.4 Die Reprivatisierung staatlicher Verantwortung2.5 Deckel, Exporte, Überforderungen. Die Verwerfungen des Wandels2.6 Altfettbeheizte Schwammstädte und wichtigere Probleme3 ESGeht noch schlimmer. Warum die aktuellen Lösungsansätze eher Probleme schaffen, als sie zu lösen3.1 Gelegenheit macht Gewinne. Wie und für wen die ESG-Regulatorik das Geschäft ankurbelt3.2 Nothing breaks like a rule. Die ungewollten Effekte technisierter Gesetzgebung3.3 Der Willigen Lähmung. Regulatorik als Kostenfaktor und Fortgeschrittenenbremse3.4 Du bist schuld, dass die Welt verbrennt. Die Individualisierung des Problems und die Ohnmacht des Einzelnen3.5 In die Sackgasse und dann immer geradeaus. Staat, Wirtschaft und Gesellschaft in der Vertrauenskrise4 Actual Impact. Wie und wo es besser geht und wie sich das skalieren lässt4.1 Planen, starten, durchziehen. Eindeutigkeit und Konsequenz als wesentlicher Faktor bei der Zielerreichung4.2 Im Kreis und dann alle zusammen. Alternative Wirtschaftsmodelle und die Hindernisse auf dem Weg dorthin4.3 Der Kapitalismus ist nicht das Problem. Warum die Regeln des Wirtschaftens auch Regeln des nachhaltigen Wirtschaftens sein können4.4 Chancen, Risiken, Glühbirnen. Wie weit kann der Staat in die Zukunft sehen, wie sehr muss er sie gestalten?4.5 Unternehmen, Unternehmer, Bürokrat und Glücksmaschine. Ein letzter kurzer Blick auf die Rolle des Staates5 Man müsste mal, man sollte mal, man wird. Wie tragfähige Modelle der Zukunft die aktuellen Folgen unseres Nichthandelns kompensieren können5.1 Wer baut uns den Kapitalismus von morgen? Ein überfälliger Blick auf Diversität und Veränderungsanreize5.2 Der schrumpfende Elefant im Raum. Ein überfälliger Blick auf Degrowth5.3. Alte und neue Transformationen. Wie sich Wirtschaft verändert und wie sie sich verändern lässtVon Herzen DankAnmerkungenQuellenImpressumHinweis zum Urheberrecht
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
[8]Ins Tal der Tränen und zurück
Von zweien, die auszogen, ein launiges ESG-Handbuch zu schreiben, und sich auf einer epochalen Lernreise wiederfanden
[10]»Das Nachhaltige muss in der gesamten Wirtschaft das neue Normal werden«, so sagte es Jörg Eigendorf, Chief Sustainability Officer der Deutsche Bank AG, im November 2023 in Christophs Podcast Bornschein. »In weniger als drei Jahrzehnten wollen wir klimaneutral sein«, verkündete EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei der Vorstellung des Green Industrial Deal im Europäischen Parlament am 18. Januar 2023. »Die Transformation der Industrie hin zur Klimaneutralität ist von entscheidender Bedeutung für Deutschland als Wirtschaftsstandort der Zukunft«, hieß es am 10. Januar 2024 in einem gemeinsamen Papier des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e. V. (BDI), des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), des Naturschutzbundes Deutschland e. V. (NABU) und des WWF Deutschland. Mit dem Beginn des Geschäftsjahres 2024 begann für zahlreiche europäische Unternehmen außerdem die Umsetzung der EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Die vom Parlament verabschiedete CSRD änderte die Anforderungen und den Umfang von Unternehmensberichten tiefgreifend. Sie schaffte damit wesentliche Voraussetzungen dafür, »das Nachhaltige« zum neuen Normal in der Wirtschaft zu machen: Nachhaltigkeit wurde zur Berichtspflicht unter den Gesichtspunkten Umwelt, Soziales und Unternehmensführung – oder auf Englisch Environmental, Social, Governance, kurz: ESG. Die CSRD war damit der nächste logisch erscheinende Schritt in der seit Jahren voranschreitenden Entwicklung der einstigen Investment-Risikobewertungskategorie ESG zum übergreifenden Maßstab für Unternehmensbilanzen, nachhaltiges Investment und Wirtschaftspolitik.
»ESG is the devil«, schrieb der reichste Mann der Welt, Elon Musk, in den Jahren 2022 und 2023 mehrfach auf dem damals noch als Twitter bekannten Netzwerk X, nachdem sein Unternehmen Tesla in ESG-Ranglisten wiederholt schlechter abschnitt als Öl- oder Tabakkonzerne. Als »ideological joyrides« – »ideologische Vergnügungsfahrten« – beschimpfte der Gouverneur von Florida, Ron De-[11]Santis, im Mai 2023 die ESG-Orientierung staatlicher Investoren – und verbot sie per Gesetz. »Akin to fraud« – »quasi Betrug« – sei ESG, erklärte Mike Belcher, ein republikanischer Abgeordneter im Repräsentantenhaus von New Hampshire, der im Januar 2024 eine Gesetzesvorlage unterstützte, die Investment nach ESG-Prinzipien unter Strafe stellte. Derweil hoffte, ja flehte Wirtschaftswissenschaftler und Reporting-Koryphäe Robert G. Eccles in der Harvard Business Review, ESG möge doch endlich wieder zu dem werden, was es einmal war: ein unspektakuläres Bewertungs- und Identifikationswerkzeug für Risikofaktoren, die für die Rentabilität eines Unternehmens und für seinen langfristigen Shareholder-Value von Bedeutung sind. »Make ESG boring again.«1
Zwischen all diesen Impulsen halten wir, der Berater, Unternehmer und Investor Christoph Bornschein und der Texter, Autor und Büroangestellte Sebastian Cleemann, es für ratsam, einmal einen genaueren Blick auf das Thema ESG zu werfen, auf seine Geschichte, Karriere und Umsetzung, vor allem aber auf die Ursachen für seine polarisierende Wirkung. Schon bald wird uns klar, dass es hier um mehr geht als um Risikobewertung, Finanzmärkte, Richtlinien und Definitionsfragen. Es geht um den Zustand der Welt und den der Wirtschaft, um die Bemühungen staatlicher Institutionen, Welt und Wirtschaft in Einklang zu bringen, und um die Beharrungskräfte eines Kapitalismus, der sich partout nicht von fossilen Erfolgsrezepten lösen möchte.
Steigen Sie ein, lernen Sie mit
Die intensive Beschäftigung mit der gleichzeitig spröde-bürokratischen und disruptiv-polarisierenden Thematik entwickelt sich schließlich zu dem, was Christoph in den Wochen und Monaten der Arbeit an diesem Buch wiederholt »eine Lernreise« nennen wird. In zahlreichen Gesprächen mit Experten und Expertinnen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und allerlei Grauzonen dazwischen lernen wir viel darüber, wie ESG-Grundsätze und Nachhaltigkeit in unserer Zeit und in unseren Breiten umgesetzt und vorangetrieben werden sollen – und [12]wie gut das funktioniert. Das von der Europäischen Kommission im Dezember 2019 vorgestellte Ziel, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen, wird durch viele Richtlinien und regulatorische Maßnahmen, durch Forderungen und Förderungen und durch etliche Pflichten in die europäische Wirtschaft getragen. Darüber, wie diese Zielsetzung dort wirkt und wie sehr diese Wirkung wiederum den formulierten Zielen dient, gibt es allerlei geteilte Meinungen. Sie werden auch in unseren Gesprächen laut.
Wir machen uns Notizen und schnell auch ein Bild: Der Kapitalismus und der technologische Fortschritt, die einander seit Jahrzehnten und Jahrhunderten vorantreiben, haben uns in eine für das menschliche Überleben nicht eben ideale Lage gebracht. Die katastrophalen Folgen des Weltwirtschaftens haben in der Regel, aber nicht ausschließlich mit der Verfeuerung fossiler Brennstoffe zur Energie- und Materialgewinnung zu tun. Es wäre ratsam, dafür bald Alternativen und Lösungen zu finden. Der aktuell vor allem politisch verfolgte Ansatz, mit dem diese Alternativen und Lösungen zur Nutzungsreife entwickelt und zum Standard gemacht werden sollen, ist jedoch nicht besonders effektiv –er besteht zu einem sehr großen Teil darin, einerseits die minutiöse Dokumentation unternehmerischen Handelns zur Pflicht zu machen und andererseits die Bewertung dieser Dokumentationen dem Finanzsektor zu überlassen. Für wohldokumentierte Nachhaltigkeitsmaßnahmen gibt es Geld, für alles andere nicht.
Wir erfahren, warum dieser Ansatz irgendwann einmal vielleicht gut gedacht war. Wir lernen, warum er problematisch ist. Wir stellen fest, dass die intendierte Wirkung nicht eintritt. Wir sprechen mit Nachhaltigkeits-, Regulierungs-, Investitions- und Unternehmensführungsverantwortlichen, wir registrieren viel Unmut und Unverständnis, aber durchaus auch Hoffnung und Einverständnis: Es wäre schon ganz gut, den Planeten nicht einfach weiter zu verbrennen. Und so ergeben sich für uns zwangsläufig Fragen. Was gibt es denn für andere Ansätze? Welche Maßnahmen hätten denn –um es mit den Worten des CEOs eines globalen Versicherungsunternehmens zu sagen – [13]»Real World Impact«? Was könnte also wirklich etwas verändern und was macht nur Arbeit?
Die Suche nach Antworten auf diese Fragen ist oft frustrierend, nicht zuletzt deshalb, weil wir feststellen: Aktuell wird wirklich viel getan, das vor allem Arbeit macht und wenig Impact verursacht. Mit einem enormen bürokratischen Aufwand werden Geschäftigkeit und Datenmengen erzeugt, die Europa zwar bis 2050 klimaneutral machen sollen, aber durch die nicht ein Tropfen Kerosin weniger in ein Flugzeug gepackt, nicht ein Kilometer weniger im Verbrenner gefahren und nicht ein Krümel Mikroplastik aus der Nahrungskette gefischt wird.
Zugleich sehen wir vielversprechende Ansätze, Lösungen, Technologien, die das Zeug hätten, einen Großteil dieser Tätigkeit entweder völlig überflüssig zu machen oder sie doch zumindest in wesentlich wirksamere Bahnen zu lenken. Der Kapitalismus und der technologische Fortschritt haben die Welt nämlich auch an einen Punkt gebracht, an dem ihre Fähigkeiten zu Innovation und Problemlösung auf enorme intellektuelle Ressourcen und produktive Netzwerke treffen. Das Powercouple, das der Welt die Katastrophe eingebrockt hat, könnte ihr auch helfen, sie zu überwinden.
Die Realität holt uns ein
Schon zwischen den ersten Gesprächen zu diesem Buch und der Abgabe des ersten Manuskripts sehen wir die Gefahr, dass all unsere Recherchen, Gesprächsauswertungen, Erkenntnisse und Aufbereitungsaufwände bald obsolet werden könnten. Zum einen erringen die Treiber des seit Jahren tobenden Kulturkampfs gegen das Feindbild einer »woken« Gesellschaft mit der Wiederwahl Donald Trumps einen wichtigen Sieg. Da zu diesem von Trump, seiner Administration und zahlreichen Wählern vehement abgelehnten Paket aus »woken« Überzeugungen auch die Idee gehört, man müsste mit der Welt, auf der man lebt, behutsamer und schonender umgehen, wirft diese Wahl die Bemühungen um Nachhaltigkeit und Klimaneutralität zurück. Die USA steigen zum zweiten Mal aus den Pariser Verträgen aus, und [14]kurz nach seinem Amtsantritt beginnt der neue Präsident die Nachhaltigkeits- und Klimaschutzpolitik der Vorgängeradministration rückabzuwickeln.
Parallel führt das lange vorausgeahnte und dann doch überraschend schnelle Platzen der Ampelkoalition im November 2024 Deutschland direkt in einen Winterwahlkampf, in dem die Themen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit nicht einmal mehr bei den Grünen eine große Rolle spielen. Es gewinnt ein konservativer Kandidat, der im Wahlkampf damit zu punkten versucht, dass er Windräder für eine hässliche Übergangstechnologie hält und gegen »linke und grüne Spinner« austeilt.
Am 26. Februar 2025 weicht die Europäische Kommission die von ihr selbst festgelegten Nachhaltigkeitsberichtspflichten auf und kündigt an, die entsprechenden Richtlinien radikal zusammenzustreichen. Ein wesentlicher Kritikpunkt an der politischen Umsetzung der Klimaziele, dem wir in unserem Buch bis dahin viel Raum gewidmet hatten, scheint plötzlich wegzubrechen.
Zwei Tage später, am 28. Februar, kommt es im Oval Office des Weißen Hauses zum Eklat: Der ukrainische Präsident Selenskyj, der amerikanische Präsident Trump und dessen Vize Vance geraten aneinander, das Treffen wird abgebrochen. In den folgenden Tagen wird immer klarer, was sich ebenfalls schon lange angedeutet hat: Die USA fallen für absehbare Zeit als verlässlicher Partner Europas aus.
In Europa sorgt dies für eilige Konsolidierungsversuche und überfällige Bemühungen um eine stärkere Integration der EU. In Deutschland wird ein 500-Milliarden-Sondervermögen zum Ausbau der Verteidigungsbereitschaft auf den Weg gebracht. Da die nach der Wahl stärkste Partei CDU zudem offenbar feststellt, dass mit dem Wegfall des starken Partners der Ausbau und die Sanierung deutscher Infrastruktur neue Dringlichkeit erhalten, gibt sie ihren lang gepflegten Widerstand gegen dafür erforderliche neue Schulden auf und strebt zusammen mit dem mutmaßlichen Koalitionspartner SPD auch hier ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro an. Klimaschutz und [15]-resilienz werden dabei zunächst gar nicht berücksichtigt, dann als Verhandlungsmasse eingesetzt, um auch die Grünen an Bord zu holen. Ein später Erfolg für das Thema, aber ein fatales Signal: Klimaschutz ist verhandelbar.
Langfristige Probleme brauchen kurzfristige Lösungen
Doch das abnehmende Interesse an einer nachhaltigen Transformation der Wirtschaft bzw. der sich immer radikaler gebärdende Widerstand dagegen soll, nein, darf nicht unwidersprochen bleiben. In unserem Fall ist dieser Widerspruch ja sogar konstruktiv: Hier, schauen Sie mal – Kapitalismus kann unter Umständen eine total gute Sache sein. Auch eine reformierte Berichtspflicht macht unseren Widerspruch nicht ungültig. Unsere Kritik dreht sich nicht primär darum, welche Unternehmen nach welchen Kriterien und welchen Wesentlichkeitsmaßstäben in welcher Formularzeile über ihren »Nettoumsatz aus Geschäften mit kohlebezogenen Aktivitäten« oder ihre »Gesamtmenge radioaktiver Abfälle« berichten müssen. Uns geht es vielmehr um die Sache an sich, um die Staatsphilosophie hinter den aktuellen regulatorischen Maßnahmen und um das Selbstverständnis des Staates.
Im Übrigen halten wir nicht viel von der Denkschule des »Immer nur ein Problem behandeln!«: Wir sehen und glauben nicht, dass die Erde und vor allem die auf ihr lebenden, in Gesellschaften und Wirtschaftsräumen organisierten Menschen auch nur ein einziges wichtigeres Problem haben als den Erhalt ihres Lebensraumes. Wenn das Haus brennt, ist es zweitrangig, wie gut das WLAN funktioniert und wie aggressiv sich Sam und Michel auf der Eigentümerversammlung angegangen sind. Wenn das Schiff sinkt, ist es egal, was die Cocktails an der Bar kosten. Wenn der Damm bricht …, nun, Sie wissen wahrscheinlich, was wir meinen. Es ist Zeit für zielführende Maßnahmen.
Um dies noch genauer auszuführen, werden wir auf den folgenden Seiten zunächst mit Ihnen abwärtsreisen. Wir werden beim erfolgreichen Kapitalismus beginnen, seine katastrophalen Folgen betrachten, [16]unseren Umgang mit diesen Folgen reflektieren und nach und nach erkennen, dass unsere bisherigen Ansätze alles eher nur schlimmer machen. Anschließend werden wir uns wieder nach oben arbeiten: Wie ginge es besser, wo wird es schon besser gemacht, was gibt uns Hoffnung? Wir konzentrieren uns überwiegend auf Aspekte staatlicher Regulierung und wirtschaftlichen Handelns, auch wenn uns unsere Recherchearbeit sehr deutlich gemacht hat, dass wir uns auch sehr viel tiefer in soziale, historische, politische, philosophische, technologische und zahlreiche andere Aspekte hätten einarbeiten können. Dafür gibt es aber zum Glück andere Bücher von klugen Menschen.
Immer wieder bauen wir in unserer Darstellung auf die Standpunkte und Erkenntnisse aus unseren tiefgehenden Gesprächen mit klugen Köpfen aus Praxis und Theorie, aus Business, Politik und Wissenschaft. Um in allen Fällen das maximal mögliche Maß an Vertraulichkeit, Offenheit und Kritik zu ermöglichen, haben wir uns bewusst dafür entschieden, unsere Expertinnen und Experten nicht beim Namen zu nennen. Einige von ihnen hätten mit einer Nennung kein Problem gehabt, aber es hätte sich seltsam angefühlt, ständig zwischen konkret identifizierten Personen und irgendwie geheimnisvollen Inputgebern und Whistleblowern hin und her zu wechseln.
Ein Aspekt noch, bevor es losgeht: Dieses Buch erhebt nicht den Anspruch, eine Anleitung zu sein – sein Untertitel verspricht kein Rezept, sondern eine Betrachtung der Möglichkeiten und einen Abriss unserer Lernreise durch das Thema. Wir bitten um Nachsicht, falls das Foto der zwei seriösen Herren im Gebüsch auf dem Cover einen anderen Eindruck erweckt haben sollte.
Vielen Dank für Ihr Interesse und viel Vergnügen auf unserer Reise.
Christoph Bornschein & Sebastian Cleemann
April 2025
[18]1 Der Preis des Erfolges.
Wie uns Wirtschaft, Konsum und Technologie Wohlstand und Glück brachten und den Planeten an den Rand des Zusammenbruchs trieben
[20]1.1 Wait, what happened?
Aufstieg und Aufstieg und weiterer Aufstieg des Kapitalismus
Mit der Formulierung von den »katastrophalen Folgen von Kapitalismus und technologischem Fortschritt« könne er zwar nichts anfangen, schreibt der CEO des Finanzkonzerns, aber das ließe sich ja am besten im Dialog erörtern. Die Hälfte unserer Buchprämisse stößt damit noch vor der ersten Interviewfrage auf Unverständnis, aber immerhin auf die beste Art von Unverständnis: interessiertes Unverständnis. Das Gespräch selbst wird dann ganz hervorragend – ein CEO-Gespräch ohne PR-Aufsicht, sehr offen und zugewandt und mit Blick auf das, was wir »die katastrophalen Folgen« nennen, durchaus realistisch. Tatsächlich müssen wir nicht einmal groß erklären, was wir meinen; die anfängliche Konfusion löst sich schnell auf. Vielleicht war sie auch nur gespielt – der natürliche Abwehrreflex des Chefs eines global erfolgreichen Unternehmens, dem zwei mutmaßliche Kapitalismuskritiker und Maschinenstürmer mit ihren »Katastrophen« auf die Pelle rücken.
Schon die Benutzung des Begriffs »Kapitalismus« deutet meist an, dass hier eine Wirtschafts- und Gesellschaftsform sehr kritisch betrachtet werden soll. Die Kapitalismuskritik ist nicht nur so alt wie der Kapitalismus selbst, sie hat ihn im Grunde erschaffen – oder ihm doch zumindest seinen Namen gegeben. Der Begriff, so der Sozialhistoriker Jürgen Kocka in seiner sehr griffigen Geschichte des Kapitalismus, »entstand als Begriff der Kritik und ist jahrzehntelang auch als solcher verwendet worden«.1 In seiner deutlich weniger griffigen, aber erhellenden Historie Schulden: Die ersten 5000 Jahre bringt es der Anthropologe David Graeber ganz ähnlich auf den Punkt: »Erfunden wurde das Wort von Sozialisten, die im Kapitalismus ein System sehen, das denen, die Kapital besitzen, die Möglichkeit gibt, die Arbeitskraft derer auszubeuten, die kein Kapital besitzen.«2
[21]Diese kritische Perspektive auf das heute global vorherrschende System aus Kapitalbesitzenden, Unternehmen, Arbeitern und Arbeiterinnen, Märkten und ihren jeweiligen Abhängigkeits- und Machtbeziehungen hat ihren Ursprung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts: 1867 erschien mit dem ersten Band des Marx’schen Kapitals das bis heute wohl wichtigste Werk der Kapitalismuskritik und der klassenlosen Utopie. Wir können Marx’ Werk hier unmöglich in unser Buch pressen und springen deshalb direkt in unser aktuelles Jahrhundert, in dem die Beschäftigung mit dem Kapitalismus und die Kritik an ihm noch einmal deutlich an Fahrt gewonnen haben. Getrieben wurde und wird diese Entwicklung durch das Ende des Kalten Krieges, die globale Finanzkrise ab 2007 und, so Jürgen Kocka, »die verstärkte Beschäftigung mit dem Erbe des Kolonialismus und mit den sich abzeichnenden Klima- und Umweltkrisen […], denn mit beidem hat Kapitalismus viel zu tun«.3
Viel Feind, viel Ehr, viel Gegenwehr: Ein derart kritisiertes System bringt natürlich auch seine Fürsprecher hervor, die – sehr, sehr grob zusammengefasst – den Kapitalismus als die einzig gültige ökonomische Entsprechung von Freiheit, Demokratie und Aufklärung verteidigen. Nicht immer sind besagte Fürsprecher zufällig auch wohlsituierte Gewinner dieses Systems, auffällig oft aber eben doch. Trotzdem haben sie zunächst durchaus recht, wenn sie darauf verweisen, dass und in welcher Geschwindigkeit die Doppelfaust von globalem Kapitalismus und technologischem Fortschritt das Leben unzähliger Menschen in großen Teilen der Welt allgemein deutlich lebenswerter gemacht sowie Lebensstandards angehoben und Teilhabe ermöglicht hat. Die katastrophalen Nebenwirkungen des Kapitalismus sind aus dieser Perspektive zu verschmerzende Begleiterscheinungen, Kinderkrankheiten oder Ergebnis der Handlungen bösartiger, krimineller Subjekte, die die Prinzipien des Kapitalismus ausnutzen und missbrauchen. Ein grundsätzliches, diesem eigenes Problem stellen sie demnach aber nicht dar.
Nun ist die Kritik an den katastrophalen Folgen des Kapitalismus nur die eine Hälfte der These unseres Buches. Die andere Hälfte be[22]zieht sich auf das Lösungspotenzial, auf die positiven Kräfte des Systems, das wir Kapitalismus nennen und das nicht nur wir eng mit dem technologischen Fortschritt verbunden sehen. Wir sind uns sehr sicher, dass wir ohne die Wirkweisen des Kapitalismus nicht solide gebildet, wohlgenährt und ausreichend geimpft im Schein der Tageslichtlampe und zweier Bildschirme unter Verwendung des digitalen Weltwissens ein Buch über die katastrophalen Folgen des Kapitalismus schreiben könnten. Wir könnten uns nicht über Videotelefonate mit Experten und Expertinnen auseinandersetzen, könnten nicht magisch mit Flugzeug, Bahn und Automobil zu Interviewterminen apparieren und gleichzeitig noch weiterrecherchieren, in unerschöpflichen Wissensreservoirs wildern und uns darüber miteinander austauschen. Wir wären alles in allem deutlich ärmer dran. Andererseits bräuchten wir in einer solchen Welt dieses Buch womöglich gar nicht schreiben, weil uns allerlei katastrophale Folgen erspart geblieben wären.
Nun, vielleicht sollten wir der Bitte des eingangs erwähnten Finanz-CEOs erst einmal nachkommen und definieren, worüber wir reden, wenn wir von Kapitalismus und dessen katastrophalen Folgen sprechen. Fangen wir mit dem Kapitalismus an.
Worüber wir reden, wenn wir über Kapitalismus reden
Das Faszinierende bzw. wahnsinnig Frustrierende bzw. für alle, die mit »Reden über Kapitalismus« ihr Geld verdienen, erfreulich Unauflösbare am Kapitalismus ist das Maß an Auslegungsfreiheit, welches der Begriff selbst und seine Definitionsgeschichte mit sich bringen. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden »Kapitalismus« und »Marktwirtschaft« inzwischen mehr oder weniger synonym verwendet. Man geht irgendwie davon aus, dass Kapitalismus auf Freiheitlichkeit und Vernunft basiert oder dass beides – Stichwort »soziale Marktwirtschaft« – zumindest durch Gesetze und Regularien gewährleistet wird. Damit sind wir eigentlich auch schon wieder raus aus der reinen Begriffsdefinition und mittendrin in der Kritik, denn warum be[23]kommt der freiheitliche, aufklärerische, demokratische Kapitalismus es denn von sich aus nicht hin, »sozial« zu sein?
Jürgen Kocka entwickelt in seiner Geschichte des Kapitalismus eine Arbeitsdefinition mit drei wesentlichen Merkmalen, die auch wir für sinnvoll halten. Demnach beruht der Kapitalismus erstens »auf individuellen Eigentumsrechten und dezentralen Entscheidungen«; diese führen ihrerseits zu Ergebnissen in Form von Gewinn oder Verlust, »die Individuen zugeschrieben werden« – also konkreten Personen, Gruppen oder Zusammenschlüssen. Zweitens werden »die verschiedenen wirtschaftlichen Akteure vor allem über Märkte und Preise, durch Wettbewerb und Zusammenarbeit, über Nachfrage und Angebot, durch Verkauf und Kauf von Waren« koordiniert. Dabei umfasst der Begriff der »Ware« im Grunde jede Form von Ressource, Arbeitskraft oder Produkt. Drittens schließlich und namensgebend bildet »Kapital« die Grundlage des Kapitalismus, so etwa in der Form der »Investition und Reinvestition von Ersparnissen und Erträgen in der Gegenwart im Streben nach Vorteilen in der Zukunft« oder als »Akkumulation von Kapital mit den Perspektiven Wandel, Wachstum und dynamische Expansion«. Diese Perspektive auf das Kapital schließt jede Form des Kreditwesens mit ein und macht Rentabilität und Profit zu entscheidenden Erfolgsmaßstäben.4
Für Kocka ist diese Definition hilfreich, weil sie ihm einen historischen Rückblick weit vor die Zeit der begrifflichen Auseinandersetzung mit »dem Kapitalismus« und weit vor die Zeit von Lohnarbeit und Industrien erlaubt. Für uns ist sie hilfreich, weil sie den Keim der Katastrophe ebenso wie den der Lösung in sich trägt. Denn wo dezentrale Entscheidungen, Wettbewerb und Zusammenarbeit, Investition und Reinvestition den wirtschaftlichen Austausch prägen, werden Fortschritt und Wohlstand möglich. Wo andererseits bei einer Akkumulation von Kapital und einer Orientierung an Wachstum und Expansion ausgerechnet Rentabilität und Profit die entscheidenden Erfolgsmaßstäbe werden, sind gewisse katastrophale Extreme schon angelegt. Das wird in der historischen Betrachtung deutlich [24]und steckt auch schon in der zeitlichen Unschärfe von Begriffen wie »Profit«, »Rentabilität« und selbst »Zukunft«. Wie langfristig soll kapitalistisches Handeln denn sein, wie nachhaltig das Streben nach Rentabilität?
Selbstverständlich gibt es auf solche Fragen keine endgültige Antwort. Kockas knappe Definition stellt ja ebenso wenig wie Marx’ ausufernde Kritik ein Regelwerk des Kapitalismus dar – beide beschreiben die beobachteten Wirkweisen eines sich seit Jahrhunderten entwickelnden Systems. Wenn wir es ganz kurz fassen sollen, dann ist Kapitalismus schlicht das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, das unsere Welt dominiert und in dem wir leben und arbeiten. Er hat unfassbaren Reichtum und hochprekäre Lebenssituationen geschaffen. Er hat Chancen eröffnet und neue Risiken in die Welt gebracht. Er hat vieles zum Guten und manches zum Schlechten verändert, neue schädliche Abhängigkeiten geschaffen und alte verfestigt. Sein Expansions- und Wachstumsdrang und sein Fortschrittsmotor haben unsere Welt in Windeseile bequemer, gesünder, gebildeter, verbundener und zugänglicher gemacht. Zugleich droht er nun, sie zu verbrauchen und zu verbrennen.
Eine historische Betrachtung
Die Geschichte des Kapitalismus haben andere schon viel detaillierter, informierter und klüger beschrieben, als wir es könnten. Wir kommen trotzdem nicht ganz drumherum, kurz auf sie einzugehen, wenn wir kapitalistische Prinzipien, technologischen Fortschritt und katastrophale Folgen in einen Zusammenhang stellen wollen. Der Kapitalismus, wie wir ihn heute kennen, trat nicht plötzlich in die Welt, als Karl Marx eines Tages aus dem Fenster schaute und sah, dass es schlecht war. Er– der Kapitalismus, nicht Marx – entstand über Jahrhunderte und Weltregionen hinweg im Zusammenspiel vieler Faktoren und Entwicklungen.
Schon lange vor Beginn unserer Zeitrechnung weisen Fernhandelsbeziehungen – etwa in und zwischen China, Indien, Persien und Arabien – Ansätze kapitalistischer Prinzipien auf. Weit vor dem Auf[25]kommen von industrieller Produktion und Lohnarbeit spielen Kredite, Wechsel und Darlehen eine Rolle in Wirtschaft und Gesellschaft, so wie auch der Staat – die jeweiligen Machthaber und ihre Verwaltung – als Treiber und Getriebener eine Rolle im sich entfaltenden kapitalistischen System spielt. »Erste Verdichtungen beobachtet man in den sich zeitweise herausbildenden Großreichen, die erheblichen Geldbedarf für ihre kriegerischen Unternehmungen entwickelten«, schreibt Kocka und verweist auf die frühen chinesischen, römischen und persischen Reiche, die die Entwicklung von Märkten und Handel begünstigen, Standards und Regeln definieren und teilweise selbst Monopolrechte wahrnehmen.5 Die Handelsbeziehungen innerhalb dieser Reiche und über ihre Grenzen hinweg formen auch die an ihnen beteiligten Gesellschaften neu und ermöglichen dort, wo zuvor vor allem die Selbstversorgerwirtschaft dominierte, nun Spezialisierung, Arbeitsteilung und Kapitalakkumulation. Im 11. und 12. Jahrhundert erlebt etwa China einen wirtschaftlichen Aufschwung, der zwar staatlich reguliert und gelenkt, aber, so Kocka, »von gewinnorientierten privaten Kaufleuten getragen« wird, »deren Investitionen […] staatlich begrenzt, aber erheblich waren und deren sozialer Status in jener Zeit stieg«. Wechselgeschäfte, Schuldbeziehungen und Kredite gibt es damals ebenso schon wie technologische Innovationen wie »Schießpulver, Kompass und Druckerpresse«.6
Das noch lange von feudalistischen Strukturen geprägte Europa betritt in der Geschichte des Kapitalismus vergleichsweise spät die Bühne, dann aber mit Macht. Speziell im heutigen Italien entstehen im 12. Jahrhundert die ersten Banken. Sie werden in der Regel von Kaufleuten betrieben, die sich auf das Finanzwesen spezialisieren, und eröffnen schon bald die Möglichkeit, über die mit dem Handel verbundenen Geldangelegenheiten neue Geschäftsmodelle zu etablieren und vom Privatkunden bis zu Staat und Kirche neue Kundenschichten zu erschließen. Der Expansionsdrang europäischer Mächte bringt neue Handelswege, Ressourcen, Produkte und Wirtschaftsweisen hervor und stärkt die Bedeutung der Kapitalgeber für Wirtschaft [26]und Staat. Die Konsolidierung öffentlicher Schulden wiederum lässt die Wirtschaftskraft vor allem der Niederlande und Englands wachsen und damit deren Kreditwürdigkeit steigen. Neue Organisationsformen, Unternehmen und Aktiengesellschaften entstehen, und mit ihnen kommt es zu den ersten katastrophalen Blasen und Crashs, die aber jeweils nur vorübergehende Rückschläge bedeuten und das grundsätzliche System kaum infrage stellen. Die zunehmend institutionell organisierten Kaufleute und ihre Geldgeber beeinflussen mit ihren Ansprüchen immer stärker auch die Arbeitsweisen und Produktionsverhältnisse der sie beliefernden Gewerbe oder sie bündeln diese gleich selbst in zentralisierten, protoindustriellen Manufakturen. Dies geschieht insbesondere außerhalb der Städte, wo die Unterbeschäftigung der bäuerlichen Schichten die Lohnkosten niedrig hält und keine Zunft- und Gildenregeln das Geschäft verkomplizieren. Das so entstehende System bringt Kocka zufolge nicht nur »Überlebensmöglichkeiten für Millionen« und eine »Beschleunigung demographischen Wachstums«, es etabliert auch die Produktionsweisen, deren fortschreitende Optimierung zu den Innovationen der eigentlichen industriellen Revolution führen wird.7
Mit der industriellen Revolution selbst geht wiederum auch das Aufkommen des Managerkapitalismus einher. Die durch Aktien- und andere Beteiligungsgesellschaftsformen diffuser gewordenen Eigentumsverhältnisse verlangen eine von der Eigentümerschaft gelöste Unternehmensführung: Überregional und global tätige Unternehmen werden zunehmend auch von überregional und global verteilten Eigentümergruppen kontrolliert und von Managern geführt, die diesen Eigentümern gegenüber in erster Linie zur »Performance« verpflichtet sind – gemessen an Rendite und Profit. Der Finanzkapitalismus nimmt Formen an und führt zu einem weiter wachsenden Abstand zwischen dem eigentlichen unternehmerischen Handeln und den auf der Kapitalseite erzielten Gewinnen. Zwar wurden, wie Graebers Schulden-Chronik festhält, »fast alle Bestandteile des finanziellen Apparats, die wir mit dem Kapitalismus verbinden – Zentralbanken, Anleihenmärkte, Leerverkäu[27]fe, Brokerfirmen, Spekulationsblasen, Verbriefung, Renten« –, weit vor der industriellen Revolution und dem Aufkommen der Kapitalismuskritik angelegt und entwickelt, doch im 20. Jahrhundert werden sie zum endgültig dominierenden Aspekt des Kapitalismus.8 Dessen »Tendenz zur Herauslösung des wirtschaftlichen Handelns aus sozialen Kontexten, diese Zuspitzung seiner Ziele auf Profit und Wachstum bei gleichzeitiger Indifferenz gegenüber sonstigen Zielen« hat nun laut Kocka mit »dem Aufstieg des Finanzmarkt-, Finanz- oder Investorenkapitalismus in den letzten Jahrzehnten ein Ausmaß erreicht, das dem System eine neue Qualität gibt und es vor neue, bisher ungelöste Herausforderungen stellt«.9 Dazu später mehr.
Es war nicht alles schlecht im Kapitalismus
Wir räumen erneut freimütig ein: Marktwirtschaft und Kapitalismus haben große Teile der Welt massiv weiterentwickelt, haben die Lebenssituation zahlloser Menschen verbessert, haben Innovationen geschaffen, die die Arbeit und das Leben an sich sicherer, einfacher, komfortabler, freier gemacht haben. Marktwirtschaft und Welthandel haben nicht nur Krieg und Konkurrenz durch Plattformen und Foren des Austausches und der konsensualen Transaktion ersetzt, sondern auch das Prinzip von Kampf und Eroberung durch das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Wie Kocka sehen auch wir in all dem, »Fortschritte, von denen sich rückblickend sagen lässt, dass sie ohne das dem Kapitalismus eigentümliche dauernde Wühlen, Drängen und Umgestalten vermutlich ausgeblieben wären«.10 Obendrein haben sich im letzten Jahrhundert einige Kontrollgruppen vorgestellt, die sehr deutlich machen, dass Planwirtschaft und Sozialismusvariationen keine Wohlstandsalternative bieten. Kapitalismus, kurz und knapp, ist Fortschritt, ist Freiheit, ist Zivilisation und liegt in der menschlichen Natur. Okay, okay.
Symbolfigur und Schutzheiliger dieser Perspektive ist der Philosoph Adam Smith. Sein Buch An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations oder kurz und deutsch Wohlstand der Nationen ist nicht nur die Gründungsschrift der klassischen National[28]ökonomie; es ist auch eine hellsichtige und realistische Beschreibung protokapitalistischer Zustände im 18. Jahrhundert und zugleich die Utopie einer »commercial society«, also einer vom informierten Handel und Tausch bestimmten Gesellschaft, die dem aufgeklärten, vernunftgetriebenen Menschen entspräche. In dieser Gesellschaft würde sich Wohlstand für alle aus den kumulierten Individualinteressen ihrer einzelnen Mitglieder ergeben.
Auch wenn das Wort »Kapitalismus« zu Smiths Zeiten noch nicht erfunden ist, legt er mit seiner Arbeit ein Idealkonzept der kapitalistischen Gesellschaft vor. In ihr wäre die Aufgabe des Staates die Bereitstellung und Pflege der militärischen Sicherheit des Landes, der inneren Sicherheit durch Justiz und Polizei sowie von Infrastruktur, Bildung und anderen öffentlichen, schwierig profitabel zu bewirtschaftenden Gütern. Wie seine heutigen Wiedergänger rechnet auch Smith die erkennbaren Schwächen des bereits real existierenden Kapitalismus entweder dem Einfluss der ihm noch im Weg stehenden und zu überwindenden Institutionen zu oder er ignoriert sie wohlgelaunt. Sehr nüchtern stellt etwa der französische Ökonom Thomas Piketty zu Beginn des 21. Jahrhunderts fest, Adam Smith habe sich »nicht die Frage eines möglichen Auseinanderdriftens der Vermögensverteilung« gestellt.11 Smith verkennt oder übergeht, dass in den sich kapitalistisch neu ordnenden Gesellschaften schon seiner Zeit bei allem insgesamt steigenden Lebensstandard eben auch die soziale Ungleichheit zunimmt.
Natürlich ist unsere Betrachtung von Smiths Jahrhundertarbeit ebenso oberflächlich wie unsere sehr verknappte historische Betrachtung des Kapitalismus. Smiths sozialpolitische Überlegungen oder seine Ausführungen zur Arbeitsteilung können wir hier nur unter »bestimmt interessant, gern später mal näher betrachten« ablegen. Bemerkenswerterweise werden diese Aspekte seines Werkes aber häufig unterschlagen. Wenn Adam Smith zitiert wird, dann meist in einem bestimmten Zusammenhang: Sein Bild von der »unsichtbaren Hand« des Marktes, die das Handeln der einzelnen Marktteilnehmer ganz automatisch zum Wohle der gesamten Gesellschaft lenke, ist es[29]senzieller Teil der Wirtschaftslehre und generell zur Chiffre für ein bedingungsloses Markt- und Kapitalismusvertrauen geworden. Dabei nutzt Smith selbst die Metapher kaum und schon gar nicht im Sinne eines Marktes, der aus seiner eigenen Superkraft heraus Eigennutz in Gemeinwohl verwandelt.
Entsprechend ist auch Smiths Bild der aufgeklärten »commercial society« mitnichten das eines reinen Laissez-faire-Wirtschaftens, bei dem es nur um die Realisierung des höchstmöglichen individuellen Gewinns geht. Smith ist schließlich, so Kocka, »nicht nur Ökonom, sondern auch Moralphilosoph«12 und in diesem Sinne ein humanistischer Denker, der sozialen Aspekten und dem Konzept der »sympathy« zwischen den Menschen – irgendwo zwischen »Sympathie«, »Mitgefühl« und »Verständnis« zu übersetzen – eine hohe Bedeutung beimisst und obendrein klare Gedanken zu vermögensadäquater Besteuerung und Bankenregulierung formuliert. Solche Gedanken und Aspekte werden beim andauernden Verweis auf die »unsichtbare Hand« gern vergessen. Dies ist umso erstaunlicher, als die Schäden, die diese unsichtbare Zauberkraft der Märkte im Lauf der Jahrhunderte eben auch angerichtet hat, sehr real und sehr wohl sichtbar sind.
1.2 Die zerstörerische Kraft des ungehemmten Wirtschaftens
Bleiben wir noch einen Moment bei Smith und dem Kontext, in dem sein Wohlstand der Nationen erschienen ist. Wenn Smith die Idee der idealen »commercial society« skizziert, tut er das mit einem recht klaren, detaillierten, oft ermüdend minutiösen Blick auf das Großbritannien des 18. Jahrhunderts. Seitenlang beschreibt er dessen Verhältnis zu seinen Kolonien und insbesondere das angespannte Verhältnis zu den dreizehn amerikanischen Kolonien. Als sein Werk 1776 erscheint, [30]sind die Unabhängigkeitsbemühungen der Proto-USA zum Unabhängigkeitskrieg eskaliert; die Boston Tea Party liegt drei Jahre zurück, der Zweite Kontinentalkongress hat 1775 die Declaration of the Causes and Necessity of Taking Up Arms verabschiedet, und keine vier Monate nach der Veröffentlichung von Smiths Werk werden die dreizehn Staaten ihre Unabhängigkeit von der britischen Krone erklären.
Smith blickt besorgt darauf, dass die Bewirtschaftung der Kolonien Kapital bindet, das deshalb im Königreich selbst fehlt. Er erklärt: »Bei der gegenwärtigen Verwaltungsart hat daher Großbritannien von der angemaßten Herrschaft über seine Kolonien nur Schaden.«13 Sich der mageren Erfolgschancen seines Ratschlags durchaus bewusst, empfiehlt er, die amerikanischen Kolonien in die Unabhängigkeit zu entlassen und ein fruchtbares Verhältnis der Koexistenz und Kooperation zu diesem neuen Imperium im Werden aufzubauen, das, »wie es auch höchst wahrscheinlich ist, eines der größten und mächtigsten Reiche werden wird, die es jemals in der Welt gegeben hat«.14
Wovon Smith in seiner hellsichtigen Erörterung dieser möglichen neuen Turbonation nur selten spricht, das sind die rund 470 000 Sklaven, die die dreizehn Kolonien schon um 1770 halten und ausbeuten.15 Der Moralphilosoph spricht sich zwar entschieden gegen die Sklaverei und gegen den von Europa unterhaltenen transatlantischen Sklavenhandel aus, doch sein Respekt gegenüber den Vertretern der Kolonien scheint davon seltsam unberührt zu sein. Auch wenn die meisten afrikanischen Sklaven zu der Zeit noch in der Karibik, in Brasilien und in den spanischen Kolonien landen, besteht doch kein Zweifel daran, dass Sklaverei und Sklavenhandel für den wirtschaftlichen Erfolg der dreizehn Kolonien essenziell waren.
Nun ist Sklaverei keine Erfindung des Kapitalismus, des Kolonialismus oder der frühen USA. Doch im transatlantischen Sklavenhandel, in seiner Einbindung in internationale Handelsbeziehungen und in seiner Bedeutung für die streng kalkulierte und ökonomisch zweckrational organisierte Plantagenwirtschaft der Kolonien erreichten Sklaverei und Dehumanisierung eine neue Eskalationsstufe. Die stän[31]dige Verfügbarkeit billiger Sklaven und die scheinbar endlose Ressource fruchtbaren Bodens in den Kolonien machten Ausbeutung und Raubbau nicht nur zu selbstverständlichen Elementen wirtschaftlichen Handelns, sondern zu Elementen des Kapitalismus, die bis heute mit ihm verbunden werden. Zugleich konnte den Abnehmern kolonialer Güter der wahre Preis der Waren weitgehend egal sein. Die horrenden Produktionsbedingungen von Zucker, Tabak oder Baumwolle waren vollständig externalisiert, das heißt, ein Großteil ihrer Kosten wurde von anderen und anderswo getragen.
Nach Jürgen Kocka leistet der Kapitalismus »aus sich selbst heraus wenig Widerstand gegen inhumane Verwendung«,16 was in Anbetracht seiner essenziellen Erfolgsindikatoren nur folgerichtig ist: Ein rein profit- und rentabilitätsorientiertes System hat kein eigenes Korrektiv in Bezug auf Faktoren, die für Profit und Rentabilität nicht relevant sind. Ob ein Faktor relevant ist oder nicht, hängt wiederum eng mit dem betrachteten Zeithorizont und der Fristigkeit der Renditeerwartungen zusammen. Anders gesagt: Dem Kapitalismus sind kurzfristige Gewinne meist wichtiger als langfristige Kosten.
Wenn man die möglichen katastrophalen Folgen dieser kurzfristigen Gewinnorientierung ignoriert, ist sie eigentlich eher Feature als Bug, eher ein Vorteil als ein Fehler im System: Kurz- bis maximal mittelfristige Gewinn- und Gewinnsteigerungserwartungen sind nämlich Investitions- und Innovationsmotoren. Dass etwa der Kapitalismus in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein wesentlicher Faktor im Kampf gegen den globalen Hunger war, dürfte unbestritten sein. Tatsächlich hat die Lebensmittelindustrie seit dem Zweiten Weltkrieg eine sensationelle Leistung erbracht, indem sie den Hunger in den entwickelten Ländern praktisch besiegt hat und indem sie in den Entwicklungsländern immerhin die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, ihn zu bekämpfen. Attraktivität für neue Marktteilnehmer, Innovationsdruck, Produktivitätssteigerung, die Optimierung der Wertschöpfungskette und der internationale Wettbewerb sorgen für reduzierte Kosten, attraktive neue Märkte und erschwingliche Preise.
[32]Die eigentlichen Gesamtkosten wurden dabei freilich zunehmend außer Acht gelassen. Die ökologischen Nachteile ökonomisch zunächst sinnvoller Monokulturen, die Umwelteffekte von Pestiziden, die Langzeitfolgen der landwirtschaftlichen Nutzbarmachung ursprünglicher Ökosysteme, der gewaltige Anteil des Ernährungssektors an den globalen Treibhausgasemissionen – das alles sind Effekte, die nicht auf der Kostenseite der Produktkalkulation auftauchen.





























