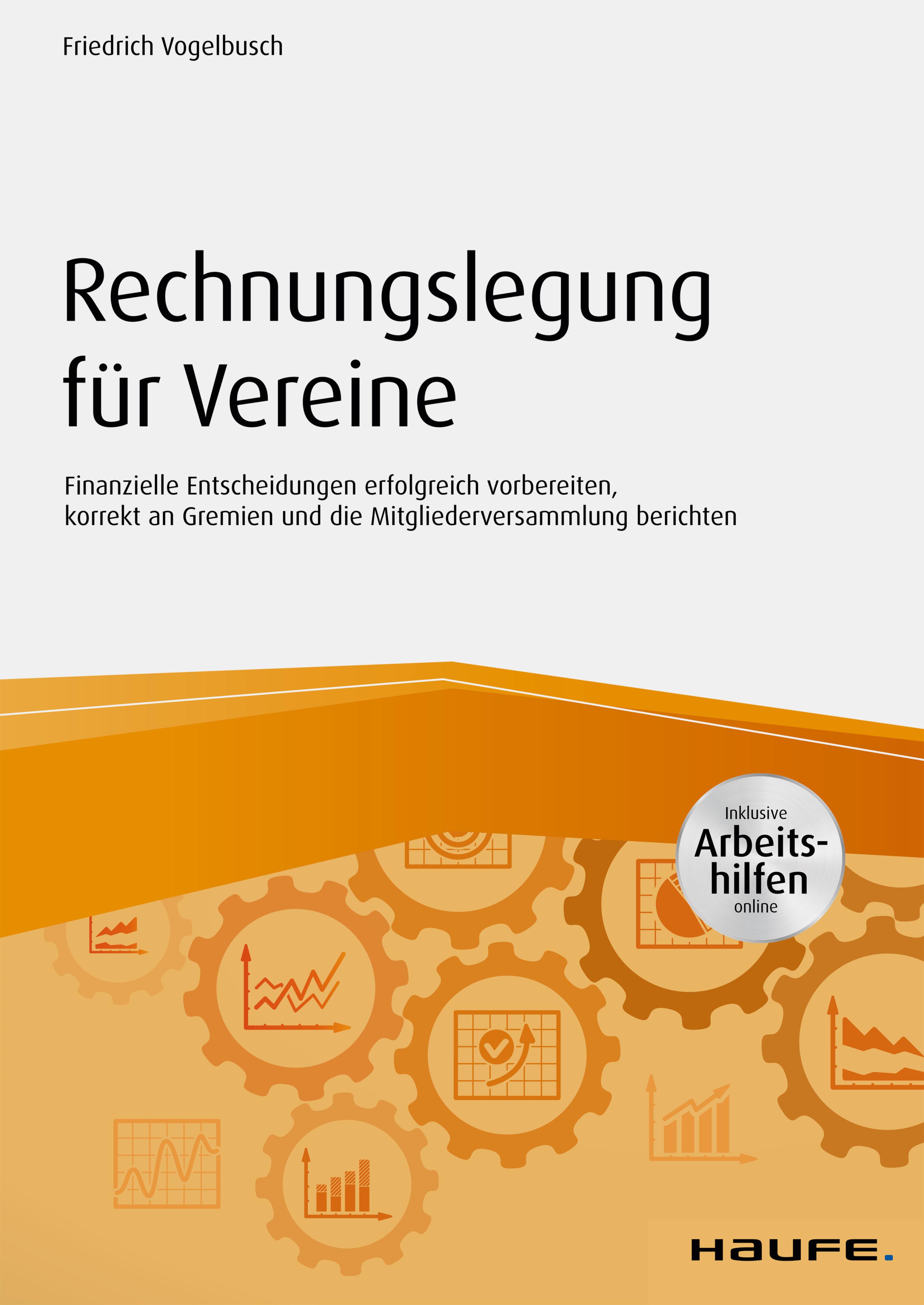
28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haufe Lexware
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Haufe Fachbuch
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Mitglieder, Spender, Fördermittelgeber und natürlich auch das Finanzamt erwarten einen umfassenden und lückenlosen Einblick in die Mittelverwendung. Aber nicht nur für die Darstellung nach außen, sondern auch um finanzielle Schieflagen zu vermeiden, spielen die richtigen Instrumente des Rechnungswesens eine wesentliche Rolle. Dieses Buch gibt Ihnen - abgestimmt auf die Vereinsgröße - das Rüstzeug an die Hand, damit Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben im Blick behalten und korrekt Rechenschaft geben können. Der Autor berät u. a. gemeinnützige Vereine und Verbände und weiß aus seiner langjährigen Erfahrung, was wirklich relevant ist. Er zeigt, was gesetzlich vorgeschrieben ist, um bei einer Rechnungsprüfung auf der sicheren Seite zu sein und Sanktionen zu vermeiden. Inhalte: - Überblick über das Vereinsrechnungswesen - Interne Instrumente zur Steuerung des Vereinsgeschehens - Externe Instrumente zur Erfüllung von gesetzlichen Vorgaben und zur Information von Vereinsmitgliedern und Aufsichtsorganen - Die richtigen Instrumente für verschiedene Entscheidungssituationen - Aufgaben und Regelungen bei der Prüfung des Rechnungswesens - Analyse des Jahresabschlusses - auch anhand von Beispielen - Das System der TransparenzArbeitshilfen online: - Überblick über das Gemeinnützigkeitsrecht - Mechanik der Steuerbegünstigung - Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit i. w. S. - Handlungsmaximen und Grundsätze für die Betätigung - Verfahren der Anerkennung - Mustersatzung - Betätigungsbereiche - Auswirkungen auf die Besteuerung des gemeinnützigen Vereins - FAQ der Besteuerung gemeinnütziger Vereine
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 309
Ähnliche
[7]Inhaltsverzeichnis
Hinweis zum UrheberrechtImpressumAbbildungsverzeichnisVorwort1 Überblick über das Vereinsrechnungswesen1.1 Besonderheit: nur rudimentäre gesetzliche Vorschriften für Vereine1.2 Exkurs: Chefmappe des RKW1.3 Verschiedene Gruppen von Adressaten des Rechnungswesens2 Externe und interne Instrumente des Rechnungswesens2.1 Externe Instrumente des Rechnungswesens2.1.1 Gesetzliche Prüfungspflicht für die Handelsbilanz und (freiwillige) Prüfungspflicht für die Vereinsbilanz2.1.2 Offenlegung des handelsrechtlichen Jahresabschlusses2.1.3 Ableitung der Steuerbilanz aus der Handelsbilanz2.1.4 Fazit: Besonderheiten der externen Rechnungslegung bei Vereinen2.2 Interne Instrumente des Rechnungswesens2.3 Instrumente des Rechnungswesens, die sowohl für externe als auch für interne Zwecke verwendet werden3 Im Laufe des Lebens eines Unternehmens eingesetzte Instrumente des Rechnungswesens (»Von der Wiege bis zur Bahre«)3.1 Businessplan3.2 Finanz- und Lohnbuchhaltung als Grundlage3.2.1 Finanzbuchhaltung in der Form der Staffelrechnung3.2.2 Finanzbuchhaltung in der Form der Einnahme-Überschussrechnung3.2.3 Finanz- und Lohnbuchhaltung in der Form der Doppelten Buchführung in Konten (Doppik)3.3 Internes Kontrollsystem3.4 Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)3.5 Jahresabschluss und Lagebericht3.6 Reporting (Kostenrechnung, Budgetierung und Controlling)3.6.1 Kosten- und Leistungsrechnung3.6.2 Kostenartenrechnung3.6.3 Kostenstellenrechnung3.6.4 Kostenträgerrechnung3.6.5 Deckungsbeitragsrechnung3.6.6 Prozesskostenrechnung3.6.7 Zielkostenrechnung3.6.8 Unternehmerische Planung bei Vereinen3.6.9 Budgetierung3.7 Umfassende Controlling- und Reportinginstrumente3.7.1 Controllinginstrumente zur Steuerung der Wirkungen3.7.2 Reportinginstrumente zur Berichterstattung über die Wirkungen eines Vereins3.7.3 Die Balanced Scorecard als umfassendes Reportinginstrument3.8 Zwischenfazit zu den Instrumenten des Rechnungswesens3.9 Investitionsrechnung3.9.1 Grundlagen der Investitionsrechnung3.9.2 Verfahren der Investitionsrechnung3.10 Kalkulation als Hauptanwendungsfall der Kostenrechnung im Verein3.11 Insolvenzprophylaxe (Überschuldungsstatus und Fortführungsprognose)3.12 Fazit zu den Rechnungslegungsinstrumenten in Vereinen4 Prüfung des Rechnungswesens von Vereinen4.1 Unterscheidung zwischen verschiedenen Vereinsgrößen4.2 Aufgaben und Regelungen der Vereinsprüfung4.2.1 Prüfung der Kassenführung bei kleineren Vereinen4.2.2 Rechnungsprüfung bei mittelgroßen und großen Vereinen5 Analyse des Jahresabschlusses/ Betriebsvergleich/Benchmarking5.1 Überblick zur Analyse des Jahresabschlusses5.2 Kennzahlenanalyse5.3 Betriebsvergleich und Benchmarking5.3.1 Betriebsvergleich5.3.2 Benchmarking5.4 Analyse von Vereinsjahresabschlüssen anhand von Beispielen5.4.1 Einnahmen- und Ausgabenrechnung in verkürzter Form für einen Verein aus dem Bereich Kultur und Bildung5.4.2 Einnahmen- und Ausgabenrechnung und Vermögensübersicht für einen Sportverein5.4.3 Haushaltsplan, Einnahmen- und Ausgabenrechnung und Bestandsverzeichnis/Vermögensübersicht für einen Verein der Freiwilligen Feuerwehr5.4.4 Zusammengefasste Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für einen in der Wohlfahrt tätigen Verein5.4.5 Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für einen in der Wohlfahrt tätigen Verein5.4.6 Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung sowie Prüfungsbericht für einen in der Wohlfahrt tätigen Verein5.4.7 Jahresabschluss und Lagebericht und Prüfungsbericht für einen Sportverein5.4.8 Abschließende Hinweise zur Vorgehensweise bei der Analyse eines Jahresabschlusses (quick and dirty)6 Das System der Transparenz für Vereine6.1 Bestandteile des Systems6.2 Prüfungen durch die Vereinsregister6.3 Prüfungen durch die Finanzverwaltung6.4 Prüfungen durch die Zuwendungsgeber6.5 Prüfungen durch private/halbstaatliche Organisationen6.6 Kontrolle durch die Jahresabschlussprüfung6.7 Gesetzliche Vorschriften zur Transparenz im Bereich der Pflege6.8 Reformvorschläge zur Rechnungslegung und Transparenz für Vereine6.9 Reformvorschläge zur Offenlegung7 Schluss und Zusammenfassung: Rechnungslegung für VereineLiteraturverzeichnisStichwortverzeichnisArbeitshilfen OnlineHinweis zum Urheberrecht
Haufe Lexware GmbH & Co KG
[6]Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-648-13779-6
Bestell-Nr.:
17026-0001
ePub:
ISBN 978-3-648-13780-2
Bestell-Nr.:
17026-0100
ePDF:
ISBN 978-3-648-13781-9
Bestell-Nr.:
17026-0150
Friedrich Vogelbusch
Rechnungslegung für Vereine
1. Auflage 2020
© 2020 Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Freiburg
www.haufe.de
Bildnachweis (Cover): © madpixblue, Adobe Stock
Produktmanagement: Annette Ziegler
Lektorat/Satz: Hans-Jörg Knabel
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
[11]Abbildungsverzeichnis
Abb. 1:Chefmappe; in Anlehnung an die RKW-FührungsmappeAbb. 2:Beispiel für eine Auswertungs- und EingabemaskeAbb. 3:»Drill-Through« als zusätzliche Funktion auf der Taskleiste eines Personal ComputersAbb. 4:Beispiel für »Drill-Through«Abb. 5:Externe und interne Adressaten des externen RechnungswesensAbb. 6:Überblick über das betriebliche RechnungswesenAbb. 7:Größeneinteilung von Vereinen nach Einnahmen und Spenden pro JahrAbb. 8:Handelsbilanz mit ÜberschuldungAbb. 9:Übersicht über die IDW-Standards zur PrüfungAbb. 10:Rechnungslegungs- und Prüfungsstandards des Instituts der WirtschaftsprüferAbb. 11:Allgemeine Regeln zur Buchführung und BuchführungspflichtAbb. 12:Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung i. w. S.Abb. 13:Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung i. e. S.Abb. 14:Weitere Grundsätze ordnungsmäßiger BilanzierungAbb. 15:Im Laufe des Lebens eines Unternehmens eingesetzte Instrumente des RechnungswesensAbb. 16:Gliederung und wesentliche Inhalte des GeschäftsplansAbb. 17:Übersicht zu ausgewählten Businessplan- und InnovationswettbewerbenAbb. 18:Geschäftsplan – Investitions- und FinanzierungsplanAbb. 19:Geschäftsplan – Finanzplan (schematische Darstellung)Abb. 20:Geschäftsplan – RentabilitätsplanAbb. 21:Schema der StaffelrechnungAbb. 22:Beispiel für die StaffelrechnungAbb. 23:Beispiel-BWA für einen ÜberschussrechnerAbb. 24:Vermögensaufstellung für einen Verein mit EÜRAbb. 25:Aufstellung über die Rücklagen eines Vereins mit EÜRAbb. 26:Vermögensaufstellung nach dem Bilanzschema (Teil 1)Abb. 27:Vermögensaufstellung nach dem Bilanzschema (Teil 2)Abb. 28:Schema der Kontenrechnung (einschließlich Beispiel)Abb. 29:Übersicht zur BilanzAbb. 30:Schema der Ermittlung des Eigenkapitals als Saldo in der BilanzAbb. 31:Ableitung der zu bebuchenden Konten aus der AnfangsbilanzAbb. 32:Gewinn- und Verlustrechnung in Kontoform[12]Abb. 33:Gewinn- und Verlustrechnung in StaffelformAbb. 34:Gewinn- und Verlustrechnung mit den in der internationalen Rechnungslegung üblichen ZwischensummenAbb. 35:Grundstruktur eines Kontenrahmens (Sachkontenrahmen 4 – SKR 04)Abb. 36:Prinzipien des internen KontrollsystemsAbb. 37:Schema einer Betriebswirtschaftlichen Auswertung (BWA)Abb. 38:Beispiel einer Betriebswirtschaftlichen Auswertung (BWA) mit Soll-Ist-VergleichswertenAbb. 39:Beispiel für eine laufend geführte OP-ListeAbb. 40:Beispiel für eine OP-Liste, die einmal im Monat als Ergänzung zur BWA erstellt wirdAbb. 41:Ausbau der Standard-BWA (dargestellt am Beispiel der DATEV e. G.)Abb. 42:Verschiedene Formen der BWA (DATEV)Abb. 43:DATEV-Auswertungslayouts für die BWAAbb. 44:Aufgaben des JahresabschlussesAbb. 45:Ist-, Normal- und Plan-KostenrechnungAbb. 46:Unterscheidung von Kostenrechnungen nach dem Zeitbezug und dem Umfang der ZuordnungAbb. 47:Übersicht zur Gliederung der KostenartenAbb. 48:Teilbereiche der KostenrechnungAbb. 49:Verfahren der KostenrechnungAbb. 50:Grundschema des BetriebsabrechnungsbogensAbb. 51:Übersicht – Verfahren zur Verrechnung der sekundären KostenAbb. 52:Beispiel für eine Erfolgsspaltung bei einem Verein im PflegebereichAbb. 53:Kostenträgerrechnung in den Ausprägungen Kalkulation und BetriebsergebnisrechnungAbb. 54:Beispiel für die Berechnung der Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der SelbstkostenAbb. 55:KalkulationsverfahrenAbb. 56:Ermittlung der Selbstkosten pro StückAbb. 57:Übersicht zur Ermittlung der Selbstkosten nach § 255 HGBAbb. 58:BetriebsergebniskontoAbb. 59:Gesamtkostenverfahren (HGB)Abb. 60:Umsatzkostenverfahren (HGB)Abb. 61:Beispiel für eine einfache Deckungsbeitragsrechnung in einer WfbMAbb. 62:Deckungsbeitragsrechnung mit DB je Engpasseinheit (je Stück) – AusgangssituationAbb. 63:Deckungsbeitragsrechnung mit DB je Engpasseinheit (je Stück) – verbesserte Verteilung der ProduktionskapazitätAbb. 64:Untergliederung der Fixkosten in UnterartenAbb. 65:Schema einer mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung[13]Abb. 66:Zahlenbeispiel für eine mehrstufige DeckungsbeitragsrechnungAbb. 67:Anwendungsbereiche der ProzesskostenrechnungAbb. 68:Prozessanalyse im Rahmen der Erstellung einer ProzesskostenrechnungAbb. 69:Formeln zur Berechnung der Prozesskostensätze, Umlagesätze und der GesamtprozesskostenAbb. 70:Beispiel Prozesskostenrechnung – der AllokationseffektAbb. 71:Beispiel Prozesskostenrechnung – unterschiedliche Kalkulationen (Zuschlagskalkulation versus prozessorientierte Kalkulation) ergeben einen KomplexitätseffektAbb. 72:Beispiel Prozesskostenrechnung – unterschiedliche Kalkulationen (Zuschlagskalkulation versus prozessorientierte Kalkulation) ergeben einen DegressionseffektAbb. 73:Beispiel für das Vorgehen beim ZielkostenmanagementAbb. 74:Phasen des PlanungsprozessesAbb. 75:Zeitliche Horizonte und Inhalte der PlanungAbb. 76:Zusammenhang der verschiedenen operativen TeilpläneAbb. 77:Eigenschaften flexibler und fixer BudgetsAbb. 78:Zusammenhang zwischen Planung, Budgetierung und BudgetkontrolleAbb. 79:Veranschaulichung der vier Messgrößen der Wirkungskette anhand von BeispielenAbb. 80:Dimensionen der Erfolgs- und Wirkungsmessung (gemessen in der handelsrechtlichen GuV und in weiteren Rechenwerken)Abb. 81:Stakeholderbezogene WirkungsmatrixAbb. 82:Beispielindikatoren für LeistungenAbb. 83:Beispielindikatoren für WirkungenAbb. 84:GemeinwohlbilanzAbb. 85:Die vier Perspektiven der Balanced ScorecardAbb. 86:Beispiel für eine Balanced ScorecardAbb. 87:Wertung der Balanced ScorecardAbb. 88:Instrumente des Kaufmanns, gegliedert nach Entwicklungsstufen des RechnungswesensAbb. 89:Übersicht über den Prozess der InvestitionsplanungAbb. 90:KostenvergleichsrechnungAbb. 91:Vollständiger Finanzplan (fiktives Beispiel für zwei Waschmaschinen)Abb. 92:Definition der RentabilitätskennzifferAbb. 93:Ermittlung der AmortisationsdauerAbb. 94:Übersicht zu den dynamischen Verfahren der InvestitionsrechnungAbb. 95:Beispiel für eine Divisionskalkulation für einen Verein mit einem stationären Pflegeheim[14]Abb. 96:Beispiel für eine Divisionskalkulation – Berechnung der DivisorenAbb. 97:Beispiel für eine Divisionskalkulation – Berechnung der kostendeckenden Investkosten (Varianten 96 % und 40 % Wagniszuschlag und 100 % Auslastung)Abb. 98:Absolute Zahl der Insolvenzen nach Branchen (2018 und 2017)Abb. 99:Insolvenzanfälligkeitsquote nach Branchen (2018 und 2017)Abb. 100:Ursachen einer unternehmerischen KriseAbb. 101:Phasen der unternehmerischen KriseAbb. 102:Insolvenzsymptome außerhalb des RechnungswesensAbb. 103:Insolvenzsymptome aus dem RechnungswesenAbb. 104:Zusammenhang zwischen Unternehmensentwicklung und UnternehmenskrisenAbb. 105:Tatbestandsmerkmale der ZahlungsunfähigkeitAbb. 106:Abgrenzung von der Zahlungsunfähigkeit – die ZahlungsstockungAbb. 107:Tatbestandsmerkmale der drohenden ZahlungsunfähigkeitAbb. 108:Tatbestandsmerkmale der ÜberschuldungAbb. 109:Finanzwirtschaftliche SanierungsmaßnahmenAbb. 110:Stadien von unternehmerischen KrisenAbb. 111:Übersicht über die Organe und die Rechenschaftslegung bei kleinen VereinenAbb. 112:Übersicht über die Organe und die Rechenschaftslegung bei großen VereinenAbb. 113:Überblick über die unterjährige Rechenschaftslegung der Geschäftsführung und der Aufsichtstätigkeit des Vorstands bei kleineren VereinenAbb. 114:Überblick über die unterjährige Rechenschaftslegung der Geschäftsführung und der Aufsichtstätigkeit des Vorstands bei großen VereinenAbb. 115:Prüfung bei kleineren Vereinen im Überblick (mit internem Kassenprüfer)Abb. 116:Checkliste zu den Erörterungen zur Kassenprüfung kleinerer VereineAbb. 117:Kassenprüfung bei mittelgroßen und großen Vereinen (mit externem Abschlussprüfer)Abb. 118:Externe und interne KennzahlenAbb. 119:Absolute Kennzahlen und VerhältniskennzahlenAbb. 120:Wichtige Kennzahlen zur Analyse des JahresabschlussesAbb. 121:Weitere Kennzahlen für VereineAbb. 122:DuPont-KennzahlensystemAbb. 123:Typen des BenchmarkingsAbb. 124:Verwaltungskosten bezogen auf die Umsatzerlöse[15]Abb. 125:Einnahmen- und Ausgabenrechnung in verkürzter Form für den Omse e. V.Abb. 126:Anzahl der Mitarbeiter 2018Abb. 127:Kennzahlen für den Omse e. V. (2018)Abb. 128:Einnahmen und Ausgaben des Gautinger SC e. V.Abb. 129:Kennzahlen zur Ertragslage für den Gautinger SC e. V.Abb. 130:Einnahmen und Ausgaben des Gautinger SC e. V.Abb. 131:Schema für den Haushaltsplan für einen Verein der Freiwilligen FeuerwehrAbb. 132:Schema für die Einnahmen- und Ausgabenrechnung inkl. Soll-Ist-Vergleichs für einen Verein der Freiwilligen FeuerwehrAbb. 133:Schema für eine Vermögensübersicht für einen Verein der Freiwilligen FeuerwehrAbb. 134:Gewinn- und Verlustrechnung des Diözesan-Caritasverbands AugsburgAbb. 135:Kennzahlen zur Ertragslage des Diözesan-Caritasverbands AugsburgAbb. 136:Bilanz des Diözesan-Caritasverbands AugsburgAbb. 137:Kennzahlen zur Vermögenslage des Diözesan-Caritasverbands AugsburgAbb. 138:Bilanz der Diakonie Rostocker Stadtmission zum 31.12.2018Abb. 139:Kennzahlen zur Vermögenslage der Diakonie Rostocker Stadtmission zum 31.12.2018Abb. 140:Gewinn- und Verlustrechnung für die Diakonie Rostocker Stadtmission e. V.Abb. 141:Kennzahlen zur Vermögenslage der Diakonie Rostocker Stadtmission für das Geschäftsjahr 2018 und das VorjahrAbb. 142:Angaben aus dem Anhang des Diakonie Rostocker Stadtmission e. V.Abb. 143:Beteiligungsübersicht des Diakonie Rostocker Stadtmission e. VAbb. 144:Beteiligungsübersicht des Diakonie Rostocker Stadtmission e. VAbb. 145:Bilanz zum 31.12.2017 des DRK Kreisverband Berlin Steglitz-Zehlendorf e. V.Abb. 146:Gewinn und Verlustrechnung 2017 des DRK Kreisverband Berlin Steglitz-Zehlendorf e. V.Abb. 147:Ertragslage des DRK Kreisverband Berlin Steglitz-Zehlendorf e. V. – PrüfungsberichtAbb. 148:Zusammensetzung der GesamtleistungAbb. 149:Kennzahlen zur Ertragslage des DRK Kreisverband Berlin Steglitz-Zehlendorf e. V. für die Jahre 2016 und 2017Abb. 150:Vermögenslage (Vermögensstruktur) des DRK Kreisverband Berlin Steglitz-Zehlendorf e. V. – Prüfungsbericht[16]Abb. 151:Vermögenslage (Kapitalstruktur) des DRK Kreisverband Berlin Steglitz-Zehlendorf e. V. – PrüfungsberichtAbb. 152:Kennzahlen zur Vermögenslage, Kapital- und Finanzstruktur des DRK Kreisverband Berlin Steglitz-Zehlendorf e. V. für die Jahre 2016 und 2017Abb. 153:Anlagenspiegel des DRK Kreisverband Berlin Steglitz-Zehlendorf e. V. zum 31.12.2017 PrüfungsberichtAbb. 154:Siegel und Unterschrift des Abschlussprüfers des DRK Kreisverband Berlin Steglitz-Zehlendorf e. V. zum 31.12.2017Abb. 155:Titelseite des Prüfungsberichts des DOSB e. V. zum 31.12.2017Abb. 156:Bilanz des DOSB e. V. zum 31.12.2017Abb. 157:Gewinn- und Verlustrechnung des DOSB e. V. für die Jahre 2017 und 2016Abb. 158:Ertragslage des DOSB e. V. 2017 und 2016 – PrüfungsberichtAbb. 159:Aufgliederung des neutralen Ergebnisses für den DOSB e. V. 2017 und 2016 – PrüfungsberichtAbb. 160:Kennzahlen zur Ertragslage des DOSB e. V. 2017 und 2016Abb. 161:Vermögenslage (Vermögensstruktur) des DOSB e. V. 2017 und 2016 – PrüfungsberichtAbb. 162:Vermögenslage (Kapitalstruktur) des DOSB e. V. 2017 und 2016 – PrüfungsberichtAbb. 163:Kennzahlen zur Vermögenslage und zur Finanzstruktur des DOSB e. V. 2017 und 2016Abb. 164:Erster Analyseblick auf die Gewinn- und VerlustrechnungAbb. 165:Zweiter bis vierter Analyseblicke auf die Bilanz[17]Vorwort
Vor Ihnen liegt eine Darstellung der Grundlagen der Rechnungslegung von Vereinen.
Meine berufliche Praxis als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer hat mich in den letzten 27 Jahren wiederholt mit dem Thema in Verbindung gebracht. Schon immer war mir aufgefallen, dass die Jahresabschlussprüfung von Vereinen eine eigene Materie ist.
Es gibt nur rudimentäre gesetzliche Vorschriften zur Rechnungslegung, dies ist anders als bei Kapitalgesellschaften und Kaufleuten. Für diese Unternehmen gibt das III. Buch des Handelsgesetzbuchs (HGB) gesetzliche Regeln für ein „kaufmännisches Rechnungswesen“ und eine doppelte Buchführung in Konten (Doppik) vor.In der Praxis ist es bei größeren Trägern (z. B. aus der Sozialwirtschaft oder bei Sportvereinen) üblich, freiwillig das kaufmännische Rechnungswesen, d. h. einen Jahresabschluss bestehend aus einer Bilanz, einer Gewinn- und Verlustrechnung und einem Anhang, aufzustellen und um einen Lagebericht zu ergänzen.Als ich Anfang 2006 meine Antrittsvorlesung an der Ev. Hochschule für soziale Arbeit in Dresden zum Thema „Transparenz im Bereich der Freien Wohlfahrt“ vorbereitete, musste ich feststellen, dass die Beschäftigung mit diesem Thema bei den meisten Vereinen noch in den Kinderschuhen steckte.
Zum 1.1.2007 hat der Gesetzgeber die Pflicht zur Veröffentlichung der Jahresabschlüsse für gewerbliche Unternehmen verschärft. Mittlerweile kann man im elektronischen Bundesanzeiger die Jahresabschlüsse, die sie ergänzenden Lageberichte und das Testat der Abschlussprüfer von über 5 Mio. Unternehmen einsehen. Zudem veröffentlichen die Kommunen in sog. Beteiligungsberichten die Haushaltspläne und Jahresabschlüsse der kommunalen Unternehmen.
Hier gibt es also noch eine „offene Baustelle“ für Vereine. Zwar gibt es weder für die Rechnungslegung noch für die Offenlegung von Vereinen gesetzliche Vorschriften, aber im Zusammenhang mit Skandalen und den sich daraus ergebenden Vorwürfen wird das Thema der Transparenz und der Offenheit oft angesprochen. Mit meinen Ausführungen in Kapitel 6 (»Das System der Transparenz für Vereine«) möchte ich dazu beitragen, dass sich möglichst viele Vereine freiwillig auf eine größere Transparenz hinsichtlich ihrer Zahlen und vereinsrechtlichen Gegebenheiten einlassen.
Bei der Darstellung der Grundlagen der Rechnungslegung ist es inhaltlich für Vereine wichtig, die Standards des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) kennenzulernen. Da es keine ausführlichen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung von Vereinen gibt, kommt den Empfehlungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer eine besondere Rolle zu. Die Rechnungslegungs- und Prüfungsstandards (RS und PS des IDW) für [18]Vereine richten sich in erster Linie an die Abschlussprüfer, da sie wertvolle Hinweise als Empfehlungen der Prüfergilde geben. In Kapitel 2 gehe ich ausführlich auf die Standards des IDW ein. Ihre Kenntnis ist eine wesentliche Grundlage für jeden im Rechnungswesen von Vereinen tätigen Mitarbeiter.
In dieses Buch fließen meine langjährigen Praxiserfahrungen in der Beratung und Prüfung von Vereinen ein. Darüber hinaus verfüge ich über Erfahrungen aus zahlreichen Vorträgen und Vorlesungen zum Thema Vereinsrechnungswesen.
Bei der Vermittlung der Materie habe ich die positive Erfahrung gemacht, dass zwei didaktische Hilfsmittel besonders geeignet sind, den Verantwortlichen im Verein die Grundzüge des Rechnungswesens zu erklären:
die strenge Unterscheidung zwischen internen und externen Rechnungslegungsinstrumenten,die chronologische Darstellung, welche Instrumente „von der Wiege bis zur Bahre“ von einem Verein genutzt werden können.Darüber hinaus ist es hilfreich, sich anhand von Praxisbeispielen einen Einblick in die unterschiedlichen Formen der Rechnungslegung von Vereinen zu verschaffen. Die Abschnitte zur Rechnungslegung und Prüfung des Rechnungswesens von Vereinen werden deshalb durch ein Kapitel abgeschlossen, in dem ich anhand von Beispielen aus der Praxis verschiedene Typen von Vereinsjahresabschlüssen darstelle und analysiere.
Da die Offenlegung von Jahresabschlüssen keine Pflicht ist, musste ich auf die freiwillig im Internet veröffentlichten Vereinsjahresabschlüsse zurückgreifen. Ich bedanke mich ausdrücklich bei den Vereinen, die dies ermöglichen. Für die kommende Zeit appelliere ich an dieser Stelle ausdrücklich dazu, größere Transparenz und Offenheit zu gewähren. Spenderinnen und Spender sowie alle Institutionen, die Vereinen Geld z. B. in Form von Zuschüssen oder Leistungsentgelten anvertrauen, erwarten einen Bericht über die Tätigkeit und die erzielten ideellen und finanziellen Ergebnisse der eingesetzten Mittel.
Bei einigen Vereinen musste ich Details der Rechnungslegung schriftlich erfragen. Besonders Herrn Bernhard Gattner vom Caritasverband für die Diözese Augsburg e. V. danke ich für seine freundliche Zuarbeit.
Auf die besonderen Anforderungen, die sich aus dem Gemeinnützigkeits- und Umsatzsteuerrecht ergeben, will ich in diesem Vorwort gar nicht eingehen. Die hier dargestellte Materie ist komplex, und es ist eine Herausforderung, nicht nur den in der Vereinspraxis tätigen Verantwortlichen die Grundlagen und die Besonderheiten der Rechnungslegung zu vermitteln, sondern auch die Ehrenamtlichen mit in den Blick zu [19]nehmen, die in Vorständen und Aufsichtsgremien über die Geschicke von Vereinen entscheiden sollen.
Die Governance-Struktur, wie Vereine hinsichtlich der Geschäftsführung und Aufsichtsgremien organisiert werden, und wie die Prüfung der Rechnungslegung stattfindet, spielt in den letzten Jahren eine immer größere Rolle. Mit der Frage, wie eine effektive Aufsicht stattfinden kann, beschäftigen sich verschiedene sog. Corporate-Governance-Kodizes in mehreren Vereinsbranchen. Hier wird zumindest den größeren Vereinen angeraten, dem hauptamtlichen Vorstand einen ehrenamtlichen Aufsichtsrat gegenüberzustellen. In der Wohlfahrtsbranche wird es seit über 15 Jahren empfohlen, in Vereinen das an das Aktienrecht angelehnte duale Modell zu verwirklichen. Da dieses Buch sich schwerpunktmäßig der Rechnungslegung widmet, kann auf das Governance-Thema nicht vertieft eigegangen werden.
Neben dem Dank an den Haufe-Lexware Verlag, die Begleitung während der gesamten Phase der Konzeption und Fertigstellung des Buchs durch Frau Annette Ziegler, möchte ich meiner Frau Heike für ihre kompetente, aber immer zugewandte Kritik und Korrektur der verschiedenen Textentwürfe danken. Ohne ihre Hilfe wäre dieses Buch nicht so fröhlich geschrieben und fertiggestellt geworden.
Dresden, den 7. Februar 2020
[21]1Überblick über das Vereinsrechnungswesen
Vereine und ihre Rechnungslegung sind traditionell ein wenig beachtetes betriebswirtschaftliches Thema.1
Über die zahlenmäßige Bedeutung der Rechtsform des eingetragenen Vereins liegt keine amtliche Statistik vor. Schätzungen auf der Basis der etwa 600 Vereinsregister in Deutschland gehen davon aus, dass derzeit mehr als 600.000 Vereine tätig sind. Darunter sind als wichtigste Kategorien über 200.000 Sportvereine, knapp 75.000 diakonische bzw. karitative Vereine und 60.000 Kulturvereine zu nennen.2 Im Jahre 2016 waren rund 36 Mio. Kinder, Jugendliche und Erwachsene Mitglieder in einem Verein.
Als Arbeitgeber spielen insbesondere die in der Sozialwirtschaft tätigen Vereine der Wohlfahrtspflege eine bedeutsame Rolle. Eine Studie der Deutschen Bank hat ermittelt, dass bei den Wohlfahrtsverbänden, die in vielen Fällen in der Rechtsform des eingetragenen Vereins strukturiert sind, 5,6 % aller Beschäftigten in Deutschland angestellt sind.3
Beim Zusammenstellen der betriebswirtschaftlichen und vereinsrechtlichen Grundlagen für die Rechnungslegung der Vereine hat es sich als notwendig herausgestellt, zwischen kleinen Vereinen auf der einen Seite und mittelgroßen bzw. großen Vereinen auf der anderen Seite zu unterscheiden.
Kleinere Vereine sind durch das persönliche Engagement der Vereinsmitglieder geprägt, ein ehrenamtlicher Vorstand ist tätig. Vorstand und Mitglieder kennen sich. Die Rechnungslegung für geringere Geschäftsumfänge kann als einfache Einnahmen-Ausgabenrechnung geführt werden. Mit Ausnahme von Übungsleitern sind keine Angestellten zu verzeichnen. Alles ist transparent und durch persönliche Bekanntschaften und im Idealfall durch Vertrauen geprägt.Dagegen sind Vereine mit einem größeren Geschäftsbetrieb (meist ein Zweckbetrieb, der Bildungsziele, sportliche, soziale oder kulturelle Ziele umsetzt) eher mit gewerblichen Unternehmen vergleichbar. Hier werden andere Instrumente der Vereinsgeschäftsführung genutzt, die Vereinsorganisation unterscheidet zwischen eh[22]renamtlichen Aufsichtsfunktionen und professionellem Management. Dem einzelnen Vereinsmitglied ist es nicht mehr ohne Weiteres möglich, durch persönliches Inaugenscheinnehmen einen Überblick über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu behalten. Für solche mittelgroßen bzw. großen Vereine sind die in der gewerblichen Wirtschaft genutzten Rechnungslegungsinstrumente empfehlenswert.Für dieses Buch ist es sinnvoll, zwischen kleinen Vereinen auf der einen und mittelgroßen bzw. großen Vereinen auf der anderen Seite zu unterscheiden. An verschiedenen Stellen dieses Buchs wird diese Unterscheidung vorgenommen und dort jeweils erläutert.
1.1Besonderheit: nur rudimentäre gesetzliche Vorschriften für Vereine
Für gewerbliche Unternehmen ist unstreitig klar, dass das Management effiziente Instrumente zur Steuerung des Betriebsgeschehens vorhalten muss. Den Gesellschaftern, Aktionären und den von ihnen ins Amt gewählten Aufsichtsgremien ist regelmäßig über den Gang der Geschäfte zu berichten (unterjährige Rechenschaft) und am Ende des Geschäftsjahres Rechnung über die getätigten Geschäfte zu legen. Um einen ausschüttungsfähigen Gewinn zu ermitteln und für die Zwecke der Besteuerung ist ein Jahresabschluss aufzustellen und ab einer gewissen Größe auch durch einen unabhängigen Dritten (Abschlussprüfer) prüfen zu lassen.
Überraschenderweise stellt man fest, dass dies bei Vereinen nicht so ist – jedenfalls, wenn man auf die gesetzlichen Vorschriften zur Buchhaltung, Rechnungslegung und Lageberichterstattung schaut. Ein betriebswirtschaftlicher Autor hat es so formuliert: es gibt zur Rechnungslegung von Vereinen nur »rudimentäre« gesetzliche Bestimmungen – dies stellt eine Besonderheit gegenüber bilanzierenden Unternehmen in der gewerblichen Wirtschaft bzw. im kommunalen Bereich dar.4
Die Ausführungen in diesem Buch nehmen mitunter Bezug auf die Sozialbranche. Vereine aus dieser Branche stehen exemplarisch für andere Vereine mit einem vergleichbaren Geschäftsvolumen. Die Übertragung der für Vereine in der Sozialbranche gefundenen Lösungen ist z. B. auf den Bereich des Sports, der Bildung, Wissenschaft oder Kultur denkbar.
Zum Rechnungswesen ist einleitend anzumerken, dass mithilfe der vielfältigen Instrumente des Rechnungswesens das betriebliche Geschehen allumfassend abgebil[23]det wird. Mithilfe des Rechnungswesens berichtet das Management und gibt Rechenschaft an die Vereinsmitglieder, die Aufsichtsorgane und die Öffentlichkeit.5
Für den Manager ist es erforderlich, alle Geschäftsvorfälle von der Planung, über die Realisierung bis hin zur Rechenschaftslegung und nachträglichen Kontrolle in steuerbaren Rechengrößen (qualitativ und quantitativ) abzubilden. Nach allgemeinen Marketinggrundsätzen müssen auch Informationen über die Nutzer, Klienten, Kunden und ihre Bedürfnisse (Marktseite) und die Mitbewerber (Konkurrenten) zur Verfügung stehen.
1.2Exkurs: Chefmappe des RKW
Die Notwendigkeit für die Geschäftsleitung, allumfassende Informationen in einer geordneten Weise parat zu haben, veranschaulicht die sog. Chefmappe des Rationalisierungskuratoriums der Deutschen Wirtschaft (RKW).
Abb. 1: Chefmappe; in Anlehnung an die RKW-Führungsmappe; Quelle: RKW (Hrsg.) (1995): RKW-Führungsmappe – Zahlen der Unternehmenssteuerung, 9. Aufl., Eschborn, S.
Traditionell wurde diese Chefmappe in Papierform gefüllt. Heute stehen elektronische Reportingsysteme zur Verfügung, die helfen, die Informationserfordernisse systematisch zur Verfügung zu stellen.
Das folgende Beispiel zeigt ein detailliertes und komplexes Berichtswesensinstrument, das heute in mittelgroßen und großen Vereinen zur Steuerung des Betriebsgeschehens angewendet wird.
[25]Beispiel: OLAP-Datenbank eines Vereins der Freien Wohlfahrt (umfassendes und systematisch gegliedertes Reportingsystem)
Beim OLAP-System handelt es sich um ein vor fast 20 Jahren eingeführtes System auf der Basis einer multidimensionalen Realtime-Datenbank.
Das ursprüngliche Projekt hieß »Wirtschaftsplan auf Basis TM1«. Für die vielfältigen Anforderungen sind in den 1990er-Jahren komplexe und verknüpfte Excel-Mappen entstanden, waren aber an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gestoßen. Es zeichnete sich ab, dass die Berechnungen nicht weiter ausgebaut werden konnten. Beim Beispielsverein stand ein Generationenwechsel im Finanz- und Controllingbereich an. Das Know-how, das sich im Kopf des ausscheidenden bisherigen Controllers befand und in ausgefeilten Excel-Mappen steckte, sollte in eine Datenbank übernommen und systematisiert abgebildet werden. Gleichzeitig sollte die Flexibilität von Excel als Frontend erhalten bleiben. Das wurde durch die genannte Datenbanksoftware gewährleistet.
Das viele Jahre nur für einen einzelnen Arbeitsplatz ausgelegte System wurde 2014 auf ein Mehrplatzsystem mit 25 Arbeitsplätzen umgestellt. Damit haben alle Verantwortlichen Zugriff auf das System. Sie können in den webbasierten Berichten in alle Richtungen und Details analysieren. Durch einen »Drill-Through« auf die relationalen Buchungsdaten kann sich jeder Berechtige (z. B. der Einrichtungsleiter) bis zu den einzelnen Buchungssätzen »durchdrillen«. Es werden alle relevanten Daten inklusive der Buchungstexte angezeigt.
Vor Kurzem wurde das System auf die aktuelle Softwareversion umgestellt. Damit wurde der Grundstein für weitere Entwicklungen gelegt.
Im Beispielsfall wurde ein Reportinginstrument für einen in der Wohlfahrt tätigen Verein mit folgenden Hilfefeldern umgesetzt (siehe Abbildungen 2–4):
Pflegeheim,Altenheim,Werkstatt für behinderte Menschen,Wohnheim für behinderte Menschen,ambulante Frühförderstelle,Tagungsort,Erholungs- und Rüstzeitenheim,Seniorenbegegnungsstätte.Der Budgetierungs- und Planungsprozess verläuft in einem Wirtschaftsjahr wie folgt:
Erstellung des Haushaltsplans,Verhandlung der Entgelte,Berechnung des genehmigten Plans,Aktualisierung,Soll-/Ist-Vergleiche,Prognoserechnung durch die jeweiligen Verantwortlichen.Mithilfe des Reporting-Tools auf der Basis der Datenbank wird die Steuerung des Beispielvereins wesentlich erleichtert. Das zunächst in Excel programmierte Controlling wird heute in einer professionellen Steuerungssoftware an mehreren Arbeitsplätzen durchgeführt. Der hier dargestellte Verein ist in den vergangenen 25 Jahren stark gewachsen. Er verfügt mittlerweile über ein professionelles Berichts- und Rechnungswesen. Die heutige IT-gestützte Lösung steht einem in der Industrie üblichen Enterprise-Resource-Planning (ERP) nicht nach!
Abb. 2: Beispiel für eine Auswertungs- und Eingabemaske; Quelle: A. Steffens (2017): Pantha Rhei
Abb. 3: »Drill-Through« als zusätzliche Funktion auf der Taskleiste eines Personal Computers; Quelle: A. Steffens (2017): Pantha Rhei
Abb. 4: Beispiel für »Drill-Through«; Quelle: A. Steffens (2017): Pantha Rhei
[28]1.3Verschiedene Gruppen von Adressaten des Rechnungswesens
Beim Ermitteln der Adressaten des Rechnungswesens stellt man fest, dass mehrere Gruppen als Empfänger von Daten aus der Betriebs- und Finanzbuchhaltung anzutreffen sind. So können z. B. verschiedene Gruppen als Adressaten des Jahresabschlusses mit der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung in den Blick genommen werden:6
finanzwirtschaftlich orientierte Adressaten (Anteilseigner, Gläubiger wie z. B. Kreditinstitute und die Finanzverwaltung),leistungswirtschaftlich orientierte Adressaten (Kunden, Lieferanten, Belegschaft und konkurrierende Unternehmen),Meinungsbildner (Finanzanalysten, Presse und Öffentlichkeit),weitere Interessierte aus der Politik oder Kostenträger,Stakeholder aus dem Umfeld des Vereins (Mitarbeiter, Vereinsmitglieder, Mitglieder von Aufsichtsgremien und Beiräten).Ausgehend von der Stellung der Adressaten bietet es sich an, interne und externe Adressaten des Jahresabschlusses bzw. des Rechnungswesens zu unterscheiden (siehe Abbildung 5).
Abb. 5: Externe und interne Adressaten des externen Rechnungswesens
[29]Der Jahresabschluss soll externen Dritten eine allgemeine und standardisierte Informationsgrundlage bieten. An der Aussage des Jahresabschlusses sind zugleich auch interne Adressaten interessiert:
Eigentümer wollen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung des eigenen Unternehmens informiert sein.Entscheidungen der Manager werden rückwirkend anhand des Jahresabschlusses bewertet. Zudem erhalten sie häufig einen leistungsorientierten Teil des Gehalts als Vergütung. Erwirtschaftet das Unternehmen z. B. einen hohen Gewinn, fällt ihre variable Vergütung entsprechend hoch aus.Kontrollorgane, wie z. B. der Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft, nutzen den Jahresabschluss, um u. a. Risiken für das Unternehmen zu identifizieren.Die weitaus größere Gruppe der Bilanzadressaten machen jedoch die externen Adressaten aus.
die Beurteilung der Vermögens- und Ertragslage des Unternehmens dient Investoren zur Entscheidungsfindung,Kreditinstitute nehmen den Jahresabschluss als Grundlage für die Beurteilung der Bonität eines Vereins und damit für die Vergabe von Krediten sowie für deren Konditionen (z. B. Zinssatz),Lieferanten wollen sichergehen, dass ihre Rechnungen bezahlt werden, und Kunden erwarten bei einer Anzahlung auch ihre Ware,dem Fiskus dient der Jahresabschluss als Grundlage für die Besteuerung.Für den am Vereinsmanagement Interessierten ist es zu Beginn seiner Ausbildung erfahrungsgemäß schwierig, einen Überblick über die verschiedenen Instrumente des Rechnungswesens zu gewinnen. Sie oder er fragt sich:
Warum gibt es so eine Fülle an Instrumenten?Gibt es eine gesetzliche Vorgabe für ein Instrument oder bin ich in der Ausgestaltung frei, meine speziellen Anforderungen und Wünsche einzubringen?Welches Instrument soll ich in einer konkreten Entscheidungssituation einsetzen?Da es ein ganzes System eingesetzter Instrumente gibt, empfiehlt sich eine Einordnung nach zwei Merkmalen:
nach innen und nach außen gerichtete Instrumente,im Lebenszyklus eines Unternehmens eingesetzte Instrumente (von der Wiege bis zur Bahre).1 Es liegen einige wenige Beiträge vor, vgl. z. B. F. Vogelbusch (2007): Rechnungslegung gemeinnütziger Vereine, in: steuer-journal.de, Das Fachmagazin für Steuerberater, Heft Nr. 21, S. 24–29, ders. (2011): Transparenz und gute Vereinsführung, in: Der Verein, Heft 3, S. 1 ff. und ders. (2011): Prüfungen in Vereinen, in: Der Verein, Heft 4, S. 10 ff.
2 Vgl. Stiftung für Zukunftsfragen (2014): Immer mehr Vereine – immer weniger Mitglieder: Das Vereinswesen in Deutschland verändert sich, Newsletter Ausgabe 254.
3 Vgl. Deutsche Bank (2010): Wirtschaftsfaktor Wohlfahrtsverbände, Studie vom 16.11.2010, db-Research, Frankfurt a. M.
4 J. Littkemann/B. Sunderdiek (1999): Der Verein: Rechtsgrundlagen zur Besteuerung, Rechnungslegung und Publizität, in: BBK 1999, F. 4, S. 1791.
5 Vgl. als Übersichtswerke zu den besonderen Anforderungen und Lösungen im NPO-Sektor und bei Vereinen: R. Schauer/R. Andessner/D. Greiling (2015): Rechnungswesen und Controlling für Nonprofit-Organisationen, 4. Aufl., Bern und F. Vogelbusch (2018): Management von Sozialunternehmen, München, Kap. 9 und 11 (S. 463 ff.).
6 Unterscheidung stammt aus K. Küting (1996): Erhebliche Gestaltungsspielräume: Das Spannungsverhältnis zwischen Bilanzpolitik und Bilanzanalyse, in: Blick durch die Wirtschaft, S. 11.
[31]2Externe und interne Instrumente des Rechnungswesens
Man unterscheidet im Rechnungswesen zwischen Instrumenten, die nach außen gerichtet sind, um die Vereinsmitglieder, Gläubiger, Zuwendungsgeber und die interessierte Öffentlichkeit zu informieren, und intern ausgerichteten Rechenwerken, die dem Management zur Steuerung des Betriebsgeschehens dienen.
Externe Instrumentedienen der Rechenschaftslegung ggü. Vereinsmitgliedern, der Information der Öffentlichkeit bzw. der Erfüllung steuerlicher oder handelsrechtlicher Pflichten.Intern ausgerichtete Rechenwerkedienen dem Management zur Steuerung, können laufend geführt werden (z. B. kurzfristige Erfolgsrechnung (BWA), Kostenstellen-Reporting) oder je nach Erfordernis in der jeweiligen Entscheidungssituation (Investitionsrechnung, Nachkalkulation)Daneben gibt es Instrumente, die sowohl nach innen als auch nach außen eingesetzt werden bzw. allgemeine Zwecke haben (Finanzbuchhaltung und Lohnbuchhaltung dienen der Dokumentation der Geschäftsvorfälle, in Gerichtsverfahren können in der Buchhaltung erfasste Geschäftsvorfälle vorgelegt werden). Sie haben eine wichtige Beweisfunktion. Für statistische Zwecke sind dagegen verschiedenste Daten einsetzbar. Aus allgemeiner, jahrhundertealter kaufmännischer Übung folgt, dass bei der Verbuchung die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung einzuhalten sind.
Abbildung 6 gibt einen Überblick über die nach innen und nach außen gerichteten Instrumente.
Für kleine Vereine mit einer überschaubaren Tätigkeit ist die externe Rechnungslegung über eine Einnahmen-Ausgabenrechnung (einfache Buchführung) ausreichend.7
Tipp zur Einnahmen-Ausgabenrechnung (einfache Buchführung)
Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW) hat am 1.3.2006 eine Stellungnahme zur »Rechnungslegung von Vereinen« verabschiedet (IDW RS HFA 14), die sich mit den Normen für den eingetragenen Verein (e. V.) befasst. Diese fachliche Stellungnahme ist für Vereine besonders bedeutsam, weil es – wie eingangs betont – keine bzw. nur rudimentäre gesetzlichen Bestimmungen zur Rechnungslegung gibt.
Der IDW RS HFA 14 betrachtet es als ausreichend, dass kleinere Vereine eine Rechnungslegung im Sinne einer Einnahmen-Ausgabenrechnung erstellen. Die einfache Buchführung sei allerdings nur für »leicht zu überschaubare Verhältnisse« angemessen und ausreichend, in denen die Zufälligkeiten der Zahlungszeitpunkte sich nicht wesentlich auswirken (IDW RS HFA 14 Tz. 19).
Abb. 6: Überblick über das betriebliche Rechnungswesen
Tipp zur steuerrechtlichen Buchführungspflicht
Steuerrechtlich ist die derivative von der originären Buchführungspflicht zu unterscheiden.
Derivative Buchführungspflicht
Nach dem Steuerrecht sind zunächst alle Unternehmer buchführungspflichtig, die unter § 238 HGB fallen. Man spricht von der derivativen oder abgeleiteten Buchführungspflicht nach § 140 Abgabenordnung (AO); sie gilt für eingetragene Vereine, die nach der Art ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit (im Zweckbetrieb bzw. im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb), nach der Branchenbetätigung (im Pflegebereich bzw. in der Krankenhausbranche) oder wegen der (extrem seltenen) Größe der Betätigung des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs nach dem Publizitätsgesetz (PublG) handelsrechtlich buchführungspflichtig sind.
Originäre Buchführungspflicht
Die steuerliche Buchführungspflicht knüpft nicht an der Tätigkeit oder der Rechtsform an, sondern am Umsatz und am Gewinn. Nach § 141 AO entsteht die steuerliche Buchführungspflicht beim Überschreiten folgender Grenzen:
In diesem Fall spricht man von originärer Buchführungspflicht. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Finanzverwaltung einen Verein, der nach § 141 AO bilanzierungspflichtig ist, ausdrücklich auffordern muss, kaufmännisch Bücher zu führen. Die steuerliche originäre Buchführungspflicht beginnt mit dem Beginn des Wirtschaftsjahres, das auf diese Aufforderung des Finanzamts folgt.
Vereine sind aufgrund ihrer Rechtsform nicht wie Kaufleute bzw. Unternehmen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft buchführungspflichtig.
Allenfalls kommt daher eine Buchführungspflicht aufgrund des Überschreitens der steuerlichen Grenzen oder des Unterhaltens eines Handelsgewerbes in Betracht. Aus den üblichen Vereinszwecken ergeben sich nach den Erfahrungen des Autors nur in sehr seltenen Ausnahmefällen (z. B. Sozialkaufhäuser und Werkstätten) handelsgewerbliche Betätigungen.
Hieraus folgt, dass Vereine eine einfache Zusammenstellung ihrer Einnahmen und Ausgaben verwenden können, um den vereinsrechtlichen und steuerlichen Rechnungslegungspflichten nachzukommen.
Wenn ein Verein sich dazu entschließt, nach den handelsrechtlichen Grundsätzen Bücher doppisch zu führen, tut er dies freiwillig. Ab einer gewissen Größenordnung der Vereinstätigkeit wird dieses kaufmännische Rechnungswesen den Vereinen empfohlen, da nur so die umfassenden Informationen bereitgestellt werden können, die das Vereinsmanagement zur optimalen Entscheidungsfindung und betrieblichen Steuerung benötigt.
Segna hat 2006 und Buchheim/Deffland/Penter haben 2008 analog der Unterscheidung der Rechnungslegungsvorschriften bei Kapitalgesellschaften (§ 267 HGB) Größenklassen für die Vereinsrechnungslegung vorgeschlagen.8 Damit ließen sich die Anforderungen, die an die Rechnungslegung von Vereinen gestellt werden, abstufen, z. B. nach Umsätzen und erhaltenen Spenden. Weitere Merkmale könnten die Zahl der Mitarbeiter und die Bilanzsumme sein. Abbildung 7 zeigt diesen Zusammenhang.
Für dieses Buch wird in Übereinstimmung mit diesen Autoren für mittelgroße und große Vereine empfohlen, einen kaufmännischen Jahresabschluss mit den Bestandteilen 1. Bilanz, 2. Gewinn- und Verlustrechnung und 3. Anhang sowie einen Lagebericht zu erstellen. Die Grundlage für die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung ist eine doppelte Buchführung in Konten (Doppik).
Abb. 7: Größeneinteilung von Vereinen nach Einnahmen und Spenden pro Jahr; in Anlehnung an Buchheim/Deffland/Penter (2008): Nachbarn, a. a. O.
2.1Externe Instrumente des Rechnungswesens
Für die Aufgabe des nach außen gerichteten externen Rechnungswesens ist es charakteristisch, dass objektive Grundlagen für die Form und die Inhalte der Rechenwerke zur Information der außenstehenden Adressaten zur Verfügung gestellt werden. Allgemeine Grundlage der nach außen gerichteten Rechnungslegung ist der Handelsbrauch – die sog. Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB).
Die GoB haben als Generalnorm den Grundsatz der Nachvollziehbarkeit und Objektivität. Ein sachverständiger Dritter muss sich nach diesem Grundsatz in angemessener Zeit einen Überblick über die Lage des Vereins und seiner Geschäftsvorfälle verschaffen können.
Die Zwecke von Buchführung und handelsrechtlichem Jahresabschluss sind aus dem Gesetzestext, der Entstehungsgeschichte des HGB sowie aus rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Begründungen abzuleiten. In der Literatur werden vornehmlich drei Buchführungs- und Jahresabschlusszwecke angeführt: die Dokumentation, die Rechenschaft und die Kapitalerhaltung.9
Unter der Dokumentation ist die vollständige und nachvollziehbare Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle zu verzeichnen. Dies ist der grundlegende Zweck der Buchführung. Die Buchführungspflicht ist in § 238 Abs. 1 HGB normiert. Aus der Buchführung können alle weiteren Informationen entnommen werden, die für den Jahresabschluss erforderlich sind.Ein weiterer Zweck ist die Rechenschaft über die wirtschaftliche Lage und Entwicklung des Unternehmens.Der Zweck der Substanz- und Kapitalerhaltung des Unternehmens wird dadurch erfüllt, dass intern und extern über die Lage informiert wird (Pflicht zur Selbstinformation des Kaufmanns und zur Offenlegung über den Bundesanzeiger) und für die Ausschüttung von Gewinnen bzw. die Entnahme von Eigenkapital bestimmte Regeln und Grenzen (Ausschüttungssperr-Regelungen) gesetzt werden.[35]Diese drei Zwecke bilden zusammen ein ausgewogenes System, das zum Ausgleich der divergierenden Interessen der Adressaten des Jahresabschlusses dient.
Am Rande sei darauf hingewiesen, dass die Buchführung und der handelsrechtliche Jahresabschluss das Fundament für den steuerrechtlichen Jahresabschluss (verkürzt die Steuerbilanz) bieten.
Aufgaben der Handelsbilanz
Die Handelsbilanz hat zwei wesentliche Aufgaben:
Feststellen des jährlichen Gewinns undfeststellen der Fortführungsprämisse.Die erste wichtige gesetzliche Aufgabe des handelsrechtlichen Jahresabschlusses nach §§ 242 ff. HGB (die sog. »Handelsbilanz«) besteht darin, den jährlichen Gewinn festzustellen, der für eine Gewinnausschüttung zur Verfügung steht. Eine gewerbliche AG oder GmbH kann u. a. nur dann einen Jahresgewinn ausschütten, wenn ein ausreichendes Eigenkapital vorhanden ist.10 Die Hauptversammlung der AG bzw. die Gesellschafterversammlung der GmbH stellt den Jahresabschluss fest und beschließt eine Gewinnverwendung (Thesaurierung/Einbehalt von Gewinnen oder Dividenden bzw. Gewinnausschüttung). Ohne den nach den handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellten Jahresabschluss ist ein Gewinnverwendungsbeschluss nichtig (§ 256 Aktiengesetz – AktG).
Damit regelt die Handelsbilanz die Kompetenz der Organe eines Unternehmens (Machtverteilung zwischen Gesellschaftern/Aktionären und Management/Vorstand). Dem Aufsichtsrat kommt die Aufgabe zu, die Bilanz zu prüfen und sie der Hauptversammlung zur Feststellung vorzuschlagen. Die wegen einer gebildeten Rückstellung oder einer Forderungseinzelwertberichtigung nicht ausschüttbaren finanziellen Mittel verbleiben im Unternehmen. Die Gesellschafter bzw. Aktionäre können nur über den ausgewiesenen Bilanzgewinn verfügen.11
ARBEITSHILFE ONLINE
Vereine sind in den allermeisten Fällen gemeinnützig. Ein gemeinnütziger Verein





























