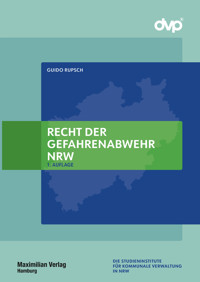
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Maximilian Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dieses Lehrbuch zum Recht der Gefahrenabwehr richtet sich in erster Linie an die Beamtenanwärterinnen und -anwärter des mittleren Dienstes, an die Auszubildenden zum Verwaltungsfachangestellten sowie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Ersten Verwaltungslehrgangs. Es ist aber auch zur Vorbereitung auf das Auswahlverfahren oder zur Auffrischung bzw. Grundlagenvermittlung für den Zweiten Verwaltungslehrgang geeignet. Der Inhalt orientiert sich an den aktuellen Lehr- und Stoffverteilungsplänen der Studieninstitute in Nordrhein-Westfalen und stellt den zu behandelnden Lehrstoff in verständlicher Form dar. Besonderer Wert wurde darauf gelegt, den abstrakten Stoff anhand vieler Beispiele anschaulich zu verdeutlichen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
GUIDO RUPSCH
RECHT DER GEFAHRENABWEHR NRW
1. Auflage
Maximilian Verlag
Hamburg
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
Redaktionsstand: 31.03.2023
ISBN 978-3-7869-1308-5
© 1. Auflage, 2023 by Maximilian Verlag, Stadthausbrücke 4, 20355 Hamburg
Ein Unternehmen der
Alle Rechte vorbehalten.
Layout: Tim Mergemeier
Produktion: Reemers Publishing Services GmbH, Krefeld
Umschlaggestaltung: Marisa Tippe
53619 Rheinbreitbach
DER AUTOR
Guido Rupsch hat 1987 bei der Stadt Köln den Vorbereitungsdienst für den gehobenen nichttechnischen Dienst begonnen und 1990 die Staatsprüfung abgelegt. Seit 1991 unterrichtet er, zunächst am Studieninstitut der Stadt Köln, dann am Rheinischen Studieninstitut, als nebenamtlicher Dozent die Fächer Allgemeines Verwaltungsrecht, Recht der Gefahrenabwehr und Methodik der Rechtsanwendung.
Er war mehr als ein Jahrzehnt im Ordnungsbereich tätig und ist stellvertretender Leiter des Bürgeramtes Nippes.
VORWORT
Dieses Lehrbuch richtet sich in erster Linie an die Beamtenanwärterinnen und -anwärter des mittleren Dienstes, an die Auszubildenden zum Verwaltungsfachangestellten sowie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Ersten Verwaltungslehrgangs. Es ist aber auch zur Vorbereitung auf das Auswahlverfahren oder zur Auffrischung bzw. Grundlagenvermittlung für den Zweiten Verwaltungslehrgang geeignet.
Der Inhalt orientiert sich an den aktuellen Lehr- und Stoffverteilungsplänen der Studieninstitute in Nordrhein-Westfalen und stellt den zu behandelnden Lehrstoff in verständlicher Form dar. Besonderer Wert wurde darauf gelegt, den abstrakten Stoff anhand vieler Beispiele anschaulich zu verdeutlichen.
Auf Fußnoten wurde weitestgehend verzichtet, weil den entsprechenden Fundstellen erfahrungsgemäß nicht nachgegangen wird. Ebenfalls wurde darauf verzichtet, Meinungsstreits und Mindermeinungen wiederzugeben. Im Interesse einer kompakten Darstellung des Stoffs wurde ausschließlich die herrschende Meinung dargestellt.
Zugunsten einer besseren Lesbarkeit wurde im Text eine einheitliche Geschlechtsform verwendet. Selbstverständlich beziehen sich die Ausführungen aber auf die Angehörigen aller Geschlechter.
Bedanken möchte ich mich bei Mariachiara Fera, Johanna Havemann und Lothar Spahlholz für fleißiges Korrekturlesen sowie wertvolle Ratschläge und Anregungen.
Über ein Feedback freue ich mich. Anregungen, Lob, Kritik oder Verbesserungsvorschläge können Sie gerne an den Verlag oder per E-Mail direkt an mich ([email protected]) richten.
Gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft der Studienleitungen in Nordrhein-Westfalen wünsche ich Ihnen viel Erfolg und ein gutes Gelingen für Ihr berufliches Weiterkommen.
Köln, im März 2023 Guido Rupsch
INHALT
Impressum
DER AUTOR
VORWORT
LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
1EINLEITUNG, BEGRIFF DER GEFAHRENABWEHR
1.1Die Stellung des Rechts der Gefahrenabwehr im deutschen Rechtssystem
1.2Die Rechtsgrundlagen für die Tätigkeit der Ordnungsbehörden
2DER AUFBAU DER ORDNUNGSBEHÖRDEN
2.1Der Aufbau der Sonderordnungsbehörden
2.2Der Aufbau der Allgemeinen Ordnungsbehörden
3DIE ZUSTÄNDIGKEIT
3.1Die sachliche Zuständigkeit
3.2Die instanzielle Zuständigkeit
3.3Die örtliche Zuständigkeit
3.4Die funktionelle Zuständigkeit
3.5Die außerordentliche Zuständigkeit
3.6Die Zuständigkeit der Polizei auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr
4DIE ERMÄCHTIGUNGSGRUNDLAGE
4.1Die öffentliche Sicherheit
4.1.1Die Individualrechtsgüter und Kollektivgüter
4.1.2Die geschriebene Rechtsordnung
4.1.3Der Staat und seine Einrichtungen
4.2Die öffentliche Ordnung
4.3Die Gefahr
4.3.1Der Schaden
4.3.2Die hinreichende Wahrscheinlichkeit
4.3.3In absehbarer Zeit
4.3.4Konkrete und abstrakte Gefahr
4.3.5Die objektive Gefahrenlage
4.3.6Gesteigerte Gefahrenbegriffe
4.3.7Die Störung
5ERMESSEN UND VERHÄLTNISMÄßIGKEIT
5.1Das Entschließungsermessen
5.2Das Auswahlermessen
5.3Die richtige Ermessenausübung
5.3.1Ermessensnichtgebrauch
5.3.2Ermessensfehlgebrauch
5.3.2.1Ermessensfehlgewichtung
5.3.2.2Sachlich falscher Zweck
5.3.2.3Unzutreffender Sachverhalt
5.3.2.4Unvollständiger Sachverhalt
5.3.3Ermessensüberschreitung
5.4Ermessensreduzierung auf Null
5.5Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit
5.5.1Der legitime Zweck
5.5.2Die Geeignetheit
5.5.3Die Erforderlichkeit
5.5.4Die Angemessenheit
5.6Der Austausch der Mittel
6DIE ORDNUNGSPFLICHT
6.1Der Verhaltensstörer
6.1.1Der unmittelbare Verhaltensstörer nach § 17 Abs. 1 OBG
6.1.1.1Person
6.1.1.2Verhalten
6.1.1.3Verursachung
6.1.2Der mittelbare Verhaltensstörer nach § 17 Abs. 2 OBG
6.1.3Der mittelbare Verhaltensstörer nach § 17 Abs. 3 OBG
6.1.3.1Zur Verrichtung bestellt
6.1.3.2Gefahrenverursachung
6.1.3.3In Ausübung der Verrichtung
6.2Der Zustandsstörer
6.2.1Der Eigentümer als Zustandsstörer
6.2.2Der Inhaber der tatsächlichen Gewalt als Zustandsstörer
6.3Störermehrheiten
6.4Behörden als Störer
6.5Der ordnungsbehördliche Notstand
7DIE HANDLUNGSFORMEN DER ORDNUNGSBEHÖRDE
7.1Ordnungsverfügungen
7.1.1Die formelle Rechtmäßigkeit einer Ordnungsverfügung
7.1.1.1Die Zuständigkeit
7.1.1.2Die Form
7.1.1.3Das Verfahren
7.1.1.4Die Begründung
7.1.2Die materielle Rechtmäßigkeit einer Ordnungsverfügung
7.1.2.1Die Ermächtigungsgrundlage
7.1.2.2Der Adressat
7.1.2.3Ermessen und Verhältnismäßigkeit
7.1.2.4Die inhaltliche Bestimmtheit
7.1.2.5Keine Unmöglichkeit
7.1.2.6Das Verbot der Aufsichtserleichterung
7.1.3Der Aufbau einer Ordnungsverfügung
7.1.3.1Der Briefkopf
7.1.3.2Der Bescheideingang
7.1.3.3Der Tenor
7.1.3.4Die Begründung
7.1.3.5Die Rechtsbehelfsbelehrung
7.1.3.6Der Bescheidausgang
7.2Realakte
7.3Ordnungsbehördliche Verordnungen
7.4Erlaubnisse und Bescheinigungen
8DER VERWALTUNGSZWANG
8.1Die Zwangsmittel
8.1.1Die Ersatzvornahme
8.1.2Das Zwangsgeld
8.1.3Der unmittelbare Zwang
8.1.4Abgrenzungsprobleme
8.2Zuständigkeit und Verfahren
8.2.1Das gestreckte Verfahren
8.2.1.1Die Androhung
8.2.1.2Die Festsetzung
8.2.1.3Die Anwendung
8.2.2Der Sofortvollzug
ANHANG 1Prüfschema „Rechtmäßigkeit einer Ordnungsverfügung“
ANHANG 2Prüfschema „Rechtmäßigkeit einer Zwangsmaßnahme im gestreckten Verfahren“
ANHANG 3Beispiel für eine Ordnungsverfügung auf Grundlage der ordnungsbehördlichen Generalklausel mit Androhung eines Zwangsgeldes
ANHANG 4Beispiel für eine Zwangsgeldfestsetzung
ANHANG 5Beispiel für eine Ordnungsverfügung auf Grundlage der Generalklausel und spezialgesetzlicher Ermächtigungsgrundlage mit Androhung der Ersatzvornahme
ANHANG 6Beispiel für die Festsetzung einer Ersatzvornahme
ANHANG 7Beispiel für eine Ordnungsverfügung auf Grundlage einer spezialgesetzlichen Ermächtigungsgrundlage mit Androhung unmittelbaren Zwangs
ANHANG 8Beispiel für die Festsetzung unmittelbaren Zwangs
ANHANG 9Beispiel für eine Ordnungsverfügung in Form der Allgemeinverfügung
LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
1EINLEITUNG, BEGRIFF DER GEFAHRENABWEHR
Unter Gefahrenabwehr versteht man die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung durch die Ordnungsbehörden oder die Polizei. Das Recht der Gefahrenabwehr wird auch Polizei- und Ordnungsrecht genannt. Von Bedeutung ist diese rein begriffliche Unterscheidung jedoch nicht.
Sowohl die Ordnungsbehörden als auch die Polizei werden – teilweise sogar mit denselben Mitarbeitern – ebenfalls im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenrechts tätig. Dieses wird daher fälschlicherweise gerne als Teil des Rechts der Gefahrenabwehr angesehen, muss aber streng von diesem getrennt werden.
Im Recht der Gefahrenabwehr agieren die Ordnungsbehörden und die Polizei in die Zukunft gerichtet. Intention ihres Handelns ist es, Schäden für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu verhindern. Sie werden somit präventiv, also vorbeugend, tätig. Davon zu unterscheiden sind die repressiven Tätigkeiten der Ordnungsbehörden und der Polizei im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenrechts. Hierdurch wird keine Gefahr abgewehrt, sondern ein in der Vergangenheit begangenes rechtswidriges Verhalten wird durch die Verhängung eines Bußgeldes geahndet.
Beispiel:
Konstantin Kahl wird von Mitarbeitern des Ordnungsamtes dabei beobachtet, wie er nackt durch den Kölner Volksgarten joggt. Als sie ihn ansprechen, reagiert er uneinsichtig und erklärt, dass Nacktjoggen durch ungehindertes Schwitzen zu einem besseren Temperaturausgleich des Körpers beitrage und Nacktheit bei körperlicher Aktivität zu einem angenehmeren Körpergefühl führe.
Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes haben nun zunächst die Möglichkeit, präventiv gegen Konstantin Kahl vorzugehen. Um zu verhindern, dass er auch in Zukunft nackt joggt, können sie Gefahrenabwehrmaßnahmen ergreifen und ihm auf Grundlage von § 14 Abs. 1 OBG aufgeben, dass er sich nicht mehr nackt auf öffentlichen Flächen des Kölner Stadtgebiets aufhalten darf.
Das Nacktjoggen stellt aber auch eine Ordnungswidrigkeit nach § 118 Abs. 1 OWiG dar. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes können daher auch das falsche Verhalten in der Vergangenheit, nämlich das bereits erfolgte Nacktjoggen, ahnden und eine Geldbuße gegen Konstantin Kahl festsetzen. Sie gehen dann repressiv gegen ihn vor.
Für eine spätere Tätigkeit im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst hat das Ordnungsrecht eine deutlich größere praktische Relevanz als das Polizeirecht. Deswegen liegt der Schwerpunkt in diesem Lehrbuch auf dem Ordnungsrecht.
1.1DIE STELLUNG DES RECHTS DER GEFAHRENABWEHR IM DEUTSCHEN RECHTSSYSTEM
Das deutsche Rechtssystem unterscheidet zwischen Öffentlichem Recht, Strafrecht und Privatrecht.
Das Öffentliche Recht unterteilt sich in Völkerrecht, Staats- und Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht sowie weitere Rechtsgebiete.
Innerhalb des Verwaltungsrechts wird weiter unterschieden in Allgemeines und Besonderes Verwaltungsrecht. Das Recht der Gefahrenabwehr bzw. das Ordnungsrecht ist Teil des Besonderen Verwaltungsrechts und baut auf dem Allgemeinen Verwaltungsrecht auf (siehe Schaubild auf Seite 20).
Auch innerhalb des Ordnungsrechts wird in Allgemeines und Besonderes Ordnungsrecht unterschieden. Sofern im Besonderen Ordnungsrecht (z. B. Umweltrecht, Lebensmittelrecht, Melderecht) keine spezialgesetzlichen Regelungen enthalten sind, gelten dort die Vorschriften des Allgemeinen Ordnungsrechts. Das Besondere Ordnungsrecht baut daher auf dem Allgemeinen Ordnungsrecht auf.
1.2DIE RECHTSGRUNDLAGEN FÜR DIE TÄTIGKEIT DER ORDNUNGSBEHÖRDEN
Soweit das Grundgesetz keine andere Regelung trifft, ist nach Art. 30 GG die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben Sache der Länder. Ebenfalls bestimmt Art. 70 Abs. 1 GG, dass die Länder das Recht der Gesetzgebung haben, soweit durch das Grundgesetz dem Bund keine Gesetzgebungsbefugnisse verliehen werden.
In vielen Bereichen des Besonderen Ordnungsrechts liegen die Gesetzgebungskompetenzen beim Bund, weil diese Bereiche Gegenstand der ausschließlichen oder der konkurrierenden Gesetzgebung sind.
Ausschließliche Gesetzgebungskompetenz bedeutet, dass alleine der Bund berechtigt ist, gesetzliche Regelungen zu erlassen. Dies gilt beispielsweise für den Bereich des Pass-, Melde- und Ausweiswesens (Art. 73 Abs. 1 Nr. 3 GG) und den Grenzschutz (Art. 73 Abs. 1 Nr. 5 GG).
Im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung können die Länder nur dann gesetzliche Regelungen treffen, wenn der Bund von seinem Gesetzgebungsrecht keinen Gebrauch macht. Allerdings hat der Bund auch hier in weiten Teilen Regelungen getroffen, beispielsweise im Bereich des Aufenthalts- und Niederlassungsrechts der Ausländer (Art. 74 Abs. 1 Nr. 4 GG) und im Bereich des Lebensmittelrechts (Art. 74 Abs. 1 Nr. 20 GG).
Der Bereich des Rechts der Gefahrenabwehr gehört weder in den Bereich der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz des Bundes noch zur konkurrierenden Gesetzgebung und fällt daher in die Gesetzgebungskompetenz der Länder.
Die Vorschriften des Rechts der Gefahrenabwehr sind in Nordrhein-Westfalen nicht in einem einzelnen Gesetzeswerk zusammengefasst worden, sondern der Gesetzgeber hat die Regelungen auf viele Gesetze verteilt.
Das für die ordnungsbehördliche Tätigkeit wichtigste Gesetz ist das Gesetz über den Aufbau und die Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz – OBG). Das Polizeigesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (PolG) gilt nicht nur für die Tätigkeit der Polizei, sondern enthält durch die Regelung des § 24 Abs. 1 OBG auch Ermächtigungsgrundlagen für die Ordnungsbehörden.
Wenn die Ordnungsbehörden Vollstreckungsmaßnahmen ergreifen, müssen die Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVG) beachten werden. Für evtl. Kostenansprüche gelten das Gebührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (GebG) und die Ausführungsverordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (VO VwVG).
Von Bedeutung sind darüber hinaus auch die Regelungen des Allgemeinen Verwaltungsrechts, sodass im Rahmen der ordnungsbehördlichen Tätigkeit das Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG) beachtet werden muss.
Neben diesen Rechtsvorschriften müssen im Recht der Gefahrenabwehr aber auch eine große Anzahl von Spezialgesetzen beachtet werden. Das können zum einen Landesgesetze sein, wie z. B. das Landesimmissionsschutzgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LImSchG). Aber auch Bundesgesetze, wie z. B. das Gaststättengesetz (GastG) oder die Gewerbeordnung (GewO), spielen hier eine Rolle.
Darstellung aus Frings/Spahlholz, Rdnr. 026
2DER AUFBAU DER ORDNUNGSBEHÖRDEN
Wie bereits dargelegt, erfolgt die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung u. a. durch die Ordnungsbehörden. In Nordrhein-Westfalen wird zwischen Sonderordnungsbehörden und Allgemeinen Ordnungsbehörden unterschieden.
Sonderordnungsbehörden sind nach § 12 OBG Behörden, denen durch Gesetz oder Verordnung auf bestimmten Sachgebieten Aufgaben der Gefahrenabwehr oder in ihrer Eigenschaft als Sonderordnungsbehörde andere Aufgaben übertragen worden sind.
Die Allgemeinen Ordnungsbehörden sind im Gegensatz zu den Sonderordnungsbehörden nicht für ein spezielles, eng umrissenes Gebiet der Gefahrenabwehr, sondern für alle denkbaren Gefahrensituationen zuständig. Sie handeln dann, wenn keine Zuständigkeit einer Sonderordnungsbehörde besteht.
Der Grund dafür, dass es neben den Allgemeinen Ordnungsbehörden auch Sonderordnungsbehörden gibt, liegt darin, dass es für die Abwehr mancher Gefahren spezieller Kenntnisse und Fertigkeiten bedarf. In der Regel sind die Sonderordnungsbehörden für ihr spezielles Aufgabengebiet personell und sachlich besser ausgestattet als die Allgemeinen Ordnungsbehörden.
2.1DER AUFBAU DER SONDERORDNUNGSBEHÖRDEN
Sonderordnungsbehörden können Teil der Kommunalverwaltung oder eigens für diesen Zweck errichtet worden sein. Sonderordnungsbehörden, die Teil der Kommunalverwaltung sind, nennt man unselbstständige Sonderordnungsbehörden. Wurden sie eigens für diesen Zweck errichtet, spricht man von selbstständigen Sonderordnungsbehörden.
Teil der Kommunalverwaltung und damit unselbstständige Sonderordnungsbehörden sind beispielsweise die Abfallwirtschaftsbehörden, die Bauaufsichtsbehörden oder die Denkmalbehörden. Eigens zu diesem Zweck errichtet wurden zum Beispiel der Landesbetrieb Mess- und Eichwesen NRW sowie der Landesbetrieb Wald und Holz NRW. Sie sind daher selbstständige Sonderordnungsbehörden.
Der Aufbau der Sonderordnungsbehörden ergibt sich nicht aus dem OBG, sondern immer aus dem jeweiligen Spezialgesetz. So ergibt sich beispielsweise für die Abfallwirtschaftsbehörden nach § 17 Abs. 1 LKrWG der dreistufige Aufbau oberste Abfallwirtschaftsbehörde, obere Abfallwirtschaftsbehörde und untere Abfallwirtschaftsbehörde. Oberste Abfallwirtschaftsbehörde ist das für Umweltschutz zuständige Ministerium, obere Abfallwirtschaftsbehörde ist die Bezirksregierung und untere Abfallwirtschaftsbehörde sind die Kreise und kreisfreien Städte.
Mit der Zuordnung der Kreise und kreisfreien Städte ist der Gesetzgeber ungenau. Bei den Kreisen und kreisfreien Städten handelt es sich nämlich nicht um Behörden, sondern um Gebietskörperschaften. Diese handeln durch die Landräte (vgl. § 42 Buchst. e KrO) bzw. durch die Oberbürgermeister (vgl. § 63 Abs. 1 Satz 1 GO).
Folgendes Schaubild verdeutlicht den Aufbau:
Dass die Abfallwirtschaftsbehörden Sonderordnungsbehörden sind, ist in § 18 Abs. 2 LKrWG festgelegt. Danach wird die zuständige Behörde als Sonderordnungsbehörde tätig.
2.2DER AUFBAU DER ALLGEMEINEN ORDNUNGSBEHÖRDEN
Der Aufbau der Allgemeinen Ordnungsbehörden ergibt sich aus § 3 OBG. Er ist ebenfalls dreistufig, unterscheidet sich aber vom Aufbau der Sonderordnungsbehörden.
Die unterste Stufe sind nach § 3 Abs. 1 OBG die örtlichen Ordnungsbehörden. Die Aufgaben der örtlichen Ordnungsbehörde werden von den Gemeinden wahrgenommen. Die zweite Stufe sind die Kreisordnungsbehörden, deren Aufgaben von den Kreisen und kreisfreien Städten wahrgenommen werden. Die dritte und letzte Stufe bilden nach § 3 Abs. 2 OBG die Bezirksregierungen als Landesordnungsbehörde.
Auch hier war der Gesetzgeber ungenau in der Formulierung und hat die Aufgaben der Kreisordnungsbehörde und der örtlichen Ordnungsbehörde nicht den Behörden, sondern den Gebietskörperschaften zugewiesen.
Der Begriff der örtlichen Ordnungsbehörde ist streng von der örtlich zuständigen Ordnungsbehörde zu trennen. Bei der örtlichen Ordnungsbehörde handelt es sich lediglich um die Bezeichnung der unteren Behördenstufe.
3DIE ZUSTÄNDIGKEIT
Aus dem Allgemeinen Verwaltungsrecht ist bekannt, dass es drei Arten der Zuständigkeit gibt, nämlich die sachliche Zuständigkeit, die instanzielle Zuständigkeit sowie die örtliche Zuständigkeit.
3.1DIE SACHLICHE ZUSTÄNDIGKEIT
Die sachliche Zuständigkeit legt fest, welches Aufgabengebiet der öffentlichen Verwaltung von welchem Behördenzweig wahrgenommen wird.
Für die Sonderordnungsbehörden wird die sachliche Zuständigkeit immer durch ein Spezialgesetz festgelegt. So bestimmt beispielsweise § 58 Abs. 2 Satz 1 BauO, dass die Bauaufsichtsbehörden bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Beseitigung sowie bei der Nutzung und Instandhaltung von Anlagen darüber zu wachen haben, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen eingehalten werden.
Auch die sachliche Zuständigkeit für die Allgemeinen Ordnungsbehörden kann sich aus einem Spezialgesetz ergeben. So regelt § 13 LHundG, dass zuständige Behörde die örtliche Ordnungsbehörde ist, in deren Bezirk der Hund gehalten wird.
Existiert kein Spezialgesetz, dann ergibt sich die sachliche Zuständigkeit der Allgemeinen Ordnungsbehörden aus § 1 Abs. 1 OBG. Danach haben die Ordnungsbehörden die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren.
Zu beachten ist hierbei, dass es sich um die öffentliche Sicherheit bzw. die öffentliche Ordnung handeln muss. Der Schutz der privaten Sicherheit bzw. der privaten Rechte obliegt im Regelfall nicht den Ordnungsbehörden, sondern den Zivilgerichten.
Beispiel:
Willi Wiese gestaltet seinen Garten um. Dabei pflanzt er u. a. drei neue Pappeln in 1 m Abstand von der Grenze zum Nachbargrundstück. Sein Nachbar Kurt Knurrig ist hierüber nicht erfreut, weil er befürchtet, dass zukünftig jeden Herbst große Mengen Laub auf sein Grundstück fallen. Er möchte deshalb, dass der nach § 41 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) NachbG vorgeschriebene Mindestabstand von 4 m eingehalten wird.
Die Ordnungsbehörden sind für diese privatrechtliche Streitigkeit nicht zuständig. Sollte Willi Wiese auf die Forderung des Nachbarn nicht eingehen, muss dieser den Privatrechtsweg beschreiten und Willi Wiese entsprechend verklagen.
Nur ausnahmsweise sind die Ordnungsbehörden auch für den Schutz privater Rechte zuständig. Dieses ist nach Punkt 1.11 VV OBG dann der Fall, wenn das zu schützende Recht hinreichend glaubhaft gemacht ist, gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und die Gefahr besteht, dass ohne ordnungsbehördliche Hilfe die Durchsetzung des Rechts nicht möglich ist oder wesentlich erschwert wird. Man spricht in diesen Fällen auch von der subsidiären, d. h. nachrangigen Zuständigkeit der Ordnungsbehörde zum Schutz privater Rechte.
Möglich sind in diesem Fall der subsidiären Zuständigkeit aber nur vorläufige Maßnahmen.
Beispiel:
Stefan Schlemmer hat in seiner Mittagspause im Restaurant „Zum schmierigen Löffel“ zu Mittag gegessen. Dieses hat ihm nicht geschmeckt, auch war die Portion für sein Empfinden viel zu klein. Er möchte daher nur den halben Preis zahlen. Hierüber kommt es zum Streit mit Konrad Koch, dem Inhaber des Lokals, der auf die Forderung nicht eingeht. Stefan Schlemmer legt nach einer längeren Diskussion die Hälfte des eigentlich zu zahlenden Preises auf den Tisch und macht Anstalten, das Lokal zu verlassen. Konrad Koch ruft daraufhin zwei uniformierte Außendienstmitarbeiter des Ordnungsamtes, die zufällig just in diesem Zeitpunkt an dem Lokal vorbeigehen, zur Hilfe und schildert ihnen den Sachverhalt.
Es geht hier ausschließlich um den Schutz privater Rechte. Allerdings könnte Konrad Koch diese nicht mehr geltend machen, wenn Stefan Schlemmer das Lokal verlassen hat, da er weder seinen Namen noch seine Adresse kennt. Das zu schützende Recht ist daher hinreichend glaubhaft gemacht. Auch ist gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen und ohne ordnungsbehördliche Hilfe ist die Durchsetzung seines Rechts auf den vollen Kaufpreis nicht möglich. Daher dürfen die beiden Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Personalien von Stefan Schlemmer feststellen und an Konrad Koch weitergeben. Damit kann dieser gerichtliche Schritte einleiten.
Was die beiden Mitarbeiter des Ordnungsamtes nicht dürfen, ist Stefan Schlemmer zur Zahlung des vollen Kaufpreises auffordern oder gar Geld aus der Geldbörse des Stefan Schlemmer an Konrad Koch geben. Dieses wären keine vorläufigen Maßnahmen mehr.
Die sachliche Zuständigkeit ist immer gegeben, wenn die Ordnungsbehörde mit der Intention der Gefahrenabwehr tätig wird. Ob tatsächlich eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung vorliegt, ist eine Frage der materiellen Rechtmäßigkeit und wird in der Klausur im Rahmen der Ermächtigungsgrundlage geprüft.
3.2DIE INSTANZIELLE ZUSTÄNDIGKEIT
Wie bereits dargelegt, sind die Ordnungsbehörden mehrstufig aufgebaut (siehe Kapitel 2). Daher muss neben der sachlichen Zuständigkeit ebenfalls geklärt werden, von welcher Behördenebene die Aufgabe wahrgenommen wird. Man spricht hier von der instanziellen Zuständigkeit.
Ebenso wie bei der sachlichen Zuständigkeit muss auch hier unterschieden werden, ob eine Sonderordnungsbehörde oder eine Allgemeine Ordnungsbehörde handelt.
Für eine Sonderordnungsbehörde ergibt sich die instanzielle Zuständigkeit wiederum immer aus einem Spezialgesetz. So wird durch § 57 Abs. 1 Satz 2 BauO die instanzielle Zuständigkeit der unteren Bauaufsichtsbehörde festgelegt.
Handelt eine Allgemeine Ordnungsbehörde, kann sich die instanzielle Zuständigkeit zunächst aus einem Spezialgesetz ergeben. § 48 Abs. 2 Satz 2 OBG regelt beispielsweise die instanzielle Zuständigkeit der Kreisordnungsbehörden und der Großen kreisangehörigen Gemeinden für die Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten und der Befolgung von Lichtzeichenanlagen im Straßenverkehr an Gefahrenstellen. Hierbei handelt es sich um die sog. stationären Geschwindigkeitsmessanlagen, im Volksmund „Blitzer“ oder „Starenkasten“ genannt.
Sofern keine spezialgesetzliche Regelung existiert, ergibt sich die instanzielle Zuständigkeit für die Allgemeinen Ordnungsbehörden aus § 5 Abs. 1 Satz 1 OBG. Danach sind die örtlichen Ordnungsbehörden für die Aufgaben der Gefahrenabwehr zuständig. Dieses sind – wie bereits in Kapitel 2.2 dargestellt – nach § 3 Abs. 1 OBG die Gemeinden, also die Bürgermeister und Oberbürgermeister.
Verwirrend ist, dass § 5 OBG mit „sachliche Zuständigkeit“ überschrieben ist. Es handelt sich hierbei um einen Fehler des Gesetzgebers. Die Aufgabenzuweisung zum Behördenzweig der Ordnungsbehörden erfolgt, wie bereits oben dargelegt, durch § 1 Abs. 1 OBG, der damit bereits die sachliche Zuständigkeit regelt. Durch § 5 Abs. 1 Satz 1 OBG wird nicht eine Aufgabe einem Behördenzweig zugewiesen, sondern es erfolgt die Bestimmung der zuständigen Ebene im Behördenaufbau.
3.3DIE ÖRTLICHE ZUSTÄNDIGKEIT
Die örtliche Zuständigkeit grenzt den räumlichen Wirkungsbereich mehrerer gleichermaßen sachlich und instanziell zuständiger Behörden voneinander ab.
Für die Sonderordnungsbehörden kann sie sich aus einem Spezialgesetz ergeben. So ist für die Passbehörden in § 19 Abs. 3 Satz 1 PassG festgelegt, dass die Passbehörde örtlich zuständig ist, in deren Bezirk der Passbewerber oder der Inhaber eines Passes für seine Wohnung gemeldet ist.
Fehlen für die Sonderordnungsbehörden Regelungen über die örtliche Zuständigkeit, dann ergibt sich diese wie für die Allgemeinen Ordnungsbehörden auch aus § 4 Abs. 1 OBG. Danach ist die Ordnungsbehörde zuständig, in deren Bezirk die zu schützenden Interessen verletzt oder gefährdet sind.
Beispiel:
Günther Gummi, wohnhaft in Bergisch Gladbach-Moitzfeld, hat sich in seiner Garage von einem Freund neue Autoreifen montieren lassen. Als er die alten Reifen beim Wertstoffhof abgeben will, stellt er verärgert fest, dass die Altreifenentsorgung dort kostenpflichtig ist. Um sich dieses Geld zu sparen, fährt er spätabends nach Overath und legt die Reifen im Schutze der Dunkelheit auf dem dortigen Bahnhofsplatz hinter einer Sitzbank ab.
Zuständig ist hier nicht der Bürgermeister der Stadt Bergisch Gladbach, sondern der Bürgermeister der Stadt Overath.
Eine Ausnahme hierzu regelt § 4 Abs. 2 OBG. Wenn es zweckmäßig ist, ordnungsbehördliche Aufgaben in benachbarten Bezirken einheitlich zu erfüllen, so kann die den beiden Ordnungsbehörden gemeinsame Aufsichtsbehörde nach dieser Regelung eine dieser Ordnungsbehörden für zuständig erklären.
Beispiel:
Matthias Maurer hat ein großes Grundstück gekauft. Dieses liegt zu drei Viertel in Wesseling und zu einem Viertel in Brühl (beide Rhein-Erft-Kreis). Er beabsichtigt, entlang des gesamten Grundstücks ein dreigeschossiges Mehrfamilien-Reihenhaus zu errichten.
Es ist zweckmäßig, dass die Baugenehmigung nur von einer Behörde erteilt wird. Die gemeinsame Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Rhein-Erft-Kreises (vgl. § 7 Abs. 1 OBG). Er kann daher den Bürgermeister von Wesseling als allein zuständig für die Bauerlaubnis erklären.
3.4DIE FUNKTIONELLE ZUSTÄNDIGKEIT
Die funktionelle Zuständigkeit regelt die Aufgabenverteilung innerhalb der sachlich, instanziell und örtlich zuständigen Behörde. Sie ergibt sich aus dem Aufgabengliederungsplan der jeweiligen Behörde.
Nach außen hin ist die funktionelle Zuständigkeit bedeutungslos. Wenn eine Entscheidung ansonsten fehlerfrei ist, hat der Verstoß gegen die funktionelle Zuständigkeit keine rechtlichen Folgen. Das liegt daran, dass unabhängig davon, welcher Mitarbeiter oder welches Amt eine Aufgabe wahrnimmt, nach außen hin immer die zuständige Behörde gehandelt hat.
Beispiel:
Bernd Baum ist Mitarbeiter beim Grünflächenamt der Stadt Köln. An einem sonnigen Vormittag ist er auf dem Weg zu einer Dienstbesprechung. Sein Weg führt ihn über die Schildergasse, eine große Einkaufsstraße und Fußgängerzone. Es ist 10:35 Uhr und er bemerkt eine Musikgruppe, die südamerikanische Folklore spielt. Nach Beendigung des aktuellen Stückes schreitet Bernd Baum ein und unterbindet die weitere Aufführung, weil – was zutreffend ist – nach der Kölner Straßenordnung Straßenmusik nur in den ersten 30 Minuten einer vollen Stunde dargeboten werden darf.
Bernd Baum ist vorliegend mit der Intention der Gefahrenabwehr tätig geworden. Hierfür ist, wie in den Kapiteln 3.1 bis 3.3 bereits dargelegt, die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln als örtliche Ordnungsbehörde zuständig. Nach dem Aufgabengliederungsplan wird die Aufgabe innerhalb der Stadtverwaltung Köln vom Amt für öffentliche Ordnung wahrgenommen. Dass hier das Grünflächenamt anstelle des Amtes für öffentliche Ordnung tätig geworden ist, führt aber nicht zur Rechtswidrigkeit der Maßnahme. Wenn das Grünflächenamt handelt, ist gegenüber dem Bürger genauso die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln tätig geworden, als wenn das Amt für öffentliche Ordnung eingeschritten wäre.
Die funktionelle Zuständigkeit muss in der Klausur nicht geprüft werden.
3.5DIE AUSSERORDENTLICHE ZUSTÄNDIGKEIT
Nicht immer kann die eigentlich sachlich, instanziell und örtlich zuständige Ordnungsbehörde rechtzeitig handeln. In solchen Fällen greift § 6 Abs. 1 OBG, der bestimmt, dass bei Gefahr im Verzug jede Ordnungsbehörde in ihrem Bezirk die Befugnisse einer anderen Ordnungsbehörde ausüben kann. Man spricht dann von der außerordentlichen Zuständigkeit.
Es müssen also folgende drei Voraussetzungen erfüllt sein:
1. Es muss Gefahr im Verzug vorliegen.
2. Es muss eine Ordnungsbehörde handeln. Es darf hier sowohl eine ranghöhere Ordnungsbehörde für eine rangniedrigere tätig werden (z. B. die Landesordnungsbehörde für die örtliche Ordnungsbehörde) als auch eine rangniedrige Ordnungsbehörde für eine ranghöhere (z. B. die örtliche Ordnungsbehörde für die Kreisordnungsbehörde). Ebenfalls darf eine Sonderordnungsbehörde für eine Allgemeine Ordnungsbehörde handeln und umgekehrt.
3. Die Ordnungsbehörde muss in ihrem Bezirk die Befugnisse einer anderen Behörde ausüben. Das bedeutet, sie muss zumindest örtlich zuständig sein.
Beispiel:





























