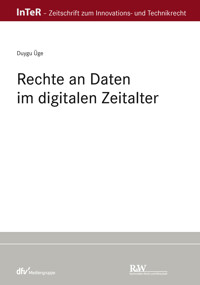
82,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fachmedien Recht und Wirtschaft
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: InTeR-Schriftenreihe
- Sprache: Deutsch
Technologische Entwicklungen wie das Internet der Dinge oder Industrie 4.0 führen zu einem enormen Anstieg der generierten Datenmengen, aus denen wertvolle Informationen und Erkenntnisse gewonnen werden können. Unternehmen, die faktischen Zugriff auf diese Daten haben, genießen erhebliche Wettbewerbsvorteile. Daten werden immer wertvoller – damit steigt auch das Bedürfnis der Dateninhaber die generierten Daten umfassend zu schützen. Das Werk gibt einen umfassenden Überblick über die rechtlichen Schutzmöglichkeiten von Daten und untersucht, ob neue Rechte an Daten notwendig sind. Dabei werden Ansätze zur Ausgestaltung eines neuen Datenrechts behandelt, wobei die Interessen beteiligter Akteure entlang der Wertschöpfungskette berücksichtigt werden. Besonders berücksichtigt werden dabei die Nutzer datengenerierender Geräte, die zunehmend daran interessiert sind, die von ihnen erzeugten Daten für eigene Wertschöpfungsprozesse zu nutzen. Eine zentrale Rolle nimmt in dem Werk daher auch die Untersuchung des EU Data Acts ein, der den Anspruch erhebt, den Zugang und Nutzung von Daten umfassend zu regulieren. Die Autorin widmet sich der Frage, ob der EU Data Act in der Lage ist, Probleme der fehlenden Zuweisung von Daten zu lösen und einen angemessenen Interessenausgleich zwischen den Akteuren zu gewährleisten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Rechte an Datenim digitalen Zeitalter
von Duygu Üge
Fachmedien Recht und Wirtschaft | dfv Mediengruppe | Frankfurt am Main
Dissertation des Fachbereichs Rechtswissenschaft der Freien Universität Berlin
Erstgutachter:
Prof. Dr. Dr. Jürgen Ensthaler
Zweitgutachter:
Prof. Dr. Bertram Lomfeld
Tag der mündlichen Prüfung: 5. Juni 2024
Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
ISBN 978–3–8005–1964–4
© 2025 Deutscher Fachverlag GmbH, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Mainzer Landstr. 251, 60326 Frankfurt am Main, [email protected]
www.ruw.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Druck: Beltz Grafische Betriebe GmbH, 99947 Bad Langensalza
Meinen Eltern
Vorwort
Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2024 von der Juristischen Fakultät der Freien Universität Berlin als Dissertation angenommen. Rechtsprechung und Literatur konnten bis Januar 2025 berücksichtigt werden.
Mein besonderer Dank gilt zunächst meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Dr. Jürgen Ensthaler, der mich bei Erstellung dieser Arbeit hervorragend betreut und unterstützt hat. Mit seinen wertvollen Anregungen und wissenschaftlichen Impulsen hat er maßgeblich zum Gelingen dieser Dissertation beigetragen. Auch meine Zeit an seinem Lehrstuhl an der Technischen Universität Berlin habe ich sehr geschätzt. Das offene und freundliche Klima war nicht selbstverständlich und ist in besonderer Erinnerung behalten. Für seine Unterstützung und seinen prägenden Einfluss auf meinen bisherigen Werdegang bin ich ihm zutiefst dankbar.
Prof. Dr. Bertram Lomfeld danke ich für die Übernahme des Zweitgutachtens.
Mein größter Dank gilt meinen Eltern, Demet und Özcan Öztürk, die mich nicht nur bei der Anfertigung dieser Arbeit, sondern in allen Lebenslagen uneingeschränkt und mit grenzenloser Geduld begleitet haben. Ohne ihre Liebe und Unterstützung wäre mein bisheriger Werdegang sowie die Anfertigung dieser Arbeit nicht möglich gewesen.
Besonders danke ich meinem Vater, der mich zur Erstellung dieser Arbeit besonders motiviert und jede einzelne Phase dieses Promotionsvorhabens begeistert verfolgt hat. Auch meinem Bruder, Baris Can Öztürk, möchte ich danken, da er stets an mich geglaubt und mich mit seiner positiven Art immer wieder gestärkt hat.
Schließlich danke ich vom Herzen meinem Ehemann, Tolga Üge, der mir mit wertvollem Austausch, Optimismus und großer Geduld zur Seite stand. Ohne ihn hätte mir in dieser Zeit eine wertvolle Stütze gefehlt.
Dr. Duygu Üge
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1: Einleitung
A. Anlass der Untersuchung
B. Untersuchungsgegenstand
C. Gang der Untersuchung
Kapitel 2: Grundlagen zu Daten
A. Begriffsbestimmung
I. Natürliche Sprache als Ausgangspunkt
1. Daten als Abbild der Realität
2. Information als Erkenntnisgewinn
II. Zweckfunktion von Legaldefinitionen von Daten und Informationen
1. Datennutzungsrecht, Informationsfreiheitsrecht
2. Datenschutzrecht, Umweltinformationsrecht
3. Strafrecht, Zivilrecht
4. Data Governance Act
III. Kernbedeutung in der Informationstechnik
1. Daten als binäre Nachrichten der Kommunikation
2. Abbild der Datenfunktion in DIN-Normen
IV. Interdepenz von Daten und Informationen in der Semiotik
1. Syntaktische Ebene
2. Semantische Ebene
3. Pragmatische Ebene
V. Bewertung
B. Rechtliche Kategorisierung von Daten
I. Personenbezogene Daten
1. Problem: Identifizierbarkeit des Betroffenen
2. Beurteilungsmaßstab der Identifizierbarkeit
a) Absolutes Verständnis
b) Relatives Verständnis
c) Rechtsprechung
aa) BGH – Dynamische IP-Adressen
bb) EuGH – Breyer
3. Bewertung
II. Nicht-personenbezogene Daten
1. Anfänglich fehlender Personenbezug
2. Aufhebung des Personenbezugs durch Anonymisierung
3. Abgrenzung zu pseudonymen Daten
C. Ökonomische Einordnung von Daten
I. Ökonomische Eigenschaften von Daten
1. Fehlende Rivalität
2. Fehlende Ausschließbarkeit
3. Fehlende Abnutzbarkeit
II. Güterqualität von Daten
III. Wertschöpfungsprozess aus Daten
1. Datenerhebung
2. Datenaufbereitung und -speicherung
3. Datenanalyse
IV. Bewertung
Kapitel 3: Schutzmöglichkeiten von Daten
A. Proprietärer Schutz von Daten
I. Zivilrechtlicher Sachbegriff als Schutzhindernis
II. Zuordnung über das Eigentum am Trägermedium
1. Bedeutungsverlust von physischen Datenträgern im digitalen Zeitalter
2. Rechtliche Schutzdefizite bei externer Datenspeicherung
III. Konstruktion des Dateneigentums
1. Zuweisung nach § 903 S. 1 BGB analog
2. Daten als Früchte einer Sache
3. Daten als Nutzungen des Datenträgers
IV. Besitzrechtliche Zuordnung der Daten
1. Grundlagen zum Besitzrecht
2. Besitzrechtlicher Schutz von Daten
a) Bestimmung des Datenbesitzers
b) Mögliche Rechtsfolgen
3. Kein ausreichender Schutz von Daten
V. Bewertung
B. Schutz von Daten durch das Urheberrecht
I. Datenbankwerk
1. Schutzvoraussetzungen
2. Bewertung
II. Datenbankherstellerrecht
1. Schutzvoraussetzungen
a) Sammlung von Werken, Daten oder anderen Elementen
b) Unabhängigkeit und Zugänglichkeit der Elemente
c) Systematische oder methodische Anordnung
d) Investition
aa) Kein Schutz von Vorinvestitionen in die Datenerzeugung
bb) Problem: Abgrenzung zwischen der Erzeugung und Beschaffung von Daten
e) Wesentlichkeit der Investition
2. Bewertung
C. Schutz von Daten durch das Geschäftsgeheimnisrecht
I. Hintergrund
II. Einordnung von Daten als Geschäftsgeheimnis
1. Schutzvoraussetzungen
a) Information
b) Geheimheit der Information
c) Wirtschaftlicher Wert der Daten
d) Angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen
e) Berechtigtes Geheimhaltungsinteresse
2. Inhaber von Geschäftsgeheimnissen
3. Rechtsfolgen des Geheimnisschutzes
III. Rechtsnatur von Geschäftsgeheimnissen
1. Diskussion nach alter Rechtslage
a) Geheimnisschutz als sonstiges Recht i.S.d. § 823 Abs. 1 BGB
b) Rechtlicher Zuweisungsgehalt des Geheimnisschutzes
2. Rechtsnatur nach neuer Rechtslage
IV. Bewertung
D. Schutz von Daten durch das Deliktsrecht
I. Eigentumsschutz des § 823 Abs. 1 BGB
II. Recht am eigenen Datenbestand als sonstiges Recht i.S.d. § 823 Abs. 1 BGB
III. Deliktsrechtlicher Schutz nach § 823 Abs. 2 BGB
IV. Bewertung
Kapitel 4: Vertraglicher Schutz von Daten
A. Faktische statt rechtliche Zuweisung von Daten
B. Vertragsrechtliche Konzeption
I. Vertragliche Zuweisung der Datenhoheit
II. Vertraglich vereinbarter Zugang zu Daten
1. Datenkaufvertrag
2. Datenlizenzvertrag
II. AGB-rechtliche Inhaltskontrolle von Datenverträgen
C. Schwächen der Vertragslösung
I. Relativität der Schuldverhältnisse
II. Vertragliche Ungleichgewichte
III. Fehlende Partizipation des Nutzers
D. Bewertung
Kapitel 5: Möglichkeiten zur Ausgestaltung von Rechten an Daten
A. Rechtfertigung staatlichen Eingriffs in den Datenmarkt
I. Deontologische Rechtfertigungsansätze
1. Okkupationstheorie
2. Eigentums- und Arbeitstheorie
3. Persönlichkeitstheorie
4. Belohnungstheorie
II. Ökonomische Rechtfertigungsansätze
1. Anreizparadigma
a) Anreiz zur Erhebung und Nutzung von Daten
b) Anreiz zur Offenbarung von Daten
2. Allokatives Marktversagen
a) Ökonomische Einordnung von Datenmärkten
aa) Primärmarkt – Datenerhebung beim Nutzer
bb) Sekundärmarkt – Handel mit Daten
b) Identifizierung des Marktversagens
aa) Marktdefizite auf dem Primärmarkt
bb) Marktdefizite auf dem Sekundärmarkt
(1) Verhinderung des Wettbewerbs für Anschlussdienst
(2) Verhinderung der vollen Wertschöpfung aus Daten
(3) Entstehung von Ungleichgewichten auf dem Markt
III. Bewertung
B. Mögliche Ansätze zur Zuweisung von Rechten an Daten
I. Handlungsbefugnisse an Daten als Gegenstand von Rechten
1. Zugangsrechte als Gegenstand der Zuweisung
2. Nutzungsrechte für die umfassende Verwertung von Daten
3. Entscheidung über die Integrität von Daten
II. Möglichkeiten der Zuweisung von Rechten
1. Ausgestaltung als Ausschließlichkeitsrecht
a) Schaffensprozess als Anknüpfungspunkt
aa) Immaterialgüterrecht sui generis
bb) Datenerzeugerrecht
cc) Dateneigentumsrecht
b) Investitionsleistung als Anknüpfungspunkt
c) Schwächen der Ausgestaltung als Ausschließlichkeitsrecht
2. Ausgestaltung als Abwehrrecht
a) Faktischer Ausschluss als Anknüpfungspunkt
b) Schwächen der Ausgestaltung als Abwehrrecht
3. Ausgestaltung als Zugangs- und Nutzungsrecht
a) Erhebung und Investition als Anknüpfungspunkte
b) Vorteile eines Zugangs- und Nutzungsrechts
c) Kein ausreichender Zugang zu Daten durch die geltende Rechtslage
III. Bewertung
Kapitel 6: EU-Data Act als Lösung
A. Zielsetzung
B. Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich
I. Persönlicher Anwendungsbereich
1. Nutzer vernetzter Produkte und verbundener Dienste
a) Vertragliche Nutzung als Anknüpfungspunkt
b) Inanspruchnahme eines verbundenen Dienstes
2. Dateninhaber
3. Datenempfänger
II. Sachlicher Anwendungsbereich
1. Daten
2. Vernetztes Produkt
3. Verbundene Dienste
C. Rechte und Pflichten von Akteuren der Wertschöpfungskette
I. Verhältnis zwischen Nutzer und Hersteller/Dateninhaber
1. Pflichten des Dateninhabers
a) Vorvertragliche Informationspflichten
b) Zugang durch technische Voreinstellung
c) Erfordernis der Datennutzungslizenz
2. Rechte des Nutzers gegenüber dem Dateninhaber
a) Bereitstellung der Daten durch Dateninhaber an Nutzer, Art. 4 Data Act
b) Recht zur Weitergabe der Daten an Dritte, Art. 5 Data Act
3. Einschränkungen
a) Wettbewerbsverbot
b) Schutz von Geschäftsgeheimnissen
II. Verhältnis zwischen Nutzer und Dritten
1. Zweckbindungsgrundsatz
2. Verbot der Weitergabe der Daten an weitere Dritte
III. Verhältnis zwischen Dateninhabern und Datenempfängern
1. Pflichten der Dateninhaber gegenüber Dritten
a) FRAND-Bedingungen für die Bereitstellung der Daten
b) Angemessene Gegenleistung
c) Verbot missbräuchlicher Klauseln
2. Einschränkungen
a) Wettbewerbsverbot
b) Schutz von Geschäftsgeheimnissen
c) Schutz vor unbefugter Nutzung oder Offenlegung von Daten
D. Kritische Würdigung: Schwächen des Data Acts
I. Keine ausreichende Stärkung der Position der Nutzer
1. Erfordernis der Datennutzungslizenz
a) Kein Ausschließlichkeitsrecht zugunsten Nutzer
b) Verhandlungsbasis für gewerbliche Nutzer?
c) Fehlender Verbraucherschutz
2. Reichweite des Zugangs- und Nutzungsrechts
a) Kein standardmäßiger und unabhängiger Direktzugriff für Nutzer
b) In-situ-Zugangsgewährung als Nutzungseinschränkung?
c) Keine uneingeschränkte Nutzungsmöglichkeit der Daten
3. Umfang des Zugangsrechts
a) Ausschluss abgeleiteter und verarbeiteter Daten
b) Problem: Unzulänglichkeit von Rohdaten für Anschlussdienste
II. Anerkennung der technisch-faktischen Alleinkontrolle der Dateninhaber
1. Uneingeschränkte Zugangs- und Nutzungsmöglichkeit für Dateninhaber
2. Kontrollmöglichkeit durch In-situ-Zugang
3. Zusätzlicher Schutz durch Abwehrrechte
III. Marktauswirkungen: Keine volle Wertausschöpfung aus Daten
1. Kontrollposition der Dateninhaber als Hindernis
2. Einschränkungen durch das Wettbewerbsverbot
a) Wann liegt ein Konkurrenzprodukt vor?
b) Problem: Nachweisbarkeit der Datennutzung
c) Parallelen zur freien und unfreien Bearbeitung im Urheberrecht
3. Einschränkungen durch die Gegenleistungspflicht des Dritten
a) Spannungsverhältnis zwischen gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtung
b) Potenzielle Auswirkungen auf die Preisgestaltung
c) Keine Wettbewerbsförderung
IV. Schnittstellen zu anderen Rechtsgebieten
1. Verhältnis zur DS-GVO
a) Abgrenzungsschwierigkeiten
b) Mehr Pflichten für Dateninhaber
c) Doppelte Absicherung als Lösung?
2. Verhältnis zum Datenbankherstellerrecht
a) Funktion des Art. 43 Data Act
b) Kein Ausschluss von Datenbankwerken
3. Verhältnis zum Geschäftsgeheimnisrecht
a) Verlust des Geheimnisschutzes
b) Unberechtigte Schutzmaßnahmen
V. Stellungnahme
E. Ansätze zur Ausgestaltung des neuen Datengesetzes
I. Verteilung von Rechten an Daten zugunsten Hersteller und Nutzer
II. Stärkung von Nutzerrechten
III. Beschränkung der technischen Alleinkontrolle der Dateninhaber
IV. Mehr Wertschöpfung aus Daten
V. Aufhebung des Verbots für Wettbewerbsprodukte
VI. Aufhebung der Gegenleistungspflicht für Dritte
VI. Abbau technischer Hindernisse
Kapitel 7: Zusammenfassung/Ausblick
Literaturverzeichnis
Kapitel 1: Einleitung
„Daten bilden die Lebensader der wirtschaftlichen Entwicklung.“1
A. Anlass der Untersuchung
Das Zeitalter der Digitalisierung führt zu einer Veränderung der Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Handeln.2 Unternehmen stehen immer mehr unter Druck, ihre Geschäftsmodelle zu überdenken und an neue Wettbewerbsbedingungen anzupassen.3 Die digitale Transformation von Unternehmen durch datenbasierte Geschäftsmodelle ermöglicht die Entwicklung neuer datenbasierter Produkte und Dienstleistungen, für deren Realisierung Daten die entscheidende Schlüsselressource sind.4 Insbesondere der vermehrte Einsatz von künstlicher Intelligenz in Unternehmen führt dazu, dass das Training mit unternehmensinternen Daten eine größere Bedeutung erlangt. Umso wichtiger wird es für Unternehmen, durch effektive Datenstrategien die riesigen Datenmengen, die im Rahmen unterschiedlicher Geschäfts- und Produktionsprozesse anfallen, effektiv und systematisch zu nutzen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt aufrechtzuerhalten. Die Nutzung und Auswertung der gewonnenen Daten können Informationen und Erkenntnisse liefern, die Unternehmen einen entscheidenden Wettbewerbsvorsprung einräumen können.5 Durch die intelligente Auswertung der erzeugten Datenmassen gewinnen Unternehmen wertvolle Informationen, die die Grundlage für die Entwicklung neuer und innovativer Produkte und Dienste sein können.6 Vermehrt werden Daten zur Erbringung und zur Realisierung von Leistungswerten eingesetzt oder selbst als handelbares Gut vermarktet.7 Der in den letzten Jahren beobachtbare exponentielle Anstieg der generierten Datenmengen ist technologischen Entwicklungen, wie dem Internet der Dinge oder der Industrie 4.0, geschuldet.8 Im Zuge der Industrie-4.0-Revolution installieren daher immer mehr Hersteller Hardware- und Softwareinstrumente zur Generierung und Übertragung von Daten über die Art und Weise der Nutzung von Maschinen, Abnutzung, Wartungsbedürftigkeit oder Nutzergewohnheiten.9 Anlagenherstellern wie auch den Anlagennutzern werden Einsichten in Produktverbesserungen und eine vorausschauende Wartung gewährt.10 Verkompliziert wird dies, wenn an der Entwicklung der Produkte mehrere Vertriebsstufen erforderlich sind, an denen mehrere Zulieferer oder Vertriebspartner beteiligt sind.11 In solch gelagerten Konstellationen werden in der Regel alle Akteure sämtlicher Betriebsstufen Interesse an den erzeugten Daten haben. Durch ihre Verwendung werden neue Datenquellen erschlossen, die die Grundlage für die Entwicklung neuer digitaler Produkte und Dienste bilden können.12 Gleichzeitig wirft die Entwicklung Fragen hinsichtlich der Verteilung und Chancengleichheit im Hinblick auf die Wertschöpfung aus Daten auf, die sich unmittelbar auf die Machtverhältnisse verschiedener Akteure auswirkt.13 Die Frage, wem welche Rechte an Daten zustehen, wird mit zunehmender wirtschaftlicher Bedeutung der Daten immer relevanter.14 In der Vergangenheit waren Daten daher immer wieder Gegenstand rechtswissenschaftlicher Diskussionen, in denen es um die rechtliche Zuweisung von Daten anhand bestehender oder noch zu schaffender Rechte ging.15 Technische Schutzmaßnahmen gewährleisten Unternehmen derzeit die exklusive Nutzung von Daten. Diese exklusive Nutzungsmöglichkeit schafft Unternehmen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Nutzungsinteressenten.16 Die fehlende Bereitschaft dieser Unternehmen ihre Daten zu teilen, wirkt sich nachteilig auf die Wertschöpfung aus Daten aus, denn oftmals sind sie nicht imstande, das Informationspotenzial der erzeugten Daten vollständig auszuschöpfen.17 Die Folge ist, dass die Daten nur einseitigen Analyseverfahren zugeführt werden, obwohl sie das Potenzial tragen, durch die Kombination mit anderen Datenquellen wichtige Informationen und Erkenntnisse für die Entwicklung neuartiger Dienste und Produkte zu liefern.18 Besonders gravierend gestaltet sich die gegenwärtige Situation für Start-Ups sowie für kleine und mittelständische Unternehmen, die für die Entwicklung neuer datenbasierter Geschäftsmodelle und Datenprodukte auf den Zugang zu Daten angewiesen sind.19 Für die Etablierung auf dem Markt müssen sie die erforderlichen Daten entweder selbst erheben oder – bei fehlenden technischen oder wirtschaftlichen Ressourcen – den Zugang von datenreichen Unternehmen begehren.20 Die oftmals fehlende Bereitschaft von datenreichen Unternehmen, Zugang zu ihren Daten zu gewähren, führt dazu, dass solchen Datenzugangspetenten der Zutritt in den Markt faktisch verweigert wird, wodurch Mehrwerte und Synergieeffekte ausbleiben.21 Gleichzeitig würde die Aufhebung von Zugangshindernissen möglicherweise dafür sorgen, dass immer weniger Unternehmen in datenbasierte Technologien investieren würden, da Wohlfahrtseffekte wie die exklusive Nutzungsmöglichkeit der erhobenen Daten sowie der Ausschluss Dritter von der Nutzung der Daten wegfallen würden.22 Eine solche Entwicklung hätte möglicherweise zur Folge, dass immer weniger Unternehmen in die Erhebung und Auswertung von Daten investieren würden, was sich nachteilig auf die Gesamtwohlfahrt auswirken könnte.23 Auch Nutzer vernetzter Geräte und Maschinen sind betroffen. Diese haben bislang keine Möglichkeit, Zugang zu den durch die Nutzung vernetzter Produkte und Maschinen erzeugten Daten zu erlangen und an der Wertschöpfung aus Daten zu partizipieren.24 Ihr faktischer Ausschluss führt dazu, dass sie auf datenbasierte Anschlussdienste der Hersteller angewiesen sind und nicht auf kostengünstigere Dienste anderer Anschlussbetreiber zurückgreifen können.25 Dieser technische Ausschluss führt dazu, dass die durch die Daten erlangten Gewinne einseitig zugunsten der Hersteller verteilt werden.26 Die nachteiligen Auswirkungen auf den europäischen Datenmarkt erkannte auch die Europäische Kommission. In ihrer Mitteilung zum Aufbau einer europäischen Datenwirtschaft formulierte sie das Ziel, Einschränkungen des Datenzugangs und der Datenübertragung für die volle Wertausschöpfung von Daten im europäischen Datenraum aufzuheben und neue Möglichkeiten für datenbasierte Innovation und Fortschritt zu gewährleisten.27 Für die Schaffung eines einheitlichen Rechtsrahmens im Umgang mit Daten stellte die Kommission als Teil ihrer angekündigten europäischen Datenstrategie verschiedene Legislativmaßnahmen vor, die die bestehenden Hindernisse aufheben und die volle Wertschöpfung aus Daten gewährleisten sollen.28 Zu diesen Maßnahmen gehört auch der am 11. Januar 2024 in Kraft getretene Data Act.29 Durch Regelungen zur verbesserten Verfügbarkeit und Nutzung soll die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen gefördert und die volle Ausschöpfbarkeit der Daten branchenübergreifend gewährleistet werden.30 Eine besondere Stellung räumt der Data Act Nutzern vernetzter Produkte und damit verbundener Dienste ein, die an der Wertschöpfung aus Daten durch die Regulierung von Zugangs- und Nutzungsrechten beteiligt werden sollen.31 Es stellen sich Fragen, ob der Data Act in der Lage ist, die gegenwärtigen Probleme des Datenmarktes zu lösen und die bestehenden Interessen verschiedener Akteure in einen angemessenen Ausgleich zu bringen.
B. Untersuchungsgegenstand
In dieser Untersuchung soll herausgearbeitet werden, ob es erforderlich ist, neue Rechte an Daten de lege ferenda einzuführen, und wie ein solches Datenrecht ausgestaltet sein könnte. Hierfür sollen zunächst Reichweite und Grenzen des geltenden Rechts untersucht werden. Im Rahmen der Diskussion um neue Rechte an Daten soll insbesondere der zuletzt in Kraft getretene Data Act der Europäischen Kommission berücksichtigt werden, der den Anspruch erhebt, die Probleme im Umgang mit Daten zu lösen. Unter Berücksichtigung der Interessenlage der jeweiligen Akteure der Wertschöpfungskette wird die konkrete Ausgestaltung der Rechte an Daten, die der Data Act für Nutzer vernetzter Produkte und verbundener Dienste vorsieht, geprüft und auf ihre Eignung für die Lösung der gegenwärtigen Probleme des Datenmarktes untersucht. Auch wenn das Datenschutzrecht keine eigentumsähnliche Zuweisung von personenbezogenen Daten vornimmt, widmet sich die Untersuchung ausschließlich den Rechten an nicht-personenbezogenen Rohdaten.32 Dabei sollen maschinen- und verhaltensgenerierte Daten gleichermaßen untersucht werden, da die Abgrenzung beider Erzeugungsarten in der Praxis nicht immer klar möglich ist. Ausgenommen von der Untersuchung ist der wettbewerbsrechtliche und kartellrechtliche Umgang mit Daten.
C. Gang der Untersuchung
Die Untersuchung ist in sieben Kapitel gegliedert. Sie beginnt im zweiten Kapitel mit der Darstellung der rechtlichen und technischen Grundlagen zu Daten. Für die Untersuchung von Daten als Objekte von Rechten wird zunächst untersucht, was unter dem Begriff „Daten“ zu verstehen ist. Dabei wird der Fokus auch auf den in diesem Kontext oft synonym verwendeten Informationsbegriff gelegt. Im Anschluss werden die einzelnen Erscheinungsformen von Daten beleuchtet. Aus der Perspektive des Rechts werden die vom Datenschutzrecht vorgenommenen Kategorien zwischen personenbezogenen und nicht-personenbezogenen Daten untersucht. Die Untersuchung dient gleichsam der Konkretisierung des Untersuchungsgegenstandes der Arbeit auf nicht-personenbezogenen Daten. Im Anschluss werden Daten ökonomisch beleuchtet. Nach der Darstellung der ökonomischen Eigenschaften von Daten wird der Wertschöpfungsprozess dargestellt, der verdeutlicht, wie Daten erhoben werden und welche Verarbeitungsschritte erforderlich sind, um Daten zu monetarisieren.
Die Untersuchung von Rechten an Daten de lege ferenda erfordert die vorherige Auseinandersetzung mit den gegenwärtigen Schutzmöglichkeiten von Daten. Im dritten Kapitel wird daher herausgearbeitet, inwieweit die gegenwärtige Rechtsordnung den Schutz von Daten gewährleistet, und welche Schutzdefizite bestehen. Die Darstellung der gegenwärtigen Schutzmöglichkeiten soll gleichsam darstellen, wie das Recht die Zuordnung von Gütern vornimmt und wie unterschiedlich die Zuordnung im Hinblick auf die Intensität ausfallen kann. Im Rahmen des Sachenrechts werden bestehende Ansätze untersucht, die ein sogenanntes „Dateneigentum“ an Daten anhand bestehender Regelungen begründen wollen. Dabei werden auch besitzrechtliche Ansätze für den Schutz von Daten berücksichtigt. Im Anschluss wird das Urheberrecht untersucht. Der Fokus richtet sich hierbei auf Schutzmöglichkeiten durch das Datenbankwerk und das Datenbankherstellerrecht. Nach der Untersuchung von Schutzmöglichkeiten im Geschäftsgeheimnisrecht soll die Untersuchung der gegenwärtigen Rechtslage mit dem Deliktsrecht den Abschluss finden.
Im vierten Kapitel werden die vertraglichen Schutzmöglichkeiten von Daten dargestellt. Dabei bildet die technische Alleinkontrolle den Ausgangspunkt der faktischen Zuordnung. Im Anschluss werden die unterschiedlichen vertraglichen Ausgestaltungsmöglichkeiten von Datenverträgen dargestellt, die gegenwärtig die Zuweisungs- und Zugangsfunktion für Daten erfüllen. Da es sich bei den Verträgen überwiegend um allgemeine Geschäftsbedingungen handelt, wird die AGB-rechtliche Inhaltskontrolle herangezogen, um die Grenzen der vertraglichen Ausgestaltung von Datenverträgen zu bestimmen. Das Kapitel endet mit der Darstellung der Schwächen der Vertragskonzeption und dient damit auch als Anlass für Überlegungen eines neuen Datenrechts.
Ansätze zur künftigen Ausgestaltung eines neuen Datenrechts werden im fünften Kapitel untersucht. Zunächst wird überprüft, ob und wie ein staatlicher Eingriff gerechtfertigt werden kann. Untersucht werden hier deontologische und ökonomische Ansätze, insbesondere das allokative Marktversagen. Im Anschluss werden nach der Bestimmung der Handlungsbefugnisse an Daten allgemeine Zuweisungsmechanismen untersucht. Der Fokus der Untersuchung liegt dabei auf Ansätzen, die Daten de lege ferenda rechtlich zuweisen wollen. Im sechsten Kapitel wird der EU-Data Act untersucht, der zugunsten der Nutzer vernetzter Geräte und damit verbundener Dienste Zugangs- und Nutzungsrechte vorsieht. Hier wird dargestellt, warum der Data Act nicht in der Lage ist, die Probleme der fehlenden Rechte an Daten zu lösen. Vorschriften im Hinblick auf die Rechte und Pflichten im Hinblick auf die Bereitstellung von Daten an öffentliche Stellen sowie Organe und Einrichtungen der Union sowie im Hinblick auf den Wechsel von Datenverarbeitungsdiensten werden dabei nicht berücksichtigt. Das Kapitel endet mit Korrekturvorschlägen, die die Schwächen des Data Acts beseitigen könnten. In Kapitel 7 werden dann die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst.
1Europäische Kommission, Eine europäische Datenstrategie, COM (2020) 66 final, S. 3.
2Bleiber, Digitale Geschäftsmodelle, S. 13.
3Kaufmann, Geschäftsmodelle in Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge, S. 3.
4Riemensperger/Falk, in: Stiftung Datenschutz, Dateneigentum und Datenhandel, S. 261f.; Bleiber, Digitale Geschäftsmodelle, S. 21; Rohde/Bürger/Peneva/Mock, in: Rohde/Bürger/Peneva/Mock, Datenwirtschaft und Datentechnologie, S. 1; Louven, NZKart 2018, 217, 217; Koehler, in: Leupold/Wiebe/Glossner, IT-Recht, Teil 6.1 Rn. 8; Schuster u.a., in: Gerth/Heim, Entrepreneurship der Zukunft, S. 83ff.; Stender-Vorwachs/Steege, NJOZ 2018, 1361, 1361; Tolks, MMR 2022, 444, 444.
5Markl, in: Hoeren, Big Data und Recht, S. 3.
6Europäische Kommission, Aufbau einer europäischen Datenwirtschaft, COM (2017) final 9, S. 1; dies., Eine europäische Datenstrategie, COM (2020) 66 final, S. 3; Bozem/Nagl, Digitale Geschäftsmodelle erfolgreich realisieren, S. 110; Schweitzer, GRUR 2019, 569, 569.
7Bleiber, Digitale Geschäftsmodelle, S. 21; Rohde/Bürger/Peneva/Mock, in: Rohde/Bürger/Peneva/Mock, Datenwirtschaft und Datentechnologie, S. 1; Louven, NZKart 2018, 217, 217; Koehler, in: Leupold/Wiebe/Glossner, IT-Recht, Teil 6.1 Rn. 8; Schuster u.a., in: Gerth/Heim, Entrepreneurship der Zukunft, S. 83ff.; Stender-Vorwachs/Steege, NJOZ 2018, 1361, 1361.
8Stender-Vorwachs/Steege, NJOZ 2018, 1361, 1361; Czychowski/Siesmayer, in: Taeger/Pohle, Computerrechts-Handbuch, Teil 20.5 Rn. 5; Czychowski/Winzek, ZD 2022, 81, 82; Hennemann, RDi 2021, 61, 61; Kerber, IIC 2016, 759, 761; Europäische Kommission, Aufbau einer europäischen Datenwirtschaft, COM (2017) 9 final, S. 4.
9Ensthaler, NJW 2016, 3473, 3473.
10Müller, DuD 2019, 159, 159.
11Żdanowiecki, in: Digitalisierte Wirtschaft/Industrie 4.0, S. 24.
12Europäische Kommission, Folgenabschätzungsbericht, S. 2.
13Esken, in: Stiftung Datenschutz, Dateneigentum und Datenhandel, S. 73; Kerber, GRUR Int, 2023, 120, 120.
14Markendorf, ZD 2018, 409, 409.
15 Siehe hierzu Grützmacher, CR 2016, 485 ff; Hoeren, MMR 2013, 486; ders., MMR 2019, 5; Fezer, MMR 2017, 3; Wandtke, MMR 2017, 6; Determann, MMR 2018, 277; ders., ZD 2018, 503; Arkenau/Wübbelmann in: Taeger, Internet der Dinge, 95ff.; Ensthaler, NJW 2016, 3473ff.; Kerber, IIC 2016, 759ff.
16Sattler, in: Sassenberg/Faber, Rechtshandbuch Industrie 4.0 und Internet of Things, § 2 Rn. 12; Louven, NZKart 2018, 217, 220; Martini/Kolain/Neumann/Rehorst/Wagner, MMR-Beil. 2021, 3, 5.
17Schweitzer/Peitz, Datenmärkte in der digitalisierten Wirtschaft, S. 18; Europäische Kommission, Aufbau einer europäischen Datenwirtschaft, COM (2017) 9 final, S. 10.
18Schweitzer, GRUR 2019, 569, 569.
19Peitz/Schweitzer, NJW 2018, 275, 275; König, in: Hennemann/Sattler, Immaterialgüter und Digitalisierung, S. 91.
20König, in: Hennemann/Sattler, Immaterialgüter und Digitalisierung, S. 91.
21Europäische Kommission, COM (2022) 68 final, Erwägungsgrund 3; Schweitzer/Peitz, NJW 2018, 275, 275.
22König, in: Hennemann/Sattler, Immaterialgüter und Digitalisierung, S. 92.
23König, in: Hennemann/Sattler, Immaterialgüter und Digitalisierung, S. 92.
24Europäische Kommission, COM (2018) 232 final, S. 10f.; Kerber, GRUR Int. 2023, 120, 122; Podszun/Pfeifer, GRUR 2022, 953, 953.
25Europäische Kommission, COM (2022) 68 final, Erwägungsgrund 19.
26 So auch Podszun/Pfeifer, GRUR 2022, 953, 953.
27Europäische Kommission, Aufbau einer europäischen Datenwirtschaft, COM (2017) 9 final, S. 9, 13.
28Europäische Kommission, Eine europäische Datenstrategie, COM (2020), 66 final, S. 13ff.; dies., Aufbau einer europäischen Datenwirtschaft, COM (2017) 9 final, S. 12.
29 Verordnung (EU) 2023/2854 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 über harmonisierte Vorschriften für einen fairen Datenzugang und eine faire Datennutzung zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/2394 und der Richtlinie (EU) 2020/1828 (Datenverordnung), abrufbar unter: https://bmdv.bund.de/Shared-Docs/DE/Anlage/DG/Digitales/eu-data-act-deutsche-fassung-22-12-23.pdf?blob=publicationFile.
30Europäische Kommission, COM (2022) 68 final, S. 3, 8; dies., Eine europäische Datenstrategie, COM (2020) 66 final, S. 1; Erwägungsgrund 1 Data Act.
31Europäische Kommission, COM (2022) 68 final, S. 1; Erwägungsgrund 5 Data Act.
32 Siehe ausführlich zu personenbezogenen Daten Schmidt, Datenschutz als Vermögensrecht, S. 127ff.
Kapitel 2: Grundlagen zu Daten
Daten sind kein Rechtsphänomen, sondern Ergebnis technologischen Fortschritts. Sie sind in großen Mengen vorhanden und stellen Wissenschaft und Praxis vor neuen Herausforderungen. Das nachfolgende Kapitel legt die erforderliche Grundlage für die Untersuchung von Daten als Objekte von Rechten. Hierfür soll zunächst der Datenbegriff untersucht und von dem oft synonym verwendeten Informationsbegriff abgegrenzt werden (A.). Im Nachgang sollen rechtliche und technische Kategorien von Daten dargestellt werden. Die Kategorisierung soll gleichsam den Untersuchungsgegenstand der Arbeit auf nicht-personenbezogene maschinen- und verhaltensgenerierte (Roh-)Daten konkretisieren (B.). Die ökonomische Betrachtung von Daten soll schließlich das besondere Wertpotenzial von Daten in der europäischen Datenwirtschaft demonstrieren und die Hintergründe für das bestehende Schutzbedürfnis von Daten darstellen (C.).
A. Begriffsbestimmung
Die Diskussion um Rechte an Daten führt zu einem immer stärker werdenden Bedürfnis, Daten und Informationen strikter voneinander abzugrenzen.33 Die Abgrenzung ist schwieriger als auf dem ersten Blick angenommen. Die Interdependenz von Daten und Informationen erschwert die getrennte und unabhängige Begriffsdeutung beider Phänomene. Der Begriff „Information“ wird herangezogen, um Daten zu definieren, doch fehlt meist die Definition des Informationsbegriffs selbst.34 Obwohl die Mehrheit zu wissen scheint, was unter Information zu verstehen ist, ist eine konkrete Begriffserklärung tatsächlich schwierig.35 Der Unterschied von Daten und Informationen ist nicht nur sprachlicher Natur, auch wenn sie teilweise synonym genutzt werden.36 Beide Begriffe können in verschiedenen Zusammenhängen unterschiedliche Bedeutung entfalten.37 Eine klare Begriffsverwendung ist jedoch gerade in rechtswissenschaftlichen Untersuchungen von großer Bedeutung, insbesondere dann, wenn Daten als Objekte von Rechten untersucht werden sollen.38 Ziel der nachfolgenden Ausführungen ist es nicht, ein alle wissenschaftliche Disziplinen umfassendes einheitliches Daten- und Informationsverständnis zu entwickeln. Dies erscheint für die Untersuchung weder zweckmäßig noch erforderlich. Vielmehr sollen kurze Exkurse in die wichtigsten Daten- und Informationsbegriffe die Grundlage für die nachfolgende Begriffsbestimmung und der Konkretisierung des Untersuchungsgegenstandes legen.39
I. Natürliche Sprache als Ausgangspunkt
Das allgemeine Begriffsverständnis spiegelt das Verständnis in der natürlichen Sprache wider, wie sie von Menschen verstanden wird. Die natürliche Sprache ist das Ergebnis historischer Entwicklungen40 oder mit Grahn „das historische Produkt der Lebenstätigkeit der Menschen“41. Nicht das reale Objekt, das mit einem Begriff beschrieben wird, ist kausal für die Entstehung des Wortes, sondern „eine reine, vom Menschen konstruierte Konvention zur Bezeichnung des Gegenstandes“42. In unterschiedlichen Abstraktionsgraden verfügt sie über Ausdrucksmittel, mit denen Menschen Abbilder realer Objekte beschreiben und auf die sie im Rahmen ihrer Kommunikation zurückgreifen.43 Auch Daten finden im alltäglichen Sprachgebrauch in unterschiedlichen Kontexten ihre Verwendung. Während früher unter Daten meist analoge Daten verstanden wurden, wird der Begriff heute für die Bezeichnung von digitalen Daten verwendet. Der Duden definiert Daten als „(durch Beobachtungen, Messungen, statistische Erhebungen u.a. gewonnene) [Zahlen]werte, (auf Beobachtungen, Messungen, statistischen Erhebungen u.a. beruhende) Angaben, formulierbare Befunde; elektronisch gespeicherte Daten, Zeichen, Informationen“44. Unter dem Begriff Information wird dagegen „das Informieren; Unterrichtung über eine bestimmte Sache; [auf Anfrage erteilte] über alles Wissenswerte in Kenntnis setzende, offizielle, detaillierte Mitteilung über jemanden, etwas; Äußerung oder Hinweis, mit dem jemand von einer [wichtigen, politischen] Sache in Kenntnis gesetzt wird; Gehalt einer Nachricht, die aus Zeichen eines Codes zusammengesetzt ist“45 verstanden. Beide Definitionen geben zwar nur ein grobes Verständnis darüber, was unter Daten und Informationen zu verstehen ist; dennoch liefern sie erste Anhaltspunkte für eine begriffliche Annäherung.
1. Daten als Abbild der Realität
Die Definition des Duden von Daten als „Ergebnis von Messungen oder statistischen Erhebungen“ geben den objektiven Charakter von Daten wieder („data as facts“).46 Daten bilden das ab, was in der Realität vorhanden ist. Reale Gegebenheiten werden durch einen Auswahlprozess als Ergebnisse von Messungen als Daten erfasst und in Form von Zeichen fixiert.47 Daneben können Daten auch Ergebnisse von Beobachtungen sein („data as observations“).48 Der Unterschied liegt dabei in der subjektiven Betrachtungsweise von Daten. Während statistische Erhebungen und Messungen ein objektives und damit reales Abbild liefern, sind Daten als Ergebnis von Beobachtungen subjektiv. Sie müssen gefiltert und interpretiert werden, um Informationen über die Realität liefern zu können.49 Die Ergebnisse der Datenerhebung werden in beiden Fällen in Form von Zahlen oder Buchstaben, also in Form von Zeichen definiert, denen wir eine bestimmte Bedeutung zumessen.50 Die Ergebnisse sind Daten, die möglicherweise das Potenzial in sich tragen, wertvolle Informationen zu liefern. Auch in empirischen Wissenschaften werden reale Gegebenheiten in Form von empirischen Daten abgebildet, die die Grundlage für Erkenntnisse und Schlussfolgerungen darstellen.51 Dieses allgemeine Begriffsverständnis verdeutlicht, dass Daten – unabhängig von einer objektiven oder subjektiven Betrachtungsweise – als Abbild oder Spiegel der Realität verstanden werden können. Sie existieren nie für sich allein, sondern geben das wieder, was in der Realität vorhanden ist.52 Dieses Verständnis legte auch das Bundesverfassungsgericht in seinem Volkszählungsurteil zugrunde, als es personenbezogene Daten als das „Abbild sozialer Realität“ bezeichnete.53 Zu sprachlichen Unklarheiten führt hingegen die Gleichsetzung des Datenbegriffs mit Begriffen wie „Information“ und „Angaben“54. Beide Begriffe sind klärungsbedürftig und helfen nur bedingt weiter, die Kernbedeutung von Daten zu ermitteln. Damit ist auch der Nachteil der natürlichen Sprache schnell erfasst, wenn sie für unterschiedliche Wirklichkeiten, dieselben Bezeichnungen verwendet.55 Solche nominalen Begriffsbestimmungen weisen keinen eigenständigen Erklärungsgehalt auf56, sondern sorgen vielmehr für sprachliche Irrtümer und Unklarheiten. Für die Untersuchung von Daten als Objekte von Rechten sind Realdefinitionen von Daten heranzuziehen, die empirische und informative Aussagen über Daten beinhalten.
2. Information als Erkenntnisgewinn
Ähnliche Probleme sind auch in der alltagssprachlichen Definition von Informationen erkennbar. Die Begriffsdeutung von Information im Duden als „Unterrichtung über eine bestimmte Sache; [auf Anfrage erteilte] über alles Wissenswerte in Kenntnis setzende, offizielle, detaillierte Mitteilung über jemanden oder etwas“ lässt sich auf das antike Begriffsverständnis von Information zurückführen. Der Begriff der Information stammt aus dem lateinischen Verb „informare“ und wird in seiner eigentlichen Urform mit „formen“, „bilden“ oder „gestalten“, im übertragenen Sinne mit „unterrichten“ und „in Kenntnis setzen“ übersetzt. Hintergrund dieser Zweideutigkeit ist die philosophische Deutung des griechischen Begriffs der „forma“, auf dessen Grundlage sich im Mittelalter die erkenntnistheoretische Deutung des Informationsbegriffs als „Formung der Erkenntnis“57und damit als die „Ermittlung und Vermittlung von Wissen“58 herausbildete.59 Das neuzeitliche Informationsverständnis findet in der erkenntnistheoretischen Deutung des Informationsbegriffes ihren Ursprung.60 Im alltäglichen Begriffsverständnis wird ein menschliches Bewusstsein vorausgesetzt, das Information empfangen, interpretieren und als Wissensvorrat speichern kann.61 Die Quellen für die Erlangung von Information sind vielfältig: Zeitungen, Fernseher, Bücher bzw. Bibliotheken oder auch Auskunftsstellen liefern Informationen für die Erlangung von Wissen.62 Zur Verdeutlichung der verschiedenen Facetten, die dem Begriff der Information innewohnen, wird Information in Vorgang, Wissensinhalt und Zustand der Kenntnis gegliedert.63Information als Wissensinhalt beschreibt das, was unter Information seit seiner erkenntnistheoretischen Deutung verstanden wird, nämlich den Inhalt der Information als Ursache des Wissenszuwachses. Doch Information meint ebenfalls den Prozess des Wissenszuwachses, der durch das Element des Vorgangs verdeutlicht wird.64 Nach dem Empfang der Information wird das Bewusstsein des Empfängers in der Regel positiv verändert – es erfolgt eine Bewusstseinserweiterung auf geistiger Ebene.65 „Informiert sein“ bedeutet damit die Veränderung dessen, was man weiß.66 Informationen führen damit zur Verringerung der Ungewissheit des Empfängers bzw. der Veränderung des vorhandenen Wissens.67 Das Ergebnis des Vorgangs ist der Wissenszustand selbst.68 Während Information damit zum einen für den Transfer von Wissen steht, kann er zum anderen das Ergebnis des Transfers bezeichnen.69 Das Ergebnis des Wissenstransfers zeigt dabei den gegenständlichen Charakter, den Information einnehmen kann, wenn im allgemeinen Sprachgebrauch von „Information haben“ oder „Informationen sammeln“ gesprochen wird.70Steinbruch stellt auf die Leistung der Information ab und resümiert Information als „den Stoff, aus dem Entscheidungen gemacht werden“71. Dieses alltagssprachliche Begriffsverständnis spiegelt die Erwartungshaltung des Empfängers wider, durch Information etwas zu erfahren und sein vorhandenes Wissen zu steigern. Im Zeitalter der Fehl- und Desinformation wird jedoch deutlich, dass Information – anders als im allgemeinen Begriffsverständnis angenommen – gerade nicht immer zuverlässig, nützlich und wahr sein muss.72 Dieses Bewusstsein wird im alltäglichen Sprachgebrauch zu einer Begriffsverschiebung dahingehend führen, Information nicht mehr ohne Vorbehalt mit Begriffen wie Wissenstransfer oder Wissenskommunikation gleichzusetzen.
II. Zweckfunktion von Legaldefinitionen von Daten und Informationen
Zur Vermeidung von sprachlichen Ungenauigkeiten und Missverständnissen, die der natürlichen Sprache von Menschen innewohnt, greift der Gesetzgeber auf Legaldefinitionen zurück, die dem Normadressaten die erforderliche Verständlichkeit und Eindeutigkeit liefern sollen.73 Insbesondere sprachliche Mehrdeutigkeiten sollen durch die Präzisierung in Legaldefinitionen verhindert werden. Da das Fehlen eines einheitlichen Begriffsverständnisses von Daten und Informationen zu Schwierigkeiten in der Rechtsanwendung führen kann,74 werden sie vor diesem Hintergrund in verschiedenen Rechtsnormen legal definiert. Im Hinblick auf Daten wird schnell deutlich, dass sie in den jeweiligen gesetzlichen Begriffsbestimmungen nur im erforderlichen Mindestumfang definiert werden. Maßgeblich ist stets der Gesetzeszweck, der im Fokus von Begriffsbestimmungen steht.
1. Datennutzungsrecht, Informationsfreiheitsrecht
Deutlich wurde dies zuletzt wieder im Datennutzungsgesetz (kurz: DNG), das in Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1024 über offene Daten und die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors am 23. Juli 2021 in Kraft getreten ist und das bis dahin geltende Informationsweiterverwendungsgesetz (kurz: IWG) abgelöst hat. In § 3 Abs. 3 DNG definiert das Gesetz Daten als „vorhandene Aufzeichnungen, unabhängig von der Art ihrer Speicherung“. Die Ausweitung auf sämtliche Aufzeichnungen dient dem Gesetzeszweck, den Fortschritt der Digitalisierung durch die volle Ausschöpfbarkeit von Daten voranzutreiben.75 Durch diese weite und damit auch zurückhaltende Definition von Daten sollen sämtliche Aufzeichnungen für innovative Geschäftsmodelle zur Verfügung stehen. Dieser Vorteil ist gleichsam ein Nachteil, denn es ist nicht greifbar, (ab) wann Daten als „Aufzeichnungen“ qualifiziert werden können, wenn sie als Objekte von Rechten definiert werden sollen. Es handelt sich wieder um eine bloß nominale Begriffsbestimmung ohne eigenständigen Erklärungsgehalt. Komplizierter wird dies durch den Umstand, dass der Begriff der „Aufzeichnung“ nicht nur für die Legaldefinition von Daten verwendet wird. Zu finden ist sie auch in § 2 Nr. 1 Informationsfreiheitsgesetz (IFG), wonach eine amtliche Information „jede amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnung, unabhängig von der Art ihrer Speicherung“ ist. Die Gleichsetzung des Aufzeichnungsbegriffs mit Daten und Informationen in beiden Legaldefinitionen lässt fälschlicherweise den Eindruck entstehen, bei beiden handele es sich um identische Phänomene.
2. Datenschutzrecht, Umweltinformationsrecht
Problematisch ist daher auch die Gleichsetzung von Daten und Informationen im Datenschutzrecht.76 In Art. 4 Nr. 1 der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) werden personenbezogene Daten definiert als „Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen“.77 Die Gleichsetzung ist nicht unproblematisch, denn geschützt werden im Grunde personenbezogene Informationen einer betroffenen Person.78
Auch das Umweltinformationsgesetz (UIG) setzt in § 2 Abs. 3 UIG Umweltinformationen mit Daten gleich. In den genannten Fällen, in denen Kriterien wie der Personen- oder Umweltbezug als maßgebliche (semantische) Anknüpfungspunkte dienen, mag die Gleichsetzung noch zweckmäßig sein. Für die abstrakte Bestimmung von Daten als Objekte von Rechten eignet sich eine solche Gleichsetzung jedoch nicht.79
3. Strafrecht, Zivilrecht
Wenig hilfreich ist auch die Definition von Daten im Strafrecht. Nach § 202a Abs. 2 StGB sind Daten nur solche, die „elektronisch, magnetisch oder sonst nicht unmittelbar wahrnehmbar gespeichert sind oder übermittelt werden“. Das maßgebliche Kriterium der fehlenden unmittelbaren Wahrnehmbarkeit der Daten ist dann gegeben, wenn Daten erst nach einer Transformation mittels technischer Hilfsmittel sinnlich wahrgenommen werden können.80 Der Grund für die Beschränkung der Definition auf die nicht unmittelbare Wahrnehmbarkeit der Daten liegt daran, dass unmittelbar wahrnehmbare Daten bereits durch die Vorschriften §§ 201, 202 StGB geschützt sind.81 Dies zeigt auch den nur bedingten Wert dieser Definition. Es handelt sich mehr um eine Beschränkung des Datenbegriffs, als dass es sich um eine positive Definition handelt.82 Das Begriffsverständnis von Daten wird vielmehr vorausgesetzt.83 Dieser Ansatz zeigt, mit Hintergrund der fehlenden datenschutzrechtlichen Definition, die mangelnde Nützlichkeit des strafrechtlichen Datenbegriffs für ein einheitliches Begriffsverständnis. Auch im Bürgerlichen Gesetzbuch wird der Begriff der Daten nicht legaldefiniert. Zuletzt wurde der Datenbegriff verwendet, um den Begriff der digitalen Inhalte zu definieren. In Umsetzung des Art. 2 Nr. 1 Digitale-Inhalte-Richtlinie werden in § 327 Abs. 2 BGB digitale Inhalte definiert als „Daten, die in digitaler Form erstellt und bereitgestellt werden“. Gemeint sind damit unter anderem Computerprogramme, Anwendungen, Videodateien, Audiodateien, Musikdateien, digitale Spiele, elektronische Bücher und andere elektronische Publikationen.84 Aufgrund der Weite der Definition sollen auch künftige Technologien erfasst werden.85 Anders als der Wortlaut augenscheinlich voraussetzt, müssen die Daten nicht Inhalte im Sinne von Informationen darstellen.86 Für die Einordnung ist allein die „Herstellung und Bereitstellung in digitaler Form“ erforderlich, sodass im Umkehrschluss analog erstellte oder bereitgestellte Daten nicht erfasst sind.87 Nach Fries werden „digitale Inhalte damit in gewisser Weise zu einem Komplementärbegriff zur Sache i.S.d. § 90 BGB“88.
4. Data Governance Act
In der zuletzt in Kraft getretenen Data Governance Verordnung wird der Begriff der Daten in Art. 2 Nr. 1 legal definiert. Danach sind Daten „jede digitale Darstellung von Handlungen, Tatsachen oder Informationen sowie jede Zusammenstellung solcher Handlungen, Tatsachen oder Informationen auch in Form von Ton-, Bild- oder audiovisuellem Material. Aus der Begriffserklärung des Data Governance Acts wird deutlich, dass Daten „etwas“ darstellen. Dadurch wird die Eigenschaft von Daten als Träger von Informationen hervorgehoben. Dies verdeutlicht die Bezugnahme auf „Handlungen, Tatsachen oder Informationen“. Der Hinweis auf Ton-, Bild- oder audiovisuelles Material knüpft dagegen auf die Strukturform von Daten an. Nicht nur strukturelle, sondern auch unstrukturelle Daten sollen unter die Begriffsdefinition des Data Governance Acts fallen. Die Begriffsdefinition ist damit weit zu verstehen. Dem europäischen Gesetzgeber scheint es darum zu gehen, alle digitalen Daten zu erfassen, die Gegenstand des Datenaustauschs sein können. Deutlich wird hier die Behandlung von Daten als Objekte, da es allein darum geht, ob eine digitale Darstellung vorliegt, unabhängig von der semantischen Bedeutung, den die Daten tragen können.
III. Kernbedeutung in der Informationstechnik
Die Legaldefinitionen von Daten und Informationen eignen sich nicht, um Daten als Objekte von Rechten zu definieren und von Informationen abzugrenzen. Da Daten aus dem Funktionszusammenhang der Informationstechnologie entstammen89, könnte die Übertragung des Datenbegriffs der Informatik auf den Rechtsterminus „Daten“ geeignet sein, Daten als Objekte von Rechten abstrakt zu bestimmen und von Informationen abzugrenzen.
1. Daten als binäre Nachrichten der Kommunikation
In der Informatik sind Daten binäre Nachrichten der Kommunikation.90 Sie werden definiert als „die Folge von Nullen und Einsen, die irgendwelche Informationen repräsentieren.“91. Hintergrund der Definition ist die Funktionsweise von Rechnern, die Informationen nur in Form von „0“ oder „1“, den sog. Bits, verarbeiten können.92 Sie stellen die kleinstmögliche Maßeinheit für Datenmengen dar.93 Ist die Codierung bekannt, können die binär codierten Daten in menschenlesbare Zeichen, wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen, übersetzt werden.94 Daten beinhalten damit keinen Sinngehalt, sondern sind vielmehr Träger codierter Information, die zwischen Sender und Empfänger zur Informationsübertragung und damit zur Kommunikation beitragen.95
2. Abbild der Datenfunktion in DIN-Normen
Dieses Verständnis spiegelt sich auch in der mittlerweile außer Kraft getretenen Norm DIN 44300 Teil 2 Nr. 2.1.13 wider, wonach Daten „ein Gebilde aus Zeichen oder kontinuierlichen Funktionen, die aufgrund bekannter oder unterstellter Abmachungen Informationen darstellen, vorrangig zum Zwecke der Verarbeitung oder als deren Ergebnis“ sind.96 Die Definition beinhaltet die Elemente Zeichen, Daten und Informationen, deren Ursprung der Informatik zuzuordnen ist.97 Zunächst soll es sich bei Daten um „Zeichen“ handeln. Nach der DIN 44300 Nr. 2 ist ein Zeichen „ein Element (als Typ) aus einer zur Darstellung von Information vereinbarten endlichen Menge von Objekten (Zeichenvorrat, character set), auch jedes Abbild (als Exemplar) eines solchen Elements“. Weiterhin sollen Daten Information „darstellen“, sodass die weitere Ebene die syntaktische Ebene darstellt.98Hoeren interpretiert das Kriterium der Darstellung anders. Nach ihm ist damit „[…] das Medium, als physisch wahrnehmbare Sache oder Eigenschaft einer Sache […]“99 gemeint. Ein Medium kann beispielsweise ein Datenträger oder ein Roman sein, solange es zur Darstellung von Informationen geeignet ist. Um jedoch auch Daten an sich zu erfassen, schlägt er vor, eine dritte Ebene einzuführen, die er als „Gebilde“ bezeichnet.100 Allein hierdurch seien Daten begrifflich von Informationen und Sachen, die Informationen tragen können, abgrenzbar.101 Nach dem Wortlaut der DIN 44300 ist davon auszugehen, dass „darstellen“ nicht das Medium meint, auf das die Daten gespeichert werden, sondern die Zeichen, die Informationen bei einer bestehenden Übereinkunft zwischen Sender und Empfänger tragen können.102 Nur eine solche Auslegung erfasst sämtliche Daten, unabhängig von der Art ihrer Speicherung. Das Potenzial von Daten zu Informationen zu werden, wird durch den Hinweis auf „bekannte oder unterstellte Abmachung“ verdeutlicht. Die Abfolge von bestimmten Zeichen kann für den Empfänger eine bestimmte Bedeutung entfalten. Information wird daher definiert als „Kenntnisse über Sachverhalte und Vorgänge“. Das Begriffsverständnis in der Informatik gleicht damit dem Verständnis im allgemeinen Sprachgebrauch. Information beinhaltet damit Kenntnisse und damit auch Wissen bezogen auf ein bestimmtes Objekt. Abgelöst wurde die DIN 44300 von der geltenden ISO/IEC 2382-1 für Informationstechnik. Danach sind Daten „Reinterpretable representation of information in a formalized manner suitable for communication, interpretation, or processing“ – eine wieder interpretierbare Darstellung von Information in formalisierter Art, geeignet zur Kommunikation, Interpretation oder Verarbeitung. Nach diesem Verständnis beruhen Daten damit auf Zeichen und liegen zunächst als kontextfreie Angaben bzw. als bloße Zeichensequenzen vor.103 Erst durch ihre Kontextualisierung werden Zeichen zu Daten104, die ihrerseits durch semantische Schemata zu Informationen interpretiert werden können.105 Information werden daher definiert als „knowledge concerning objects, such as facts, events, things, processes or ideas, including concepts, that within a certain contexthas a particular meaning” – Wissen über Objekte wie Fakten, Ereignisse, Dinge, Prozesse oder Ideen, einschließlich Konzepte, die in einem bestimmten Kontext eine bestimmte Bedeutung haben. Informationen müssen demnach einen Bedeutungsgehalt aufweisen. Daten werden demnach dann zu Informationen, wenn ihnen in einem bestimmten Kontext aufgrund einer getroffenen Vereinbarung eine bestimmte Bedeutung zugewiesen wird.106
IV. Interdepenz von Daten und Informationen in der Semiotik
Die Interdependenz von Daten und Informationen in den bisherigen Begriffsbestimmungen hat verdeutlicht, dass eine getrennte Begriffsbestimmung beider Phänomene schwierig ist. Daher eignet sich insbesondere das dreidimensionale Konzept der Semiotik107, auf die auch Zech in seiner Begriffsbestimmung von Information zurückgreift.108 Die Semiotik ist schon seit der Antike bekannt. Schon Platon und Aristoteles nutzten sie in ihren Erkenntnistheorien für die Frage, in welcher Beziehung ein Zeichen zu dem Objekt steht, das es beschreibt.109 Die Semiotik findet ihren Ausgangspunkt in der These, dass Informationen durch Zeichen repräsentiert werden.110
1. Syntaktische Ebene
Die syntaktische Dimension untersucht die in der Information vorhandenen Zeichen und ihrer Beziehung zueinander.111 Im Rahmen der syntaktischen Betrachtungsweise von Information kommt es nicht auf die Bedeutungsebene an. Maßgeblich ist allein die Zeichenebene, nicht dagegen das durch das Zeichen bezeichnete Objekt und die Personen, welche sie verwenden.112 Damit fallen auch sinnlose Zeichenfolgen unter den Begriff der syntaktischen Information,113 da die sich hinter der Abfolge möglicherweise befindende Bedeutung für den Empfänger unberücksichtigt bleibt.114 Es ist nur erforderlich, dass Zeichen oder Daten vorliegen, welche als Teil von Information in verschiedenen Zusammenhängen verschiedene Funktionen erfüllen können. Als Beispiel dienen hier Buchstaben des lateinischen Alphabets, die bei einer bestimmten Abfolge eine Bedeutung aufweisen können. Im Rahmen der syntaktischen Betrachtungsweise spielt allerdings die Bedeutung eines Wortes keine Rolle. Untersucht werden nur die einzelnen Buchstaben und ihre Beziehung zueinander, nicht die Bedeutung, die eine bestimmte Abfolge der Buchstaben tragen könnte. Auf der syntaktischen Ebene kommt es damit auf die Informationsübertragung als solche an.115 Einen ähnlichen Ansatz verfolgen Shannon und Weaver. Sie entwickelten in ihrer „Mathematical Theory of Communication“116 ein logarithmisches Informationsmaß auf Grundlage der Zeichenwahrscheinlichkeit einer Sprache. Ziel ihrer Untersuchung war die Berechnung des Informationsgehalts, den eine Quelle pro Zeichen aussendet.117 Information soll dabei als Maß der Ungewissheit über ein Zeichen sein.118 Nicht berücksichtigt wurde im Rahmen ihrer Untersuchung der Inhalt bzw. die Bedeutung der Information für den menschlichen Geist. Vielmehr sollte die symbolgetreue Übertragung vom Sender zum Empfänger, beide nicht-menschlicher Natur, betrachtet werden.119
2. Semantische Ebene
Die Bedeutungsebene wird erst in der semantischen Dimension von Information berücksichtigt.120 Anders als die Syntax setzt sich die semantische Dimension mit der Beziehung der Zeichen zu einer Tatsache auseinander.121 Es wird damit nach einer tieferen Bedeutung einer Zeichenabfolge gefragt.122 Zur Abgrenzung zwischen syntaktischer und semantischer Information ist es zwingend erforderlich, dass ein Zeichen vorliegt, „[…] das vom Empfänger stellvertretend für einen Begriff interpretiert wird.“123. Maßgeblich ist damit die Interpretation des Zeichens durch einen Empfänger.124 Ohne ein interpretierendes System ist die Erlangung einer Bedeutung damit nicht möglich.125 Zeichen sind daher für die Gewinnung einer Bedeutung fundamental und damit kleinste Elemente einer Kommunikation. Für die Übertragung des Zeichens in die semantische Information ist eine vorher festgelegte Übereinkunft, auch Code genannt, erforderlich, die allein in der Vorstellung des Erzeugers existiert und für die Übertragung des Zeichens zu dem in ihm verkörperten Begriff zuständig ist.126 Ein Code ist damit eine „[…] Regel, nach der die Information durch die Zeichen repräsentiert wird […]“127. Liegt ein solcher „Code“ nicht vor, handelt es sich um syntaktische Information. Erst wenn das Zeichen zu einer Bedeutung übertragen wird, spricht man neben der syntaktischen auch von der semantischen Information. Aus juristischer Sicht gehört die semantische Ebene der Information zum Informationsrecht, „da dieses auf die Information für den Menschen und nicht auf die Syntax der Daten abzielt“128. Semantische Informationen sind bereits heute Gegenstand verschiedener Schutzrechte wie etwa im Immaterialgüterrecht und Datenschutzrecht.129
3. Pragmatische Ebene
Die Auseinandersetzung mit der Wirkung von Information für den Adressaten wird in der pragmatischen Dimension berücksichtigt.130 Die Bedeutung kann objektiv für alle Adressaten identisch sein. Unterschiede wird es jedoch in der Wirkung der Information bei einzelnen Empfängern geben. Betrachtet wird der Zweck der Information, den der Absender hat, und die Wirkung, die beim Empfänger eine mögliche Entscheidungsgrundlage liefert.131 Sowohl die semantische als auch die pragmatische Dimension berücksichtigen damit den Menschen als Adressaten der Information, während die syntaktische Dimension allein die Zeichen analysiert, unabhängig von einem menschlichen Geist. Schwierigkeiten bereitet die Abgrenzung zwischen semantischer und pragmatischer Information. Hintergrund dieser Abgrenzungsproblematik ist, dass bei beiden Dimensionen der Empfänger im Vordergrund steht. Die Abhängigkeit vom vorhandenen Wissen des Empfängers kann damit dazu führen, dass Information zu unterschiedlicher Wirkung führen kann, obwohl sie auf semantischer Ebene von beiden verstanden wird.132 Die unterschiedliche Wirkung kann durch die unterschiedliche semantische Interpretation sogar verstärkt werden, wenn „[…] verschiedene Empfänger vom Objekt, das durch ein Zeichen repräsentiert wird, nicht die gleiche gedankliche Vorstellung haben.“133
V. Bewertung
Die Untersuchung des allgemeinen Sprachverständnisses hat verdeutlicht, dass die synonyme Verwendung von Daten und Informationen für sprachliche Irrtümer in der Verwendung beider Begrifflichkeiten sorgen kann. Hinzukommt, dass die alltägliche Sprache vom sozialen Wandel abhängig ist und sich daher nicht immer eignet, die Kernbedeutung von Objekten zu erfassen. Das alltägliche Sprachverständnis kann damit nur erste Anhaltspunkte für eine Begriffsannäherung liefern. Auch das Recht liefert mit seinen Legaldefinitionen keine allgemeingültige Definition von Daten. Daten und Informationen werden teilweise synonym verwendet. Insbesondere in den Fällen, in denen es dem Gesetzgeber auf den inhaltlichen Bezug der Daten ankommt, scheint ein Rückgriff auf den Informationsbegriff üblich zu sein. Der Begriff der Daten wird dabei entweder mit dem Begriff der „Aufzeichnung“ oder der „Information“ gleichgesetzt. Allein das Strafrecht knüpft auf die technische Bedeutung von Daten an, nimmt eine Begriffsklärung jedoch nur in Form einer negativen Legaldefinition vor. Dies ist nicht unproblematisch, denn sowohl Daten als auch Informationen können Objekte verschiedener Schutzrechte sein.134 Die Begriffsbestimmungen erfolgen in den jeweiligen Gesetzen stets kontext- und zweckbezogen. Dies ist auch im Sinne von Legaldefinitionen, denn enge Begriffsdeutungen hindern die Anwendbarkeit der Normen für nicht vorhersehbare Sachverhalte, wohingegen die Definition im erforderlichen Mindestmaße die Anwendbarkeit der jeweiligen Normen auch im Zeitalter des digitalen Wandels ermöglicht. Nach den informationstechnischen Begriffsdefinitionen von Daten in der DIN 44300 und ISO/IEC 2381- 1 sind Daten Zeichen bzw. Signale in ihrer Urform kontextfreie Angaben, die erst durch ihre Kontextualisierung und Interpretation zu Informationen werden.135 Daten werden damit als „informationelle Atome“ von Informationen verstanden.136 Sie sind damit die Grundeinheit, die bei „Auflösung der Information durch den Computer in binäre Aussagen (ja/nein) die Grundlage für die Einheitsbildung sind“.137 Die Untersuchung der Semiotik zeigt Parallelen zum informationstechnischen Daten- und Informationsbegriff.138 Die einzelnen Elemente, die durch die Definition in der DIN 44300 umfasst werden, ähneln den semiotischen Ebenen. Nach informationstechnischer Vorstellung ist das Datum als Einheit informationstragender Zeichen der Ebene der Syntax zuzuordnen.139 Werden Daten für sich allein betrachtet, sind sie nach der DIN 44300 Zeichen oder Zeichengebilde. Dieses Verständnis wird in der semiotischen Theorie im Rahmen der syntaktischen Interpretation vertreten. Für die Einordnung als „Daten“ werden mithin keine Anforderungen an die dahinterstehende Semantik gestellt.140 Als syntaktische Informationsgüter können sie einen semantischen Gehalt offenbaren, müssen es jedoch nicht.141
Für die Untersuchung ist entscheidend, dass die Zeichen in maschinenlesbarer Form vorliegen und in ihrer digitalen Struktur der maschinellen Datenverarbeitung zugänglich sind.142 Damit sind Daten gemeint, die einer spezifischen Kodierung unterliegen und nur mit spezifischen Algorithmen und Tools gelesen und verarbeitet werden können.143 Sie können das Potenzial haben, durch ihre Interpretation bzw. Verknüpfung mit anderen Daten eine bestimmte Bedeutung zu entfalten, erforderlich ist dies jedoch nicht. Dies führt zur weiteren Feststellung, dass Daten Bestandteil von Information sind. Für die Untersuchung kann Information aus rechtlicher Sicht nur das sein, was von dem menschlichen Empfänger auch verstanden wird.144 Gleichsam bedeutet dies, dass Information für den Zweck der Untersuchung auch nicht mit Wissen gleichgestellt werden kann. Wissen entsteht erst durch die Interpretation semantischer Information durch den menschlichen Geist. Soll Information als Objekt von Daten abgrenzbar sein, ist nicht auf den geistigen Prozess der Wissensentstehung abzustellen, sondern vielmehr auf das Objekt, auf das sich die menschliche Interpretation bezieht. Für den Zweck der nachfolgenden Untersuchung soll unter dem Begriff der Information im Sinne der rechtlichen Behandlung nur solche Information verstanden werden, die die semantische Bedeutungsebene erreicht, unabhängig davon, ob der Empfang der semantischen Information zwangsläufig zum Wissenszuwachs führt oder nicht. Für die Einordnung als Information kommt es nur darauf an, ob Information (irgend-)eine Bedeutung entfaltet. Ein solches Verständnis ist die geeignetste Grundlage für die Abgrenzung von Daten.





























