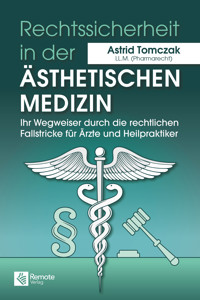
94,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Remote Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wie Sie Ihre medizinisch-ästhetischen Behandlungen an den gesetzlichen Vorgaben ausrichten und Ihre berufliche Existenz sichern Sie wollen als medizinisch-ästhetisch behandelnder Arzt oder Heilpraktiker rechtssicher agieren, sind mit den vielen gesetzlichen Vorgaben überfordert oder verstehen nicht, wie diese umzusetzen sind? Sie möchten sich mit zielgerichteter Werbung von der Konkurrenz abheben, sind aber unsicher, welche Werbung für die verschiedenen medizinisch-ästhetischen Verfahren erlaubt ist? Mit diesen Problemen sind Sie nicht allein: Viele Ärzte und Heilpraktiker glauben, die Verwendung eines Produkts ohne Zulassung, sei ein Off-Label-Use. Folglich gehen sie davon aus, dass eine entsprechende Patientenaufklärung sie vor Haftungsrisiken schützt. Tatsächlich könnten sie eine illegale Produktanwendung vornehmen, die von keiner Haftpflichtversicherung gedeckt wird und strafrechtlich als Körperverletzung gilt. Doch das muss nicht sein! In "Rechtssicherheit in der ästhetischen Medizin" erklärt Astrid Tomczak LL.M. (Pharmarecht) unter anderem die Unterschiede zwischen On-Label-, Off-Label-Use und unlizenzierter Verwendung. Dieses Buch gibt Ihnen Klarheit über den rechtlichen Rahmen und die erforderliche Form der Aufklärung. Minimieren Sie Haftungs- und Abmahnrisiken und gewinnen Sie dauerhafte rechtliche Sicherheit für Ihre berufliche Existenz. Mit diesem Buch erhalten Sie: - geballtes Know-how zu wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekten Ihrer medizinisch-ästhetischen Behandlungen - ein umfassendes Rechtsverständnis für die ästhetische Medizin - Zugang zu einem kostenlosen Kurs in Heilmittelwerberecht oder in Antikorruptionsrecht für das Gesundheitswesen im Wert von je 195 €Diese Problemlösungen hält Ihr "Wegweiser durch die rechtlichen Fallstricke für Ärzte und Heilpraktiker" für Sie bereit: Rechtsfragen der ästhetischen Medizin Für Ärzte und Heilpraktiker haben sich in den letzten Jahren viele gesetzliche Änderungen ergeben, beispielsweise bei den erlaubten Behandlungsformen zur Eigenbluttherapie. Finden Sie Ihren Weg durch den Paragrafendschungel, erfahren Sie, welche Behandlungen Heilpraktikern in der ästhetischen Medizin erlaubt sind und welche dem Arztvorbehalt unterliegen. Heilmittelwerberecht In der ästhetischen Medizin herrscht ein starker Konkurrenzkampf, in dem gute Werbung den Unterschied machen kann. Sie erhalten in diesem Buch Einblick in das Heilmittelwerberecht, erfahren, welche Formen der Werbung erlaubt sind und wie Sie Rechtsstreitigkeiten und Abmahnungen vermeiden können. Rechtsunsicherheit bei Off-Label-Use von Arzneimitteln Wann ist eine Produktanwendung ein Off-Label-Use? Wann ist die Produktanwendung mangels Zulassung oder CE-Zertifikat unzulässig? Verstehen Sie die Unterschiede zwischen Off-Label- und Unlicensed-Use für ein minimiertes Haftungsrisiko. Verabschieden Sie sich vom rechtlichen Wirrwarr In Ihrer täglichen Arbeit handeln Sie stets nach bestem Wissen und Gewissen. Aber dies reicht nicht aus und kann schwerwiegende Folgen haben. Viele Heilpraktiker in der ästhetischen Medizin riskieren aufgrund von Unwissenheit ihre Heilpraktikererlaubnis. Sie können Haftungs- und Abmahnrisiken erheblich minimieren, indem Sie sich mit den unterschiedlichen Regelungen für Arzneimittel, Pharma und Medizinprodukte auseinandersetzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Haftungsausschluss:
Die Ratschläge im Buch sind sorgfältig erwogen und geprüft. Alle Angaben in diesem Buch erfolgen ohne jegliche Gewährleistung oder Garantie seitens des Autors und des Verlags. Die Umsetzung erfolgt ausdrücklich auf eigenes Risiko. Eine Haftung des Autors bzw. des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden oder sonstige Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und/oder unvollständiger Informationen verursacht wurden, ist ausgeschlossen. Verlag und Autor übernehmen keine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und ebenso nicht für Druckfehler. Es kann keine juristische Verantwortung und keine Haftung in irgendeiner Form für fehlerhafte Angaben und daraus entstehende Folgen vom Verlag bzw. Autor übernommen werden.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
1. Auflage 2024
© 2024 by Remote Verlag, ein Imprint der Remote Life LLC, Fort Lauderdale, Fl., USA
Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.
Projektmanagement: Franziska Kellner
Lektorat und Korrektorat: Katrin Gönnewig, Miriam Buchmann, Luise Hartung
Umschlaggestaltung: Zarka Bandeira (Ursprungsdesign), Melanie Göttlicher (Finalisierung)
Satz und Layout: Melanie Göttlicher
Illustrationen und Grafiken: i3alda/Depositphotos.com, Leamsign/Depositphotos.com
Abbildungen im Innenteil: © Astrid Tomczak
ISBN Print: 978-1-960004-60-4
ISBN E-Book: 978-1-960004-61-1
www.remote-verlag.de
Der Autor spricht mit seiner Ansprache jedes Geschlecht sowie Diverse Personen an. Das generische Maskulinum wurde ausschließlich für eine bessere Lesbarkeit des Sprachflusses gewählt.
INHALTSVERZEICHNIS
1. EINLEITUNG ÄSTHETISCHE MEDIZIN
2. MARKTÜBERBLICK DEUTSCHLAND
A. MARKTDEFINITION
I. ABGRENZUNG HEILKUNDE UND KOSMETIK
II. PRODUKTE
III. INDIKATIONEN
IV. INVASIVITÄT
V. AKTEURE
VI. MARKTENTWICKLUNG
B. RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN
I. ARZNEIMITTELRECHT
1. ARZNEIMITTELGESETZ (AMG)
2. ARZNEIMITTELDEFINITIONEN
a. Präsentationsarzneimittel
b. Funktionsarzneimittel
3. ARZNEIMITTEL UND IHR EINSATZ IN DER ÄSTHETISCHEN MEDIZIN
a. Botulinumtoxin
i. Produkte und Zulassungen
ii. Off-Label-Use
iii. Unlicensed Use
iv. Einsatz von Botulinumtoxin durch Heilpraktiker und Zahnärzte
b. Plättchenreiches Plasma (PRP)
i. Varianten der PRP-Therapie
ii. Gesetzliche Grundlagen der PRP-Anwendung
iii. Übersicht Gerichtsurteile und aktueller Status
c. Eigenfett
i. Einsatzbereiche autologen Eigenfetttransfers
ii. Rechtliche Rahmenbedingungen des Fetttransfers
d. Hyaluronidase
i. Übersicht Hyaluronidase-Produkte Deutschland
ii. Arzneimittelrechtliche Vorgaben
e. Produkte zur Lipolyse
i. Inhaltsstoffe und Wirkmechanismen von Lipolyseprodukten
ii. Lipolyseprodukte Deutschland
iii. Arzneimittelrechtliche Vorgaben
II. MEDIZINPRODUKTERECHT
1. EU-MEDIZINPRODUKTEVERORDNUNG (MP-VO)
a. Neuerungen im Überblick
b. Medizinproduktebegriff
c. Fiktive Medizinprodukte
2. GESETZ ZUR DURCHFÜHRUNG UNIONSRECHTLICHER VORSCHRIFTEN BETR. MEDIZINPRODUKTE (MPDG)
a. Regelungsinhalte
b. Untergesetzliche Änderungen
3. MEDIZINPRODUKTE UND IHR EINSATZ IN DER ÄSTHETISCHEN MEDIZIN
a. Stoffliche Medizinprodukte
b. Dermale Filler auf Hyaluronsäurebasis
i. Abgrenzung zwischen Medizinprodukt und Arzneimittel
ii. Hyaluronsäurefiller mit Betäubungsmittelzusatz
iii. Selbstmedikation mit Dermalen Fillern
iv. Anwendung lidocainhaltiger Dermalfiller durch Heilpraktiker
v. Wiederverwendung angebrochener Hyaluronsäurefiller
c. Kollagenfiller
d. Mesotherapie-Produkte
i. Indikationen der Mesotherapie
ii. Überblick Wirkstoffe
iii. Bewertung der Wirkstoffe
iv. Verabreichung der Wirkstoffe
v. Rechtsfolgen nach Medizinprodukterecht
e. Brustimplantate
i. Implantatregister
ii. Implantatpass
iii. PIP-Skandal
f. Fäden
i. Import von Fäden in die Europäische Union
ii. Auswirkungen eines fehlenden EU-Bevollmächtigten
g. Geräte
i. Licht/Hoch- und Niederfrequenz/Ultraschall
ii. Optische Strahlung
iii. Hochfrequenzgeräte
iv. Nieder- oder Mittelfrequenzgeräte
v. Ultraschallanwendungen
h. Kryolipolyse
i. Hyaluron-Pen
j. Plasma-Pen
k. Microneedling
1. Arten des Microneedlings
2. Anwendungen/Indikationen
3. Absolute/relative Kontraindikationen
4. Nebenwirkungen/Risiken
5. Grad der Invasivität
6. Produktstatus Microneedling-Roller und Microneedling-Geräte
7. Abschließende Risikobewertung der Microneedling-Methode
4. OFF-LABEL-USE VON MEDIZINPRODUKTEN
a. Medizinproduktrecht und Off-Label-Use
b. Abweichende Vereinbarung zwischen Arzt und Patient
c. Vernünftigerweise vorhersehbarer Missbrauch
d. Rechtsfolgen des Off-Label-Use von Medizinprodukten
III. VERORDNUNG ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN WIRKUNGEN NICHTIONISIERENDER STRAHLUNG BEI DER ANWENDUNG AM MENSCHEN (NISV)
1. GELTUNGSBEREICH UND REGELUNGSZIELE
2. ARZTVORBEHALTE
a. Laseranwendungen
b. Hochfrequenzanwendungen
c. Ultraschallanwendungen
d. Folgen von Verstößen gegen Arztvorbehalte
3. FACHKUNDE
a. Fachkundemodule
b. NiSV-Schulen
c. Fachkundenachweise
4. DOKUMENTATIONS- UND MELDEPFLICHTEN
5. GERICHTSURTEILE IM ZUSAMMENHANG MIT DER NISV
IV. MARKTVERHALTENSREGELN
1. HEILMITTELWERBEGESETZ (HWG)
a. Geltungsbereich
b. Werbebegriff
c. Fachkreis- und Publikumswerbung
d. Werbeverbote
i. Allgemeine Werbeverbote
ii. Verbote in der Publikumswerbung
2. GESETZ GEGEN DEN UNLAUTEREN WETTBEWERB (UWG)
a. Anwendungsbereich
b. Zusammenspiel mit dem Heilmittelwerbegesetz
c. Abmahnungen
3. ANTIKORRUPTIONSGESETZ FÜR DAS GESUNDHEITSWESEN
a. Hintergrund
b. Tatbestand
c. Beispiele
V. BERUFSRECHTLICHE REGELUNGEN
1. (MUSTER-)BERUFSORDNUNG DER ÄRZTE (M-BOÄ)
2. HEILPRAKTIKERGESETZ (HEILPRG) UND BERUFSORDNUNG
a. Heilpraktikergesetz
b. Berufsordnung der Heilpraktiker
3. MEDIZINPRODUKTEBERATER
4. PHARMAREFERENT
VI. PATIENTENSCHUTZ
1. DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG (DSGVO)
2. PATIENTENRECHTEGESETZ
a. Eckpunkte zur Aufklärung bei medizinisch-ästhetischen Behandlungen
i. Inhalt und Teile der Aufklärung
ii. Wer klärt auf?
iii. Zeitpunkt der Aufklärung
b. Gerichtsurteile zu Aufklärungsmängeln
ÜBER DIE AUTORIN
LITERATURVERZEICHNIS
QUELLENVERZEICHNIS
1. EINLEITUNG ÄSTHETISCHE MEDIZIN
Kaum ein Bereich in der Medizin wird so kritisch betrachtet wie die Ästhetik. Dies hat vor allem damit zu tun, dass es der klassischen Medizin suspekt erscheint, vermeintlich Behandlungen ohne Indikation durchzuführen und teilweise risikobehaftete Eingriffe an gesunden Menschen vorzunehmen. Die mediale Darstellung von Schönheitsbehandlungen trägt nicht dazu bei, diese kritischen Haltungen zu verändern. Dabei wird die Ästhetik jedoch häufig auf ihre Extreme reduziert. Dies führt zu einem völlig verzerrten Bild und verkennt die Realität, in der Menschen unter ihrem aktuellen Erscheinungsbild leiden und nach Optimierungsmöglichkeiten suchen.
In ihren Anfängen vor vielen Jahrzehnten mag sie auf der Seite der Behandler ein Fachgebiet für wenige Exoten im ärztlichen Bereich gewesen sein. Die Patienten haben sie vor allem aus Prominenten und sehr wohlhabenden Teilen der Bevölkerung rekrutiert. Heute ist die ästhetische Medizin längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
Umso wichtiger ist es festzuhalten, dass auch in der ästhetischen Medizin Regelungen und Standards existieren, die die Sicherheit der Patienten gewährleisten sollen.
Ziel dieses Buches ist es, die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen in der ästhetischen Medizin verständlich und praxisnah darzustellen und damit allen Akteuren im Markt einen guten Überblick zu bieten.
Um Ihnen einen »soften Einstieg« in das häufig nachgefragte Thema des Heilmittelwerberechts zu geben, haben Sie über diesen Link: https://doctor-s-delight.de/heilmittelwerberecht die Möglichkeit, sich ein kostenloses Video-Tutorial zum Thema anzusehen. Melden Sie sich einfach an und holen Sie sich die wichtigsten Infos für Ihren Werbeauftritt.
Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis: Ich benutze wegen der besseren Lesbarkeit in diesem Buch in der Regel nur die weibliche oder männliche Form. Selbstverständlich schließe ich damit aber immer alle Geschlechter ein.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre
Astrid Tomczak
2. MARKTÜBERBLICK DEUTSCHLAND
A. MARKTDEFINITION
Um den Markt für die ästhetische Medizin zu definieren, lohnt sich zunächst eine Standortbestimmung: Umgangssprachlich werden Begriffe wie Kosmetik, Ästhetik, medizinische Kosmetik, ästhetische Behandlung, kosmetische Chirurgie und viele mehr miteinander vermischt. Rechtlich gesehen ist es jedoch entscheidend, klar zwischen ästhetischer Medizin und Kosmetik abzugrenzen. Die Kosmetik soll dabei als Pflege und Erhalt des guten Zustandes der Hautoberfläche, der Haare, Nägel, Zähne und Mundschleimhaut definiert werden. Eine Veränderung der Körperform fällt nicht unter den Begriff der Kosmetik (vgl. Art. 2 Abs. 1a VO (EG) Nr. 1223/2009). Die ästhetische Medizin umfasst dagegen minimalinvasive und invasive Behandlungen, die Ärzten und Heilpraktikern vorbehalten sind, da sie trotz kosmetischer Zielsetzung der Heilkunde zuzurechnen sind.
In der täglichen Praxis sind diese Abgrenzungsfragen häufig schwer zu beantworten. Die Innovationskraft der kosmetischen und ästhetischen Industrie hat in den letzten Jahren zu vielen Überschneidungen der beiden Bereiche geführt. So finden sich beispielsweise Plasmapens, Microneedling-Geräte oder die Kryolipolyse sowohl in Kosmetikstudios als auch in den Praxen von Ärzten und Heilpraktikern. Wer diese Anwendungen lege artis durchführen darf und wer nicht, ist anhand des Heilpraktikerrechts und der seit den 1960er-Jahren entwickelten Rechtsprechung zu prüfen. Das Heilpraktikerrecht ist zwar Bundesrecht, der Vollzug und die Auslegung der Vorschriften obliegen jedoch den Ländern. Dies führt in Einzelfällen zu einem uneinheitlichen Rechtsverständnis in den einzelnen Bundesländern.
Die Entwicklung der Rechtsprechung erfordert hingegen Geduld und einen langen Atem, wie ich später am Beispiel der Eigenblutbehandlung zeigen werde. Der Gang durch die Instanzen ist zeitaufwendig und begründet lange Phasen der Rechtsunsicherheit für die Behandler und Patienten.
I. ABGRENZUNG HEILKUNDE UND KOSMETIK
Die Ausübung der Heilkunde ist eine Tätigkeit mit Erlaubnisvorbehalt (§ 1 Abs. 1 HeilPrG). Sie ist, wie bereits erwähnt, im Heilpraktikergesetz geregelt. Doch was unter diesem sperrigen Begriff zu verstehen ist, wird dort nicht erklärt. Hier hat sich die Rechtsprechung im Laufe der Jahre bemüht, Kriterien aufzustellen.
Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) und der Bundesgerichtshof (BGH) haben Auslegungshilfen entwickelt, die eine Behandlungsform unter anderem dann als Heilkunde klassifizieren, wenn1:
Die Behandlung selbst zwar keine medizinischen Kenntnisse voraussetzt, jedoch die Frage aufwirft, ob sie im Einzelfall begonnen werden darf,
Die Behandlung ärztlich-diagnostisches Fachwissen erfordert, um einer Gesundheitsgefährdung durch den Eingriff vorzubeugen (BVerwG, Urt. v. 28.9.1965 – I C 105/63),
Die Behandlung gesundheitliche Schäden verursachen kann (BGH, Urt. v. 13.9.1977 – 1 StR 389/77),
Die Tätigkeit nach allgemeiner Auffassung ärztliche oder heilkundliche Fachkenntnisse erfordert (BVerwG, Urt. v. 20.01.1966 – I C 73/64).
Ärztliche Fachkenntnisse können im Hinblick auf das Ziel, die Art oder die Methode der Tätigkeit erforderlich sein. Für die medizinisch notwendigen Behandlungen lässt sich damit die Frage nach der Heilkundeausübung schnell klären. Denn wenn es um die Diagnose (pigmentierte Läsionen!), Heilung oder Linderung von krankhaften Hautveränderungen geht und nicht nur um die Pflege und Verschönerung der Haut, sind wir eindeutig im Bereich der Heilkunde angelangt. Hier darf die Kosmetikerin nicht tätig werden.
Aber ist Ästhetik auch Heilkunde? Hier herrschte jahrelang große Unsicherheit, denn die Verschönerung der Hautoberfläche ist seit jeher die Domäne der Kosmetik. Minimalinvasive Verfahren wie Faltenunterspritzung oder Mesotherapie befanden sich lange Zeit in einem rechtlichen Graubereich, was auch dazu führte, dass Herstellerfirmen Kosmetikerinnen ganz offiziell mit entsprechenden Produkten belieferten.
Nach mehreren Urteilen von Verwaltungsgerichten2 zur Notwendigkeit einer Heilpraktikererlaubnis für diese Tätigkeiten stellte das Oberlandesgericht Karlsruhe 2012 sinngemäß fest, dass eine erlaubnispflichtige Ausübung der Heilkunde stets dann vorliege, wenn die Tätigkeit ärztliche beziehungsweise medizinische Fachkenntnisse erfordere und die Behandlung bei generalisierender und typisierender Betrachtung gesundheitliche Schädigungen verursachen könne. Der kosmetische Zweck eines Eingriffs in den Körper schließe diese Bewertung nicht aus; ein solcher Eingriff sei der Ausübung der Heilkunde zumindest gleichzustellen (OLG Karlsruhe 17.02.2012 – 4 U 197/11). Das Injizieren der Hyaluronsäure in die Haut erfordere neben dem erforderlichen allgemeinen medizinischen Wissen für die Verabreichung von Injektionen auch zusätzliche Kenntnisse über den Aufbau und die Schichten der Haut sowie über den Verlauf von Blutgefäßen, Nervenbahnen und Muskelsträngen. Aufgrund der mit dem Eingriff verbundenen Risiken, wie beispielsweise Gefäßverschlüsse mit anschließenden Nekrosen, der Möglichkeit zu erblinden oder entzündliche Reaktionen, wurde für einen Erlaubnisvorbehalt entschieden.
Die Frage, ob es sich bei bestimmten ästhetischen Behandlungen um die Ausübung der Heilkunde handelt oder nicht, thematisiere ich an anderer Stelle nochmals, da sich der ästhetische Markt vor allem durch seine Heterogenität auszeichnet. Er gliedert sich in diverse Unterkategorien. Alle Methoden und Technologien in diesen Teilmärkten haben zwar gemeinsam, dass sie auf ein verbessertes äußeres Erscheinungsbild abzielen und in aller Regel keine medizinische Notwendigkeit für die jeweilige Behandlung besteht. Vielmehr handelt es sich um Wunschbehandlungen, die daher auch nicht von den öffentlichen Kostenträgern übernommen werden. Die zum Einsatz kommenden Produkte basieren jedoch auf unterschiedlichen Technologien, die teilweise die gleichen Indikationen bedienen. Um die Komplexität des Marktes zu erfassen, die auch rechtliche Implikationen nach sich zieht, werden folgende Segmentierungen vorgenommen:
Abb. 1: Marktsegmentierung
II. PRODUKTE
Derzeit lassen sich bei produktbezogener Marktbetrachtung verschiedene Teilmärkte definieren.
Laser und andere Geräteanwendungen (Energy based devices): Ein stark wachsender Teilmarkt sind die sogenannten »Energy based devices«. Hierunter werden in der ästhetischen Medizin alle Geräte verstanden, die sich typischen Problematiken des alternden Gesichts und Körpers beziehungsweise der Figurformung widmen. Dabei kommen neben der Lasertechnologie auch Hoch- oder Niederfrequenzgeräte, Ultraschall- und Radiowellen, Gleichstrom, physikalisches Plasma oder Kryolipolyse-Geräte zum Einsatz.
Brustimplantate und sonstige Implantate: Eine wohlgeformte Brust ist für viele Frauen ein wichtiger Aspekt ihrer Weiblichkeit. Neben den klassischen Silikon-Implantaten werden, wenn auch im geringen Umfang, nach wie vor kochsalzgefüllte Implantate eingesetzt. Moderate Brustvergrößerungen um maximal eine Körbchengröße sind durch Behandlungen mit Eigenfett oder alloplastischen Füllmaterialien (z. B. Hyaluronsäure) möglich.
Neben der Brustästhetik werden Weichteilimplantate auch für Gesichts- und Körperbehandlungen verwendet. Hierzu zählen beispielsweise Wangen- und Kinnimplantate, Po-, Waden- und Testikelimplantate sowie sogenannte »customised implants«. Letztere werden individuell für einen Patienten und dessen Behandlungswunsch angefertigt.
Füllmaterialien: Dieser Markt ist neben dem der Neuromodulatoren als einer der dominierenden Teilmärkte zu nennen. Er umfasst verschiedene Produktkategorien, die sich der Behandlung von Falten und Volumendefiziten verschrieben haben. Als Goldstandard für diese Behandlungen gilt die synthetisch hergestellte Hyaluronsäure. Diese wird mittels Bakterienfermentation im Labor produziert. Bei der weiteren Verarbeitung werden sogenannte Quervernetzer (i. d. R. Esterverbindungen) hinzugefügt, die die einzelnen Hyaluronketten mehr oder minder stark miteinander verknüpfen. Dadurch wird eine verbesserte Haltbarkeit, Hebe- und Füllkapazität des finalen Produkts erreicht. Andere Filler bestehen aus Polyamid-Gelen, Silikonen oder Acrylaten. Letztere werden mit Hyaluronsäure oder Kollagen gemischt, um die Injizierbarkeit zu verbessern.
Zieht man dagegen die Verweildauer als Differenzierungskriterium heran, unterscheidet man resorbierbare und permanente Filler. Durch moderne Vernetzungsverfahren ist die Haltbarkeit von Hyaluronsäurepräparaten bei einigen Formulierungen nach Herstellerangaben auf bis zu 24 Monate gestiegen.3 Kollagenprodukte, die heute kaum mehr zum Einsatz kommen, weisen dagegen lediglich eine Haltbarkeit zwischen vier und sechs Monaten auf.
Permanente Materialien werden nie komplett abgebaut. Dies hat in der Vergangenheit zu einer Vielzahl ernsthafter Nebenwirkungen geführt, mit denen Patienten teilweise ein Leben lang zu kämpfen haben. Aufgrund dieser Erfahrungen wurde die Verwendung permanenter Filler von den ärztlichen Fachgesellschaften nicht mehr empfohlen. Ihr Marktanteil war zumindest in Deutschland in die Bedeutungslosigkeit abgerutscht. Inzwischen ist hier eine kleine Trendumkehr zu beobachten. Zuletzt hat ein Produkt sogar die begehrte FDA-Zulassung für die Vermarktung am USamerikanischen Markt erhalten (»Bellafill«).
Kollagenstimulatoren: Lange Zeit fristeten Kollagenstimulatoren ein Schattendasein, doch dies hat sich mit dem besseren Verständnis des Alterungsprozesses drastisch verändert. Mit dem Wissen, dass der Abbau von Proteinen ein wesentlicher Aspekt des Alterungsprozesses ist, werden moderne Therapiekonzepte heute häufig mit dem Einsatz von Kollagenstimulatoren angereichert. Mit der Markteinführung von »Sculptra« wurde diese neue Kategorie an Injektionsprodukten eröffnet, die nicht als Füllmaterialien verstanden werden dürfen. Das Produkt, das auf Poly-L-Milchsäure basiert und unter dem Handelsnamen »New Fill« 2004 gelauncht wurde, hatte aufgrund diverser Nebenwirkungen und mehrmaliger Eigentümerwechsel eine schwierige Startphase. Es drohte deshalb, zumindest in Europa, wieder vom Markt zu verschwinden. Mit der Übernahme der Vertriebsrechte für Westeuropa durch das britisch-französische Pharmaunternehmen Sinclair Pharma im Jahre 2011 erlebte Sculptra eine beeindruckende Renaissance. Mithilfe einer europäischen Expertengruppe wurden neue Anwendungsempfehlungen erarbeitet und ein umfassendes Trainingsprogramm für Ärzte aufgelegt. Nach und nach konnte sich das Produkt stabil im Markt etablieren. Mit der Rückgabe der Vertriebsrechte an den Eigentümer Galderma im Februar 2020 erfolgt die weltweite Produktvermarktung nun direkt durch Galderma.
Weitere kollagenstimulierende Substanzen sind das aus der Zahnheilkunde bekannte Calcium Hydroxylapatit sowie Polycaprolacton.4 Beide Materialien werden heute unter verschiedenen Handelsnamen und mit kleinen herstellerspezifischen Abweichungen in Deutschland vertrieben.
Skinbooster und Mesotherapie Skinbooster- und Mesotherapie-Produkte werden zur Hautverjüngung in den oberflächlichen Hautschichten eingesetzt. Im Gegensatz zu den klassischen Fillern haben sie überwiegend nur eine sehr kurze Verweildauer im Gewebe und erzielen in den meisten Fällen keinerlei primären Volumeneffekt. Die verwendeten Mesotherapie-Cocktails werden unter anderem mit Mineralien, Vitaminen, Spurenelementen oder Aminosäuren angereichert. Sie dienen der Verbesserung der Hautoberfläche und -struktur. Ihre Basis bildet häufig native Hyaluronsäure. Einige Konfusion entsteht immer wieder wegen des Begriffs der Mesotherapie. Dieser wird uneinheitlich sowohl für die Form der Behandlung als auch für die in diesem Bereich angewandten Unterspritzungstechniken verwendet.
Skinbooster sind dagegen häufig, aber nicht immer niedermolekulare, nicht quervernetzte Hyaluronsäuren, die in unterschiedlichen Konzentrationen in eher oberflächliche Hautstriche gespritzt werden. Ziel der Behandlung ist es, die Oberflächenrauigkeit zu vermindern, den transepidermalen Wasserverlust zu verringern und den Feuchtigkeitshaushalt der Haut zu verbessern.5
Um diese Produktkategorie von der Mesotherapie abzugrenzen und zusätzlich einen etwas länger anhaltenden Effekt zu erzielen, sind einige Unternehmen dazu übergegangen, auch ihre Skinbooster-Produkte mit einem Quervernetzer zu versehen (z. B. Restylane Vital von Galderma). Eine längere Verweildauer der Hyaluronsäure sorgt durch die Wasserbindung des Moleküls für eine gute Durchfeuchtung der Haut. Die injizierte gelartige Hyaluronsäure dehnt das Gewebe zusätzlich mechanisch auf. Diese beiden Vorgänge sorgen offenbar für eine Aktivierung der dermalen Fibroblasten und führen damit zu einer Neokollagengenese.6
In jüngster Zeit wurden unvernetzte Mixturen für hoch- und niedermolekulare Hyaluronsäure (z. B. Profhilo) entwickelt und auf den Markt gebracht. Ihre besondere Zusammensetzung soll zusätzlich zur Kollagen- auch die Elastin-Produktion der Haut in statistisch signifikantem Ausmaß ankurbeln und die Proliferation von Adipozyten und Keratin fördern.7
Botulinum Während statische Falten und Volumendefizite mit Füllmaterialien behandelt werden, verlangen mimische Falten eine andere Herangehensweise. Mimische oder dynamische Falten entstehen durch wiederholte Muskelkontraktionen. Die alternde Haut ist aufgrund nachlassender Elastizität irgendwann nicht mehr in der Lage, in ihren Ursprungszustand zurückzukehren. Die Falte bleibt sichtbar. Als Standardtherapie haben sich hierfür Produkte auf der Basis von Botulinumtoxin A etabliert. Die Wirkung tritt einen bis sieben Tage nach der Injektionsbehandlung ein. Durch die verminderte Muskelkontraktion glättet sich die Haut im Behandlungsareal nach und nach. Bei tieferen Falten kann in einem zweiten Schritt eine zusätzliche Korrektur mit Hyaluronsäure erfolgen. Einige Botulinumpräparate sind inzwischen auch in vielen medizinischen Bereichen zugelassen. Indikationen, bei denen medizinische und ästhetische Ziele miteinander verschwimmen. Beispiele sind hierfür die Anwendung bei Hyperhidrose, Migräne und bei bestimmten Formen des Haarverlusts (»Alopecia contentionalis«).8
Fäden In jüngerer Zeit haben Behandlungen mit verschiedenen Fadenmaterialien im Gesicht und am Körper eine Renaissance erfahren. Nach desaströsen Nebenwirkungen mit permanenten Materialien wie beispielsweise Gold- und Polyethylenfäden war diese Behandlungsmethode für Jahrzehnte verpönt.9 Durch die Entwicklung resorbierbarer Fäden mit neuen Haltetechnologien hat sich das Fadenlifting von einer reinen Nischenanwendung zu einem Standardvorgehen entwickelt.10 Dabei wird der klassische Zugfaden vom reinen Gewebestimulationsfaden unterschieden. Zugfäden sind in der Lage, durch Gewebekompression eine Repositionierung von altersbedingt abgesunkenen Hautpartien zu erreichen. Dieser physikalische Liftingeffekt wird zwei bis drei Monate nach der Implantation durch einen regenerativen Effekt in Form von Kollagen- und Elastinaufbau rund um das Fadengerüst ergänzt.11
Gewebestimulationsfäden weisen keinen signifikanten Repositionierungseffekt auf. Sie dienen, ähnlich wie Mesotherapie- oder Skinbooster-Anwendungen, vor allem dazu, die Hautqualität zu verbessern.12 Die zum Einsatz kommenden Materialien für beide Fadenarten sind unter anderem Poly-L-Milchsäure, Polycaprolacton, Polydioxanone und Mischungen aus diesen Komponenten.
Peelings: Mit dem verstärkten Fokus auf hautverjüngende Maßnahmen sind professionelle Peelings in den letzten fünf bis acht Jahren wieder vermehrt in das Bewusstsein von Behandlern und Patienten gerückt. Sie stehen für verschiedene Indikationen und Anwendungstiefen zur Verfügung. Als Substanzen kommen u. a. Glykolsäure (Alpha-Hydroxysäure), Salizylsäure (Beta-Hydroxysäure), Glucono lacton, Lactobionsäure, (Poly-Hydroxysäuren) oder Trichloressigsäure zum Einsatz. Neben den in Arztpraxen verwendeten Peelings gibt es unzählige Produkte für den Einsatz in Kosmetikinstituten und im Heimbereich. Diese Märkte unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht (z. B. Kosmetik- versus Medizinprodukt) vom ärztlichen Markt, den ich hier ausschließlich betrachte.
Injektionslipolyse: Die nicht operative Entfernung von störenden Fettpölsterchen verdient ebenfalls gesonderte Erwähnung. Seit ihrer ersten Anwendung im Jahr 1988 durch den italienischen Arzt Dr. Silvio Maggiori bei Xanthelasmen ist sie als Behandlungsoption aus dem medizinischästhetischen Markt nicht mehr wegzudenken. Im Laufe der Zeit haben sich zusätzlich zum ursprünglich eingesetzten Phosphatidylcholin weitere Substanzen etabliert. Dazu gehören unter anderem Desoxycholsäure, Koffein, Artischockenextrakt, verschiedene B-Vitamine, Vitamin C oder Mischungen aus diesen Molekülen.
III. INDIKATIONEN
Altersbedingte Veränderungen des Gesichts und Körpers sind naturgemäß die vorherrschenden Indikationen in der ästhetischen Medizin. Nähert man sich von dieser Seite, lassen sich typische Behandlungswünsche der Patienten identifizieren und wie eine Schablone über die Zulassungen der bereits vorgestellten Produkte legen.
Energy based devices: Für den Bereich der Geräteanwendung lässt sich daraus nachfolgende Aufstellung generieren:
Abb. 2 Indikationen Energy based devices
Brustimplantate: Die Brustimplantate dienen im Bereich der ästhetischen Medizin in aller Regel der Vergrößerung und Formung der Brust. Im Bereich der Rekonstruktiven Chirurgie finden sie ihren Einsatzbereich z. B. beim Wiederaufbau der Brust nach Brustkrebs. Hier sind Indikationsüberschneidungen an der Tagesordnung. Behandlungen mit Gesichts- und Körperimplantaten sollen lang anhaltend Form und Volumen im jeweiligen entsprechend vorgealterten Anwendungsbereich geben.
Filler: Bei der Anwendung von Fillern haben sich die möglichen Anwendungsgebiete über die Jahre stetig weiterentwickelt. Wurden zu Beginn vor allem Falten und Fältchen unterspritzt, analysiert und behandelt man das alternde Gesicht heute kausal.13 Typische Indikationen sind:
☐ Auffüllen der Stirn und Schläfenregion
☐ Korrektur der Nase
☐ Volumenverlust Oberlid
☐ Anheben der Augenbrauen
☐ Korrektur der Tränenrinne
☐ Volumenaufbau im Mittelgesicht
☐ Korrektur der Submalaregion
☐ Füllen der Nasolabialfalten
☐ Korrektur der Lippen (Volumen, Kontur, Philtrum, Mundwinkel)
☐ Mentolabialfalten
☐ Marionettenfalten
☐ Kieferwinkel
☐ Kinn (Projektion und Dimension)
☐ Venusringe am Hals
☐ Falten im Dekolleté
☐ Volumendefizite Handrücken
Kollagenstimulatoren: Kollagenstimulatoren kommen überall dort zum Einsatz, wo sich altersbedingte oder anderweitig erworbene Volumendefizite im Gesicht, am Hals, Dekolleté oder an den Handrücken zeigen. Teilweise werden die Produkte verdünnt gespritzt, um Anwendungen auch in Arealen mit dünner Haut und wenig subkutanem Gewebe durchführen zu können.14
Mesotherapie-Produkte und Skinbooster: Typische Indikationen für Skinbooster- und Mesotherapie-Behandlungen sind trockene Haut, Sonnenschäden, feine Fältchen, Elastizitätsverlust und Strukturdefizite. Meso-Cocktails werden aber auch für Narben-, Problemhaut- oder Haarwachstumsbehandlungen eingesetzt.15
Botulinumtoxin: Seit seinem ersten Einsatz in der Glabellafalte in den 1990er-Jahren hat Botulinumtoxin eine breite Anwendung in der ästhetischen Medizin gefunden.16 Die FDA-Zulassung für die kosmetische Behandlung der Glabellafalte erfolgte 2002.17 Behandelt werden heute unter anderem Stirnquerfalten, Krähenfüße, Bunny Lines, Gummy Smile, Pliseefältchen, Mundwinkel, Masseter und auch das Platysma.18 Immer mehr Patienten wünschen sich zudem in den Sommermonaten eine »ästhetische« Schweißdrüsenbehandlung, um sichtbare Flecken bei leichter Bekleidung zu vermeiden.
Fäden: Einsatzbereiche für die Zugfäden sind das Mittelgesicht, die Kinnkontur oder der Hals. Auch das Anheben der Augenbrauen ist im begrenzten Umfang möglich. Die Fäden zur Gewebestimulation zielen eher auf den Aufbau von Kollagen und Elastin ab. Sie führen zu einer leichten Straffung und können demzufolge auch zur Behandlung von Falten (siehe Indikationen Filler), Dellen nach Liposuktion oder bei Cellulite zum Einsatz kommen. Selbstverständlich lassen sich Zugfäden und Gewebestimulationsfäden auch kombiniert verwenden.
Peelings: Durch Peelings wird ein Teil der Oberhaut (Epidermis) und beim tiefen Chemical Peeling auch der Unterhaut (Corium) entfernt, um alters- oder lichtgeschädigte Zellen zu entfernen. Dadurch wird die Hautstruktur verfeinert und Mitesser, Akne, sonnengeschädigte Haut, Fältchen, Narben oder große Poren können behandelt werden.
Injektionslipolyse: Die Injektionslipolyse kann sowohl am Körper als auch im Gesicht gegen unerwünschte Fettpölsterchen zum Einsatz kommen. Nach allgemeiner Auffassung sollte nur der Augenbereich ausgespart werden. Häufige Nachfragen betreffen die Submental-Region, die Hängebäckchen, Oberarme, Bauch, Reiterhosen, die Innenseite der Oberschenkel, die Hüften oder auch den Übergang vom Gesäß zum Oberschenkel.
IV. INVASIVITÄT
Betrachtet man die vorgestellten Verfahren und Produkte nach dem Kriterium der Invasivität, lassen sich folgende Unterscheidungen vornehmen:
Non-invasiv: z. B. transdermale Applikation von Wirkstoffen ▪ Minimalinvasiv: z. B. Injektionsbehandlungen, Fäden, Microneedling
Invasiv: z. B. operative Fettabsaugung oder Brustvergrößerung mit Implantaten
Ein wichtiger Trend in der ästhetischen Medizin geht seit Jahren weg von operativen Eingriffen hin zu sanften Methoden mit wenig Traumatisierung, Schmerz und Ausfallzeit.19 Zudem haben viele Patienten Angst, dass ein operativer Eingriff eine zu drastische Veränderung bedeutet, die vielleicht von der Umwelt nicht akzeptiert würde. Denn noch immer ist eine ästhetische Behandlung ein Thema, das nicht jeder Patient offen mit seinem sozialen Umfeld diskutieren möchte. Kleinere Eingriffe, die über einen längeren Zeitraum kontinuierliche Veränderungen nach sich ziehen, erfreuen sich daher nach wie vor steigender Beliebtheit. Dies ermöglicht den Patienten zudem, in aller Regel direkt nach der Behandlung wieder in den Alltag zurückzukehren. Für die rechtliche Betrachtung der verschiedenen eingesetzten Produkte und ihrer Anwender sind alle vorgenannten Aspekte von Bedeutung. Zunächst ist zu klären, um welches Produkt es sich handelt, z. B. um ein Kosmetikum, ein Medizinprodukt oder ein Arzneimittel. Dann stellt sich die Frage nach den rechtlichen Anforderungen, die mit der Zugehörigkeit zu einer dieser Produktgruppen verbunden sind. Zu denken ist hier an Notifizierungen, die CE-Kennzeichnung oder die Arzneimittelzulassung, aber auch an Kennzeichnungspflichten, notwendige Studiendaten, Anmerkungen zu möglichen Vertriebswegen und Anforderungen an die Ausbildung der vorgesehenen Anwender, um nur einige zu nennen. Geht es um die Indikation selbst, stellt sich die Frage, ob das Produkt dafür überhaupt angewendet werden darf, welche Risiken eine Anwendung ohne entsprechende Zulassung für den Anwender und für den Patienten birgt und beispielsweise auch, wie und ob diese Indikationen beworben werden. Last, but not least spielt auch der Grad der Invasivität der Anwendungen eine wichtige Rolle. Neben der Frage, wer invasiv arbeiten darf, ist beispielsweise auch zu klären, welche Anforderungen an Aufklärung, Wartezeiten, Räumlichkeiten und Aus- oder Fortbildung des Behandlers zu stellen sind.
V. AKTEURE
Das Feld der ästhetischen Medizin ist ein attraktiver Markt, der seit Jahrzehnten mit zweistelligen Zuwachsraten lockt. Das zieht sowohl Unternehmen aus dem ethischen Medizinmarkt als auch Behandler jeder medizinischen Fachrichtung an. In der ästhetischen Medizin gibt es weder ein AMNOG20 noch Budgets der gesetzlichen Krankenkassen oder Preisvorgaben. Der Wettbewerb und die eigene Marketing-, Produkt- oder Behandlungsleistung bestimmen über den Erfolg der Akteure.
Auf der Seite der Produktanbieter finden sich viele verschiedene Konstellationen. Da sind zunächst die Arzneimittel- und Medizinproduktehersteller, die nach eigenen Rezepturen Produkte für die ästhetische Medizin herstellen und vermarkten. Für den Vertrieb der Produkte bedienen sie sich unterschiedlicher Konzepte. Entweder besucht der eigene, geschulte Außendienst als Pharmareferent oder Medizinprodukteberater die Ärzte oder der Vertrieb wird über Partnerfirmen (Distributoren) organisiert. Welche Rechte und Pflichten mit diesen Rollen einhergehen, werde ich ausführlich beleuchten.
Weiterhin spielen Groß- und Zwischenhändler sowie Importeure eine Rolle, auch wenn diese beiden Gruppen in der Regel keine eigenen Produkte herstellen. Hier ergeben sich für alle Marktteilnehmer aufgrund der seit 26.05.2017 europaweit geltenden Medizinprodukteverordnung neue Verpflichtungen, die in einem der folgenden Kapitel ausführlich dargestellt werden.
Die Apotheken sind im Hinblick auf ihr Dispensierrecht für apotheken- und verschreibungspflichtige Arzneimittel zu nennen. Trotz anderweitiger Bestrebungen, die ich ebenfalls im Verlauf thematisieren werde, gibt es in der ästhetischen Medizin derzeit keine verschreibungspflichtigen Medizinprodukte. Die Tätigkeit der Apotheken fällt, soweit es Medizinprodukte betrifft, daher vor allem in den Bereich des Großhandels.
Einige Hersteller bieten zudem Fremdfirmen die Möglichkeit, sogenannte Private-Label-Produkte herzustellen. Diese Produkte entsprechen in ihrer Zusammensetzung häufig, aber nicht immer den bereits auf dem Markt befindlichen Originalprodukten. Sie kommen im Falle des Private Labels oder White Labels aber mit einem neuen Namen und einer anderen Verpackung in den Vertrieb und werden in aller Regel von einem Dritten angeboten. Mit Inkrafttreten der MP-VO haben sich auch hierfür rechtliche Änderungen ergeben.
Betrachtet man die Anwenderseite, so findet sich auf dem deutschen Markt ein interessanter Mix aus verschiedenen medizinischen Fachbereichen. Neben den eher originär auf ästhetische Behandlungen ausgerichteten Fachärzten für plastische und ästhetische Chirurgie und den Fachärzten für Haut- und Geschlechtskrankheiten finden sich Allgemeinmediziner, Gynäkologen, Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, Chirurgen, Anästhesisten, Orthopäden, Zahnärzte, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen, Internisten, Neurologen und viele Fachrichtungen mehr. Auch Heilpraktiker (Nicht-Ärzte) haben die ästhetische Medizin als Tätigkeitsfeld für sich entdeckt und bieten entsprechende Behandlungen an. Welche Fachgruppe welche Behandlungen in welchem Setting durchführen darf, werde ich im Fortgang aufzeigen.
Abb. 3: Anwender in der ästhetischen Medizin
VI. MARKTENTWICKLUNG
Der Markt für die ästhetische Medizin hat sich als wachstumsstark und nahezu krisensicher erwiesen. Gern wird der sogenannte Lipstick-Effekt angeführt, der nichts anderes besagt, als dass gerade in Zeiten ökonomischer Krisen die Absatzzahlen für Schönheitsprodukte steigen.21 Laut einer Untersuchung des VKE – Verband der Vertriebsfirmen kosmetischer Erzeugnisse e. V. – legte in der weltweiten Finanzkrise 2008/2009 die dekorative Kosmetik um acht Prozent zu, allen voran der Lippenstift.22 Diese psychologische Erkenntnis aus dem kosmetischen Segment kann zu einem gewissen Grad auch auf den Markt für ästhetische Medizin übertragen werden.
Die genaue Größe lässt sich allerdings nur schätzen, da keine unabhängigen und alle Teilmärkte umfassenden Marktdaten zur Verfügung stehen.
Energy based devices: Der Gerätemarkt ist beispielsweise stark innovationsgetrieben und profitierte im letzten Jahrzehnt vor allem von Technologien und Verfahren, die operative Eingriffe bis zu einem gewissen Grad ersetzen können. Nicht-invasive Fettreduktion, z. B. durch Kälte- oder Hitzeanwendungen, Geräte zur Muskelstimulation und zum Fettabbau sowie Hochleistungslaser zur Tattooentfernung haben das Marktwachstum enorm vorangetrieben.23
Dabei waren die Geräteanwendungen auf dem deutschen Markt bisher generell wenig reguliert. So konnten auch Laien z. B. ästhetisch orientierte Laserbehandlungen durchführen, ohne eine medizinische Ausbildung nachweisen zu müssen. Mit den neuen Vorgaben aus der Verordnung zum Schutz vor schädlichen Wirkungen nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen (NiSV) hat sich das geändert. Die NiSV regelt dabei ausschließlich den gewerblichen Betrieb und die kosmetischen Anwendungen mit Geräten, die nichtionisierende Strahlung emittieren.
Brustimplantate: Brustimplantate haben dank des Skandals um die sogenannten PIP-Implantate des französischen Unternehmens Poly Implant Prothése S.A. (PIP), ansässig in La Seyne-sur-Mer bei Toulon, traurige Berühmtheit erlangt. Um die Herstellungskosten niedrig zu halten, hatte das Unternehmen seine Produkte mit billigem Industriesilikon statt mit Medical-grade-Silikon gefüllt. Die reißanfälligen Implantate könnten nach Schätzungen weltweit bei Hunderttausenden Frauen eingesetzt worden sein und zu schwersten Komplikationen führen, wenn das Industriesilikon in das umliegende Gewebe austritt. In einem langwierigen Rechtsstreit, der sogar den Europäischen Gerichtshof erreichte, wurden die Pflichten der sogenannten »Benannten Stellen«, die das Qualitätssystem der Hersteller von Medizinprodukten überwachen, eingehend geprüft. Die Dimension des Skandals hatte damals sowohl die inhaltliche Ausgestaltung als auch die Geschwindigkeit, mit der die Medizinprodukteverordnung schließlich verabschiedet wurde, stark beeinflusst. Neben den Fragen zu Aufgaben, Haftung und Prüfpflichten der »Benannten Stellen« nach den neuen MP-VO-Vorgaben werden auch die Dokumentationspflichten bei Brustimplantaten besprochen. Bei den bereits angesprochenen patientenindividuellen Implantaten stellen sich unter anderem Fragen zur CE-Kennzeichnung von Einzelanfertigungen.
Die globale Marktgröße für Brustimplantate wurde 2021 auf 1.157,36 Milliarden USD berechnet, wobei im Prognosezeitraum (2023–2030) eine CAGR von 13,3 Prozent verzeichnet wurde. Der Markt wird bis 2030 voraussichtlich einen Wert von 3.142,73 Milliarden USD erreichen.24
Filler: Der globale Filler-Markt wird sich zwischen 2022 und 2030 voraussichtlich verdoppeln.25 Filler, bis auf solche, die Kollagen enthalten, sind als Medizinprodukte der Klasse III reguliert und gehören damit ebenso wie Brustimplantate oder Herzschrittmacher zur höchsten Risikoklasse im Medizinprodukterecht. Die neue Medizinprodukteverordnung hat nicht nur die Anforderungen an Studiendaten und Produktnachverfolgung erhöht, sondern sieht erstmals überhaupt Regelungen für medizinischästhetische Produkte vor.
Botulinumtoxin: Der weltweite Markt für Botulinumtoxin wird voraussichtlich von 7,49 Milliarden USD im Jahr 2023 auf 10,62 Milliarden USD im Jahr 2030 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,1 Prozent im Prognosezeitraum entspricht.26
Botulinumtoxin ist ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel, das daher in Deutschland nur über Apotheken abgegeben werden darf. Auf dem deutschen Filler-Markt tummeln sich etwa 70 verschiedene Anbieter aus vielen unterschiedlichen europäischen und außereuropäischen Ländern. Demgegenüber ist der Markt für Botulinumtoxin sehr viel übersichtlicher, gerade einmal sechs Anbieter vermarkten aktuell in der ästhetischen Medizin Botulinumtoxinprodukte auf dem deutschen Markt. Interessante rechtliche Fragen befassen sich bei dieser Produktkategorie mit Off-Label-Anwendungen und dem berechtigten Anwenderkreis.
Fäden: Fadenbehandlungen gehören noch nicht in allen medizinisch-ästhetisch ausgerichteten Praxen zum Standardangebot. Der Markt für Lifting- und Gewebestimulationsfäden hat ein großes Wachstumspotenzial.27 Zug- und Gewebestimulationsfäden werden aus unterschiedlichen Materialien hergestellt. Traditionell kommt ein Großteil der Fadenprodukte aus dem asiatischen Raum, hier vor allem aus Korea und China, nach Europa. Dies ist rechtlich nicht unkritisch, denn für einen rechtskonformen Vertrieb außereuropäischer Produkte in der Europäischen Union gibt es einige Vorgaben zu beachten.
Injektionslipolyse: Die Injektionslipolyse ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil im minimalinvasiven Armamentarium vieler medizinisch-ästhetisch tätiger Behandler. Umso erstaunlicher ist es, dass hier noch weniger Marktdaten vorliegen als zu den anderen bereits vorgestellten Produkten und Verfahren. Das Netzwerk Global Health, ein in Deutschland ansässiger, weltweit tätiger Ärzteverband, hat sich bereits 2003 mit der Injektionslipolyse befasst. Aus dem großen Interesse vieler Ärzte, sich in der Technik der Injektionslipolyse ausbilden zu lassen, entstand das Netzwerk Lipolyse. In den ersten Jahren wurden Therapie- und Ausbildungsstandards für Lipolyseanwendungen entwickelt, weltweit Workshops abgehalten und Forschungskooperationen mit Universitäten initiiert. Mitgliederbefragungen des Netzwerks zeigen das exponentielle Wachstum dieser Therapieform. Wurden 2004 nur 183 Patienten mittels Lipolyse behandelt, waren es 2011 schon 13.600 Patienten und 2015 74.000 Behandlungen.28 Zwar bilden diese Zahlen nur die Behandlungen der Netzwerkmitglieder ab und nicht den Gesamtmarkt, sie vermitteln jedoch die Beliebtheit der Anwendung und lassen Rückschlüsse auf das Potenzial und das Wachstum dieses medizinisch-ästhetischen Teilmarkts zu. Rechtliche Aspekte zur Injektionslipolyse befassen sich sowohl mit Abgrenzungsfragen zwischen Arzneimittel und Medizinprodukterecht, der Herstellung beziehungsweise Zulassung solcher Produkte als auch der Patientenaufklärung.
B. RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN
Die ästhetische Medizin ist durch ein Geflecht von ineinandergreifenden europäischen und deutschen Gesetzen und Verordnungen geregelt. Es gibt einerseits Gesetze, die bestimmte Produktkategorien regeln, wie z. B. Arzneimittel, Medizinprodukte, Kosmetika oder Nahrungsergänzungsmittel. Andererseits existieren Vorschriften, die bestimmte Anwendungen regeln wie z. B. den Einsatz von Geräten, die nichtionisierende Strahlung emittieren. Flankiert werden diese Vorschriften durch die Marktverhaltensregeln des Heilmittelwerbe- und Antikorruptionsrechts, Berufsordnungen, Datenschutzbestimmungen und das Patientenrechtegesetz.
I. ARZNEIMITTELRECHT
Das deutsche Arzneimittelrecht, wie wir es heute kennen, verdankt sein Vorhandensein u. a. einem aufsehenerregenden Arzneimittelskandal. In den Jahren 1961 bis 1962 wurde der sogenannte Contergan-Skandal aufgedeckt. Das Medikament Contergan war ein zunächst rezeptfrei erhältliches und millionenfach verkauftes Beruhigungsmittel, das unter anderem Thalidomid enthielt. Es wurde Schwangeren gezielt zur Linderung der typischen Morgenübelkeit, aber auch als Beruhigungs- und Schlafmittel empfohlen und galt als besonders sicher und nebenwirkungsarm. Das Pharmaunternehmen Grünenthal GmbH in Stolberg bestritt zunächst die Zusammenhänge zwischen Contergan und den schweren Missbildungen bei Neugeborenen. Dabei handelte es sich um Fehlbildungen von Gliedmaßen oder das komplette Fehlen von Gliedmaßen und Organen. Ärzte und Öffentlichkeit vermuteten einen Zusammenhang zwischen den damals durchgeführten Kernwaffentests und den Fehlbildungen, auch aufgrund mangelnder Datentransparenz und Koordination der Behörden. Schließlich berichteten 1961 der deutsche Arzt Widukind Lenz und der australische Gynäkologe William McBride erstmals unabhängig voneinander über beobachtete Zusammenhänge zwischen der Conterganeinnahme durch die Mutter und entsprechenden Fehlbildungen beim Neugeborenen.29 Daraufhin wurde der Skandal Schritt für Schritt aufgeklärt und das Arzneimittelrecht nicht nur in Deutschland reformiert. Bis 1961 gab es in Deutschland nämlich kein eigenes Arzneimittelgesetz, sondern Teile des Arzneimittelrechts waren in vielen verschiedenen Gesetzen und Verordnungen geregelt.30 Bis dahin musste der pharmazeutische Unternehmer nur die Unbedenklichkeit der Produkte und den Herstellprozess nachweisen. Mit dem 1978 in Kraft getretenen neuen Arzneimittelgesetz wurde insbesondere ein Zulassungssystem eingeführt, das strenge Anforderungen an den Nachweis über Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit von Arzneimitteln stellt. Außerdem wurden Schutzvorschriften für klinische Arzneimittelstudien erlassen und die Haftung der pharmazeutischen Unternehmen verschärft.31 Westdeutschland etablierte im Jahr 1962 zudem als letztes EWG-Land das Bundesministerium für Gesundheit.
Das Gesetz gewährte allen Medikamenten, die schon auf dem Markt waren, eine Übergangsfrist bis zum Jahr 2005, um ihre Wirksamkeit und Unbedenklichkeit nachzuweisen. Für viele Mittel war dieser Nachweis nicht möglich, für zahlreiche kleinere Pharmaunternehmen zu aufwendig. Tausende Präparate verschwanden vom Markt.
1. ARZNEIMITTELGESETZ (AMG)
Das Arzneimittelgesetz ist die rechtliche Grundlage für die Herstellung, die Zulassung und den Handel mit Arzneimitteln in Deutschland. Außerdem regelt es Fragen der Pharmakovigilanz und die rechtlichen Rahmenbedingungen für klinische Prüfungen. Seit dem 16.08.2019 enthält es durch das Inkrafttreten des Gesetzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) Regelungen, die die Herstellung verschreibungspflichtiger Arzneimittel in der Praxis neu definieren. Dies hat auch Einfluss auf ästhetische Behandlungen, wie ich später noch zeigen werde.
Das deutsche Arzneimittelrecht spiegelt bis auf wenige länderspezifische Ausnahmen das europäische Arzneimittelrecht wider. Die europäische Richtlinie 2001/83/EG (Human-Kodex) wurde vom deutschen Gesetzgeber folgerichtig im AMG umgesetzt.
2. ARZNEIMITTELDEFINITIONEN
Die Kategorisierung eines Produkts als Arzneimittel beinhaltet eine Vielzahl rechtlicher Implikationen. Der Eröffnung des Anwendungsbereichs des Arzneimittelgesetzes folgen kosten- und zeitintensive Prozesse im Bereich der klinischen Prüfungen sowie Zulassungs-, Überwachungs- und Strafvorschriften, die der pharmazeutische Unternehmer über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg berücksichtigen muss. Die Frage der Produkteinordnung hat zudem Auswirkungen auf Preisgestaltung, Bewerbung, Erstattungsfähigkeit und Produkthaftung.32 Nicht zuletzt diese Aspekte dürften auch den ein oder anderen Hersteller von medizinisch-ästhetischen Produkten veranlassen, genauer über die regulatorische Bewertung seiner Waren nachzudenken. Das Arzneimittelgesetz kennt im Wesentlichen zwei Arzneimittelbegriffe, die hier für das weitere Verständnis vorab erläutert werden.
a. Präsentationsarzneimittel
In § 2 Abs. 1 Nr. 1 AMG wird der Begriff des Präsentations- oder Bezeichnungsarzneimittels definiert. Danach sind Arzneimittel Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen, die zur Anwendung im oder am menschlichen Körper […] und als Mittel mit Eigenschaften zur Heilung oder Linderung oder zur Verhütung menschlicher […] oder krankhafter Beschwerden bestimmt sind. Erfasst werden Arzneimittel nach der Funktion genauso wie Arzneimittel, die aufgrund ihrer Bewerbung und Präsentation beim verständigen, durchschnittlich informierten und aufmerksamen Verbraucher schlüssig oder konkludent den Eindruck eines Arzneimittels erwecken.33





























