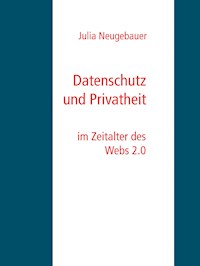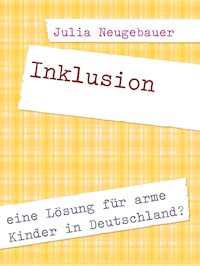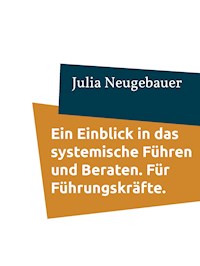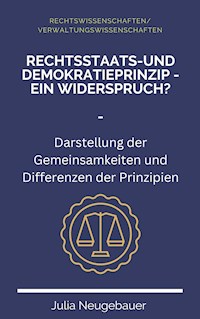
35,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Insbesondere in der Corona-Krise ab dem Jahre 2020 wurden erstmalig Freiheitseingriffe in die Grundrechte sichtbar und die Einschränkungen diese wurde teilweise als "dramatisch" beschrieben. Es wurden Lockdowns, Ausgangssperren, Maskenpflichten, Berufsausübungsverbote verhängt und die gesellschaftlichen wie auch kulturellen Handlungsfähigkeiten der Bevölkerung beschränkt. Voßkuhle spricht in diesem Zusammenhang von einem "Stresstest" (Voßkuhle 2020, S. XIX) für den Grundrechtsteil (vgl. ebd.). Verschwörungstheoretiker, Maßnahmengegner und so genannte Querdenker sahen durch die Grundrechtsbeschränkungen sowie Aufhebungen dieser und somit durch staatliches Handeln die Demokratie in der Corona-Krise gefährdet. In diesem Kontext gilt zu hinterfragen, weshalb es dem Staat in einigen Fällen möglich ist, rechtsstaatlich einzugreifen und Grundgesetze auf Zeit einzuschränken. Somit wurden beispielsweise während der Corona-Krise die Versammlungsfreiheit der Demonstrationen von Anti-Coronamaßnahmen-Gegner durch Verstöße aufgelöst oder die Freiheitsrechte durch Ausgangssperren bezüglich des Infektionsschutzgesetzes beschränkt. Aber auch weitere gewalttätige Versammlungen können beispielsweise durch Polizei und Staat aufgelöst werden. Hinsichtlich des Ukrainekonflikts demonstrierte im Frühjahr 2022 in Berlin ein Autokorso gegen die angebliche Diskriminierung russischsprachiger Menschen und verwendete dabei rechtswidrige Zeichen, wie ein Z, das für den Angriffskrieg Russlands steht. Weshalb ist es erlaubt und notwendig in diesem Fall strafrechtlich und als Staat einzugreifen, ein Strafverfahren einzuleiten und einen Platzverweis auszusprechen und weshalb wurde dennoch die Versammlung nicht vollständig aufgelöst oder verboten (vgl. Koall 2022)? Weshalb sind solche Eingriffe bezüglich des Rechtsstaates in der heutigen Zeit noch möglich und weshalb sind die Befürchtungen einer Ent-Demokratisierung unbegründet? Die Befürchtungen der Skeptiker, Verschwörungstheoretiker und Maßnahmengegner hinsichtlich der Coronaproblematik sollen mittels der Analyse hinterfragt werden. Sicherlich gilt es die staatlichen Eingriffe stets kritisch zu hinterfragen und einige Grundrechtsbeschränkungen wurden zudem vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe aufgelöst. Es wird den Fragen nachgegangen, ob Schnittpunkte zwischen den Prinzipien vorhanden sind, welches Verhältnis zwischen diesen beiden bestehen sollte, ob die Prinzipien miteinander konkurrieren oder sich ausschließen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 47
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Rechtsstaats- und Demokratieprinzip - ein Widerspruch
Rechtsstaats- und Demokratieprinzip - ein WiderspruchInhaltsverzeichnisAbkürzungsverzeichnis1. Einleitung2. Darstellung der zwei Prinzipien2.1. Demokratieprinzip2.2. Rechtsstaatsprinzip3. Darlegung und Vergleich der Prinzipien4. Fazit5. LiteraturverzeichnisImpressumRechtsstaats- und Demokratieprinzip - ein Widerspruch
Julia Neugebauer M.A.; Mag. rer. publ.
Rechtsstaats- und Demokratieprinzip - ein Widerspruch?
-
Darstellung der Gemeinsamkeiten und Differenzen der Prinzipien
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Darstellung der zwei Prinzipien
2.1. Demokratieprinzip
2.1.1. Versuch einer Definition der Begrifflichkeit Demokratie
2.1.2. Legitimationskette
2.1.3. Wesentlichkeitstheorie
2.1.4. Mittelbare, parlamentarische und repräsentative Demokratie
2.1.5. Direkte Volksabstimmung
2.1.6. Weisungsgebundenheit
2.1.7. Wahlen
2.1.8. Parteidemokratie, Parteifreiheit und Parteifinanzierung
2.1.9. Mehrheitsprinzip und Minderheitenschutz
2.1.10. Mehrparteiensystem
2.1.11. Grundrechte
2.2. Rechtsstaatsprinzip
2.2.1. Definition von Recht
2.2.2. Rechtsgebundenheit der Rechtsprechung
2.2.3. Gewaltenteilung
2.2.4. Unabhängigkeit der Richter
2.2.5. Normenpyramide
2.2.6. Vorrang und Vorbehalt sowie Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
2.2.7. Parlamentsvorbehalt, Gesetzesvorbehalt und Wesentlichkeitstheorie
2.2.8. Länder
2.2.9. Rechtswegegarantie, Rechtsschutz und Rechtssicherheit inklusive Rückwirkungsverbot
2.2.10. Verhältnismäßigkeitsprinzip
2.2.11. Materielle Gerechtigkeit
3. Darlegung und Vergleich der Prinzipien
4. Fazit
5. Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
ABS. Absatz
ART. Artikel
GG Grundgesetz
D.h. Das heißt
ETC. Et cetera
1. Einleitung
Insbesondere in der Corona-Krise ab dem Jahre 2020 wurden erstmalig Freiheitseingriffe in die Grundrechte sichtbar und die Einschränkungen diese wurde teilweise als "dramatisch" beschrieben. Es wurden Lockdowns, Ausgangssperren, Maskenpflichten, Berufsausübungsverbote verhängt und die gesellschaftlichen wie auch kulturellen Handlungsfähigkeiten der Bevölkerung beschränkt. Voßkuhle spricht in diesem Zusammenhang von einem "Stresstest" (Voßkuhle 2020, S. XIX) für den Grundrechtsteil (vgl. ebd.). Verschwörungstheoretiker, Maßnahmengegner und so genannte Querdenker sahen durch die Grundrechtsbeschränkungen sowie Aufhebungen dieser und somit durch staatliches Handeln die Demokratie in der Corona-Krise gefährdet.
In diesem Kontext gilt zu hinterfragen, weshalb es dem Staat in einigen Fällen möglich ist, rechtsstaatlich einzugreifen und Grundgesetze auf Zeit einzuschränken. Somit wurden beispielsweise während der Corona-Krise die Versammlungsfreiheit der Demonstrationen von Anti-Coronamaßnahmen-Gegner durch Verstöße aufgelöst oder die Freiheitsrechte durch Ausgangssperren bezüglich des Infektionsschutzgesetzes beschränkt. Aber auch weitere gewalttätige Versammlungen können beispielsweise durch Polizei und Staat aufgelöst werden. Hinsichtlich des Ukrainekonflikts demonstrierte im Frühjahr 2022 in Berlin ein Autokorso gegen die angebliche Diskriminierung russischsprachiger Menschen und verwendete dabei rechtswidrige Zeichen, wie ein Z, das für den Angriffskrieg Russlands steht. Weshalb ist es erlaubt und notwendig in diesem Fall strafrechtlich und als Staat einzugreifen, ein Strafverfahren einzuleiten und einen Platzverweis auszusprechen und weshalb wurde dennoch die Versammlung nicht vollständig aufgelöst oder verboten (vgl. Koall 2022)? Weshalb sind solche Eingriffe bezüglich des Rechtsstaates in der heutigen Zeit noch möglich und weshalb sind die Befürchtungen einer Ent-Demokratisierung unbegründet? Die Befürchtungen der Skeptiker, Verschwörungstheoretiker und Maßnahmengegner hinsichtlich der Coronaproblematik sollen mittels der Analyse hinterfragt werden. Sicherlich gilt es die staatlichen Eingriffe stets kritisch zu hinterfragen und einige Grundrechtsbeschränkungen wurden zudem vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe aufgelöst. Dennoch sollte in dieser Arbeit nicht die einzelnen Eingriffe hinsichtlich der Coronaproblematik eingegangen, untersucht und dargestellt werden, sondern vielmehr geklärt werden, weshalb und in welcher Form Eingriffe möglich sind und wie diese mit der Staatsform Demokratie zusammenhängen können.
Da hierbei das rechtsstaatliche Agieren und demokratische Werte im Fokus stehen, gilt klarzustellen, was eigentlich unter Demokratie und unter rechtsstaatlichem Handeln zu verstehen ist. Hierbei werden die Prinzipien, wie Demokratieprinzip und Rechtsstaatsprinzip untersucht, näher beleuchtet und dargestellt. Es wird den Fragen nachgegangen, ob Schnittpunkte zwischen den Prinzipien vorhanden sind, welches Verhältnis zwischen diesen beiden bestehen sollte, ob die Prinzipien miteinander konkurrieren oder sich ausschließen und weshalb diese gleichermaßen wichtig sein sollten. Um den Fragestellungen nachzugehen, erscheint es zunächst als sinnvoll die zwei Prinzipien mit ihren Eigenschaften und Ausprägungen ausgiebig und detailliert darzustellen. Anschließend werden diese miteinander verglichen und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet. Darüber hinaus werden Staatsformen weiterer Länder und deren Gegebenheiten mit dem Idealtyp der Prinzipien näher beleuchtet. Im Fazit werden die Ergebnisse zusammengefasst und offene, ungeklärte Gegebenheiten und Verbesserungen hinsichtlich staatlichen Agierens aufgezeigt.
2. Darstellung der zwei Prinzipien
2.1 Demokratieprinzip
2.1.1. Versuch einer Definition der Begrifflichkeit Demokratie
Hinsichtlich des Demokratiebegriffs seien mannigfaltige inkorrekte sowie umstrittene Auslegungen und Fehleinschätzungen und sowohl eine vielseitige Einsetzung der Begrifflichkeiten Demokratisierung und Demokratie vorhanden (vgl. Denninger, zit. n. Battis; Gusy 2017, S. 44; vgl. Detterbeck 2018, S. 19). "Denn die Grenze zwischen unzweifelhaftem verfassungsrechtlichen Gebot und verfassungspolitischem Wunsch ist in vielen Fällen fließend, insbesondere, wenn man das Demokratieprinzip als ein teilweise noch der Verwirklichung harrendes Verfassungsziel versteht" (vgl. Battis; Gusy 2017, S. 44). Eine freiheitliche demokratische Grundordnung werde durch basale materielle Rechtspositionen, wie beispielsweise die Menschenwürde, das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit sowie durch fundamentale Richtlinien der Organisation des Staates, wie Demokratie, Unabhängigkeit der Richter und Rechtsstaatsprinzip gestaltet (vgl. Detterbeck 2018, S. 26). Übersetzt aus dem Griechischen heiße Demokratie Herrschaft des Volkes (vgl. Battis; Gusy 2017, S. 44) und in Art. 20 I GG ist im Grundgesetz festgelegt, dass die Bundesrepublik ein demokratischer Bundesstaat sei (vgl. Detterbeck 2018, S. 19).
Grundlegend für die Demokratie und das Demokratieprinzip sei die Volkssouveränität als Staatsform, die im Artikel 20 Absatz II GG erwähnt wird und dadurch determiniert ist, dass die Staatsgewalt durch das Volk unmittelbar durch Wahlen und Abstimmungen bestimmt wird (vgl. Art. 20 II 2, 1. Art. GG; vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2021; vgl. Iurratio 2021; vgl. Grote 2009, S. 9; Hofmann 2008, S. 4-7; vgl. Badura 2018, S. 5f; vgl. Detterbeck 2020, S. XVI; vgl. Battis; Gusy 2017, S. 50: vgl. Detterbeck 2018, S. 19) und das Staatsvolk Träger und Subjekt der Staatsgewalt sei (vgl. Badura 2018, S. 6). "Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus" (Art. 20 Abs. II Satz 1 GG).
2.1.2. Legitimationskette
Hierbei ist insbesondere ein rückführbarer und vollständiger Prozess ausgehend vom Wille des Volkes aus, das als ununterbrochene Legitimationskette benannt ist, zu beachten (vgl. auch Detterbeck 2020, S. XVI; vgl. Detterbeck 2018, S. 19). Dieser Prozess sollte Personalentscheidungen sowie Ernennungen betreffen und den Faktor von unten nach oben wahren (vgl. lurratio 2018). Hinzuzufügen sei in diesem Kontext, dass für die Legitimität das Prinzip der Volkssouveränität und des Verfassungsstaates Basis sei (vgl. Badura 2018, S. 16). Hinsichtlich der Rechtssprechung gilt eine einschränkungsfreie Bindung an das Gesetz, das für die Legitimation der Demokratie Prämisse sei (vgl. Detterbeck 2020, S. XVI; Art. 97 I GG).