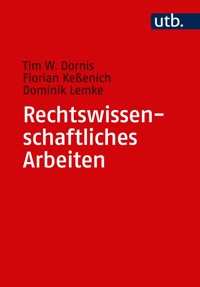
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Verlässlicher Leitfaden für rechtswissenschaftliches Arbeiten Das Lehrbuch vermittelt Studierenden juristischer Studiengänge die Grundregeln rechtswissenschaftlichen Arbeitens und den Umgang mit Quellen aller Literaturgattungen der Rechtsprechung und der Gesetzgebung. Es werden die Herangehensweise an juristische Fallfragen, die effiziente Recherche sowie der sichere Umgang mit Stil und Sprache behandelt. Besonderes Gewicht liegt auf der Vermittlung der Grundlagen wissenschaftlich korrekter Arbeit, vor allem zur Vermeidung von Plagiaten. Mit seinen zahlreichen Beispielen und Mustern, die dank der übersichtlichen Struktur schnell auffindbar sind, sowie einer vollständigen Muster-Hausarbeit dient dieser Leitfaden auch als Nachschlagewerk in Einzelfragen. Ein Leitfaden bei der Erstellung rechtswissenschaftlicher Arbeiten: Anhand zahlreicher Beispiele werden die Herangehensweise an juristische Fallfragen, die Recherche, die Zitierregeln, der Stil und die Sprache sowie die Remonstration erläutert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Tim W. Dornis / Florian Keßenich / Dominik Lemke
Rechtswissenschaftliches Arbeiten
Ein Leitfaden für Form, Methode und Inhalt zivilrechtlicher Studienarbeiten
Mohr Siebeck GmbH & Co. KG
Inhaltsverzeichnis
|V|Vorwort
Die Idee zu diesem Buch entstand aus der Erfahrung mit den zivilrechtlichen Übungen und Methodenkursen im Studiengang Rechtswissenschaft an der Leuphana Law School. Wie an jeder juristischen Fakultät und in allen juristischen Studiengängen stellen Prüfungsleistungen in Form von Haus- und Studienarbeiten die Studierenden immer vor besondere Herausforderungen. Eines der Ziele jeder Lehrveranstaltung, in der eine Haus- oder Studienarbeit zu erstellen ist, muss darum auch in der Vermittlung von Fähigkeiten bei der Anwendung juristischer Methoden liegen. Die Beherrschung der Systematik und der Methodik der Falllösung sind nicht nur für das grundständige Studium, sondern auch und gerade für die Fortsetzung nach dem ersten Abschluss, für eine sich anschließende weitere akademische Qualifikation, vor allem aber für die spätere Tätigkeit in der Praxis von essentieller Bedeutung. Ein weiterer unverzichtbarer, wenngleich häufig vernachlässigter Bestandteil des juristischen „Handwerkszeugs“ neben den genannten Aspekten der Systematik und Methodik ist der souveräne Umgang mit juristischen Quellen. Dies gilt mit Blick auf die Recherche, die Auswertung und Analyse sowie die Verarbeitung, vor allem bei der Erstellung von Gutachten und Themenarbeiten. Die Qualität der juristischen Arbeit bestimmt sich letztlich aus der Gesamtheit dieser Kenntnisse und Fähigkeiten.
Das Buch wurde im Juni 2018 fertiggestellt. Wir danken den bei der Recherche und Erstellung mitwirkenden studentischen und wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Lehrstuhls, Lydia Dammann-Tamke, Juliane Dietrich, Charlotte Düring, Lina Gelvez, Manuel Heigl, Theresa Henne, Tobias Kircher, Julia Lehmann, Birte Soetbeer, Mareike Rutz, Vera Nordbeck, Bettina Schmiedler, Theresa Fischer, Julian Wernicke und Nele Marie Herbold sowie Christian Strunk ganz herzlich.
Lüneburg, im August 2018 Tim W. Dornis,
Florian Keßenich
und Dominik Lemke
|1|§ 1 Einführung
Ziel dieses Lehrbuches ist es, Studierenden[1] die Grundregeln juristisch-wissenschaftlicher Arbeit, insbesondere das richtige Recherchieren, den richtigen Aufbau einer Haus- oder Seminararbeit sowie das korrekte Zitieren zu vermitteln.
Immer wieder zeigt es sich bei der Korrektur von Haus-, Seminar- sowie Bachelor- oder Masterarbeiten, dass die Grundzüge juristisch-wissenschaftlichen Schreibens nicht beherrscht werden. Das ist wenig überraschend. Schließlich sehen juristische Studiengänge traditionell nur selten eine gesonderte Lehrveranstaltung zum wissenschaftlichen Arbeiten vor. Insoweit sind die Studierenden meist auf eine weitestgehend autodidaktische, zum Teil aus der Not heraus rein eklektische Herangehensweise im Sinne eines Learning by doing verwiesen.
Dieser Zustand ist zu bedauern. Die Fähigkeit zur effizienten Quellenrecherche, zur konkreten Falllösung oder zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit einem Thema sowie letztlich auch und gerade zum Verfassen strukturierter und verständlicher Texte ist ein wesentliches Qualifikationsmerkmal der Juristen. Neben der Kenntnis des Rechts ist es gerade die Fähigkeit zu seiner Anwendung, die den Juristen auszeichnet. Das Anfertigen von Hausarbeiten vermittelt die hierzu erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten zwangsläufig. Man kann insoweit geradezu von einer unverzichtbaren persönlichkeitsbildenden „Erfahrung“ sprechen. Nicht nur ist der Studierende bei der Bearbeitung gefordert, eigenständig und unabhängig an der Fallfrage zu arbeiten. Die Falllösung stellt mit Blick auf den Umgang mit den stets knappen „Ressourcen“ erhebliche Anforderungen. Dies betrifft vor allem die zur Bearbeitung zur Verfügung stehende Zeit, die Verfügbarkeit der Quellen und den Umgang mit eigenem Fach(nicht)wissen. Die Lerneffekte sind vielfältig. Zu nennen sind allerdings vor allem die systematische Herangehensweise an die Falllösung oder Forschungsfrage, die Auseinandersetzung mit der juristischen Denkweise, aber auch Fragen des Zeitmanagements.
Wenngleich der Schwerpunkt auf dem richtigen Umgang mit der Rechtsprechung und Literatur, dabei insbesondere dem korrekten Zitieren liegt, erschöpft sich dieses Lehrbuch nicht in diesen Grundfragen. Es soll den Studierenden vielmehr als Anleitung bei allen Arbeitsschritten einer juristischen Studienarbeit dienen. Es beginnt daher allgemein mit Fragen der Herangehensweise an juristisch-wissenschaftliche Arbeiten (§ 2). Dies wird ergänzt durch Leitlinien zur Recherche (§ 3). Erläuterungen zu Aufbau und Bestandteilen einer juristisch-wissenschaftlichen Arbeit folgen, mit |2|besonderem Fokus auf Fragen der richtigen Erstellung eines Literaturverzeichnisses (§ 4). Ein weiterer Schwerpunkt ist der korrekte Umgang mit Quellen im Rahmen von Nachweisen und Zitaten, vor allem der Fußnotengestaltung (§ 5). Nach einem Kapitel zu Stil und Sprache bei juristisch-wissenschaftlichen Texten (§ 6) widmet sich die Arbeit schließlich dem immer noch vernachlässigten Thema der Remonstration (§ 7). Der Anhang enthält eine Musterhausarbeit im Zivilrecht, wie sie in juristischen Studiengängen etwa als Gegenstand einer „kleinen Übung“ angefertigt wird. In den einzelnen Kapiteln dieses Buches wird immer wieder exemplarisch auf Teile der Hausarbeit verwiesen.
|3|§ 2 Grundlagen
Vorab soll ein Überblick zur grundsätzlichen Herangehensweise an eine juristisch-wissenschaftliche Arbeit gegeben werden. Wenngleich es hierzu keinen „Königsweg“ und kein klares und umfassend gültiges Regelwerk im Sinne eines one-size-fits-all geben mag, ist doch klar, dass sich Fehler und Unsicherheiten bei der Herangehensweise an juristisch-wissenschaftliche Arbeiten immer in der Qualität des Inhalts einer Arbeit niederschlagen. Selbst hervorragende Rechtskenntnisse und methodische Fähigkeiten kommen nicht hinreichend zur Geltung, wenn die Grundregeln der Erstellung juristisch-wissenschaftlicher Arbeiten nicht beherrscht werden.
I.Differenzierung: Gutachterliche Falllösung und Themenarbeit
Es gibt zwei Kategorien juristisch-wissenschaftlicher Arbeiten im Studium. Ein Großteil dieser schriftlichen Arbeiten verlangt von den Studierenden eine sogenannte gutachterliche Falllösung. Dies sind die Hausarbeiten der kleinen und großen Übung, die vor allem in Staatsexamensstudiengängen als Leistungsnachweis erwartet werden. Daneben erfordert das Studium gerade in späteren Semestern regelmäßig sogenannte Themenarbeiten, so insbesondere in Form von Seminar-, Bachelor- oder Masterarbeiten sowie von schriftlichen Hausarbeiten im Rahmen des Schwerpunktbereiches.[2]
II.Gutachterliche Falllösung
Literatur:Bydlinski, Franz/Bydlinski, Peter, Grundzüge der juristischen Methodenlehre, 2. Auflage, Wien 2012, S. 17ff.; Hildebrand, Tina, Juristischer Gutachtenstil, 2. Auflage, Tübingen 2011, S. 95ff.; Klaner, Andreas, Wie schreibe ich juristische Hausarbeiten, 3. Auflage, Berlin 2003, S. 78ff.; Körber, Torsten, Zivilrechtliche Fallbearbeitung in Klausur und Praxis, JuS 2008, 289, 290ff.; Mann, Thomas, Einführung in die juristische Arbeitstechnik, 5. Auflage, München 2015, § 5; Putzke, Holm, Juristische Arbeiten erfolgreich schreiben, 5. Auflage, München 2014, |4|S. 6ff., 27ff.; Reimer, Franz, Juristische Methodenlehre, Baden-Baden 2016, S. 52ff.; Rollmann, Christian, Die juristische Hausarbeit, JuS 1988, 42, 43f.
Einstiegsfall (verkürzter Abschnitt aus der Musterhausarbeit im Anhang):
Hobbyimker V einigt sich im Oktober 2014 mit K über den Verkauf eines Bienenvolkes für € 150. Eines seiner Bienenvölker wird mit Sicherheit – voraussichtlich Ende Juni 2015 – eine neue Bienenkönigin hervorbringen. Die alte Bienenkönigin wird dann zusammen mit einem Großteil des alten Volkes aus einem der Bienenkörbe ausziehen. Sobald dies geschieht, soll der Schwarm gefangen und dem K übereignet werden.
Ende Mai 2015 kommt es zum verfrühten Ausbrechen des neuen Schwarms. Vom Nachbarn N informiert, eilt der V gerade noch rechtzeitig hinzu, um den Schwarm zu verfolgen. Auf einer Eiche wenige Kilometer weiter lässt sich die Königin mit dem Schwarm nieder. Für V vollkommen unerwartet kommt es dort zur Vereinigung mit einem weiteren, am selben Tag in der Nähe ausgezogenen Schwarm des Imkers (I), der diesen ebenfalls verfolgt hat. V und I gelingt es, das nun vereinigte große Volk in einen von V mitgebrachten Bienenkorb zu überführen.
K ist über die Vereinigung sehr verärgert. Er habe schließlich sein „eigenes“ Volk erwerben wollen. Da sich das neue Bienenvolk nicht mehr aufteilen lasse, müsse er sich die ganze Angelegenheit nochmals überlegen.
Wie ist die Rechtslage?
Ist die Arbeit als Falllösung konzipiert, so sind zunächst der Sachverhalt und die Fragestellung zu erfassen. Dies ist selbstverständlich. Dennoch ist die Ursache einer überwiegenden Anzahl von Fehlern bei der Bearbeitung das Fehl- oder Nichtverständnis des Sachverhalts oder der Aufgabenstellung. Zum Teil werden Fallfragen falsch verstanden oder sogar ganz oder teilweise übersehen.
1.Ausgangspunkt: Aufgabenstellung
Für die Erstellung einer gutachterlichen Falllösung kommt es zunächst auf die Aufgabenstellung – d.h. die konkrete Fallfrage – an. Die Fallfrage steht am Anfang und im Zentrum der Bearbeitung. Nur bei genauer Kenntnis und Beachtung der Fallfrage kann der Sachverhalt mit der richtigen Konzentration und Gewichtung verstanden und beurteilt werden.[3]
Eine zivilrechtliche Aufgabenstellung ist in der überwiegenden Zahl aller Fälle daran ausgerichtet, Ansprüche der Beteiligten zu prüfen. Dies kann bereits konkret für ein bestimmtes Verhältnis und einen bestimmten Anspruch formuliert sein:
Kann V von K den Kaufpreis in Höhe von € 3.000 verlangen?
Hat B gegen U einen Anspruch auf Nacherfüllung?
|5|In diesen Fällen ist nur das konkrete Verhältnis (hier: V – K, B – U) und der bestimmte Anspruch (hier: Kaufpreis, Nacherfüllung) zu prüfen. Ausführungen zu Beziehungen zu oder zwischen anderen im Sachverhalt auftauchenden Personen wären nicht nur verfehlt und führten zu Punktabzügen. Sie raubten auch wertvollen Platz für die relevanten Ausführungen.
Die Fragestellung kann aber auch weiter gefasst sein:
Kann A von B die Zahlung von 5.000 € verlangen?
Hat C gegen D einen Anspruch auf Schadensersatz?
Wer ist Eigentümer des PKW ?
In diesen Fällen ist die Bandbreite der zu prüfenden Ansprüche und Anspruchsgrundlagen weiter. Es muss dann dem Sachverhalt entnommen werden, woraus sich etwa der Zahlungsanspruch ergeben kann. Dies könnte ein vertraglicher Anspruch, etwa auf Kaufpreiszahlung, ein Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung oder ein Schadensersatzanspruch, sei es aus Vertrag (§§ 280ff. BGB ) oder aus Delikt (§§ 823ff. BGB ), sein, wobei mehrere dieser Grundlagen zu prüfen sein können.
Schließlich kann die Aufgabenstellung auch ganz allgemein – wie in der anhängenden Musterhausarbeit – gehalten sein:
Wie ist die Rechtslage?
In diesem Fall sind sämtliche vernünftigerweise in Frage kommenden Ansprüche zwischen den beteiligten Personen zu prüfen.[4]
2.Grundlage der Falllösung: Sachverhalt
Vor dem Hintergrund der konkreten Aufgaben- oder Fragestellung ist der Sachverhalt zu erfassen. Die Feststellung des Sachverhalts ist, wie es Franz Bydlinski treffend erklärt hat, der erste Schritt zu einer rationalen Rechtsgewinnung.[5] Entscheidend ist das genaue Verständnis aller Tatsachen. Es gilt der Grundsatz, dass jeder Satz des Sachverhalts eine Bedeutung für die Falllösung haben kann – und in der Regel auch hat. Oftmals verbergen sich Hinweise z.B. in wörtlichen Äußerungen der Beteiligten. Aber auch Zeit- oder Ortsangaben können von Bedeutung sein. Die Bedeutung derartiger Hinweise erschließt sich zuweilen erst nach einer gründlichen und zeitlich ausgedehnten Befassung mit dem Sachverhalt. Es ist daher sinnvoll und ratsam, den Sachverhalt auch während der Bearbeitungszeit immer wieder zu lesen.[6] Ob es erforderlich ist – wie es vereinzelt empfohlen wird – den Sachverhalt abzutippen, mag dahinstehen.[7] Entscheidend ist allerdings, dass der Sachverhalt gründlich und vollständig gelesen und verstanden wird. Dabei darf der Sachverhalt nicht „überinterpretiert“ werden, d.h. die geschilderten Tatsachen sind so hinzunehmen, wie sie |6|vom Aufgabensteller formuliert wurden.[8] Keineswegs dürfen Probleme ergänzt oder Fragen beantwortet werden, die der Sachverhalt überhaupt nicht aufwirft.
Nur auf der Grundlage einer gründlichen Sachverhaltserfassung kann Wichtiges von Unwichtigem unterschieden und können die einzelnen Bestandteile des relevanten Sachverhalts in ihrer Bedeutung für die rechtliche Lösung eingeordnet werden. Aus diesem Grund ist es, insbesondere bei komplexen Sachverhalten, auch ratsam, eine Skizze anzufertigen, gegebenenfalls kombiniert mit einer sogenannten Zeitleiste für einen Überblick über den chronologischen Ablauf der Ereignisse im Sachverhalt. Die Reihenfolge der Handlungen und Ereignisse kann von entscheidender Bedeutung sein. Es handelt sich dabei auch keinesfalls um eine Fleißarbeit oder Geduldsübung. Die Umsetzung der Sachverhaltsinformationen in eine logisch-grafische Struktur zwingt den Bearbeiter der Falllösung zum einen dazu, den Sachverhalt tatsächlich umfänglich zu erfassen. Zum anderen ermöglicht die notwendige und meist unvermeidliche Reduktion der Informationen eine Konzentration auf das Wesentliche.
Die nachfolgenden Beispiele einer Beziehungsskizze und Zeitleiste beziehen sich auf den Sachverhalt der Musterhausarbeit am Ende des Lehrbuches.
Abb. 1: Einfache Beziehungsskizze zur Musterhausarbeit
|7|Abb. 2: Detaillierte Beziehungsskizze zur Musterhausarbeit
Oktober 2014:
Kaufvertrag zwischen V und K über neues, voraussichtlich Ende Juni 2015 ausziehendes Bienenvolk zum Preis von € 150 (tatsächlicher Wert € 180).
Ende Mai 2015:
Verfrühtes Ausbrechen des neuen Volkes und Vereinigung mit einem Schwarm des I.
Kurz darauf:
V berichtet K über die Vereinigung; T bietet das Teilvolk auf „The Digital Beemaster“ über den Account des K zur Versteigerung an, Anfangspreis € 60.
Darauffolgender Abend:
Anderes Mitglied bietet dem K für das Teilvolk € 210, K nimmt sofort an und fordert noch in derselben Nacht per E-Mail von V die Übereignung des Teilvolkes
Nächster Morgen:
K erfährt von T über Angebot des D über € 96 für Teilvolk und „zieht das Angebot zurück“
Einige Tage später:
D verlangt von K Übereignung des Volkes, anderenfalls Schadensersatz i.H.v. € 108 (entgangener Gewinn)
Abb. 3: Zeittafel zur Musterhausarbeit
|8|Hat man die Aufgabenstellung und den Sachverhalt in dieser Form erfasst und strukturiert, kommt es im Anschluss darauf an, die relevanten Rechtsprobleme zu erkennen und zu formulieren.[9]
III.Themenarbeit
Literatur:Beyerbach, Hannes, Die juristische Doktorarbeit: Ein Ratgeber für das gesamte Promotionsverfahren, 2. Auflage, München 2017; Büdenbender, Ulrich/Bachert, Patric/Humbert, Doreen, Hinweise für das Verfassen von Seminararbeiten, JuS 2002, 24, 24ff.; Brandt, Edmund, Rationeller schreiben lernen, 5. Auflage, Baden-Baden 2016, S. 40ff.; Bull, Hans-Peter, Wie „riskant“ sind Themenarbeiten? – Hilfestellungen und Tipps für Studierende, JuS 2000, 47, 47ff.; Franck, Norbert/Stary, Joachim (Hrsg.), Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens, 17. Auflage, Paderborn 2013, S. 151ff.; Konrath, Christoph (Hrsg.), SchreibGuide JuS, 3. Auflage, Wien 2013, S. 33ff., 99ff.; Mann, Thomas, Einführung in die juristische Arbeitstechnik, 5. Auflage, München 2015, S. 191ff.; Möllers, Thomas M.J., Juristische Arbeitstechnik und wissenschaftliches Arbeiten, 8. Auflage, München 2016, S. 159ff.; Noltensmeier, Silke/Schuhr, Jan C., Hinweise zum Abfassen von (Pro)Seminararbeiten, JA 2008, 576, 577ff.; Schimmel, Roland/Weinert, Mirko/Basak, Denis, Juristische Themenarbeiten, 2. Auflage, Heidelberg 2011, S. 173ff.; Thieme, Werner, Die Anfertigung von rechtswissenschaftlichen Doktorarbeiten, 2. Auflage, Göttingen 1963, S. 7ff.
Bei einer juristischen Themenarbeit sind weniger strenge Regeln der Herangehensweise zu beachten als bei einer Falllösung. Allerdings erfordert auch die Vorbereitung einer Themenarbeit eine systematische Herangehensweise. Streng genommen lassen sich auch für Themenarbeiten zwingende Regeln für die Tatsachen- und Themenerfassung sowie die Abstraktion der Fragestellung formulieren. Insoweit bestehen zahlreiche Parallelen zur Bearbeitung einer juristischen Falllösung.
Zwar sieht sich der Studierende bei einer Themenarbeit keinem vorgegebenen „zu lösenden“ Sachverhalt mit Aufgabenstellung gegenüber. Am Anfang der Bearbeitung steht vielmehr eine Forschungsfrage. Diese gleicht der Aufgabenstellung allerdings zumindest insoweit, als es auch bei wissenschaftlichen Forschungsfragen (z.B. „Was sind die Unterschiede zwischen dem deutschen und dem britischen Recht der Anfechtung und Unwirksamkeit von Willenserklärungen?“) in erster Linie darum geht, die für die Beantwortung relevanten Rechtsprobleme herauszuarbeiten und im Sinne einer juristischen Fallbearbeitung zu „lösen“.
Zudem fehlt es bei Themenarbeiten in der Regel nicht an einem „Sachverhalt“. Auch Themenarbeiten befassen sich – wenngleich die Forschungsfrage abstrakt formuliert sein mag – mit der Lösung von Fällen. Dies erfolgt weitaus abstrakter und weniger detailbezogen als bei der Falllösung. Nur die wenigsten Themenarbeiten werden aber ohne Bezugnahme auf konkrete Fallbeispiele (aus der Rechtsprechung oder hypothetischer Natur) auskommen. Dennoch kommt einer „Sachverhaltserfassung“ bei Themenarbeiten in der Regel deutlich weniger Bedeutung zu als bei der juristischen Falllösung.
|9|1. Themenauswahl
Anders als bei einer Hausarbeit, wo ein Sachverhalt ausgegeben wird, den es zu lösen gilt, besteht bei Themenarbeiten die erste Hürde darin, ein geeignetes Thema zu finden, über das man schreiben möchte. Zwar wird das Thema manches Mal vom Prüfer vorgegeben. Nicht selten, insbesondere bei Bachelor- oder Masterarbeiten, wird jedoch von den Studierenden erwartet, selbst eine Themenauswahl vorzunehmen.
Bei der Auswahl des Themas ist darauf zu achten, dass es Raum für eigene Ideen und die Entwicklung neuer oder Weiterentwicklung vorhandener Lösungsansätze bietet. Es darf sich daher nicht nur in der schlichten Wiederholung von Auffassungen und Lösungen bereits abgehandelter Rechtsfragen erschöpfen,[10] sondern sollte sich mit ungelösten, umstrittenen Problemfragen beschäftigen und im Idealfall eigene Lösungsansätze verfolgen. Darüber hinaus sollte das Thema auch den eigenen juristischen Interessen entsprechen.[11] Ansonsten entsteht die Gefahr, der nur halbherzigen und oberflächlichen Befassung.
In den seltensten Fällen schwebt einem Studenten bereits vorab ein Thema vor. Regelmäßig fällt die Themenfindung eher schwer und „nicht vom Himmel“. In diesen Fällen hilft ein Besuch (oder mehrere) in der Bibliothek oder das Durchforsten von Datenbanken, um auf ungelöste Streitfragen zu stoßen. So ist es z.B. hilfreich, Fachzeitschriften der vergangenen Monate „quer“ zu lesen. Dabei stößt man schnell auf eine Fülle von streitigen Rechtsfragen. Auch neuere Entwicklungen der obergerichtlichen Rechtsprechung oder aktuelle Gesetzgebungsvorhaben können Anhaltspunkte liefern.[12] Beides kann gelegentlich auch Gegenstand der medialen Berichterstattung sein, die bei der Suche daher ebenfalls hilfreich sein kann. Darüber hinaus können auch Gespräche mit Kommilitonen, Dozenten oder Praktikern Hinweise geben.[13]
2.Themenformulierung und Exposé
Nachdem ein Thema ausgewählt wurde, gilt es, dieses konkret zu formulieren und von anderen Bereichen oder Aspekten abzugrenzen.[14] Gerade bei Bachelor- und Masterarbeiten ist häufig im Vorfeld ein sog. Exposé anzufertigen. Ein Exposé ist ein beschreibender Text, der das Thema der geplanten Arbeit in groben Zügen schildert. Es umfasst in der Regel einen Problemaufriss, eine erste Gliederung, die einen Ausblick |10|auf die Schwerpunkte, Forschungsfragen und Rechtsprobleme gibt, gegebenenfalls auch einen groben Zeitplan sowie ein vorläufiges Literaturverzeichnis.[15]
Das Abfassen eines Exposés hat mehrere Vorteile. Zunächst ist man gezwungen, sich einen Überblick über das Thema und die dazu bestehenden Auffassungen und Erkenntnisse zu verschaffen.[16] Wer hat schon etwas dazu geschrieben? Was wurde dazu geschrieben? Welche Urteile gibt es zu der Frage? Zudem dient es auch der Selbstkontrolle.[17] Liegt mir das Thema? Interessiert es mich? Eignet es sich wirklich? Und nicht zuletzt liefert es Erkenntnisse, ob das Thema vielleicht enger oder weiter gefasst werden sollte. Die Abfassung eines Exposés zwingt auch dazu, die zu behandelnde Thematik zu strukturieren und von anderen Themenbereichen abzugrenzen.[18] Welche Aspekte möchte ich behandeln? Welche sollten zwingend behandelt werden? Schließlich kann das Exposé bei der Abfassung der eigentlichen Arbeit als Leitfaden herangezogen werden. Es ist daher auch dann von Vorteil, ein Exposé zu erstellen, wenn es vom Dozenten nicht gefordert wird.
3.Kategorien
Themenarbeit ist nicht gleich Themenarbeit. Man kann zwischen verschiedenen Typen unterscheiden. Wenngleich alle Arten von Themenarbeiten viele Überschneidungen und Verbindungen aufweisen, lassen sich nach Thieme[19] einige wesentliche Typen voneinander unterscheiden.
a)Standardthema: Dogmatische Sachfrage
Die Behandlung einer konkreten dogmatischen Sachfrage[20] ist häufig in Themenarbeiten anzufinden und geradezu ein Klassiker. Es geht dabei im Grunde um nichts anderes, als das, was man schon als Einzelproblem aus Falllösungen kennt – die Interpretation von speziellen Normen. Welche Rechtsfolge ist aus der Norm abzuleiten? Was fällt unter einen bestimmten Begriff? Diese Frage ist dann, ähnlich der Streitdarstellung in einer konkreten Falllösung, unter Behandlung der vertretenen Ansichten und Rechtsprechung auszuleuchten. Dies geschieht in einer Themenarbeit abstrakt, |11|was aber nicht bedeutet, dass für einzelne Aspekte nicht Fallbeispiele genannt und behandelt werden dürften.
Beispiele für dogmatische Sachfragen sind z.B. die aktuellen Fragen einer Abdingbarkeit der Entschädigungspauschale im Sinne des § 288 Abs. 5 BGB im Verzugsfall[21] oder – im arbeitsrechtlichen Bereich – die Anrechenbarkeit von Leistungen auf den Mindestlohnanspruch.[22]
b)Für höhere Ansprüche: Grenzziehungsfragen
Ebenfalls häufig anzutreffen, wenngleich meist erheblich anspruchsvoller in der Bearbeitung, ist die Frage nach einer Grenzziehung für die Reichweite rechtlicher Normen. Konkret wird dann z.B. gefragt: Wie weit darf eine Norm reichen? Wie weit muss sie reichen? Sind möglicherweise Änderungen angezeigt? Bei diesen Themen gilt es immer, eine Interessen- und Güterabwägung zwischen kollidierenden Werten, Prinzipien und Interessen vorzunehmen.[23] Zwangsläufig erfordern derartige Themen einen höheren Grad an Abstraktion als streng dogmatische Themen. Zudem ist es meist erforderlich, über den Rahmen einer rein juristischen Argumentation hinauszugehen. Ein Beispiel, welches sich vor dem Hintergrund des seit Jahren stärker ins öffentliche Bewusstsein drängenden Terrorismus formulieren lässt, ist die Frage nach dem Verhältnis von Freiheit und Sicherheit: Mehr Sicherheit geht zu Lasten der Freiheit und umgekehrt. Wo ist die Grenze zu ziehen? Und konkret auf eine juristische Betrachtung: Wie sind die geltenden Normen auszulegen, zu ergänzen oder vielleicht sogar strukturell zu verändern, um den geänderten Anforderungen gerecht zu werden?
c)Das Fortgeschrittenenthema: Die Behandlung eines ganzen Sach- oder Rechtskomplexes
Schließlich kann auch ein Rechtskomplex Gegenstand einer Themenarbeit sein. Diese Art der Themenstellung wird allerdings in der Regel nur für Arbeiten jenseits des Grundstudiums in Betracht kommen. Die Anforderungen an die Bearbeitung sind hier meist erheblich.
Bei dieser Art von Themenarbeit läuft die Bearbeitung darauf hinaus, ein bestimmtes Rechtsgebiet zunächst allgemein zu beleuchten. Das erfordert, dem Leser die Grundlagen des Sach- oder Rechtskomplexes zu vermitteln, indem dessen Prinzipien, Eigenarten und Probleme erläutert werden. An diesen allgemeinen Teil anschließend ist dann auf die konkreten, speziellen Fragestellungen einzugehen.[24] Dabei sollte stets versucht werden, aus den einzelnen Feststellungen und Problempunkten eine übergeordnete Aussage abzuleiten:[25]
|12|Die eben unter a) exemplarisch angeführten dogmatischen Sachfragen entspringen jeweils einem Rechtskomplex, der es durchaus wert sein kann, auch allgemein beleuchtet zu werden. Themen wären in diesem Falle „die Entschädigungspauschale“ bzw. „der Mindestlohnanspruch“. Es versteht sich von selbst, dass im Rahmen einer Gesamtbetrachtung des Sach- und Rechtskomplexes als jeweils untergeordnete Fragestellungen auch auf die Abdingbarkeit (der Entschädigungspauschale) oder die Anrechenbarkeit (des Mindestlohn) einzugehen wäre.
4.Vorgehensweise und Fertigstellung
Der Einstieg in die Themenbearbeitung besteht nicht selten im klassischen Brainstorming. Es empfiehlt sich, schlicht und ergreifend alles zu notieren, was einem einfällt. Gegebenenfalls werden Zusammenhangsskizzen mit Stichworten erstellt. Dabei muss (und darf) man sich nicht auf juristische Fragen beschränken, sondern vielmehr auch alle anderen Gesichtspunkte berücksichtigen, die das Thema berühren. Dies können etwa wirtschaftliche, soziale, politische oder historische Aspekte oder anderer Wissenschaftsdisziplinen wie der Medizin, der Technik- oder der Naturwissenschaften sein.[26] Gerade in Themenarbeiten darf – und sollte bei gegebenem Anlass auch – der berühmte „Blick über den Tellerrand“ gewagt werden. Besonders modern und empfehlenswert ist es z.B. das interdisziplinäre Instrumentarium der ökonomischen Analyse des Rechts zu bemühen.[27] Aus der ökonomischen Durchdringung juristischer Themen ergeben sich häufig wichtige Erkenntnisse, die z.B. Anlass bieten, eine Rechtsänderung – entweder durch Auslegung des geltenden Rechts oder durch Änderung (de lege ferenda) – vorzuschlagen.
Zudem hat der Betreuer häufig in einem ersten Gespräch Tipps und erste Literatur- oder Rechtsprechungshinweise gegeben. Diese helfen beim Einstieg und dürfen keinesfalls ignoriert werden. Auf Basis dieser Anhaltspunkte geht es im nächsten Schritt in die Recherche (siehe hierzu ausführlich unten § 3). Hierzu sind die einschlägige Literatur und Rechtsprechung zusammenzutragen.[28] Der gesammelte Stoff ist systematisch zu ordnen und zu gewichten. Welche Autoren, Gerichte oder Werke werden besonders häufig zitiert, welche vertreten wichtige Ansichten und Argumente? Hierzu ist eine erste Lektüre aller relevanten Quellen nötig. Bereits hierbei kann und sollte man sich umfangreiche Notizen machen, Passagen markieren und nicht zuletzt auch die bibliographischen Daten der jeweiligen Werke sowie die exakten Fundstellen notieren. Nichts ist ärgerlicher (weil zeitintensiv) als nachträglich erneut diejenigen Werke aus den Regalen der Bibliothek suchen zu müssen, die bereits schon einmal auf dem Tisch lagen.
|13|Auf der Grundlage der durch die Lektüre gewonnenen Erkenntnisse, Ordnung und Gewichtung können schließlich eine erste grobe Gliederung sowie gegebenenfalls auch ein Arbeits- und Zeitplan erstellt werden.
Idealerweise entwickelt sich die Arbeit von diesem Punkt an kontinuierlich weiter. Neben der schrittweisen und vor allem lückenlosen „Abarbeitung“ der relevanten Literatur und Rechtsprechung ist vor allem auf die Struktur der Arbeit zu achten. Wenngleich sich viele Probleme und Facetten erst im Zuge der konkreten Diskussion von Einzelfragen zeigen werden, darf das Gesamtbild – vor allem die Forschungsfrage – nicht aus den Augen verloren werden. Der Bearbeiter ist darum ständig gefordert, den „Blick für das Wesentliche“ zu wahren. Dies kann (und sollte) vor allem auch im Austausch mit dem Betreuer der Arbeit (gegebenenfalls durch Rückfragen und Besprechungen) sichergestellt werden. Die notwendige Fokussierung auf die Forschungsfrage verlangt aber gerade vom Bearbeiter selbst die Bereitschaft und die Fähigkeit, den Blick auf das Große und Ganze nicht zu verlieren. Sehr häufig wird sich in bestimmten Phasen der Bearbeitung darum – vor allem gegen Ende der Arbeit – die Notwendigkeit ergeben, einzelne Bereiche eines Themas nicht weiter zu verfolgen. Dann kann es auch erforderlich werden, wenngleich viel Zeit und Arbeit in eine bestimmte Teilfrage geflossen sein mögen, resolut zu kürzen. Insoweit gilt für Hausarbeiten wie für Themenarbeiten gleichermaßen, dass der Blick auf die Bäume nicht die Sicht auf den Wald verdecken darf.
Sobald die inhaltliche Bearbeitung abgeschlossen ist, sind die formellen Voraussetzungen für eine vollständige und ordnungsgemäße Themenarbeit zu schaffen. Dies gilt in erster Linie für die korrekte Gestaltung der Fußnoten und des Literaturverzeichnisses sowie der sonstigen Bestandteile der Arbeit (siehe hierzu unten §§ 4 und 5). Zur abschließenden Kontrolle von Sprache, Rechtschreibung und des Ausdrucks, vor allem aber auch im Hinblick auf die Verständlichkeit und Schlüssigkeit der Gedankenführung kann es sich aber auch als sinnvoll erweisen, eine Korrekturlesung durch neutrale Dritte zu veranlassen. Diese Korrektur darf die Grenzen der zulässigen Hilfeleistung selbstverständlich nicht überschreiten. Die Themenarbeit muss nach den meisten Prüfungsordnungen als „eigenständige“ Arbeit gelten. Eine schlichte Kontrolle auf Verständlichkeit und Richtigkeit der Sprache, der Rechtschreibung und der Formalitäten stellt dies jedoch nicht in Frage.
Bei alledem ist ein gutes Zeitmanagement essentiell für das Gelingen der Arbeit. Gerade gegen Ende der Bearbeitungsfrist geraten viele Studierende in Zeitnot. Hier darf auf keinen Fall unterschätzt werden, wie zeitintensiv formale und organisatorische Notwendigkeiten sein können. Hierzu zählen z.B. die Formatierung, der Druck oder die Bindung. Gerade für die Formatierung sollte man sich je nach Umfang der Arbeit genügend Zeit lassen. Die Formatierung umfasst insbesondere die einheitliche Gestaltung der Fußnoten und die Erstellung des Literatur- und Inhaltsverzeichnisses. Im Idealfall entwickeln sich diese Teile von Anfang an mit der Arbeit. Dies spart nicht nur Zeit, sondern auch Nerven. Nicht zu unterschätzen ist auch der Zeitaufwand, den der Druck und die Bindung mit sich bringen können. Erfahrungsgemäß lässt ein Großteil der Studierenden die Arbeit am Abgabetag drucken und binden. Dies birgt die Gefahr langer Wartezeiten im Copy-Shop. Die beste Vorsorge ist darum das Einplanen eines ausreichenden Zeitpuffers. Generell ist es ratsam, sich eine Frist für |14|die inhaltliche Bearbeitung zu setzen, die jedenfalls eine Woche vor der offiziellen Abgabefrist liegt. Dies bietet zum einen die Möglichkeit, die Arbeit ein letztes Mal in Ruhe zu lesen und dabei möglicherweise noch bestehende Fehler zu beheben, zum anderen kann die Arbeit in Ruhe formatiert und gedruckt werden.
|15|§ 3 Recherche
Literatur:Karmasin, Matthias/Ribing, Rainer, Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten. Ein Leitfaden für Facharbeit/ VWA , Seminararbeiten, Bachelor-, Master-, Magister- und Diplomarbeiten sowie Dissertationen, 9. Auflage, Wien 2017, S. 99ff.; Klaner, Andreas, Wie schreibe ich juristische Hausarbeiten, 3. Auflage, Berlin 2003, S. 90ff.; Konrath, Christoph (Hrsg.), SchreibGuide JuS, 3. Auflage, Wien 2013, S. 40ff., 52ff., 64ff.; Mann, Thomas, Einführung in die juristische Arbeitstechnik. Klausuren, Hausarbeiten, Seminararbeiten, Dissertationen, 5. Auflage, München 2015, § 1 Abschnitt IV sowie §§ 2–4; Möllers, Thomas M.J., Juristische Arbeitstechnik und wissenschaftliches Arbeiten, 8. Auflage, München 2016, § 5; Vogel, Ivo, Erfolgreich recherchieren – Jura, 2. Auflage, Berlin 2015.
Nach der Sachverhaltserfassung und Analyse der Aufgabenstellung für juristische Falllösungen sowie nach der Formulierung der Forschungsfrage bei Themenarbeiten beginnt die Materialsuche. Der Vorgang der sogenannten Recherche ist selbstredend die Grundlage jeder juristisch-wissenschaftlichen Arbeit. Ohne eine sorgfältige Ermittlung der relevanten Literatur und Rechtsprechung wird keine gute Arbeit gelingen. Die Bedeutung der juristischen Quellen variiert je nach Aufgabenstellung. Es gilt deshalb immer, verschiedene Möglichkeiten der Informationsgewinnung zu unterscheiden. Noch immer nimmt jede juristisch-wissenschaftliche Arbeit ihren Ausgangspunkt idealerweise in der Bibliothek. Diese ist quasi das „Labor der Juristen“. In neuerer Zeit haben zudem die Recherche in juristischen Datenbanken sowie die allgemeine Internet-Recherche an Bedeutung gewonnen.
I.Juristische Bibliotheken
Die juristische Bibliothek ist die traditionell und nach wie vor wichtigste Beschaffungsquelle für Informationen. Wenngleich andere Formen der Informationsvermittlung und -beschaffung auf dem Vormarsch sind (siehe hierzu sogleich unten II . und III .), ist das Studium der Rechtswissenschaften doch nach wie vor ein „Bibliotheksstudium“.[29]
|16|1. Allgemeines
Eine gut ausgestattete juristische Bibliothek sollte alle Bestände an einschlägigen Buchkategorien, d.h. Kommentare, Handbücher, Lehrbücher, Monographien, aufweisen. Daneben muss ein Grundbestand an Fachzeitschriften vorhanden sein. Auch die amtlichen Entscheidungssammlungen, etwa der Bundesgerichte ( BV erfG, BGH , BAG , BV erwG etc.), sind in gut ausgestatteten Bibliotheken umfassend vorhanden. Mit Hilfe der jeweiligen digitalen Kataloge kann der Bestand einer jeden Bibliothek auch online schnell durchsucht werden.
Neben der räumlichen Vertrautheit mit den für eine Recherche, gegebenenfalls auch als Arbeitsplatz in Betracht kommenden Bibliotheken kommt es für eine erfolgreiche Vorbereitung auf ein möglichst effizientes Verfahren der Quellenermittlung und -beschaffung an.[30] Die Nutzung von Bibliothekskatalogen, die Voraussetzungen und Möglichkeiten der Ausleihe und die technischen Voraussetzungen für eine Quellensicherung (z.B. Fotokopie, pdf-Scan) sind neben den räumlichen Gegebenheiten und dem Bestand entscheidend für den Erfolg der Arbeit in und mit der jeweiligen Bibliothek.[31] Neben den juristischen Fachbereichsbibliotheken der Universitäten kommen für eine erfolgreiche Recherche zudem Institutsbibliotheken (z.B. juristische Max-Planck-Institute), Gerichtsbibliotheken, Firmen- und Verbandsbibliotheken sowie Landes- und Staatsbibliotheken in Betracht.[32]
Neben der Suche nach und Arbeit mit gedruckten Quellen in der Bibliothek sind zunehmend auch die Möglichkeiten einer Online-Recherche zu beachten. Ein großer Teil noch vor wenigen Jahren ausschließlich im Bestand von Bibliotheken vorhandener Quellen ist mittlerweile in juristischen Datenbanken, zum Teil sogar frei verfügbar im Internet einsehbar (siehe hierzu unten II . und III ., zu den frei verfügbaren Quellen insbesondere III . 3. b)). Dennoch gilt nach wie vor, dass wesentliche Teile der juristischen Literatur nur „in Papierform“ eingesehen werden können. Kaum jemals wird sich eine juristische Studienarbeit darum allein durch Arbeit vom heimischen Schreibtisch aus erstellen lassen.
Je nachdem, wie speziell ein Thema oder eine Problematik ist, kann es mehr oder weniger häufig vorkommen, dass in der eigenen Universitätsbibliothek ein gesuchtes Werk nicht vorhanden ist. Dann kann regelmäßig das Werk über die sogenannte Online-Fernleihe aus anderen Bibliotheken bestellt werden. Es können sowohl Leih- als auch Kopiebestellungen (insbesondere Aufsatzkopien) vorgenommen werden. Um eine Bestellung abzugeben, benötigt der Nutzer ein Fernleihe-Benutzerkonto seiner Bibliothek. Ist dies vorhanden, kann er über den Gemeinsamen Verbundkatalog der Bibliotheken[33] recherchieren und bestellen. In der Regel werden pro Bestellung zwischen EUR 1,00 und EUR 1,50 in Rechnung gestellt. Der anschließende Versand an die „Heimbibliothek“ kann aber stets einige Tage, mitunter sogar einige Wochen |17|dauern. Für schnellere Lieferungen ist deshalb der Dokumentenlieferdienst subito zu bevorzugen[34]. Dies ist ein als Verein organisierter Zusammenschluss wissenschaftlicher Bibliotheken, dem fast alle Universitätsbibliotheken Deutschlands angehören, und der auch mit dem Gemeinsamen Verbundkatalog der Bibliotheken[35] verbunden ist. Er bietet sowohl Fernleihen, als auch Teilkopien an. Der Versand dauert – dies ist der Vorteil gegenüber der Online-Fernleihe – nur ein bis drei Tage. Ein Nachteil sind die höheren Preise: Die Standard-Buchausleihe kostet für Studierende beispielsweise EUR 9,00. Bei gescannten Dokumenten (Aufsätze, Teilkopien) besteht die Möglichkeit der Lieferung als pdf-Datei per E-Mail (ab EUR 4,00), ansonsten per Post (ab EUR 6,50). Im Gegensatz zur Online-Fernleihe liefert subito die per Post gesendeten Werke auch an die Privatadresse.
2.Quellenrecherche
Die mit Blick auf die Erstellung einer juristischen Studienarbeit wichtigsten Kategorien von Quellen werden im Folgenden kurz vorgestellt. Dies sind neben den Entscheidungen der Gerichte vor allem Kommentare, Handbücher, Lehrbücher, Monographien, Zeitschriften und Sammelwerke.
Vorab sei allerdings darauf hingewiesen, dass eine genaue Abgrenzung der einzelnen Kategorien zum Teil schwierig sein kann.[36] Dies liegt vor allem an dem in den letzten Jahren erheblich angewachsenen Angebot nahezu sämtlicher Literaturgattungen. Dem Leitsatz des „publish or perish“ folgend haben vor allem Vertreter der Wissenschaft zu einer enormen Vervielfältigung von Lehrbüchern, Fallsammlungen und ähnlichen ausbildungsrelevanten Literaturgattungen beigetragen. Auch die Anzahl der juristischen Zeitschriften hat sich in den letzten Jahrzehnten erhöht. Für jedes noch so spezielle Gebiet scheint es mittlerweile eine eigene Zeitschrift zu geben.
Vor diesem Hintergrund ist erkennbar, dass nicht nur die Wissenschaft und Praxis in der Lage sein müssen, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Auch und gerade die Recherche für eine juristische Studienarbeit erfordert mittlerweile die Fähigkeit zur Filterung und Auswahl aus der Informationsflut.
a)Entscheidungssammlungen der Gerichte
aa)Deutsche Gerichte
Die wichtigsten Entscheidungen der obersten deutschen Bundesgerichte werden in amtlichen Entscheidungssammlungen veröffentlicht.
Als Beispiele zu nennen sind die Entscheidungssammlungen des Bundesverfassungsgerichts ( BV erf GE ) sowie der obersten Gerichtshöfe des Bundes, namentlich des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen ( BGHZ ) sowie in Strafsachen ( BGHS t), des Bundesarbeitsgerichts ( BAGE ), des Bundessozialgerichts ( BSGE ), des |18|Bundesfinanzhofes ( BFHE ) und des Bundesverwaltungsgerichts ( BV erw GE ). Darüber hinaus gibt es Entscheidungssammlungen des Bundespatentgerichts ( BP at GE ) und des Bundesdisziplinarhofs ( BDHE ).[37] Daneben gibt es auch amtliche Entscheidungssammlungen von Gerichten niedrigerer Stufen, wie etwa der Oberlandesgerichte in Zivilsachen ( OLGZ ).[38] Diese Sammlungen erscheinen mindestens jährlich in einem gebundenen Werk. In gut ausgestatteten Bibliotheken sollte sich jeweils eine lückenlose Sammlung aller erschienenen Bände befinden. Mittlerweile ist ein Großteil der Entscheidungen oberster Bundesgerichte allerdings auch online zugänglich (siehe hierzu sogleich unten III . 2. b)).
Ältere Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen und in Strafsachen aus den Jahren vor 1945 finden sich zudem in den Entscheidungssammlungen RGZ und RGS t.[39] Die Urteile dieser Gerichte finden sich im Volltext in der juris-Datenbank (hierzu sogleich unten II . 1.).
bb)Europäische und internationale Gerichte
Auf europäischer Ebene ist in erster Linie der Europäische Gerichtshof von Bedeutung. Dieser besteht aus dem Gerichtshof der Europäischen Union (Eu GH ) und dem Gericht (EuG). Daneben gibt es auf der dritten Stufe noch die Fachgerichte, so im Moment vor allem das Gericht für den öffentlichen Dienst der Europäischen Union (EuGöD).[40]
Die Entscheidungen des Eu GH und des EuG sind bis 2011 in der amtlichen sog. allgemeinen Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofs und des Gerichts (Slg.), bestehend aus zwei Teilen (Teil I mit Entscheidungen des Eu GH und Teil II mit solchen des EuG), auf Papier veröffentlicht worden.[41] Seit 2012 wird die allgemeine Sammlung ausschließlich in digitaler Form auf der Website „ EUR -lex“[42] veröffentlicht. Über das Suchformular der Curia-Website[43] lässt sich auch ältere Rechtsprechung, meistens inklusive der jeweiligen Schlussanträge des Generalanwalts, finden.
Schließlich sind auch noch die digitalen Entscheidungssammlungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ( EGMR )[44] und – für das internationale Recht – des Internationalen Gerichtshofs ( IGH )[45] in Den Haag zu nennen.
|19|b) Kommentarwerke
Juristische Kommentarwerke arbeiten ein Rechtsgebiet oder Teile eines Rechtsgebiets umfassend und systematisch auf. Sie befassen sich dabei in der vom Gesetz vorgegebenen Abfolge mit einzelnen Artikeln, Paragraphen oder Abschnitten der jeweiligen Gesetzeswerke oder Regularien.[46] Die innere Struktur der Kommentierung und die Argumentation zu den einzelnen Vorschriften weisen dabei regelmäßig eine systematische und auf die praktische Rechtsanwendung ausgerichtete Struktur auf. So finden sich im Ansatz regelmäßig immer Aussagen zu Systematik, Entstehungsgeschichte und Zweck der jeweils kommentierten Gesetzesnormen und Regelungsbereiche. Die Erläuterung der Tatbestandsmerkmale und der Rechtsfolgen berücksichtigt stets die Rechtsprechung und das zu den jeweiligen Fragen vorhandene Schrifttum. Dies erklärt die besondere Bedeutung der Kommentarwerke für die juristische Praxis.
aa)Eignung für die Studienarbeit
Für die Bearbeitung einer juristischen Studienarbeit ist zu unterscheiden. Für den direkten Einstieg in ein Rechtsgebiet eignen sich Kommentarwerke allenfalls in Ausnahmefällen. Nur in Fällen, in denen der gesamte Kommentar – oder der Abschnitt einer Kommentierung – dazu bestimmt ist, neben den notwendigen Detailinformationen auch einen Überblick zu verschaffen, empfiehlt sich der sofortige Blick in ein Kommentarwerk. Das beste Beispiel für eine derartige „Überblickskommentierung“ im Zivilrecht ist:
Jacoby, Florian/von Hinden, Michael, Studienkommentar BGB , 15. Aufl., München 2015.
Immer noch hilfreich können auch Vorauflagen sein.
Kropholler, Jan, Studienkommentar BGB , 10. Aufl., München 2007.
Ebenso können auch in ausführlichen Kommentarwerken jeweils einzelne Abschnitte dazu geeignet sein, einen Überblick zu verschaffen. Dies ist z.B. der Fall, wenn der Kommentierung einzelner Vorschriften eines Rechtsgebiets eine Zusammenfassung vorangestellt ist. Diese „Vorkommentierungen“ sind dann in der Regel mit „Vorbemerkung“ oder „Vor §§ 677ff.“ sowie ähnlichen Kennzeichnungen versehen, die deutlich machen, dass für das gesamte Gebiet geltende allgemeine Fragen in der Vorkommentierung quasi „vor die Klammer gezogen“ werden.
Dornis, in: Westermann u.a., Erman BGB , Bd. 1, 15. Aufl. 2017, Vor §§ 677ff. BGB
|20|Von diesen genannten Überblickskommentierungen abgesehen befassen sich die meisten Kommentare aber ohne systematisch-einführende Erläuterung auf hohem Niveau und mit zahlreichen Details mit den Einzelfragen und Streitpunkten der jeweils kommentierten Vorschriften.
Aus diesem Grund eignen sich Kommentierungen regelmäßig nicht zum Einstieg in die Bearbeitung einer Studienarbeit. Kommentarwerke erlangen darum in der Regel erst in einem späteren Stadium der Bearbeitung Bedeutung.
bb)Kategorisierung
Bei Kommentarwerken ist nach verschiedenen Kategorien der Aufbereitung zu differenzieren.
Besondere Bedeutung in der Praxis haben die vertieft-wissenschaftlichen Kommentarwerke (sogenannte Großkommentare), die eine umfassende Aufbereitung der Thematik zum Ziel haben. Daneben existiert eine Vielzahl kürzerer Werke (vereinzelt als „Kurzkommentare“ bezeichnet), in denen nur die wesentlichen Probleme erörtert und weiterführende Fragen allenfalls angesprochen sowie mit weiterführenden Nachweisen versehen werden.[47] In die letztgenannte Kategorie fallen die meisten sogenannten Praktikerkommentare, die darauf angelegt sind, überwiegend von Richtern, Rechtsanwälten und Juristen in der Verwaltung genutzt zu werden. Deren Ausrichtung ist stark an der Rechtsprechung orientiert. Zum Teil ist sogar ausdrücklich von sogenannten Präjudizienkommentaren die Rede.[48]
Zur ersten Kategorie gehören etwa die jeweils mehrbändigen Werke des Münchener Kommentars zum BGB [49] und des „Staudingers“[50] sowie des „Soergels“[51], wohl auch noch des „Erman“[52].
Der zweiten Gattung gehören der „Palandt“[53] und der „Jauernig“[54] sowie die neueren Werke des „Bamberger/Roth“[55] und des „Prütting/Wegen/Weinreich“[56] an.




























