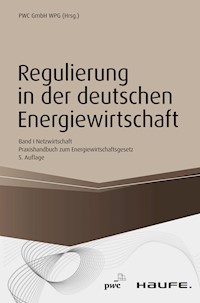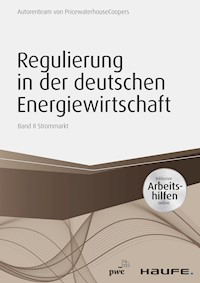
114,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haufe Lexware
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Haufe Fachbuch
- Sprache: Deutsch
Das Autorenteam erklärt Ihnen die verschiedenen gesetzlichen Vorgaben und die Auswirkungen auf den deutschen Strommarkt: z.B. das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das Kraft-Wärmekopplungs-Gesetz (KWKG) und deren Novelle von 2016, den Zertifikatehandel und wichtige EU-Vorgaben sowie das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewirtschaft. Der Band befasst sich zudem mit Zukunftsthemen wie virtuellen Kraftwerken, intelligenten Messsystemen, E-Mobility und den neuen Geschäftsmodellen, die sich durch die technologische Weiterentwicklung ergeben. Darüber hinaus wagen die Experten einen Ausblick auf den Strommarkt im Jahr 2030. Inhalte: - Technisch-wirtschaftliche Grundlagen des Strommarktes - Kostenstrukturen und Preisbildung - Politische Ziele und gesetzliche Rahmenbedingungen - Marktintegration von Renewables und Auswirkungen auf den Kraftwerkspark - Zukunftsthemen: Digitalisierung, neue Technologien und Systemansätze - Smart Grids und intelligente Mess-Systeme - Geschäftsmodelle auf dem Strommarkt der Energiewende Arbeitshilfen online: - Gesetzessammlung und Richtlinientexte - Begründungen zu den Gesetzen und Verordnungen - Weitere Unterlagen zu ausgewählten Einzelfragen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 778
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Verzeichnis der Bearbeiterinnen und Bearbeiter
Inhaltsübersicht
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
1 Einführung
1.1 Energiewende und Strommarktdesign
1.2 Kernfragen des Strommarktdesigns
1.3 Der Strommarkt 2.0
1.4 Energiewende als Chance für Unternehmen
1.5 Anpassung der Unternehmensstrategien
2 Grundlagen des Strommarkts
2.1 Technisch-wirtschaftliche Grundlagen der Stromwirtschaft
2.1.1 Stromerzeugung
2.1.1.1 Konventionelle Stromerzeugung
2.1.1.2 Erneuerbare Stromerzeugung
2.1.1.3 Einteilung von Kraftwerkstypen nach ihrem Verwendungszweck
2.1.2 Stromübertragung und -verteilung
2.1.3 Stromimport und -export
2.1.4 Stromverbrauch
2.2 Kostenstrukturen und Preise
2.2.1 Kosten der Stromerzeugung
2.2.1.1 Kapitalkosten
2.2.1.2 Betriebskosten
2.2.1.3 Brennstoffkosten
2.2.1.4 Kosten für CO2-Emissionen
2.2.2 Kosten der Stromübertragung und -verteilung
2.2.2.1 Netzentgelte
2.2.2.2 Einflussfaktoren auf die Netzentgelte
2.2.3 Strompreis einschließlich Umlagen und Steuern
2.2.3.1 Welche Umlagen und Steuern werden erhoben?
2.2.3.2 Struktur der Preisbestandteile und Einflussgrößen
2.3 Preisbildung auf dem deutschen Strommarkt
2.3.1 Die unterschiedlichen Preisbildungsmechanismen
2.3.1.1 Over The Counter (OTC-Handel)
2.3.1.2 Börsenhandel
2.3.1.3 Preisbildung an der Börse
2.3.3 Ausblick auf zukünftige Entwicklungen
2.4 Preisaufsicht
2.4.1 Kartellrechtliche Preisaufsicht
2.4.2 Markttransparenz durch das neue Strommarktgesetz
2.4.3 Weitere Möglichkeiten der Marktpreisaufsicht
2.4.3.1 ACER
2.4.3.2 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen
2.4.3.3 Handelsüberwachungsstelle der EEX
2.5 Bedeutung der deutschen Stromwirtschaft für Deutschland und Nachbarn
2.5.1 Vorgehen und verwendete Daten für die Analyse
2.5.2 Verflechtung der deutschen Stromwirtschaft mit weiteren Wirtschaftssektoren im In- und Ausland
2.5.3 Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte der deutschen Stromwirtschaft
2.5.3.1 Bruttowertschöpfung und Bruttoinlandsprodukt
2.5.3.2 Beschäftigung
2.5.3.3 Treibhausgas
2.5.4 Volkswirtschaftliche Einschätzung der Energiewende
3 Der Strommarkt für die Energiewende
3.1 Politische Ziele und gesetzliche Rahmenbedingungen
3.1.1 Energiepolitik in der EU und in Deutschland
3.1.2 EU-Vorgaben und Umsetzung in deutsches Regelwerk
3.1.2.1 Binnenmarktrichtlinien
3.1.2.2 Umwelt- und klimapolitische Richtlinien
3.1.2.3 Digitalisierung des Messwesens
3.1.2.4 Beihilfenrechtlicher Rahmen
3.1.3 Oberziele in Deutschland
3.1.3.1 Umweltverträglichkeit
3.1.3.2 Wirtschaftlichkeit
3.1.3.3 Versorgungssicherheit
3.2 Emissionshandel
3.2.1 Logik des Emissionshandels
3.2.2 Ausgestaltung des europäischen Emissionshandels
3.2.3 Der Emissionshandel in der Kritik
3.3 Marktintegration erneuerbarer Energien
3.3.1 Heranführung an den Markt
3.3.1.1 Die Entwicklung bis zum EEG 2014
3.3.1.2 Das EEG 2017
3.3.1.3 Ausdehnung des Ausschreibungsmodells
3.3.1.4 Prozess- und Systemaspekte des EEG 2017
3.3.1.5 Exkurs: Dezentrale Erzeugungskonzepte
3.3.2 Bilanzkreistreue
3.4 Anreize für Neuinvestitionen in Erzeugungskapazität
3.4.1 Reicht der Energy-only-Markt aus?
3.4.2 Arten von Kapazitätsmechanismen
3.4.3 Investitionsanreize durch konsistente Preissignale
3.5 Kraftwerksmix für die Energiewende
3.5.1 Veränderung des Kraftwerksparks
3.5.2 Ausstieg aus der Kernenergieerzeugung
3.5.2.1 Änderungen des Atomgesetzes
3.5.2.2 Verfahren bei Stilllegung, Rückbau und Endlagerung
3.5.2.3 Finanzierung des Kernenergieausstiegs
3.5.2.4 Klageverfahren
3.5.3 Ausstieg aus der Stromerzeugung aus Kohle?
3.5.3.1 Stand der Diskussion
3.5.3.2 Sicherheitsbereitschaft für Braunkohle
3.5.3.3 Effekte des Kohleausstiegs auf die CO2-Emissionen
3.5.4 Gaskraftwerke
3.5.4.1 Aktuelle Rolle der mit Erdgas befeuerten Kraftwerke
3.5.4.2 Wirtschaftliche Situation der Gaskraftwerke
3.6 Versorgungssicherheit
3.6.1 Europäischer Regelungsrahmen (Strom und Gas)
3.6.2 Nationaler Regelungsrahmen
3.6.3 Vorgaben zur Abschaltkaskade
3.6.4 Regelenergie
3.6.5 Redispatch
3.6.6 Netzreserve
3.6.7 Kapazitätsreserve und Sicherheitsbereitschaft
3.7 Vernetzungen in Europa
3.7.1 Bedeutung der Grenzkuppelkapazitäten
3.7.2 Status Quo: Verbundnetz Strom
3.7.3 Öffnung der Märkte für Regelenergie
3.7.4 Auftrennung der DE-AT Strompreiszone
4 Technologien zur Umsetzung der Energiewende
4.1 Smart Grid und intelligente Messsysteme
4.1.1 Smart Grid in der Energiewende
4.1.2 Anforderungen an ein Smart Grid
4.1.3 Smart Meter Gateway und Administration
4.1.4 Typische Betriebs- und Geschäftsprozesse
4.1.5 IT-Architektur und Technologiestack von der Zentrale bis zum Zählerschrank
4.1.6 Flexibilität im Energiesystem aus Netzsicht
4.1.7 Flexibilität im Energiesystem aus Vertriebssicht
4.1.8 Rolle von Speichern, Demand Side Management und virtuellen Kraftwerken für das Smart Grid
4.1.9 Smart Meter Rollout und Bedeutung für das deutsche Energiesystem
4.1.9.1 Das Messstellenbetriebsgesetz
4.1.9.2 Moderne Messeinrichtung
4.1.9.3 Intelligente Messsysteme
4.2 Virtuelle Kraftwerke
4.2.1 Begriffsdefinition
4.2.2 Virtuelle Kraftwerke im Smart Market und im Smart Grid: Nutzen und Einsatzfelder
4.2.3 Technologien und Komponenten virtueller Kraftwerke
4.2.4 Virtuelle Kraftwerke: Eine Integrationsaufgabe in Echtzeit
4.3 Speicher
4.3.1 Überblick zu Stromspeichertechnologien
4.3.2 Marktüberblick Deutschland
4.3.3 Entwicklungen und Trends
4.3.4 Stromspeicher und EEG sowie Stromsteuer
4.4 Power-to-X
4.4.1 Power-to-Gas
4.4.1.1 Spartenübergreifende Systemlösung – Definition und Standortbestimmung
4.4.1.2 Produkte Wasserstoff (Technologie Elektrolyse) und Methan (Technologie Methanisierung)
4.4.1.3 Bedeutung als Stromspeicher und Systemdienstleister
4.4.1.4 Potenziale im Zusammenhang mit dem Erdgasnetz
4.4.1.5 Umsetzungsstand in Deutschland und entwicklungstechnische Tendenzen
4.4.1.6 Rechtliche Rahmenbedingungen
4.4.1.7 Kriterien für eine Standortwahl/erfolgskritische Faktoren
4.4.1.8 Bedeutung von Power-to-Gas für den Mobilitätssektor
4.4.2 Power-to-Heat
4.4.2.1 Sektorübergreifende Systemlösung – Definition und Standortbestimmung
4.4.2.2 Die Power-to-Heat-Technologie
4.4.2.3 Bedeutung als Systemdienstleister
4.4.2.4 Umsetzungsstand in Deutschland und entwicklungstechnische Tendenzen
4.4.2.5 Rechtliche Rahmenbedingungen
4.4.2.6 Kriterien für eine Standortwahl/erfolgskritische Faktoren
4.5 Lastmanagement (Demand Side Management)
4.5.1 Flexibilisierung des Stromsystems
4.5.2 Demand Side Management
4.5.3 Lastmanagement zur Integration erneuerbarer Energien
4.5.4 Die Verordnung zu abschaltbaren Lasten und sonstige Erlösmöglichkeiten
4.5.5 Arten von Lastmanagement
4.5.6 Entwicklungen im Bereich Demand Side Management
4.5.7 Potenziale von Lastmanagement
4.5.8 Zukünftige Herausforderungen
5 Energieeffizienz und Sektorkopplung
5.1 Energieeffizienz
5.1.1 Politikziel Energieeffizienz
5.1.2 Energieaudits und Energiemanagementsysteme
5.1.2.1 Energieaudits nach DIN EN 16247-1
5.1.2.2 Energiemanagementsystem nach ISO 50001
5.1.3 Energieeffizienz-Netzwerke
5.1.3.1 Bedeutung
5.1.3.2 LEEN-Managementsystem
5.1.3.3 30 Pilot-Netzwerke
5.1.3.4 Initiative Energieeffizienz-Netzwerke
5.1.3.5 Herausforderungen bei Energieeffizienz-Netzwerken
5.2 Wärme
5.2.1 Überblick
5.2.2 Rahmenbedingungen
5.2.3 Maßnahmen zur Umsetzung der Energiewende im Wärmemarkt
5.2.4 Weiterentwicklung rechtlicher Vorgaben im Wärmemarkt
5.2.4.1 Gebäudeenergiegesetz (RefE)
5.2.4.2 Mieterstromgesetz (RefE)
5.3 Alternative Antriebstechnologien und Lösungsansätze im Bereich Verkehr
5.3.1 Rahmenbedingungen für Mobilität und Verkehr in Deutschland
5.3.1.1 Wachsender Verkehr
5.3.1.2 Ansprüche an „grüne Städte“
5.3.1.3 Überschreitung von Schadstoff-Grenzwerten in Ballungszentren
5.3.1.4 Rechtliche Rahmenbedingungen
5.3.1.5 Klimapolitische Debatte
5.3.2 Alternative Antriebe als Bausteine eines künftigen Mobilitätssystems
5.3.2.1 Marktentwicklung und Herausforderungen
5.3.2.2 Elektroantrieb
5.3.2.3 Brennstoffzellentechnologie
5.3.2.4 Gasbetriebene Fahrzeuge
5.3.3 Spezifische Lösungsansätze für Städte und Kommunen
5.3.4 Ausblick und Chancen
6 Digitalisierung in der Energiewirtschaft
6.1 Veränderungen durch Digitalisierung
6.1.1 Digitalisierung als Megatrend
6.1.2 Veränderungen entlang der Wertschöpfungskette
6.1.3 Chancen und Herausforderungen für Energieversorger
6.2 Data Analytics als prozessübergreifende Entscheidungsgrundlage
6.2.1 Zusammenspiel der Marktteilnehmer und Auswirkungen auf die Daten- und Prozessqualität
6.2.2 Datenbasierte Lösungsansätze
6.2.3 Wettbewerb und Kundenwert
6.3 Datensicherheit
6.3.1 Wachsendes Gefahrenpotenzial – auch für kritische Infrastrukturen
6.3.2 Die Zukunft des Internetprotokolls – Chancen und Risiken
6.3.3 Das „Internet of Things“ – IoT
6.3.4 Gesetzliche und regulatorische Anforderungen zur digitalen Sicherheit
6.3.4.1 Kritische Infrastrukturen
6.3.4.2 IT-Sicherheitsgesetz
6.3.4.3 IT-Sicherheitskatalog der BNetzA
6.3.5 Einrichtung eines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS)
6.4 Blockchain-Anwendungen in der Energiewirtschaft
6.4.1 Vertrauen ohne Mittelsmann
6.4.2 Anwendungsbeispiele in der Energiewirtschaft
6.4.3 Entwicklung, Chancen und Risiken
6.5 Wandel zu einem digitalen EVU
6.5.1 Fokus auf den Faktor Mensch
6.5.2 Neue Formen der Zusammenarbeit, Mitsprache und Arbeitsplatzgestaltung als wichtige Bestandteile
6.5.3 d.quarks – elementare Bausteine der digitalen Transformation
6.5.3.1 Agile Kollaboration
6.5.3.2 Partizipation
6.5.3.3 Arbeitsplatzgestaltung
6.5.4 Entwicklung einer digitalen Kultur
7 Geschäftsmodelle im Strommarkt der Energiewende
7.1 Herkömmliche Geschäftsmodelle unter Druck
7.2 Erzeuger
7.2.1 Erzeugungskonzepte von der dezentralen Einzelanlage über das Großkraftwerk bis zum Anlagencluster
7.2.2 EOM, Regelleistung, Direktvermarktung, Kapazitätsmarkt: Gibt es den optimalen Markt?
7.2.3 Chancen, Risiken und Hedgingstrategien der Erzeugung
7.2.4 Stärken- und Schwächenprofile der verschiedenen Arten von Erzeugungsanlagen
7.2.5 Anlagenzugriff: Die zukünftige Rolle des Anlagen-Contracting
7.2.6 Virtuelle Kraftwerke als Geschäftsmodell
7.2.6.1 Marktüberblick Deutschland und Einflüsse auf europäischer Ebene
7.2.6.2 Ausblick auf die nächsten fünf Jahre
7.2.7 Veränderungen im Geschäftsmodell von Großkraftwerken
7.3 Handel und Beschaffung einschließlich Bilanzkreisverantwortliche
7.3.1 Der Energiehandel als Geschäftsmodell
7.3.2 Optimierung und Dispatching
7.3.2.1 Grundsätzliches Vorgehen
7.3.2.2 Intraday-/Day-Ahead-Handel und Regelenergie
7.3.2.3 Terminhandel
7.4 Netzbetreiber
7.4.1 Smart Grid Operator
7.4.2 Bereitstellung von Prozessen und IT
7.4.3 Nutzung der Breitbandtechnologie
7.4.4 Aufbau einer E-Mobility-Struktur
7.5 Energiedienstleistungen
7.5.1 Geschäftsmodell Energiedienstleister
7.5.2 Von der Energieberatung zum Energiemanagement
7.5.3 Wachstumschancen – Welche Themen haben Zukunftspotenzial?
7.5.4 Kernkompetenzen für den Dienstleistungsmarkt
7.6 Vertrieb
7.6.1 Kundenbedürfnisse – Was erwartet der Kunde?
7.6.2 Kundensegmentierung
7.6.3 Der Einfluss der Digitalisierung
7.6.4 Der Wandel vom Commodity- zum Lösungsanbieter
7.6.4.1 Serviceangebote zur Erweiterung des Produktportfolio
7.6.4.2 Verknüpfung mit Produkten aus dem energiefernen Bereich
7.6.4.3 Whitelabel-Produkte anbieten und umsetzen
7.6.4.4 Vertriebsplattformen
7.6.5 Kernfähigkeiten zur Umsetzung der neuen Produktwelt
7.7 Verbraucher (Industrie, Gewerbe, Haushalt, Prosumer)
7.7.1 Stromkosten
7.7.2 EEG-Umlage
7.7.2.1 Eigenerzeugung, Eigenversorgung, Stromspeicher und Mieterstrommodelle i.S.d. EEG 2017
7.7.2.2 Besondere Ausgleichsregelung gem. §§ 63 ff. EEG 2017
7.7.3 KWKG-Umlage
7.8 Geschäftsmodelle im Messstellenbetrieb
7.8.1 Einführung in die Geschäftsmodelllandschaft des Messstellenbetriebs
7.8.2 Geschäftsmodell des grundzuständigen Messstellenbetreibers
7.8.3 Geschäftsmodell des wettbewerblichen Messstellenbetreibers
7.8.4 Geschäftsmodell des Smart Meter Gateway Administrators
8 Investoren und ihre Transaktionsentscheidungen
8.1 Transaktionsumfeld im Strommarkt
8.2 Investoren
8.2.1 Überregional-integrierte Energieversorger
8.2.2 Regionale Energieversorger und Kommunen
8.2.3 Finanzinvestoren
8.2.4 Bürgerbeteiligungen und Privatinvestoren
8.3 Transaktionsobjekte im Strommarkt
8.3.1 Konventionelle Stromerzeugung
8.3.2 Erneuerbare Energien
8.3.3 Exkurs: Auswirkungen der EEG-Novelle auf den Onshore-Windenergiemarkt aus Sicht der Kapitalgeber
8.3.3.1 Allgemein erwartete Konsequenzen für den deutschen Onshore-Windenergiemarkt
8.3.3.2 Investorenzuwachs schmälert die Renditen
8.3.3.3 Rolle der Banken
8.3.3.4 Nachfrage nach Onshore-Projekten
8.3.4 Dezentrale Stromerzeugung und virtuelle Kraftwerke
8.3.5 Energiedienstleistungen und digitale Kundenlösungen
8.3.6 Netze und Smart Grids
8.4 Bewertung der Transaktionsobjekte
8.4.1 Bewertungsmethoden
8.4.2 Finanzielle Überschüsse und Cash-Flow
8.4.3 Energiespezifische Besonderheiten bei der Planung der Cash-Flows
8.4.4 Kapitalisierungszinssatz
8.4.5 Energiespezifische Besonderheiten bei der Ermittlung des Kapitalisierungszinssatzes
8.4.6 Transaktionswerte
8.5 Fazit und Ausblick
9 Ausblick auf Strommarkt 2030
Stichwortverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Arbeitshilfen online
Hinweis zum Urheberrecht
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Freiburg
Ihre Arbeitshilfen zum Download:
Die folgenden Arbeitshilfen stehen für Sie zum Download bereit:
Gesetzessammlung und Richtlinientexte
Begründungen zu den Gesetzen und Verordnungen
Weitere Unterlagen zu ausgewählten Einzelfragen
Den Link sowie Ihren Zugangscode finden Sie am Buchende.
Regulierung in der deutschen Energiewirtschaft
Regulierungin der deutschen Energiewirtschaft
Band II Strommarkt
Herausgegeben von
PricewaterhouseCoopers
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
1. Auflage
Haufe GruppeFreiburg · München · Stuttgart
Zitiervorschlag:PwC-Bearbeiterin/Bearbeiter, Strommarkt, Abschnitt x.y.z.
Bibliografische Information der deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print: ISBN 978-3-648-09631-4 Bestell-Nr. 10220-0001
ePUB: ISBN 978-3-648-09632-1 Bestell-Nr. 10220-0100
Regulierung in der deutschen Energiewirtschaft, Band II Strommarkt1. Auflage 2017© 2017 Haufe-Lexware GmbH & Co. [email protected]: Bettina Noé
Nachdem sich mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Autorenschaft teilen, ist es nicht möglich gewesen, das Werk an allen Stellen auf dem neuesten Stand zu halten. Die Angaben entsprechen dem Wissensstand bei Redaktionsschluss am 31.01.2017. Vereinzelt konnten noch neuere Entwicklungen bis Ende März 2017 berücksichtigt werden. Da Hinweise und Fakten dem Wandel der Rechtsprechung und Gesetzgebung unterliegen, kann für die vorliegenden Angaben keine Haftung übernommen werden; dafür bitten wir die Leserschaft um Verständnis.Die Informationen sind nur für den persönlichen Gebrauch des Lesers bestimmt. Dieses Werk sowie alle darin enthaltenen einzelnen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronische Systeme. Alle im Buch angegebenen Internetverbindungen wurden letztmals am 30.04.2016 abgerufen.
Lektorat: Ulrike Fuldner, Rechtsanwältin, FA für Steuerrecht, AschaffenburgDTP: Agentur: Satz & Zeichen, Karin Lochmann, BuckenhofDruck: BELTZ Bad Langensalza GmbH, Bad Langensalza
Vorwort
Schon bei den Vorbereitungen für die Neuauflage des Bandes I unseres Buches „Regulierung in der deutschen Energiewirtschaft – Netzwirtschaft“ entstand die Idee, auch weitere Themen aus dem Sektor der Energiewirtschaft für ein interessiertes Fachpublikum praxisorientiert aufzubereiten und damit verständlicher zu machen. Dabei wurde schnell klar, dass die Situation der beiden erstrangigen Energieträger Strom und Gas im Gegensatz zum Band I nicht sinnvoll gemeinsam dargestellt werden kann – zu groß sind die Unterschiede beider Energiearten; man denke nur an die verschwindend geringe Gaserzeugung in Deutschland im Gegensatz zur aktuellen Überkapazität bei der deutschen Stromerzeugung. Das Speicherproblem kann bei der Gasversorgung als gelöst betrachtet werden, bei der Stromerzeugung jedoch stellt es eine der großen technisch-wirtschaftlichen Herausforderungen dar. Auch unter Umweltaspekten liegen Gas- und Stromwirtschaft „meilenweit“ auseinander. Der Begriff der „Energiewende“, der uns täglich begleitet und im Portemonnaie der Verbraucher spürbare Folgen hat, ist bislang weitestgehend mit der Stromwirtschaft verknüpft.
Sehr schnell stand also fest, dass sich Band II unseres Buches auf die Stromwirtschaft konzentrieren würde. Während wir zu Beginn unserer Überlegungen meinten, den Fokus auf die Stromerzeugung legen zu können, wurde doch bald klar, dass ein solcher Themenkreis viel zu eng gezogen wäre. Wir haben uns deshalb im Autorenkreis einmütig entschieden, den Strommarkt insgesamt zu beleuchten, allerdings unter weitestgehender Ausklammerung der bereits im Band I behandelten Probleme der Netzwirtschaft. Natürlich lässt sich der Strommarkt ohne Netze nicht darstellen. Die Stichworte „Smart Grid“, „Smart Meter Rollout“, „Gateway Administrator“ und „Virtuelle Kraftwerke“ verdeutlichen die Zusammenhänge auch ohne weitere Erläuterungen. Die „Digitalisierung“ mit all ihren Facetten ist auch in der Stromwirtschaft eine große Herausforderung für die Unternehmen. Traditionelle Geschäftsmodelle geraten „außer Mode“; sie müssen – beginnend mit der Umgestaltung der Erzeugungs- und Verteilungsanlagen über Veränderungen der internen Unternehmensstruktur und -kultur bis hin zur Angebotspalette und im Umgang mit Kunden an die sich ändernde Situation angepasst werden.
Keine leichte Aufgabe, die wir uns da gestellt haben, so viel war den Beteiligten recht bald klar. Die Strukturen und Handlungsweisen sind im Strommarkt sehr eng miteinander verknüpft. Ihre hochkomplexe Funktionsweise ist nur schwer zu durchschauen; wir haben es mit einem Marktgeschehen zu tun, das sich ohne Big Data und ohne Digitalisierung nicht mehr steuern lässt. Immer weniger Akteure sind diesen Herausforderungen – auch bei weitgehender Inanspruchnahme externer Dienstleister – gewachsen.
Eine Gesamtsicht „aus einem Guss“ ist auch wegen unterschiedlicher politischer Ansichten und der erforderlichen Harmonisierung mit EU-Vorgaben nur schwer möglich. Eine stimmige Gesamtregelung des Strommarktes seitens des nationalen Gesetzgebers erscheint nahezu ausgeschlossen. Stets muss auf Vorhandenem aufgesetzt und an den Rändern neu justiert werden. Daraus resultiert zwangsläufig ein Flickenteppich, der bereits bei einer Lektüre des vielfach geänderten Energiewirtschaftsgesetzes von 2005 ins Auge springt, ganz abgesehen von den großen Veränderungen, die in den letzten Jahren EEG und KWKG – auch unter dem Einfluss aus Brüssel – erfahren haben.
Wir haben das Werk mit einigen Anläufen dennoch bewältigt und sind nicht ohne Stolz, dass es uns gelungen ist, wichtige Einzelfragen und Zusammenhänge sinnhaft darzustellen. Im Umfang und in der Intensität der Stoffbehandlung einschließlich der Darstellung der anzuwendenden Rechtsquellen geht dieses Handbuch über die sonst vorliegenden Erläuterungswerke hinaus. Ergebnis ist ein Werk, das wesentliche Rahmenbedingungen darstellt und die Alltagsarbeit in den Unternehmen mit der Gründlichkeit eines Handkommentars hinreichend unterstützen kann. Für eine weitere Vertiefung wird allerdings auf Spezialliteratur und tagesaktuelle Quellen zurückzugreifen sein.
Nach wie vor sind wir unserem Ansatz treu geblieben, ein „Handbuch für die Praxis“ zu verfassen, im Unternehmensalltag verwendbare Informationen zu vermitteln und – wo sinnvoll und möglich – Lösungen aufzuzeigen. Wir hoffen, dass das Werk diesem Zweck gerecht wird.
Das Werk nutzt die Erfahrungen unserer in der Versorgungswirtschaft und den angrenzenden Feldern tätigen Mitarbeiter mit entsprechend breiter praktischer Projekterfahrung. Für Hinweise jeder Art sind Herausgeber und Autoren dankbar. Der Gegenstand dieser Publikation wird auch künftig steter Veränderung unterworfen bleiben.
Wir bedanken uns bei Frau stud. jur. Anna Misko für die Erstellung des Literaturverzeichnisses sowie bei Frau M.A. Anja Cavunt und Herrn Dipl.-Kfm. Thomas Dautzenberg für ihre umsichtige organisatorische Betreuung der Autoren und des „Making-Of“ des Werks. Unser Dank gilt schließlich Herrn Rechtsanwalt Wolfgang Britsch, der diese Publikation als hausinterner Schriftleiter redaktionell, gestalterisch und harmonisierend begleitet hat. Den Autoren danken wir für ihre sachkundigen Entwürfe und für ihre Bereitschaft, sich mit ihren Texten in die Erfordernisse eines in sich möglichst geschlossenen Gesamtwerks einzuordnen.
Das Buch wäre ohne die jahrelange Einbindung der Autoren in die Arbeiten der PricewaterhouseCoopers GmbH WPG und der PricewaterhouseCoopers Legal AG mit den sich daraus ergebenden vielfältigen Anregungen und ohne den kritischen Gedankenaustausch mit den Kollegen nicht zustande gekommen. Hierfür sei auch an dieser Stelle allen Beteiligten gedankt. Der PricewaterhouseCoopers GmbH WPG ist ebenfalls dafür zu danken, dass sie das Entstehen dieses Werks finanziell ermöglicht hat.
Düsseldorf, im März 2017
Norbert SchwietersRalf KurtzVolker BreisigChristian LiebaugMichael KopetzkiPeter MussaeusDer Herausgeber
PwC
Über uns: Unsere Mandanten stehen tagtäglich vor vielfältigen Aufgaben, möchten neue Ideen umsetzen und suchen Rat. Sie erwarten, dass wir sie ganzheitlich betreuen und praxisorientierte Lösungen mit größtmöglichem Nutzen entwickeln. Deshalb setzen wir für jeden Mandanten, ob Global Player, Familienunternehmen oder kommunaler Träger, unser gesamtes Potenzial ein: Erfahrung, Branchenkenntnis, Fachwissen, Qualitätsanspruch, Innovationskraft und die Ressourcen unseres Expertennetzwerks in 157 Ländern. Besonders wichtig ist uns die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Mandanten, denn je besser wir sie kennen und verstehen, umso gezielter können wir sie unterstützen.
Der Bereich Energy von PwC ist Teil des internationalen Energy-Netzwerks mit etwa 4.000 qualifizierten Branchenexperten. Wir betreuen Mandanten aller Größenklassen: von großen internationalen börsennotierten Energiekonzernen über Regionalversorger bis hin zu kommunalen und in verschiedensten Stufen des Querverbundes tätigen öffentlichen Unternehmen, Institutionen und Industrieverbänden. Zu unseren Mitarbeitern zählen neben Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Juristen auch Wirtschaftswissenschaftler, Diplomingenieure, Naturwissenschaftler, IT-Spezialisten, Umweltprüfer und -berater, Restrukturierungsspezialisten sowie weitere Experten mit Know-how aus der Versorgungs- und Energiewirtschaft.
PwC: Mehr als 10.300 engagierte Menschen an 22 Standorten. 1,9 Mrd. Euro Gesamtleistung. Führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft in Deutschland.
PwC Legal
Über uns: In unserer globalen, sich rasch verändernden Wirtschaftswelt sind Kooperation, Umstrukturierung, Transaktion, Finanzierung und gesellschaftliche Verantwortung Themen, die unsere Mandanten zunehmend beschäftigen. Für verschiedenste komplexe Aufgabenbereiche benötigen sie rechtliche Handlungssicherheit. Deshalb beraten wir sie ganzheitlich und in enger Zusammenarbeit mit den Steuer-, Human-Resources- und Finanzexperten von PwC und unserem internationalen Legal-Netzwerk in über 90 Ländern. Ob weltweit agierendes Unternehmen, öffentliche Körperschaft oder vermögende Privatperson, jedem Mandanten steht bei uns ein persönlicher Ansprechpartner zur Seite, der ihn in allen wirtschaftsrechtlichen Belangen verantwortungsvoll unterstützt. So helfen wir unseren Mandanten, ihren wirtschaftlichen Erfolg langfristig zu sichern.
PwC Legal: Mehr als 200 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte an 18 Standorten. Integrierte Rechtsberatung für die Praxis.
Verzeichnis der Bearbeiterinnen und Bearbeiter
Joachim AlbersmannDipl.-Ingenieur (Elektrotechnik)
Michael AlkemeyerM.A.
Theresa BrandtM.Eng.
Derya BaghistaniM.Sc.
Daniel BeshahDipl.-Kaufmann
Dr. Volker BreisigDipl.-Ingenieur, Dipl.-Wirt.-Ingenieur
Adrian BründlM.Sc.
Dr. Daniel CallejonRechtsanwalt
Nicolas DeutschDipl.-Ökonom
Gunther DütschDipl.-Volkswirt
Pia EllendtMBA
Dr. Marcus EulDipl.-Wirt-.-Informatiker
Derk FischerDipl.-Mathematiker
Tobias FischerM.Sc.
Marc GoldbergRechtsanwalt
Hendrik GollnischDipl.-Ingenieur
Dr. Carsten HentrichDipl.-Informatiker
Dr. Borge HessDipl.-Volkswirt
Paula HesseM.Sc.
Ingo KamenzDipl.-Ingenieur
Janina KarthausM.Sc.
Hubertus KleeneRechtsanwalt
Christian KleinSteuerberater
Florian KöhnleinB.Eng.
Michael KopetzkiDipl.-Wirt.-Ingenieur
Michael H. KüperRechtsanwalt, M.Sc
Ralf KurtzDipl.-Kaufmann
Saskia LehmannM.Sc.
Christian LiebaugDipl.-Ingenieur
Christian LindenDipl.-Wirt.-Ingenieur
Julia MärzDipl.-Wirt.-Informatikerin
Dominik MartelRechtsanwalt, LL.M.
Dirk-Henning MeierRechtsanwalt, LL.M., M.Sc
Julian Meyer-WilmesB.Sc.
Peter MussaeusRechtsanwalt
Jörg NetzbandDipl.-Wirt.-Ingenieur
Felix NeuschwanderDipl.-Wirt.-Ingenieur
Jan Philipp OtterRechtsanwalt
Michael PachmajerDipl.-Geograph
Dr. Axel von PerfallDipl.-Kaufmann
Thomas PohlmeyerDipl.-Kaufmann
Ingo RauschRechtsanwalt
Reinhard RümlerDipl.-Forstwirt
Christoph SängerRechtsanwalt
Dr. Marc SalevicRechtsanwalt
Dr. Jan-Philipp SauthoffWirtschaftsprüfer
Laura SchanteyM.Sc.
Dr. Thomas SchmidWirtschaftsprüfer
André SchnelteDipl.-Kaufmann
Prof. Dr. Norbert SchwietersWirtschaftsprüfer, Steuerberater
Maik SinagowitzDipl.-Wirt.-Ingenieur
Michael SponringDipl.-Ingenieur
Tobias SteffensWirtschaftsprüfer
Dr. Georg TeichmannDipl.-Kaufmann
Christian TeßmannRechtsanwalt
Maximilian ThiesM.Sc.
Katja TiefenbacherDipl.-Wirt.-Informatikerin
Maximilian TöllnerRechtsanwalt
Klaus WassermannDipl.-Betriebswirt (FH)
Vincenz WeißflogM.Sc.
Inhaltsübersicht
Vorwort
Verzeichnis der Bearbeiterinnen und Bearbeiter
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
1 Einführung
1.1 Energiewende und Strommarktdesign
1.2 Kernfragen des Strommarktdesigns
1.3 Der Strommarkt 2.0
1.4 Energiewende als Chance für Unternehmen
1.5 Anpassung der Unternehmensstrategien
2 Grundlagen des Strommarkts
2.1 Technisch-wirtschaftliche Grundlagen der Stromwirtschaft
2.2 Kostenstrukturen und Preise
2.3 Preisbildung auf dem deutschen Strommarkt
2.4 Preisaufsicht
2.5 Bedeutung der deutschen Stromwirtschaft für Deutschland und Nachbarn
3 Der Strommarkt für die Energiewende
3.1 Politische Ziele und gesetzliche Rahmenbedingungen
3.2 Emissionshandel
3.3 Marktintegration erneuerbarer Energien
3.4 Anreize für Neuinvestitionen in Erzeugungskapazität
3.5 Kraftwerksmix für die Energiewende
3.6 Versorgungssicherheit
3.7 Vernetzungen in Europa
4 Technologien zur Umsetzung der Energiewende
4.1 Smart Grid und intelligente Messsysteme
4.2 Virtuelle Kraftwerke
4.3 Speicher
4.4 Power-to-X
4.5 Lastmanagement (Demand Side Management)
5 Energieeffizienz und Sektorkopplung
5.1 Energieeffizienz
5.2 Wärme
5.3 Alternative Antriebstechnologien und Lösungsansätze im Bereich Verkehr
6 Digitalisierung in der Energiewirtschaft
6.1 Veränderungen durch Digitalisierung
6.2 Data Analytics als prozessübergreifende Entscheidungsgrundlage
6.3 Datensicherheit
6.4 Blockchain-Anwendungen in der Energiewirtschaft
6.5 Wandel zu einem digitalen EVU
7 Geschäftsmodelle im Strommarkt der Energiewende
7.1 Herkömmliche Geschäftsmodelle unter Druck
7.2 Erzeuger
7.3 Handel und Beschaffung einschließlich Bilanzkreisverantwortliche
7.4 Netzbetreiber
7.5 Energiedienstleistungen
7.6 Vertrieb
7.7 Verbraucher (Industrie, Gewerbe, Haushalt, Prosumer)
7.8 Geschäftsmodelle im Messstellenbetrieb
8 Investoren und ihre Transaktionsentscheidungen
8.1 Transaktionsumfeld im Strommarkt
8.2 Investoren
8.3 Transaktionsobjekte im Strommarkt
8.4 Bewertung der Transaktionsobjekte
8.5 Fazit und Ausblick
9 Ausblick auf Strommarkt 2030
Stichwortverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Arbeitshilfen online
Abkürzungsverzeichnis
aJahrAAmperea.A.anderer Ansichta.a.O.am angegebenen Orta.E.am Endea.F.alte Fassunga.o.außerordentlich(e/er)Abb.AbbildungABl.AmtsblattAbLaVVerordnung über Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten 2016Abs.AbsatzACEREuropean Agency for the cooperation of the Energy RegulatorsAEUVVertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Fassung aufgrund des am 01.12.2009 in Kraft getretenen Vertrages von Lissabon)AFIDRichtlinie über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (EU)AGAktiengesellschaftAGVOAllgemeine GruppenfreistellungsverordnungAktGAktiengesetzAlt.AlternativeÄq.ÄquivalentARegVAnreizregulierungsverordnungArt.ArtikelAtGAtomgesetzAtVfVAtomrechtliche VerfahrensverordnungAufl.AuflageAusglMechVAusgleichsmechanismusverordnungBAFABundesamt für Wirtschaft und AusfuhrkontrolleBaFinBundesanstalt für FinanzdienstleistungsaufsichtBAnzBundesanzeigerBBDer Betriebs-Berater (Zeitschrift)BBPlGBundesbedarfsplangesetzBDEWBundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.Bek.BekanntmachungBGBBürgerliches GesetzbuchBGBl.BundesgesetzblattBGHBundesgerichtshofBGWBundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft e.V.Bh/aBenutzungsstunden pro JahrBHKWBlockheizkraftwerkBIKOBilanzkreiskoordinator(en)BImSchGBundesimmissionsschutzgesetzBImSchVBundesimmissionsschutzverordnungBIPBruttoinlandsproduktBI-ToolBusiness Intelligence Tool (Software zur systematischen Analyse von Daten)BKBeschlusskammerBKartABundeskartellamtBKMBilanzkreismanagementBKVBilanzkreisverantwortliche(r)BMFBundesministerium der FinanzenBMUBBundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und ReaktorsicherheitBMVIBundesministerium für Verkehr und digitale InfrastrukturBMWiBundesministerium für Wirtschaft und EnergiebneBundesverband Neuer Energieanbieter e.V.BNetzABundesnetzagenturBRDeutscher BundesratBR-Drs.Drucksache des Deutschen BundesratsBRegBundesregierungBSIBundesamt für Sicherheit in der Informationstechnikbspw.beispielsweiseBTDeutscher BundestagBT-Drs.Drucksache des Deutschen BundestagsBuchst.BuchstabeBVerfGBundesverfassungsgerichtBWSBruttowertschöpfungbzgl.bezüglichbzw.beziehungsweiseCACertificate AuthorityCAPMCapital Asset Pricing Model (Preismodell für Kapitalgüter bzw. Kapitalgutpreismodell)CCD CoECooperative Cyber Defence Centre of ExcellenceCCPCentral CounterpartyCCZCorporate Compliance ZeitschriftCDMClean Development Mechanism (Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung)CEERCouncil of European Energy RegulatorsCERCertified Emission ReductionsCIMComputer-integrated ManufacturingCLSControllabel Local SystemCO2KohlenstoffdioxidCOPCoefficient of PerformanceCPCertificate PolicyCRMCustomer Relationship ManagementCSVComma-separated values (Dateiformat)CtEurocentd.h.das heißtDEHStDeutsche EmissionshandelsstelledenaDeutsche Energie-Agentur GmbHDERDistributed Energy ResourcesDiGiNetz-GesetzGesetz zur Erleichterung des Ausbaus digitaler HochgeschwindigkeitsnetzeDQMDatenqualitätsmanagementDSCRDebt Service Coverage RatioDSLDigital Subscriber LineDSMDemand Side Management (Lastmanagement)DSRDemand Side ResponseDVDatenverarbeitungE2P-ratioEnergy to Power ratioEBITEarnings before interest and taxes (Gewinn vor Zinsen und SteuernEBITDAearnings before interest, taxes, depreciation and amortization (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände)ECCEuropean Commodity Clearing AGEDIFACTElectronic Data Interchange for Administration, Commerce and TransportEDL-GEnergiedienstleistungsgesetzEDMEnergiedatenmanagementEEAusGGesetz zur Einführung von Ausschreibungen für Strom aus erneuerbaren Energien und zu weiteren Änderungen des Rechts der erneuerbaren EnergienEEDEnergy Efficiency Directive (EU Energieeffizienzrichtlinie)EEGErneuerbare-Energien-GesetzEEG AnlagenAnlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren EnergienEEG-ProjekteProjekte für EEG-AnlagenEEWärmeGErneuerbare-Energien-WärmegesetzEEXEuropean Energy Exchangeel.elektrischElWOGElektrizitätswirtschafts und -organisationsgesetz (Österreich)EMASEco-Management and Audit SchemeEMIREuropean Market Infrastructure RegulationemwZeitschrift für Energie, Markt und WettbewerbEnEGEnergieeinsparungsgesetzEnergieStGEnergiesteuergesetzEnEVEnergieeinsparverordnungEnLAGGesetz zum Ausbau von EnergieleitungenENTSO-EEuropean Network of Transmission System Operators for Electricity (Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber)ENTSO-GEuropean Network of Transmission System Operators for Gas (Verband Europäischer Fernleitungsnetzbetreiber für Gas)EntsorgFondsGEntsorgungsfondsgesetzEnWGEnergiewirtschaftsgesetzEnWZZeitschrift für das gesamte Recht der EnergiewirtschaftEOMEnergy-only Market (Großhandelsmarktes für Energielieferungen)EREnergieRecht (Zeitschrift)ERGEGEuropean Regulators' Group for Electricity and GasERPEnterprise Resource Planning (Ressourcenplanung des gesamten Unternehmens)etEnergiewirtschaftliche Tagesfragen (Zeitschrift)etc.et ceteraEUEuropäische UnionEUAEuropean Emission AllowancesEU-ETSEU Emission Trading System (Europäischen Emissionshandelssystem)EuGHEuropäischer GerichtshofEuZWEuropäische Zeitschrift für WirtschaftsrechtEVUEnergieversorgungsunternehmenewdas magazin für die energie wirtschaft (Zeitschrift)EWeRKZeitschrift des Instituts für Energie- und Wettbewerbsrecht in der kommunalen Wirtschaft e.V.FCCFederal Communications CommissionFERCFederal Energy Regulatory CommissionFFAVFreiflächenausschreibungsverordnungFn.FußnoteFTTBFibre to the Basement/Building (Glasfaser bis ins Gebäude)FTTCFibre to the Curb (Glasfaser bis zur Bordsteinkante)FTTHFibre to the Home (Glasfaser bis in die Wohnung)GasNEVVerordnung über die Entgelte für den Zugang zu GasversorgungsnetzenGasNZVVerordnung über den Zugang zu GasversorgungsnetzenGbRGesellschaft bürgerlichen RechtsGDEWGesetzes zur Digitalisierung der EnergiewendeGEEVGrenzüberschreitende-Erneuerbare-Energien-VerordnungGEGGebäudeenergiegesetzgem.gemäßGEMIOGerman Economic Model of Inputs and OutputsGGGrundgesetzggf.gegebenenfallsGGPSSOGuidelines for Good TPA Practice for Storage System OperatorsGHDGewerbe, Handel und DienstleistungenGIS-SystemGrafisches InformationssystemGmbHGesellschaft mit beschränkter HaftunggMSBgrundzuständiger MessstellenbetreiberGPKEFestlegung einheitlicher Geschäftsprozesse und Datenformate zur Abwicklung der Belieferung von Kunden mit Elektrizitätgrds.grundsätzlichGuDGas- und Dampf (-kraftwerk)GWGigawattGWAGateway-AdministratorGWBGesetz gegen WettbewerbsbeschränkungenGWhGigawattstundehStundeHEOhöhere Entscheidungs- und OptimierungsfunktionenHGBHandelsgesetzbuchHÜStHandelsüberwachungsstelle bei der EEXi.d.F.in der Fassungi.d.R.in der Regeli.e.S.im engeren/eigentlichen Sinni.e.S.im engeren (eigentlichen) Sinni.S.d.im Sinne der/desi.S.v.im Sinne voni.V.m.in Verbindung miti.W.im Wesentlicheni.w.S.im weiteren SinnIDWInstitut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.IEAInternationale EnergieagenturIECInternational Electrotechnical Commission (Internationale Elektrotechnische Kommission)IFRSInternational Financial Reporting StandardsiKSinternes Kontrollsysteminsb.insbesondereIoTInternet of ThingsIRInfrastrukturrecht (Zeitschrift)IRRInternal Rate of Return (interner Zinsfuß)ISMSInformationssicherheits-ManagementsystemITInformationstechnologieITSiGIT-SicherheitsgesetzJIJoint Implementation (Gemeinschaftsreduktion)JVPJahresverbrauchsprognoseKAKonzessionsabgabeKap.KapitelKartBKartellbehörde(n)KAVVerordnung über Konzessionsabgaben für Strom und GasKernbrStGKernbrennstoffsteuergesetzKfWKreditanstalt für WiederaufbauKfZKraftfahrzeugkJKilojoulekmKilometerKraftNAVKraftwerks-NetzanschlussverordnungkVKilovoltkWKilowattkWhKilowattstundekWh/aKilowattstunden pro JahrKWK-AnlageKraft-Wärme-Kopplungs-AnlageKWKGKraft-Wärme-KopplungsgesetzkWpKilowatt Peak, maximale Leistung eines Photovoltaik-Moduls bzw. einer SolarstromanlageLANLocal Area NetworkLEENLernende Energieeffizienz-NetzwerkeLFLieferant(en)LGLandgerichtlit.littera (Buchstabe)LKartBLandeskartellbehördeLLCRLoan Life Coverage RatioLRegBLandesregulierungsbehörde(n)lt.lautLTELong Term EvolutionmMeterm.w.N.mit weiteren NachweisenM2MMachine to MachineMaBiSMarktregeln für die Bilanzkreisabrechnung StromMADMarktmissbrauchsrichtlinieMaKonVMarktmanipulations-KonkretisierungsverordnungMAPMarktanreizprogrammmcgMikrogrammMDMMeter Data ManagementMerit OrderEinsatzreihenfolge der KraftwerkeMg SMMegagramm SchwermetallMin.Minutemind.mindestensMio.MillionMIVmotorisierter IndividualverkehrMMSMeter Management SystemMrd.MilliardeMRLMinutenreserveleistungMSBMessstellenbetrieb/-betreiberMsbGMessstellenbetriebsgesetzMSDMessdienstleisterMSRMarktstabilitätsreserveMTSMarkttransparenzstelle für den Großhandel mit Strom und Gas bei der BNetzAMWMegawattMWhMegawattstunde (=1.000 kWh)MWpMegawatt Peak (Spitzenleistung eines Photovoltaik-Kraftwerks)NABEGNetzausbaubeschleunigungsgesetzNAPnationaler AllokationsplanNAPENationaler Aktionsplan EnergieeffizienzNAVNiederspannungsanschlussverordnungNBNetzbetreiberNEPNetzentwicklungsplanNetzResVNetzreserveverordnungNEVNetzentgeltverordnungNJWNeue Juristische WochenschriftNPENationale Plattform ElektromobilitätNr.NummerNRVNetzregelverbundesNRWNordrhein-WestfalenNVwZNeue Zeitschrift für Verwaltungsrechto.Ä.oder Ähnliche(s)o.g.oben genanntOCGTOpen Cycle Gas TurbineOLGOberlandesgerichtOPCOpen Platform CommunicationsÖPNVöffentlicher PersonennahverkehrOTCOver the Counter (über den Tresen)OTC-Handelaußerbörslicher Handelp.a.per annoPEVPrimärenergieverbrauchPJPetajoule (=1000 Terajoule entspricht etwa 278 GWh)PKIPublic Key Infrastructure (Public-Key-Infrastruktur)PLCPower Line CommunicationPLCRProject Life Coverage RatioPRLPrimärregelleistungPVPhotovoltaikPwCPricewaterhouseCoopersRdERecht der Energiewirtschaft (Zeitschrift)RdERecht der Energiewirtschaft (Zeitschrift)reBAPregelzonenübergreifender einheitlicher BilanzausgleichsenergiepreisREERecht der Erneuerbaren Energien (Viertelsjahresschrift)RefEReferentenentwurfRegERegierungsentwurfREMITRegulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency (Verordnung über die Integrität und Transparenz des Energiegroßhandelsmarkts)ResKVReservekraftwerksverordnungresp.respektiveRLMregistrierende LeistungsmessungRn.RandnummerROGRaumordnungsgesetzRSKReaktor-SicherheitskommissionRSK-SÜanlagenspezifische SicherheitsüberprüfungRz.RandzifferS.Seites.o.siehe obens.u.siehe untenSCADASupervisory Control and Data Acquisitionsec.SekundeSESocietas Europaea (Europäische Gesellschaft)SigGSignaturgesetzSLPStandardlastprofilSMGSmart Meter GatewaySMGASmart Meter Gateway AdministratorSM-PKISmart Meter Public Key InfrastructureSNGSynthetik Natural Gassog.sogenannt(e)SPSspeicherprogrammierbare SteuerungSRLSekundärregelleistungStandAGStandortauswahlgesetzStrlSchVStrahlenschutzverordnungStromGVVVerordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem NiederspannungsnetzStrommarktGGesetz zur Weiterentwicklung des StrommarktsStromNEVVerordnung über die Entgelte für den Zugang zu ElektrizitätsversorgungsnetzenStromNZVVerordnung über den Zugang zu StromversorgungsnetzenStromStGStromsteuergesetzStromStVVerordnung zur Durchführung des Stromsteuergesetzes (Stromsteuer-Durchführungsverordnung)SysStabVSystemstabilitätsverordnungtTonneTEHGTreibhausgas-EmissionshandelsgesetzTHGTreibhausgasTKTelekommunikationTKGTelekommunikationsgesetzTRTechnische RichtlinieTSOTransmission Systems OperatorTWhTerrrawattstundeTz.Textzifferu.a.und andere(m/n)u.Ä.und Ähnliche(s)u.a.m.und andere(s) mehru.E.unseres Erachtensu.U.unter UmständenUBAUmweltbundesamtUEBLLLeitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen (EU)ÜNBÜbertragungsnetzbetreiberUS-GAAPUnited States Generally Accepted Accounting Principles (Allgemein anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze der Vereinigten Staaten)usw.und so weiterUTILMDUtilities Master Data message (elektronisches Nachrichtenformat)UVPGGesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfungv.vomv.a.vor allemV2GVehicle-to-GridVbhVollbenutzungsstundeVbh/aVollbenutzungsstunde pro JahrVDEVerband der Elektrotechnik Elektronik und Informationstechnik e.V.VDEWVerband der Elektrizitätswirtschaft e.V.VERVerified Emission ReductionsVGVerwaltungsgerichtvgl.vergleicheVKUVerband kommunaler Unternehmen e.V.VNBVerteilernetzbetreiberVOVerordnungVorbem.VorbemerkungVSNVersorgungssicherheitsnachweisvzbvBundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.WACCWeighted Average Cost of CapitalWANWide Area NetworkWEWindenergieWEOWorld Energy OutlookWLANWireless Local Area NetworkXMLExtensible Markup Language (maschinenlesbare Sprache für die Gliederung und Formatierung von Texten und anderen Daten)z.B.zum Beispielz.T.zum TeilZAMGZentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, ÖsterreichZDHZentralverband des Deutschen HandwerksZiff.Ziffer(n)ZURZeitschrift für UmweltrechtZusfGZusammenführungsgesetzzzgl.zuzüglichLiteraturverzeichnis
Altrock/Oschmann/ TheobaldMartin Altrock/Volker Oschmann/Christian Theobald, Erneuerbare-Energien-Gesetz Kommentar, 4. Aufl., München 2013AEEAgentur für Erneuerbare Energien e.V., Studienvergleich – Investitionskosten erneuerbarer und fossiler Kraftwerke, 2012AGEBArbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V., Pressedienst Nr. 04|16 v. 03.11.2016Energieverbrauch in Deutschland im Jahr 2015,Stand März 2016AgoraAgora Energiewende gGmbH, Die Rolle des Emissionshandels in der Energiewende, Perspektiven und Grenzen der aktuellen Reformvorschläge, 2015.AsmusThomas Asmus in Detlef Haritz/Stefan Menner (Hrsg.) Umwandlungssteuergesetz, 4. Aufl. 2015BAFABundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle online, Entwicklung des Grenzübergangspreises für Erdgas/Monatliche Entwicklung der Einfuhr von Rohöl/Drittlandskohlebezüge und durchschnittliche Preise frei deutsche Grenze für KraftwerkssteinkohleBAFinBundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, über Marktmanipulation, abrufbar unter: http://bit.ly/2qpoZSIBallwieserWolfgang Ballwieser, Unternehmensbewertung – Prozess, Methoden und Probleme, Stuttgart 2011Beyer/KellerSven Beyer, Günther Keller, Bewertung von Energieversorgungsunternehmen, in: Jochen Drukarczyk/Dietmar Ernst (Hrsg.), Branchenorientierte Unternehmensbewertung, München 2010BDEWBundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., Entwicklung des Stromverbrauchs in Deutschland, Berlin, 11.03.2015Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., Analyse und Bewertung von Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des Regelenergiemarktes Strom, April 2015Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., Erneuerbare Energien und das EEG: Zahlen, Fakten, Grafiken, Februar 2016Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., Die Digitale Energiewirtschaft: Agenda für Unternehmen und Politik, Mai 2016.Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., BDEW-Strompreisanalyse Mai 2016 – Haushalte und IndustrieBDWWie hoch sind die Anschaffungs- und Betriebskosten von Wasserkraftwerken?, abrufbar unter: http://bit.ly/1Y8pQy2BenzSebastian Benz, in: Zeitschrift für Umweltrecht (ZUR) 2008Bente/LöhndorfBente Löhndorf, Energieeffizienz in der Wirtschaft: Gesetzliche Regeln vs. Freiwillige Selbstverpflichtung, v. 22.04.2015, abrufbar unter: http://bit.ly/2oUrmglBKartABundeskartellamt, Monitoringbericht 2016Bundeskartellamt, Beschluss v. 12.09.2003, B 8 – Fa – 21/03Bloomberg/Chatham House/UNEP’s SEFIPrivate Financing of Renewable Energy, 2009BMFBundesministerium der Finanzen, Entwicklung der Energie- (vormals Mineralöl-) und Stromsteuersätze in der Bundesrepublik Deutschland, abrufbar unter: http://bit.ly/2pt5IycBMUBBundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Aktionsprogramm Klimaschutz 2020, Kabinettsbeschluss, 2014Bewertung des Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 Abschlussbericht, 18.11.2016, abrufbar unter: http://bit.ly/2fBTOiwBundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Nationales Entsorgungsprogramm, Programm für eine verantwortungsvolle und sichere Entsorgung bestrahlter Brennelemente und radioaktiver Abfälle, 26.05.2016, abrufbar unter: http://bit.ly/2p2BKO9Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Klimaschutzplan 2050, 14.11.2016, abrufbar unter: http://bit.ly/2fBrXeoBMWiBundesministerium für Wirtschaft und Energie, Initiative Energieeffizienz-Netzwerke, 2014Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Vierter Monitoring-Bericht zur Energiewende „Die Energie der Zukunft“, November 2015Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, NAPE-Meter, vom 26.10.2016, abrufbar unter: http://bit.ly/2quVQ5JBundesministerium für Wirtschaft und Energie, Erneuerbare Energien in Deutschland – Daten zur Entwicklung im Jahr 2015, Februar 2016Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Impulspapier Strom 2030 Langfristige Trends – Aufgaben für die kommenden JahreBMWiBundesministerium für Wirtschaft und Energie, Grünbuch „Ein Strommarkt für die Energiewende“, 2016Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Weißbuch „Ein Strommarkt für die Energiewende“, 2016Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Moderne Kraftwerkstechnologien 2016, abrufbar unter: http://bit.ly/2oUMGT0Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referentenentwurf, Verordnung zur Ausschreibung der Förderung für Strom aus erneuerbaren Energien sowie zur Änderung weiterer Verordnungen zur Förderung der erneuerbaren Energien, Stand 26.04.2016Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Zahlen und Fakten, Energiedaten 2016Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Zahlen und Fakten zum Strommarkt der Zukunft https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/strommarkt-der-zukunft.html, Abruf 09.05.2017Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Novelle der Anreizregulierung – Modernisierungsoffensive für VerteilernetzeBundesministerium für Wirtschaft und Energie, Bruttostromerzeugung 2015 in Deutschland, Stand: 28.01.2016Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Energiedaten Tabelle 20, Stand 21.03.2016BNetzABundesnetzagentur, Beschluss BK6-11-09, Stand: 30.10.2012Bundesnetzagentur, Mitteilung Nr. 8 zur Festlegung „Marktregeln für die Durchführung der Bilanzkreisabrechnung Strom (MaBiS 2.0)“ vom 04.06.2013, BK6-07-002Bundesnetzagentur, Regelenergie, abrufbar unter: http://bit.ly/2qpoh87Bundesnetzagentur, Monitoringbericht 2015Bundesnetzagentur, Was kostet der Netzausbau?, Stand vom 04.09.2015, abrufbar unter: http://bit.ly/2pUCkTbBundesnetzagentur, Quartalsberichte 2015 sowie Gesamtjahresbetrachtung 2015 zu Netz- und SystemsicherheitsmaßnahmenBundesnetzagentur, Kraftwerksliste (Anlagen in Deutschland ≥ 10 MW), Stand: 10.05.2016Bundesnetzagentur, Systemrelevante Kraftwerke, abrufbar unter: http://bit.ly/2qv4P6NBNetzABundesnetzagentur, Übersicht der Stromnetzbetreiber, Stand: 23.06.2016Bundesnetzagentur, Positionspapier zur Anwendung der Vorschriften der Einspeisung von Biogas auf die Einspeisung von Wasserstoff und synthetischem Methan in GasversorgungsnetzeBundesnetzagentur, Auszug aus dem Bericht zur Feststellung des Bedarfs an Netzreserve für den Winter 2016/17 sowie das Jahr 2018/2019, Stand: April 2016Bundesnetzagentur, Anreizregulierung von Strom- und Gasnetzbetreibern: Das Prinzip des simulierten Wettbewerbs, abrufbar unter: http://bit.ly/2p5HwzxBourwiegKarsten Bourwieg in Gabriele Britz/Johannes Hellermann/Georg Hermes, Energiewirtschaftsgesetz, 3. Aufl. 2015Börse FrankfurtBörse Frankfurt, Grundlagen: Steuerung und Kontrolle, Handelsüberwachungsstelle HÜSt, abrufbar unter: http://www.boerse-frankfurt.de/inhalt/grundlagen-steuerung-huestBPBBundeszentrale für politische Bildung 2016: Energiequellen und Kraftwerke, Stand: 24.09.2013Breuer/LindnerDaniel Breuer/Thomas Lindner in: Recht der Erneuerbaren Energien 2015BritschWolfgang Britsch in: PwC (Hrsg.), Entflechtung und Regulierung in der Energiewirtschaft, 1. Aufl. 2007Wolfgang Britsch in: Regulierung in der deutschen Energiewirtschaft, Band I Netzwirtschaft, 4. Aufl., Freiburg/München 2015Brunekreeft/MeyerGert Brunekreeft/Roland Meyer, Anreizregulierung bei Stromverteilnetzen: Effizienz versus Investitionen oder effiziente Investitionen?, April 2015; DEHSt online (2015): Emissionshandel in Zahlen, Stand 17.06.2015Büdenbender/Rosin/ BachertUlrich Büdenbender/Peter Rosin/Patric Bachert in: Düsseldorfer Schriften zum Energie- und Kartellrecht, Band 5, Essen 2006Damisch/Locarek-JungePeter Nicolai Damisch/Hermann Locarek-Junge, Sind Realoptionen im Marktgleichgewicht wertlos?, 2003DEHStDeutsche Emissionshandelsstelle, Emissionshandel und die Aufgaben der DEHSt, 2015denaDeutsche Energie-Agentur GmbH, Potenzialatlas Power to Gas, 2016denaDeutsche Energie-Agentur GmbH, Internationaler Einsatz von Lastmanagement. Analyse von Instrumenten zur Unterstützung und Erschließung von Demand Side Management in den Ländern Dänemark, Schweiz und Frankreich., 2014Deutsche Energie-Agentur GmbH, Arten von Lastmanagement, v. 23.03.2015, abrufbar unter: http://www.effizienteenergiesysteme.de/themen/lastmanagement/laststeuerung.htmlDeutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Lastmanagement in der Industrie: Erlöse erwirtschaften – zur Energiewende beitragen, 2014Droste-Franke et al.Bert Droste-Franke/Holger Berg/Annette Kötter, Brennstoffzellen und Virtuelle Kraftwerke, 2008Energate MessengerGaskraftwerk Hamm mit geänderter Fahrweise, 17.08.2015, abrufbar unter: http://bit.ly/2qB773AKeine Energiewende ohne Gaskraftwerke, 11.12.2015, abrufbar unter: http://bit.ly/2pCDUWREufinger/MaibaumEufinger/Oliver Maibaum in: Ines Zenke/Ralf Schäfer, Energiehandel in Europa, 3. Aufl., München, 2012FNRFachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (2014): Faustzahlen, https://biogas.fnr.de/daten-und-fakten/faustzahlen/, Aufruf am 26.10.2016FähnrichKlaus-Peter Fähnrich, Service Management. Universität Leipzig, Institut für Informatik. Vorlesung 2003Fraunhofer ISI/FfEFraunhofer Institut für System und Innovationsforschung/ Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft mbH, Lastmanagement als Beitrag zur Deckung des Spitzenlastbedarfs in Süddeutschland, 2013Fraunhofer Institut für System und Innovationsforschung/ Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft mbH, 30 Pilot-Netzwerke, Abschlussbroschüre, 2014.Fraunhofer/ISEAktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland auf Datenbasis des Bundesverbandes Solarwirtschaft e.V., 2016; Aufruf am 28.09.2016, abrufbar unter: http://bit.ly/2qBlk0DFraunhofer/IWESInstitutsteil Energiesystemtechnik, Kassel: Auswertung des Effekts der Sonnenfinsternis vom 20.03.2015 auf das deutsche Energieversorgungssystem, 2015FrenzWalter Frenz, Paradigmenwechsel im EEG 2014: von der Staats- zur Marktwirtschaft, RdE 2014 465 ff.Fuchs/PetersMarie-Christine Fuchs/Franziska Peters, Die Europäische Kommission und die Förderung erneuerbarer Energien in Deutschland – Eine Bewertung des EEG-Beihilfeverfahrens und der neuen Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien mit einem kritischen Blick auf die Leitlinienpolitik der Kommission, RdE 2014, 409 ff.GDVGesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., Positionspapier – Zur Verbesserung der Bedingungen für Investitionen in Infrastruktur, Stand: August 2014, , abrufbar unter: http://bit.ly/2qvjjUrGerdes/ZöcklerKlaus Gerdes/Jan-Frederik Zöckler, Regulierung der Netzentgelte, in: PwC (Hrsg.), Entflechtung und Regulierung in der deutschen Energiewirtschaft, 3. Aufl., Freiburg 2012Gierke/PaulTorsten Gierke/Michael Paul in Wolfgang Danner/Christian Theobald (Hrsg.), Energierecht, Stand: Mai 2016Graichen/ Steigenberger/LitzPatrick Graichen/Markus Steigenberger/Philipp Litz, Die Rolle des Emissionshandels, in der Energiewende, 2015GroßWolfgang Groß, in: Wolfgang Groß, Kapitalmarktrecht, 6. Aufl., Frankfurt am Main, 2016GrowitschChristian Growitsc et.al:, Die Energiewirtschaft im Wandel – Herausforderungen und Strategien der Energieversorgungsunternehmen et 2015, 57 ff.Gruber u.a.Anna Gruber/Serafin von Roon/Christoph Pellinger/Tim Buber/Tobias Schmid, Lastflexibilisierung in der Industrie in Konkurrenz zu weiteren funktionalen Speichern, 2013GundelJörg Gundel, in: Wolfgang Danner/Christian Theobald (Hrsg.), Energierecht, Europäisches Energierecht, Stand: Mai 2016HaslerJosef Hasler, Die nachholende Nachfragequote – ein Konzept zur nachhaltigen Integration der erneuerbaren Energien, et 2012, 8 ff.Hentrich/PachmajerCarsten Hentrich/Michael Pachmejer, d.quarks – Der Weg zum digitalen Unternehmen, Murmann Verlag, Hamburg, 2016Henzelman u.a.Torsten Henzelmann, Finanzierung und Finanzierbarkeit der Energiewende, in: Carsten Herbes/Christian Friege (Hrsg.), Handbuch Finanzierung von Erneuerbare-Energie-Projekten, 1. Aufl., München 2015Herbes/FriegeCarsten Herbes/Christian Friege (Hrsg.), Handbuch Finanzierung von Erneuerbare-Energien-Projekten, Teil II: Risiken in Erneuerbare-Energien-Projekten, 1. Aufl., München 2015Höfer/SchmaltzReinhard Höfer/Franziska Schmaltz, in: Energiewirtschaftliche Tagesfragen (et) 2015, Heft 6HullJohn C. Hull, Options, Futures and other Derivates, 7. Aufl. 2009IWRInternationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) (2013): Wert basiert auf den im Artikel zur „Eröffnung des Solarparks Neuhardenberg“ benannten Projektkosten von 200 Mio. EUR für eine Freiflächen-PV-Anlage mit Ppeak 145 MWel, Aufruf am 21.11.2016, abrufbar unter; http://www.iwr.de/news.php?id=22174JudithDaniel Judith, in: Wolfgang Danner/Christian Theobald (Hrsg.), Energierecht, Stand: Mai 2016KachelMarkus Kachel, Das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 2016 EnWZ 2016, 51 ff.KahleChristian Kahle, Ermittlung der Förderhöhe für PV-Freiflächenanlagen nach dem EEG 2014 – Ausschreibungsmodell in: Recht der Energiewirtschaft (RdE) 2014, 372 ff.KasperzakRainer Kasperzak, Beteiligungscontrolling, in: Jörn Littkemann/Horst Zündorf (Hrsg.), Ein Handbuch für die Unternehmens- und Beratungspraxis, Herne/Berlin 2004Kollmuss/Schneider/ ZhezherinAnja Kollmuss/Lambert Schneider/Vladyslav Zhezherin, Has Joint Implementation reduced GHG emissions? Lessons learned for the design of carbon market mechanisms, 2015KöllnSteffen Kölln, Bürgerbeteiligung – Baustein im Finanzierungskonzept, ew 2016, 35 ff.Koenig u.a.Christian Koenig/Jürgen Kühling/Winfried Rasbach, Energierecht, 3. Aufl., Stuttgart 2012Kühne/BrodowskiGunther Kühne/Christian Brodowski, Das neue Energie-wirtschaftsrecht nach der Reform 2005, in: NVwZ 2005KüperMichael H. Küper/Peter Mussaeus in: Franz Jürgen Säcker (Hrsg.) EEG-Kommentar, 3. Aufl. 2014Küper/CallejonMichael H. Küper/Daniel Callejon, Änderungen der Besonderen Ausgleichsregelung durch das EEG 2017, RdE 2016, 440 ff.LietzFranziska Lietz, in: Wolfgang Danner/Christian Theobald, Energierecht EEG, München 2014LiestmannVolker Liestmann, Dienstleistungsentwicklung durch Service Engineering – Von der Idee zum Produkt (2002). Forschungsinstitut für Rationalisierung, Reihe FIR+IAW-Praxis Edition, Luszak, H., Eversheim, W. (Hrsg.).Lüdemann/Ortmann/ PokrantVolker Lüdemann/Manuel Christian Ortmann/Patrick Pokrant, Das neue Messstellenbetriebsgesetz, in: Zeitschrift für das gesamte Recht der Energiewirtschaft (EnWZ) 2016LEENLernende Energieeffizienz-Netzwerke GmbH (LEEN), LEEN-System, v. 22.04.2015 Was ist ein Netzwerk?, abrufbar unter: http://leen.de/leen-netzwerke/LEENLernende Energieeffizienz-Netzwerke GmbH (LEEN), Auf einen Blick, v. 22.04.2015; abrufbar unter: http://leen.de/leen-netzwerke/auf-einen-blick/MaibaumOliver Maibaum in Ines Zenke/Ralf Schäfer, Energiehandel in Europa, 3. Aufl., München, 2012MisslingStefan Missling, in: Wolfgang Danner/Christian Theobald, Energierecht, Stand: Mai 2016MohrJochen Mohr, Integration der erneuerbaren Energien in wettbewerbliche Strommärkte – obligatorische Direktvermarktung und Ausschreibung von Förderberechtigungen, RdE, 2015, 433 ff.MonopolkommissionSondergutachten 65, Energie 2013: "Wettbewerb in Zeiten der Energiewende“Monopolkommission, Sondergutachten 71 „Energie 2015: „Ein wettbewerbliches Marktdesign für die Energiewende“MTSMarkttransparenzstelle, über ihre Aufgaben, abrufbar unter: http://bit.ly/2qpEFFiMusseus/SchwindPeter Mussaeus/Susan Schwind, in: PwC (Hrsg.) Regulierung in der deutschen Energiewirtschaft, Band I Netzwirtschaft, 4. Aufl., Freiburg/München 2015Mussaeus et al.Peter Mussaeus/Christoph Sänger/Dirk-Henning Meier, Strompreiszonen Quo vadis?, Energiewirtschaftliche Tagesfragen (et) 2017, 82 ff.Müller/Kahl/SailerThorsten Müller/Hartmut Kahl/Frank Sailer, Das neue EEG 2014 ER 2014, 139 ff.Niederberger/ WassermannMarlen Niederberger/Sandra Wassermann, Die Zukunft der Energiegenossenschaften: Herausforderungen und mögliche Ansätze für zukünftige Geschäftsmodelle et 2015, 55 ff.OrtliebBirgit Ortlieb, Europäischer Energiebinnenmarkt – Rückblick und Ausblick, EWeRK 2016, 198 ff.PanosKonstantin Panos: Praxisbuch Energiewirtschaft – Energieumwandlung, -transporte und -beschaffung im liberalistischen Markt, 3. Aufl. 2013PequotPequot Publishing Inc. – Gas Turbine World Handbook 2014-15, Volume 31: Simple Cycle PricesPaschottiaRüdiger Paschotta, RP-Energie-Lexikon, Artikel: „Kohlekraftwerk“, Stand 13.08.2016; „Volllaststunden“, Stand 25.11.2014; „Pumpspeicherkraftwerk“, Stand 07.11.2016PielowJohann-Christian Pielow, Änderungen der Besonderen Ausgleichsregelung durch EEG 2017 in Zeitschrift für Umweltrecht (ZUR) 2010, 115 ff.PöhlerFrank Pöhler, Geschäftsführer Bayerische Elektrizitätswerke GmbH, Bayerischer Energiedialog am 10.01.2015: Vortrag Pumpspeicher-KraftwerkePrognos AGPrognos AG/EWI/GWS, Entwicklung der Energiemärkte – Energiereferenzprognose, 2014PschickAndreas Pschick, Management von Marktpreisrisiken im Stromgroßhandel, Diss. Graz 2008PustlaukMaria Pustlauk, Auschreibung für PV-Freiflächenanlagen- das EEG auf dem zu einer wettbewerblichen Förderung erneuerbarer Energien EWeRK 2016, 71 ff.PwC/EBSPricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC) und EBS Business School, Energieverbrauch erfolgreich steuern, 2011PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC) und EBS Business School, Erfolgsfaktoren eines „Ganzheitlichen Energiemanagements (GEM)“, 2012PwCPricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC), Transaktionsmonitor Energiewirtschaft, Januar 2013; März/November 2014; April 2016PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC),Virtuelle Kraftwerke als wirkungsvolles Instrument für die Energiewende, Februar 2012PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC), Energie- und Versorgungsunternehmen im Spannungsfeld zwischen Ertrag, Investitionen und Verschuldung, Mai 2014PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC) Bevölkerungsbefragung Stromanbieter März 2015PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC), Finanzwirtschaftliche Herausforderungen der Energie- und Versorgungsunternehmen, Mai 2015PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC), Deutschlands Energieversorger werden digital, Januar 2016PwCPricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC), Berechnungen auf Basis von aktuellen Beobachtungen des deutschen Windmarktes, Stand: November 2016QuaschningVolker Quaschning, Sektorkopplung durch die Energiewende/Anforderungen an den Ausbau erneuerbarer Energien zum Erreichen der Pariser Klimaschutzziele unter Berücksichtigung der Sektorkopplung, 2016Reichenbach/Werner/ SchneiderFrank Reichenbach/Florian Werner/Jochen Schneider, Finanzierungsmöglichkeiten für dezentrale Anlagen, et 2016, 34 ff.Riewe/MeyerJohannes Riewe/Jost Hanno Meyer, Stromspeicher im EnWG – ein Werkzeugkasten aus rechtswissenschaftlicher Sicht, EWeRK 2015, 138 ff.Rothe/RonkartzSebastian Rothe/Tim Ronkartz, M&A Review 2015, Heft 4RuffertMatthias Ruffert, in: Christian Calliess/Matthias Ruffert, EUV/AEUV Kommentar, 5. Aufl. 2016RWE Power AGBeispielwerte der Kraftwerke Westfalen (Steinkohle) und der Kraftwerke BoA 2&3 Grevenbroich-Neurath (Braunkohle), 2016SandhövelArmin Sandhövel, Chancen und Herausforderungen bei erneuerbaren Energien fur institutionelle Investoren, et 2012, 56 ff.Sänger/RümlerChristoph Sänger/Reinhard Rümler, in: PwC (Hrsg.) Regulierung in derdeutschen Energiewirtschaft, Band I Netzwirtschaft, 4. Aufl., Freiburg/München 2015, Abschnitt 5.4.2, S. 175Sauthoff/Klüssendorf/ BindigJan-Philipp Sauthoff/Nils Klüssendorf/Roland Bindig, in: M&A Review 2011, Heft 10Sauthoff/Klüssendorf/ Topphoff-ErpensteinJan-Philipp Sauthoff/Nils Klüssendorf/AndreaTopphoff-Erpenstein, Bewertung mit Ertragswert- und DCF-Verfahren, in: PwC (Hrsg.), Entflechtung und Regulierung in der deutschen Energiewirtschaft, 3. Aufl., Freiburg 2012Schäfer-Stradowsky/BoldtSimon Schäfer-Stradowsky/Benjamin Boldt, „Power-to-Gas“ – gesetzlich konturierte Verwertungspfade für den Weg in die energiepolitische Gegenwartin: Zeitschrift für Umweltrecht (ZUR) 2015, 451 ff.Schäfer-Stradowsky/BoldtSimon Schäfer-Stradowsky/Benjamin Boldt, Energierechtliche Anmerkungen zum Smart Meter-Rollout, EnWZ 2015, 349 ff.Scherer/HeselhausJoachim Scherer/Sebastian Heselhaus, in: Dauses, EU-Wirtschaftsrecht, Umweltrecht, 40. Aufl. 2016SchexBernhard Schex, in: Martin Kment, Energiewirtschaftsgesetz: EnWG, 1. Aufl. 2015SchneiderLambert Schneider: Stromgestehungskosten von Großkraftwerken: Entwicklungen im Spannungsfeld von Liberalisierung und Ökosteuern, Freiburg 1998Schneider/Raeck/ ReichenbachJochen Schneider/Matthias Raeck/Frank Reichenbach, Die Bedeutung des Energiehandels fur Smart Energy-Geschaftsmodelle, et 2013, 10 ff.Schulz/MöllerThomas Schulz/Beatrice Möller, Pilot des EEG-Systemwechsels – die FFAV – Die Ausschreibung der finanziellen Förderung für Solar-Freiflächenanlagen, ER 2015, 87 ff.SchwintowskiHans-Peter Schwintowski, Kundenanlagen – das unbekannte Wesen, EWeRK 2012, 43 ff.Hans-Peter Schwintowski, Handbuch Energiehandel, 3. Aufl., ESV Berlin 2014SötebierJan Sötebier, in: Gabriele Britz/Johannes Hellermann/Georg Hermes, Energiewirtschaftsgesetz 3. Aufl. 2015Stappert/Vallone/ GroßHolher Stappert/Angelo Vallone/Franz-Rudolf Groß, Die Netzentgeltbefreiung für Energiespeicher nach § 118 Abs. 6 EnWG, RdE 2015, 62 ff.StatkraftPresseinformation; Statkraft: Gaskraftwerke stehen meistens still, 12.02.2016 Chemiepark knapsack, abrufbar unter: http://bit.ly/2pCAtznStromtarifevergleichstromtarife-vergleich.net – Pumpspeicherkraftwerk 2.0 im Bodensee: Betonkugel als Stromspeicher, abrufbar unter: http://bit.ly/2ptuLkZTheobaldChristian Theobald, in: Jens-Peter Schneider/Christian Theobald (Hrsg.), Recht der Energiewirtschaft, 2. Aufl. 2008Christian Theobald, in: Wolfgang Danner/Christian Theobald (Hrsg.), Energierecht, Stand: Mai 2016Theobald/Gey-KernChristian Theobald/Tanja Gey-Kern, Das dritte Energiebinnenmarktpaket der EU und die Reform des deutschen Energiewirtschaftsrechts 2011, EuZW 2011, 896 ff.Thomas/AltrockHenning Thomas/Martin Altrock, Einsatzmöglichkeiten für Energiespeicher, Zeitschrift für Umweltrecht (ZUR) 2013, 579 ff.Thumfart/SuppanDominik Thumfart/Michael Suppan, Finanzierungsinstrumente im Bereich Erneuerbare Energien: ein Überblick, in: Markus Gerhard/Thomas Rüschen/Armin Sandhövel (Hrsg.), Finanzierung Erneuerbarer Energien, 2. Aufl., Frankfurt am Main 2015Tiefenbacher/ OlbrichKatja Tiefenbacher/Sebastian Olbrich, „Developing a Deeper Understanding of Digitally Empowered Customers – A Capability Transformation Framework in the Domain of Customer Relationship Management“ (2016), PACIS 2016 Proceedings. 293. abrufbar unter: http://aisel.aisnet.org/pacis2016/293UBAUmweltbundesamt, UBA (2015): Der Europäische Emissionshandel, abrufbar unter: http://bit.ly/1dv5JIGWBGUWissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, Politikpapier – Finanzierung der globalen Energiewende, 2012WermterSusanne Wermter, Investments in erneuerbare Energien – positiver Effeket auf das Portfolio Kreditwesen 2013, 51WengelerFritz Wengeler, Intelligente Messsysteme und Zähler vor dem Pflicht-Roll-Out, EnWZ, 2014, 500 ff.Wissel/Fahl/Blesl/ VoßSteffen Wissel/Ulrich Fahl/Markus Blesl/Alfred Voß, Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung – „Erzeugungskosten zur Bereitstellung elektrischer Energie von Kraftwerksoptionen in 2015“, 2010YescombeE.R. Yescombe, Principles of Project Finance, 2nd edition 2013Zenke/SchäferInes Zenke/Ralf Schäfer (Hrsg.), Energiehandel in Europa – Öl, Gas, Strom, Derivate, Zertifikate, 2. Aufl. 20091Einführung
1.1Energiewende und Strommarktdesign
Mit dem Pariser Klimaabkommen „COP21“, das im November 2016 in Kraft trat, hat die globale Energiewende ein konkretes Datum bekommen: Von 2050 an soll nicht mehr Kohlendioxid emittiert werden als gleichzeitig absorbiert wird. In Deutschland hatte die BReg bereits 2010 die Energiewende ausgerufen und beschlossen, die Treibhausgas-Emissionen bis 2050 im Vergleich zu 1990 um 80 bis 95% zu vermindern. Der „Klimaschutzplan 2050“ vom November 2016 bekräftigt diese Zielsetzung und die Absicht, „in diesem Rahmen einen angemessenen Beitrag zur Umsetzung der Verpflichtung von Paris zu leisten, auch mit Blick auf das im Übereinkommen von Paris vereinbarte Ziel der weltweiten Treibhausgas-Neutralität im Laufe der zweiten Hälfte des Jahrhunderts“1.
Die Energiewende forciert den Wandel, den die Energiewirtschaft seit dem Ende der Energiemonopole in den letzten zwei Jahrzehnten erlebt hat, angefangen mit der Liberalisierung Ende der 90er Jahre. Allerdings haben die Umwälzungen der letzten Jahre, insb. der beschleunigte Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland nach dem Unglück von Fukushima und der massive Zuwachs an Strom aus erneuerbaren Energien, viele der zuvor sehr erfolgreichen Unternehmen der Energiebranche überrascht und zu tiefgreifenden Veränderungen in ihrer strategischen Ausrichtung gezwungen. Auch neue Marktteilnehmer, die große Erwartungen auf den Ausbau der erneuerbaren Energien oder zunehmende Energieeffizienzanstrengungen gesetzt haben, müssen sich einem schwierigen Marktumfeld mit häufig wechselnden politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen stellen.
Die Liberalisierung der Energiewirtschaft stellte die Energieversorger vor die Frage, wie ein nicht speicherbares Produkt „Strom“ auf Märkten gehandelt werden kann. Die Einführung eines Großhandelsmarktes für Energielieferungen, auch Energy-only-Markt (EOM) genannt, in den die Kraftwerke in der Rangfolge ihrer Grenzkosten (Merit-Order) einliefern2, war die Antwort darauf. Die Aussicht auf steigende Energiepreise veranlasste die Unternehmen zu umfangreichen Kraftwerksinvestitionen im In- und Ausland; weitere erhebliche Bilanzverlängerungen ergaben sich mit der Ausweitung der Handelsaktivitäten. Das „Energiekonzept der Bundesregierung für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung“ v. 28.09.2010 und der unerwartete Erfolg der erneuerbaren Energien haben diesen Unternehmensstrategien die Grundlage entzogen. Ziel ist es, bis 2050 den Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch auf 60 % und an der Stromversorgung sogar auf 80 % zu erhöhen; der Bruttostromverbrauch soll insgesamt gegenüber dem Bezugsjahr 2008 bis 2050 um 25 % reduziert werden. Hier zeigt sich eine tektonische Verschiebung der politischen Zielsetzung im magischen Dreieck der Energiepolitik: Versorgungssicherheit ist nach wie vor unverzichtbar, gesellschaftlich und politisch gewollt ist es aber, über einen definierten Zeitraum auf einem definierten Pfad die weitgehend CO2-freie Energieversorgung zu erreichen, und zwar zu möglichst niedrigen Kosten.
Mit 32 % der deutschen Bruttostromerzeugung (185 TWh) deckten die erneuerbaren Energien 2016 einen erheblichen Teil der Energieversorgung ab, an zweiter Stelle nach der Braunkohle und vor Steinkohle und Kernenergie3. Der Anteil liegt etwa auf dem Niveau des Vorjahres, geschuldet einem schwachen Onshore-Windjahr und einem Rückgang an Solarenergie aufgrund von Wetterbedingungen und geringem Ausbau, deutlich unter dem Ausbauziel von 2,5 GW. Kompensierend hierzu konnte die Bruttostromerzeugung aus Offshore-Windenergie zuletzt um 50 % auf 12 TWh gesteigert werden. Den größten Anteil an der Erzeugung aus erneuerbaren Energien hat Onshore-Wind mit 66 TWh, gefolgt von Photovoltaik mit 37,5 TWh4. In Anbetracht dieser Entwicklung erscheinen die von der BReg angestrebten Ausbauziele für die Nutzung der erneuerbaren Energien im Stromsektor (Anteil von 40 bis 45 % an der der Stromerzeugung im Jahr 2025, 55 bis 60 % im Jahr 20355) erreichbar.
Ist das unter den Bedingungen konventioneller, i.W. oligopolistischer Erzeugung entwickelte Marktdesign auch bei einer zunehmend erneuerbaren Stromproduktion noch angemessen? Die Frage ist, wie ein so hoher Anteil von erneuerbaren Energien in den Strommarkt integriert werden kann und Marktpreissignale das Angebot und die Nachfrage so steuern, dass die Ziele der Energiewende im Trilemma von Versorgungssicherheit, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit erreicht werden. Das bisherige Strommarktdesign gibt Anlass zu Zweifeln an der Funktionsfähigkeit:
Ist es Ausdruck wirtschaftlicher Ressourcenallokation, wenn in Form negativer Strompreise, wie sie aufgrund des massiven Anfalls von Windstrom z.B. über Weihnachten 2016 zu verzeichnen waren6, dafür bezahlt werden muss, dass teuer produzierter Strom abgenommen, gewissermaßen „entsorgt“ wird, weil er überflüssig ist?
Ist es Ausdruck eines funktionsfähigen Strommarktes im vorgenannten Sinne, wenn derzeit v.a. Kohlekraftwerke am Netz sind, emissionsärmere Gaskraftwerke weitgehend stillstehen7 und die politische Diskussion um die Zwangsstilllegung von Kohlekraftwerken geführt wird?
Ist es Ausdruck eines funktionsfähigen Strommarktes, wenn Verbraucher andere Preise sehen als die Produzenten, weil Steuern, Umlagen und andere Abgaben die Marktpreissignale überlagern?
Mit dem StrommarktG8 hat die BReg 2016 die Weichen für ein überarbeitetes Strommarktdesign gestellt. Reichen diese Vorschläge aus für die angestrebte Transformation unserer Energieversorgung und -nutzung? Und welche Konsequenzen hat das für Unternehmen und Verbraucher? Eine Antwort auf diese Fragen erfordert die intensive Auseinandersetzung mit den Regeln und der Funktionsweise des aktuellen Strommarktes und den im abgelaufenen Jahr veröffentlichten neuen Regelwerken und Konzepten.
1.2Kernfragen des Strommarktdesigns
Die Energiewirtschaft ist als strategischer Sektor hochgradig reguliert. Sie ist aber in Deutschland zugleich in das wirtschaftliche Ordnungssystem der sozialen Marktwirtschaft eingebettet. Unbeschadet einer starken Rolle des Staates sollten also wettbewerbliche Ordnungselemente das Marktdesign bestimmen.
Nach Walter Eucken, einem der Väter der sozialen Marktwirtschaft, sollen in einer Wettbewerbsordnung Anbieter und Nachfrager ihre individuellen Wirtschaftspläne aufstellen und über den Preismechanismus koordinieren. Es ist die Aufgabe der Ordnungspolitik, die Spielregeln und Rahmenbedingungen für das Handeln der Individuen festzulegen9. Im Mittelpunkt steht die „Herstellung eines funktionsfähigen Preissystems vollständiger Konkurrenz“10. Daraus leitet Eucken die konstituierenden Prinzipien der Wettbewerbsordnung ab: Das Primat der Währungspolitik, offene Märkte, Privateigentum, Vertragsfreiheit, Haftung, die Konstanz der Wirtschaftspolitik und die Zusammengehörigkeit der konstituierenden Prinzipien11.
Es liegt nahe, die Ausgestaltung des Strommarktdesigns vor diesem Hintergrund zu analysieren, denn es geht im Kern darum, Spielregeln so zu setzen, dass die Wirtschaftsakteure ihre Pläne in einem marktwirtschaftlichen Wirtschaftssystem im Einklang mit den Zielen der Energiewende koordinieren. Grundprämisse ist dabei, dass ein funktionsfähiger Preismechanismus die Entscheidungen der handelnden Personen bestimmt, nicht staatliche Lenkung. Ausweislich des von der BReg vorgelegten Weißbuchs zur Energiewende scheint diese Prämisse auch an Raum zu gewinnen. Eine große Rolle spielt hierbei, dass Innovationen und Skaleneffekte die Kosten der erneuerbaren Energien nach unten treiben und deren Wirtschaftlichkeit deutlich erhöhen. Das EEG, seit vielen Jahren das wesentliche Instrument zur Erreichung der Ausbauziele bei den erneuerbaren Energien und Musterbeispiel für die bürokratische Lenkung der Energiewende12, fokussiert vor diesem Hintergrund inzwischen mehr auf die Markt- und Systemintegration des Ökostroms. Bürokratie kommt somit nicht nur an ihre Grenzen, sie ist auch zunehmend entbehrlich.
Rückt man die Funktionsfähigkeit des Preismechanismus in den Vordergrund, so stellen sich bei der Ausgestaltung des Strommarktdesigns für die Energiewende fünf Kernfragen:
1.Warum reicht der Handel mit Emissionsrechten nicht aus, um Preissignale für eine umweltverträgliche Energieversorgung zu setzen? Seit 2005 besteht ein europäisches Emissionshandelssystem, das von nationalen Vorschriften zum Umwelt- und Klimaschutz vielfach überlagert ist.
2.Wie können volatile erneuerbare Energien Preissignalen ausgesetzt und so in den Strommarkt integriert werden, dass Erzeugung und Verbrauch synchronisiert sind? Die Marktintegration der erneuerbaren Energien impliziert zum einen die Frage, wie die staatlichen Subventionen für den Ausbau der erneuerbaren Energien schrittweise heruntergefahren und durch eine marktwirtschaftliche Vergütung ersetzt werden können. Zum anderen umfasst die Fragestellung das Problem, den anteilig sinkenden Strom aus konventioneller Erzeugung mit dem zunehmenden Strom aus erneuerbarer Erzeugung über Preissignale und die Zuordnung von Verantwortlichkeiten so zu kombinieren, dass Angebot und Nachfrage am Strommarkt jederzeit übereinstimmen13.
3.Welche Preissignale erfordert der angemessene Ausbau von (konventionellen wie erneuerbaren) Erzeugungskapazitäten, Speichern und Flexibilitäten auf der Nachfrageseite unter den Bedingungen der Energiewende? Der Ausgleich von Angebot und Nachfrage und das Setzen von Anreizen für Investitionen ist die zentrale Frage eines jeden Wirtschaftssystems. Das Stromsystem ist historisch darauf angelegt, dass sich die Erzeugung der Nachfrage anpasst, klassischerweise geprägt durch die Unterscheidung in Grund- und Spitzenlast. Diese Unterscheidung ist mit dem starken Anfall erneuerbarer Energien mittlerweile weitgehend hinfällig geworden, da der Zustrom von Wind- und Sonnenenergie nicht bedarfs-, sondern dargebotsabhängig erfolgt. Insofern muss es in Zukunft darum gehen, zunehmend auch auf der Nachfrageseite Anreize zu setzen, das Energiesystem flexibel zu gestalten14. Last hat in dieser Sicht den gleichen Wert wie Kapazität. Auch Batteriespeicher werden in Zukunft eine wachsende Rolle spielen. Die Ergänzung des „Energieerzeugungsmarktes“ durch sog. „Kapazitätsmechanismen“ wird in diesem Zusammenhang diskutiert.
4.Wie kann der Einsatz Erneuerbarer Energien über den Strommarkt hinaus ausgeweitet werden? Die Stromproduktion in Deutschland entspricht ca. 40 % des Energieverbrauchs, andere wesentliche Anteile liegen im Verkehr und im Bereich der Wärmeerzeugung, Sektoren, in denen nach wie vor Verbrennungstechnologien dominieren. Ist eine ganzheitliche Betrachtung dieser Sektoren mit der Stromproduktion i.S. einer Sektorkopplung im Rahmen der Energiewende sinnvoll, welche Preissignale unterstützen dies? Im Kern geht es bei der Sektorkopplung um die Frage, welche Rolle Strom aus erneuerbaren Energien im Vergleich zu den Primärenergieträgern Öl, Kohle und Gas in Zukunft spielen wird. Grundlegende Technologien stehen dafür bereits bereit – Batteriespeicher15, Power-to-X-Anwendungen16, Elektrofahrzeuge17, etc. –, sind aber aufgrund der Kostensituation und fehlender Infrastruktur zurzeit kaum relevant.
5.Welche Rolle spielt die EU? Errichtung und Nutzung von Erzeugungskapazität erfolgen umso effizienter, je größer der Raum ist, für den diese Infrastruktur vorgehalten wird. Eine Untersuchung von prognos im Auftrag des Weltenergierates–Deutschland e.V. zeigt, dass aufgrund des Zeitversatzes von Lastspitzen innerhalb von 15 europäischen Ländern die Residuallast, also die aus regelbaren Kraftwerken bereitzustellende Leistung, in der höchsten Stunde um 8 bis 10 GW sinkt, im Jahr 2030 um 27 bis 34 GW sinken wird18. Die Errichtung eines Strombinnenmarktes innerhalb der EU ist somit ohne Zweifel ein wichtiger Schritt in Richtung auf ein effizientes Strommarktdesign.
Ausgenommen von der Analyse des Strommarktdesigns ist der Netzbereich, mit dem wir uns an anderer Stelle ausführlich beschäftigen19. Energienetze sind natürliche Monopole im Eigentum von Marktakteuren. Infolgedessen sind die Regelungen des Zugangs, der Qualität und v.a. der Entgelte typische Aufgaben eines Regulators, in Deutschland der BNetzA.
1.3Der Strommarkt 2.0
Die BReg hat im Sommer 2015 als Ergebnis der von ihr angeregten Diskussion um das Strommarktdesign der Zukunft das Weißbuch „Ein Strommarkt für die Energiewende“ vorgelegt. Das darauf basierende StrommarktG ist am 30.07.2016 in Kraft getreten. Es soll in der Phase des Übergangs infolge des Ausbaus der erneuerbaren Energien, der Beendigung der Kernenergienutzung in Deutschland bis 2022 und des Zusammenwachsens der europäischen Märkte für Strom sicherstellen, dass die Stromversorgung sicher, kosteneffizient und umweltverträglich erfolgt.
Dies soll durch ein Maßnahmenpaket erreicht werden, nach dem zugrundeliegenden Weißbuch unterschieden in drei „Bausteinen“:
Abb. 1:Maßnahmen zum Strommarkt 2.0, aus: BMWi, Ein Strommarkt für die Energiewende, S. 59
Nach Jahren massiver staatlicher Einflussnahme auf den Erzeugungsmix in Deutschland – Stichworte: EEG, KWKG, Atomausstieg – sollen jetzt die Marktmechanismen gestärkt werden. Der Strommarkt soll gewährleisten, dass die Einspeisungen in das Stromnetz jederzeit die Entnahmen decken, ausreichend Kapazitäten zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage vorhanden sind (Vorhaltefunktion) und durch geeignete Preissignale vorhandene Kapazitäten zur richtigen Zeit und im erforderlichen Umfang kontrahiert und tatsächlich eingesetzt werden (Einsatzfunktion). In diesem Zusammenhang bekennt sich der Gesetzgeber zum liberalisierten, europäischen Strommarkt. Die Integration des europäischen Binnenmarktes für Strom soll vorangetrieben werden, der Wettbewerb Anreize für Innovationen und Nachhaltigkeit schaffen, die Integration erneuerbarer Energien verbessern und die Förderkosten für erneuerbare Energien senken.
Das StrommarktG erteilt dem Kapazitätsmarkt eine Absage20. Der Energy-only-Markt soll eine freie Bildung der Strompreise ermöglichen und darüber die Vorhaltung von und Investitionen in Kapazität entlohnen. Es wird erwartet, dass durch den Preismechanismus Überkapazitäten abgebaut und umgekehrt tatsächlich benötigte flexible Kapazitäten refinanziert werden. Die Instrumentarien hierzu stellt nach der Erwartung des Gesetzgebers der Markt bereit, da Marktteilnehmer sich gegen Preisspitzen absichern werden, z.B. mit den neuen Börsenprodukten oder durch langfristige Liefer- und Absicherungsverträge. Dies setzt voraus, dass Preise oberhalb der Grenzkosten (Mark-up) künftig akzeptiert werden. Kapazitätsmärkte im europäischen Umfeld mögen die Preisspitzen abschwächen, allerdings dürfte dies i.S.d. Gesetzes sein, das insgesamt eine stärker europäische Sicht auf den Strommarkt und damit auch auf den notwendigen Zubau an Kapazität legt.
Das StrommarktG will das Bilanzkreis- und Ausgleichsenergiesystem stärken und den Marktteilnehmern starke Anreize geben, ihre Lieferverpflichtungen zu erfüllen21. Die Stärkung der Bilanzkreistreue und die Flexibilisierung der Nachfrageseite sind wesentliche Elemente zur Steigerung der Funktionsfähigkeit des Energy-Only-Marktes. Weiter will das Gesetz Flexibilität auf der Angebots- und der Nachfrageseite stärken22. Eine Reihe von Maßnahmen flankiert diese Zielsetzung, u.a. die Weiterentwicklung der Regelenergiemärkte und die Ausgestaltung der Netzentgelte, um ein marktdienliches Verhalten auf der Nachfrageseite zu fördern. Die Neuregelungen betonen die wachsende Bedeutung der Energieeffizienz und ihrer Verknüpfung mit der Flexibilisierung des Systems. Die Sektoren Strom, Wärme und Verkehr sollen in Zukunft stärker gekoppelt werden.
Das StrommarktG räumt der Versorgungssicherheit zentrale Bedeutung ein23. Zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit wird das bisherige Monitoring nach dem EnWG weiterentwickelt, um den europäischen Kontext einzubinden und die Versorgungssicherheit quantitativ und stärker prospektiv, d.h. wahrscheinlichkeitsbasiert zu überwachen. Zum Ausgleich regionaler Engpässe bei der Stromversorgung halten die ÜNB weiterhin zeitlich befristet Kraftwerke als Netzreserve vor. Die bereits vorhandene Regelung nach der ResKV wurde durch das StrommarktG bis 2023 verlängert und wird in Abhängigkeit vom Netzausbau künftig weiterentwickelt. Physikalisch sichert eine Kapazitätsreserve zukünftig den Strommarkt 2.0 ab24. Sie ist vom Markt getrennt und umfasst Kraftwerke, die nur im Ausnahmefall eingesetzt werden, wenn das vorhandene Angebot die Nachfrage nicht deckt. Schließlich werden bestimmte Braunkohlekraftwerke (insgesamt 2,7 GW) zwischen 2016 und 2019 gegen Vergütung in die neue Sicherheitsbereitschaft überführt. Damit werden sie zunächst vorläufig und nach jeweils vier Jahren endgültig stillgelegt, letztlich als Beitrag zur Erfüllung der deutschen Klimaschutzziele in 202025.
Mit dem Weißbuch und dem darauf basierenden StrommarktG ist die Diskussion um das Strommarktdesign in Deutschland auf der Grundlage eines transparenten Prozesses zu einem Zwischenergebnis gekommen. D.h. nicht, dass die Diskussion damit bereits zu Ende ist. Es gibt erhebliche Zweifel, dass der Energy-only-Markt ausreichend Anreize setzt für Investitionen in Kapazität und Flexibilität. Anzuerkennen ist, dass ein Ausgangspunkt gesetzlich definiert worden ist, der für die nächsten Jahre die Grundlage für einen funktionsfähigen Strommarkt schafft, Weiterentwicklungen für die Zukunft ermöglicht und den Unternehmen den klaren Auftrag gibt, nun konkret die Umsetzung der Energiewende in Angriff zu nehmen.
1.4Energiewende als Chance für Unternehmen
Erneuerbare Energien, dezentrale Erzeugung und Speicherung von Strom haben im Zusammenwirken mit der Digitalisierung und der Elektromobilität das Potenzial für eine dritte industrielle Revolution, vergleichbar mit den vorangegangenen beiden industriellen Revolutionen, die auch durch das gleichzeitige Aufkommen von neuen Energieformen und neuen Techniken der Kommunikation, Informationsverarbeitung und des Transports gekennzeichnet waren26. Sektorkopplung bedeutet in dieser Sicht, dass die Energiewende Folgen weit über den eigentlichen Energiesektor hinaus hat und ein wichtiger Treiber für viele Innovationen im Bereich der Industrie und der privaten Haushalte ist. Dies eröffnet Unternehmen eine Vielzahl neuer Chancen.
Vor dem Hintergrund der Energiewende müssen sich die Unternehmen der Branche fragen, welche Rolle sie in Zukunft einnehmen27, worin ihre „Existenzberechtigung“ liegt – in der Funktion des Energieerzeugers, der kostenoptimal Strom am Markt anbietet, in der Funktion des Systemintegrierers, der das Energiesystem durch Netzdienstleistungen sichert, in der Funktion des Energiedienstleisters nah am Kunden oder in der Funktion, neue Services „hinter dem Zähler“ bereitzustellen, z.B. im Bereich der „smart Energy