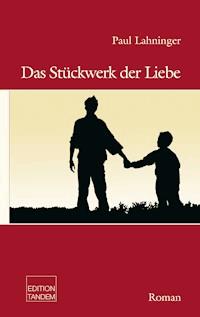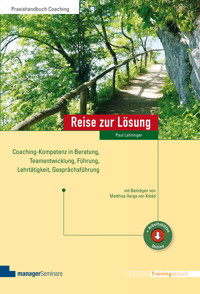
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: managerSeminare Verlags GmbH
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Edition Training aktuell
- Sprache: Deutsch
Paul Lahninger öffnet sein vielfältiges und tiefes Methodenspektrum rund um die wertschätzende und lösungsorientierte Begleitung von Personen oder Teams. In sieben Bausteinen behandelt Lahninger das Thema Coaching als Haltung, als Kompetenz und als Prozess. Das Buch liefert Methoden, Kopiervorlagen, Praxisbeispiele aus unterschiedlichsten Arbeitsfeldern und Anregungen für das Selbstcoaching – mit Beiträgen des Strukturaufstellers Matthias Varga von Kibéd.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Lahninger
Reise zur Lösung
Coaching-Kompetenz in Beratung, Teamentwicklung, Führung, Lehrtätigkeit, Gesprächsführung
© 2010 managerSeminare Verlags GmbH
3. Auflage 2018
Endenicher Str. 41, D-53115 Bonn
Tel: 0228-977910
www.managerseminare.de/shop
Der Verlag hat sich bemüht, die Copyright-Inhaber aller verwendeten Zitate, Texte, Abbildungen und Illustrationen zu ermitteln. Sollten wir jemanden übersehen haben, so bitten wir den Copyright-Inhaber, sich mit uns in Verbindung zu setzen.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten.
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
ISBN: 978-3-98856-069-8
Herausgeber der Edition Training aktuell:
Ralf Muskatewitz, Jürgen Graf, Nicole Bußmann
Lektorat: Michael Busch, Jürgen Graf
Coverfoto: Paul Lahninger
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
Ihre Download-Ressourcen
Begleitend zum Buch stehen Ihnen Arbeitshilfen für die persönliche Verwendung zum Download im Internet zur Verfügung. Sie können die Vorlagen jederzeit in hoher Qualität abrufen und einsetzen.
www.managerseminare.de/tmdl/b,268485
An der Reise zur Lösung haben sich beteiligt
… mit Fachbeiträgen:
Prof. Dr. Matthias Varga von Kibéd
Mag. Peter Laninschegg
Reinhold Rabenstein1
Maga. Helga Gumplmaier1
Judith Kirchmayr-Kreczi1
Maga. Barbara Reschreiter1
Toni Wimmer1
Dr. Eva Scala1
Herta Fragner
… mit Praxisbeispielen aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen:
Judith Mayer: Mitarbeitergespräch als Führungsinstrument
Herbert Brindl: Coaching-Instrumente in der Führung
Maga. Heidi Gartner: Vom Lehrer als Wissensvermittler zum Lerncoach
Dipl.-Ing. Stephan Wieninger: Coaching-Elemente im persönlichkeitsbildenden Unterricht
Manuela Schaffran: Prüfungsvorbereitung und Coaching im Einzel-Sprachunterricht in Englisch
Daniela Dirnberger: Teamprozess zur Jahresplanung in der Jugendarbeit, Selbstwertstärkung mit Jugendlichen
Simone Lindorfer: Fachkräfte in Übersee per Telefon coachen,
Entwicklungszusammenarbeit unter Extrembedingungen
Karin Hirschmüller: Berufliche Entscheidungen treffen
Olivia Wollinger: Haltungen im Coaching und im Shiatsu
Lektorat:
Mag. Peter Laninschegg
Nadja Fritzsche
Maga. Gertrude Sachs
Johannes Lahninger
Heidi Voggenberger: Schreibarbeiten, Korrekturen und EDV-Grafik
Ich bedanke mich für die gemeinsame Auseinandersetzung und für wertvolle Beiträge. Dank auch an Robert Graf1, der mich auf dem Weg zum Coaching begleitet hat.
1 Netzwerk: www.AGB-Seminare.at
Inhaltsverzeichnis
Cover
Impressum
Herzlich Willkommen
Etappe 1 – Coaching als Haltung
Die Kutsche
Praxisbeispiel: Überlastung bewältigen
Wertschätzend begleiten
Coaching – Anwendungsspielräume
Setting-Qualitäten
Coachend begleiten: inhaltlich enthaltsam
Coaching-Haltung
Die Wertorientierung trägt die Methode
Systemische Thesen
Effektiv kommunizieren – systemisch betrachtet
„Wirklichkeit“ ist etwas, das wir erschaffen
Coaching als Zutrauen in Veränderung
Grenzen des coachenden Begleitens
Etappe 2 – Coaching als Kompetenz
Zuhören – Fragen – Feedback
Auftrag und Zielvereinbarung
Die Gesprächsführung
Aktiv zuhören/Übungsbeispiele
Positiv umformulieren/Übungsbeispiele
Einfühlung trainieren
Fragen als Coaching-Instrument
Feedback geben als Coach
Selbstreflexion als Coach
Selbstwahrnehmung vertiefen
Abgrenzen und auftanken
Coaching-Elemente vielseitig umsetzen
Etappe 3 – Coaching als Prozess
Leitfäden für den Ablauf
Lösungsfokussierte Beratung
Die Wunderfrage als Trance-Technik
Praxisbeispiel
Coaching-Reflexionsbogen
Fragedesigns
Von „Stress eingrenzen” bis „Ressourcenorientierte Gedanken begleiten”
Etappe 4 – Teamentwicklung begleiten
Teamqualität stärken
Teamarbeit in Symbolen
Theseninterview
Teamqualität Thesenblatt
Methodisch gestalten
Teamcoaching und Moderation: Begriffe
Coaching versus Führungsverantwortung
Qualitäten in Team-Moderation und Coaching
Teambesprechungsziele klären
Moderation und Teamcoaching vorbereiten
Praxisbeispiel: Aufgabenverteilung
Rhetorik im Beg-LEITEN
Entscheidungsprozesse begleiten
Entscheiden als Kernkompetenz stärken
Entscheidungsprozesse im Team gestalten
Praxisbeispiel: Teamentscheidungsprozess
Methodische Ideen
4-Plakate mit „Dynamic Facilitation“
„ReTeaming“: lösungsorientierte
Leben – leisten – lernen
Kollegiale Beratung: einander Ideen zumuten
Praxisbeispiel: lösungsfokussiert
Interview mit Namenszug
Praxisbeispiel: Teamvernetzung
Praxisbeispiel: Teamentwicklungstag
Instrumente nutzen
Teamselbstreflexion: „Erfolgstipps der Jury“
Arbeitsgruppe – Detailauftrag
Rückmeldungen als Wünsche
Herausforderungen bewältigen
Ergebnisse konkret umsetzen
„Tanzkarte: Auf in den Reigen!“
Teamqualität individuell stärken
Teamqualität verbessern – Selbstreflexion
Teamarbeit: Qualitäten reflektieren
Teamkommunikation reflektieren
Wertorientierung: Prioritätenliste
Teamcheck
Feedback-Kartenspiel
Etappe 5 – Konfliktbearbeitung gestalten
Konfliktdynamik verstehen
Konfliktstress weckt Notprogramme
Konflikte entspannen und lösen
L.Ö.S.E.N.
Dissens-Kompetenz
Verhaltensvarianten im Konflikt: Systematik
Praxisbeispiel
Lösungsfindung Einzelner begleiten
Chancen und Risken von Konfliktbegleitung
Praxisbeispiel: frei entscheiden
Versöhnung gestalten: Selbstreflexion
Praxisbeispiel: Versöhnung gestalten
4-Positionen-Reflexion
Dissens leben/Praxisbeispiel
Aspekte von Mediation
Konfliktparteien begleiten
Mediation: Streitschlichtung
Konfliktbegleitung in Teams gestalten
Versöhnung begleiten
Praxisbeispiel: Versöhnung begleiten
Praxisbeispiel: Einmischung klären
Praxisbeispiel: Kontentrennung
Mediation: Praxisbeispiel Gesprächskultur
Versöhnung trotz Eskalation: ein kreativer Ansatz
Praxisbeispiel: Konkurrenz regeln
Persönliche Konfliktkompetenz
Etappe 6 – Unterschiedlichste Settings
Begleiten als Führungskraft
Begleiten in der Bildungsarbeit
Begleiten in der Arbeit mit Jugendlichen
Begleiten im Rahmen von Beratung
Telefon-Coaching von Fachkräften in Übersee
Berufliche Entscheidungen treffen
Haltungen im Coaching und im Shiatsu
Begleiten im Seminare
Die Haltung trägt die Methode
Etappe 7 – Besselt leiten 3
Menschenbilder leiten uns
Zuwendung zu mir selbst
Persönlichkeitsentfaltung durch Selbstliebe
Love it – change it – leave it
Beseelt arbeiten – Selbstreflexion
Zuwendung zu anderen
Kooperation als Grundprinzip
Resonanz als Kommunikationsform
Zuwendung zur Aufgabe
Verantwortung leben
Ökologie als Chance
Ethik: meine Wertorientierung leben
Leben als fortlaufendes Lernen
Das Beste in mir stärken und pflegen
Wege und vermeintliche Umwege
Wünsche für mich
Persönlichkeitsentwicklung einladen
Meditieren
Mystik als Weg
Wertorientierung weiterentwickeln
Ansprüche und Bedürfnisse
Zusammenspiel der Ich-Instanzen
Ich-Anteile organisieren
Werte ganzheitlich leben
Werte tragen uns
Beseelt leben – Gesprächsimpulse in Fragekärtchen
Zugewandt: Mein Leitbild
Das Tor zum Himmel
Anhang
Stichwortverzeichnis
Literatur
Ökologisch leben – das persönliche Kyoto-Ziel
Der Autor: Aspekte meiner Lebensgeschichte
Lehrgang: Coaching-Kompetenz entfalten
Herzlich Willkommen
… Ihre Kompetenz zu stärken, zu entfalten und Lösungsfindung wertschätzend zu begleiten. Willkommen, Ihre Sichtweise von Gesprächsführung, Teamentwicklung und Konfliktlösung zu vertiefen und neue Handlungsspielräume zu gewinnen. Willkommen, eigene Anliegen durchzudenken und Leitfäden für Ihr Selbstcoaching zu nutzen.
Vielleicht wird dieses Buch auch für Sie eine Reise zur Lösung.
Die ersten drei Etappen dieser Reise bieten Grundverständnis und Know-how für unterschiedlichste Situationen, insbesondere für Einzelgespräche. Die Etappen vier bis sechs zeigen konkrete Anwendungsbereiche. Etappe sieben lädt Sie ein, Wertorientierung umfassender zu betrachten.
Ich, du, Sie …
Als Leserin und Leser werden Sie natürlich mit „Sie“ angesprochen. In Seminaren, Workshops und Moderationen lade ich fast immer auf das Du-Wort ein. So verwende ich in den Arbeitsblättern für den unmittelbaren Gebrauch in Gruppen und Teams das „Du“ als Anrede. In der Reflexion meiner persönlichen Erfahrungen spreche ich gerne in Ich-Form und lade Sie ein, sich mit dieser Perspektive zu identifizieren, so wie es für Sie stimmt.
Ich wünsche mir, dass dieses Buch Ihnen hilft, Kompetenz und Leichtigkeit zu entdecken, mit Verständnis und Wertschätzung auf verschiedenste Aspekte Ihrer Arbeit zu schauen und Lernmöglichkeiten wahrzunehmen. Meine Gedanken habe ich aus eigenem Erleben formuliert und freue mich, wenn etwas von dem, was mich beeindruckt und zum Lernen herausgefordert hat, auch für Sie hilfreich ist und Sie in Ihren beruflichen Herausforderungen begleitet.
Herzlichen Dank
an alle, die durch ihr Vorbild, durch Beiträge, durch Anregungen und kritische Rückmeldungen zu diesem Werk beigetragen haben. Ich bedanke mich bei allen, die mich herausgefordert haben zu lernen, und bei allen, die mich durch Wertschätzung, Ermutigung und gute Wünsche gestärkt haben.
Salzburg
Paul Lahninger, www.topseminare.at, Autor, Psychotherapeut, Ausbildungsleiter für Coaching- und Train-the-Trainer-Lehrgänge sowie Führungskräfteseminare im Ausbildungsinstitut AGB – einem Trainernetzwerk mit 25 Jahren Methodenkompetenz (www.AGB-seminare.at).
Zahlreiche der im Buch beschriebenen Arbeitshilfen stehen Ihnen als Download zur Verfügung. Zugriff über den Link:
www.managerseminare.de/tmdl/b,190669
Bin ich Coach?
Arbeitsgespräch zum Manuskript am 23. Juli 2009 in Wien. von Matthias Varga von Kibéd
Möglicherweise ist das Ihre Frage am Beginn dieses Buches, das förderliche Haltungen und Aspekte der Gesprächsführung als Unterstützung zur Lösungsfindung anbietet: „Bin ich Coach?“ Sollten Sie derzeit meinen, Sie wären kein Coach, so erlaube ich mir weiterzufragen: Woher wissen Sie das? – Mit hoher Wahrscheinlichkeit leben Sie Kompetenzen, die für andere Menschen nützlich sind, um eigenverantwortliche Lösungen zu entdecken. Und auch wenn Sie sich als Coach bezeichnen, lade ich Sie auf die Frage ein: Woran erkennen Sie, dass das, was Sie tun und was Ihnen in dieser Tätigkeit wertvoll erscheint, sich als hilfreich erweist?
Dieses Buch möchte Sie anregen, diesen Fragen Aufmerksamkeit zu schenken und dabei den Blick auf Qualitäten zu richten, die in unterschiedlichsten Lebenssituationen wertvoll sind. Vermutlich sind Ihnen Qualitäten des Coachings auch vertraut, wenn Sie Erfahrungen reflektieren, Entscheidungen durchdenken, Einsichten gewinnen und sich dabei selbst „Coach“ sind.
Eine wesentliche Kostbarkeit ist die Orientierung an Eigenverantwortung; Eigenverantwortung, die bereichert und stärkt; Eigenverantwortung, die wir dringend benötigen auf unserer Reise als gesamte Menschheit. Mit diesem Blick auf das Ganze wird der Gewinn durch Coaching-Qualitäten besonders deutlich: Was in unserem Denken verändert sich, wenn wir auf das Ganze schauen und unseren Einfluss auf das Ganze bewusst wahrnehmen?
Eigenverantwortung als Zivilcourage
Beim menschlichen Mitschwingen in der Gesamtheit einer großen Gemeinschaft geschieht es oft, dass die Gesamtheit der Masse unreflektierter ist als viele Einzelne. Dies zeigt sich auch in fürchterlichen Beispielen der Geschichte. Das Mitschwingen mit der Gemeinschaft an sich ist noch keine Qualität, so sehr das gemeinsame Erleben, das über die spezifische Wahrnehmung hinausgeht, auch ein faszinierendes Phänomen sein mag. So kann es politisch sehr wichtig sein, dass sich einzelne Personen auch gegen Gruppendruck behaupten. Es braucht immer die persönliche Prüfung vor dem Einlassen auf das Gemeinsame, sodass die Emanzipation des selbstbestimmten Individuums eine kostbare Qualität ist, in der wir aus negativer Verbundenheit heraustreten können.
Wir können Verbundenheit wählen oder aber wählen, individuell anders zu denken und zu handeln als andere. Wenn zum Beispiel bestimmte Formen von Profitorientierung zunehmend von vielen Menschen abgelehnt werden, so schließe ich mich diesem Trend gerne an. Doch ich möchte mich nicht gerne der Masse der Menschen anschließen, die sich an maximaler Mobilität mit dem eigenen Auto orientiert. Andererseits kann es wohltuend sein, sich in Verbundenheit mit den vielen Menschen wahrzunehmen, die globale Verantwortung als hohe Priorität leben.
Widerstand gegen den Trend der Mehrheit ist eine wertvolle Gelegenheit, um die Richtung der Gemeinschaft zu prüfen und bei Bedarf zu korrigieren. In diesem Sinne wünsche ich mir anregende Gegensätze.
Anerkennen von inneren Widersprüchen
Eigenverantwortung kann auch bedeuten, sich mit eigenen inneren Widersprüchen auseinanderzusetzen. Mir gefällt zum Beispiel die Idee, als Teil von Friedensarbeit gesellschaftliche Gewaltmuster in mir selbst zu erkennen und innere Friedensarbeit als Voraussetzung für äußere Friedensarbeit zu sehen. Wahrscheinlich ist es für manche Menschen auch wichtig, in Bezug auf solche Widersprüche in sich selbst zunächst so etwas wie Traurigkeit oder Erschütterung zu empfinden. Das Ziel dieser Auseinandersetzung kann sein, Annahme für alle Aspekte in der eigenen Person zu entwickeln, auch für die Anteile, die unserer Werthaltung widersprechen. Dies zu lernen, ist wohl eine der größten Herausforderungen der Persönlichkeitsentwicklung.
Verantwortlichkeit durch Erfolgsorientierung
In herausfordernden persönlichen Lernzielen zeigt sich die Wirksamkeit einer Haltung, die auf das schaut, was gelingt. Ein deutliches Beispiel dafür bietet die Suchttherapie. Da gibt es den Ansatz der Anonymen Alkoholiker mit der täglichen Erneuerung eines Beschlusses. Für die Entscheidung zur Enthaltsamkeit wird der kurze Zeitraum eines Tages genommen und es ist wesentlich, dass der Beschluss dann für diesen Tag gilt und nicht innerhalb eines Tages ständig erneuert werden muss. Wenn der Beschluss halbherzig ist, kann es sein, dass dieser innerlich angezweifelt wird und dieser Zweifel bereits ein gewisser Mangel wäre. In dieser Forderung zur Entschiedenheit für einen Tag liegt in gewisser Weise etwas Radikales. Die Gemeinschaft stützt zwar Menschen, die einen Rückfall hatten, doch das bedeutet, dass sie mit der Vorstellung von Misserfolg arbeitet. Etwas milder dargestellt, können wir einen Rückfall als Umweg zum gesetzten Ziel deuten. Doch auch die Vorstellung eines Umweges enthält eine Kritik: Es ist nicht der direkte Weg.
Ein anderer Ansatz verzichtet auf die Vorstellung des Rückfalls und arbeitet mit der Konstruktion einer Erfolgsgeschichte. Im Falle eines Rückfalls hilft der Gedanke: „Da habe ich es einen halben Tag geschafft, vielleicht schaffe ich es das nächste Mal einen ganzen Tag.“ So können wir das, was wir üblicherweise Rückfall nennen, als Ausnahme von der Enthaltsamkeit sehen. Die Aufmerksamkeit in der Ausnahmesituation kann dann darauf gerichtet werden, wie ich dabei mit mir umgehe. Dies entspricht einem Training in kontrolliertem Trinken: Die Ausnahme wird aufgewertet, sozusagen vertieft. Von der Logik her ist dies ein paradoxes Konzept. Doch es scheint, dass diese Konzepte wirksamer sind als die Orientierung an einem radikalen Beschluss.
So laden wir Sie ein, sich zu fragen, welche Auswirkungen das für Sie haben könnte, wenn Sie Ihre persönliche Erfolgsgeschichte zu Ihrer Coaching-Kompetenz konstruieren. Vielleicht ist dies eine hilfreiche Metapher, um andere Menschen wirksam zu begleiten, Lösungen zu finden und eigenverantwortlich zu handeln, vielleicht auch, indem Sie sich vorstellen, wie kostbar Ihr Beitrag für das Ganze sein kann.
Fotos und Grafiken
S. 56, 239 … Helga Gumplmaier
S. 100, 355 … Bernhard Weiser
S. 224, 300 … Herbert Brindl
S. 247 … Reinhold Rabenstein
S. 297, 298 … Judith Mayer
S. 323 … Olivia Wollinger
S. 345, 350, 370 … Robert Graf
Alle weiteren Fotos und Grafiken … Paul Lahninger
Die Fotos stehen in keinerlei Zusammenhang zu den zitierten Fallbeispielen!
Etappe ICoaching als Haltung
Urwald im Norden Indiens
„Wir stehen Menschen bei und halten zu ihnen, während sie sich selbst helfen!”
Erich Fromm
Mit einem Auszug aus „Momo” von Michael Ende wird die Grundidee von Begleitung zu selbstständigen, eigenverantwortlichen Lösungen gezeigt und die wörtliche Abschrift einer hilfreichen Coaching-Einheit gibt Einblick in die konkrete Umsetzung dieser Qualität.
Die Reise zur Lösung wird getragen durch Werthaltungen: Wertschätzendes Begleiten ist eine Kommunikationsform, die sich in unterschiedlichen Rahmenbedingungen als äußerst effektiv erweist. Es geht darum, die Besonderheit der jeweils einzigartigen Situation wahrzunehmen und ein angemessenes und hilfreiches Setting zu schaffen. Systemische Thesen unterstützen die Werthaltung des Zutrauens als Beitrag für Veränderung und Weiterentwicklung.
Zur eigenen Lösung reisen
Die Kutsche
Praxisbeispiel: Überlastung bewältigen
Wertorientierung
Wertschätzend begleiten
Coaching – Anwendungsspielräume
Setting-Qualitäten
Coachend begleiten: inhaltlich enthaltsam
Coaching-Haltung
Die Wertorientierung trägt die Methode
Systemische Thesen
Effektiv kommunizieren – systemisch betrachtet
„Wirklichkeit“ ist etwas, das wir erschaffen
Coaching als Zutrauen in Veränderung
Grenzen des coachenden Begleitens
Wertorientierung
Wertschätzend begleiten
Coaching verstehen wir als zielorientiertes, wertschätzendes Begleiten einer Person oder eines Teams in persönlichen, eigenverantwortlichen und autonomen Prozessen der Lösungsfindung durch unterstützende Fragen, ohne Ratschläge zu geben oder das Ergebnis zu beeinflussen. Dieser Prozess wird durch die Haltung und die methodische Kompetenz von Coachs in unterschiedlichsten Situationen und „Settings“ wirksam.1
In einem Coaching-Prozess bearbeiten Ratsuchende Herausforderungen und Entwicklungsprozesse, machen sich persönliche Kompetenzen bewusst, stärken und erweitern Handlungsspielräume. Coaching ist ziel- und lösungsorientiert in Bezug auf konkrete Situationen.2 Anlass für Coaching ist, dass eine Person Unterstützung in Anspruch nimmt, um …
Entscheidungen zu treffen,Arbeitsvorgänge zu verbessern,besondere Herausforderungen zu bewältigen,Beziehungen zu verbessern,Konflikte zu lösen,Gefühle oder Sorgen zu bearbeiten,Werthaltungen zu reflektieren.Die ratsuchende Person ist dabei für Lernen und Entscheidungen selbst verantwortlich.3
Humanistische Psychologie als Quelle
Die Idee, Menschen durch Fragen anstatt durch Ratschläge zu unterstützen, ist Jahrtausende alt. Sokrates beschrieb sich auch als Geburtshelfer für Ideen. In der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts hat Carl Rogers die „klientenzentrierte Gesprächstherapie“ ausgearbeitet und ihre Wirksamkeit systematisch erforscht. Im Unterschied zur klassischen Psychoanalyse verzichtet er dabei auf Deutungen und konzentriert sich auf wertschätzendes, einfühlendes Zuhören. Aus diesen Erfahrungen formulierte er die Kernthese der humanistischen Psychologie: „Das Individuum verfügt potenziell über unerkannte Möglichkeiten, um sich selbst zu begreifen und sein selbstgesteuertes Verhalten zu verändern; dieses Potenzial kann erschlossen werden.“4 In seinen Publikationen betont Carl Rogers die Wirksamkeit des Zuhörens für die individuelle Lösungssuche und Weiterentwicklung. Die Kunst des Zuhörens ist die Kernkompetenz dessen, was wir mit Coaching meinen.
Professionelles Coaching
Coaching im engeren Sinn meint einen deklarierten, professionell geleiteten Prozess mit einem Profi-Coach in einem entsprechend geschützten Setting mit vorheriger Absprache von Ziel und Dauer.2
Dieses Coaching ist keine Psychotherapie und keine Fachberatung. Andererseits wird in manchen psychotherapeutischen Ansätzen „coachend“ gearbeitet. Auch Fachberatung wird häufig Teilschritte beinhalten, in denen Coaching-Qualitäten genutzt werden. Ein Aspekt von Coaching-Kompetenz besteht darin, die Möglichkeiten und Grenzen im konkreten Anwendungsspielraum zu beachten (siehe folgende Seite).
Grenzen und Risken
Qualitäten des coachenden Begleitens können in unterschiedlichste Situationen einfließen. Die Intensität des eigenverantwortlichen Lösungsfindungsprozesses wird durch Rahmenbedingungen und Kompetenzen der Beteiligten ermöglicht und eingeschränkt. Getragen wird dieser Prozess von der Haltung der Person, die die Begleitung anbietet. Ein wesentliches Risiko sehe ich darin, dass Menschen die Rolle des Begleitens so sehr genießen, dass sie zu wenig auf die Grenzen des Angemessenen und des Auftrags der Ratsuchenden achten. Die Bewusstheit der eigenen Rolle und der Rahmenbedingungen des Settings sowie die Bereitschaft, sich selbst kritisch zu reflektieren, hilft
auf den Auftrag der Betroffenen zu achten,die Angemessenheit des Themas zu prüfen,eigene Ziel- und Lösungsvorstellungen zurückzustellen.Coaching – Anwendungsspielräume
Der Begriff Coaching wird unterschiedlich verwendet, häufig wird jede Unterstützung als Coaching bezeichnet, z.B.: „Make-up-Coachs“, die ähnlich wie Sport-Coachs eingreifen und Anweisungen geben.
In diesem Buch geht es um Coaching als Begleitung eigenverantwortlicher Zielsetzung und Lösungsfindung – ohne jedes Eingreifen und ohne Ratschläge zu geben.
1. Coaching im engeren Sinn
Coaching-Prozesse der autonomen Lösungsfindung brauchen klare Rollenverteilung. Diese Rollen sind am deutlichsten, wenn Ratsuchende sich an unabhängige Profis wenden: Interne, entsprechend ausgebildete Coachs innerhalb einer Organisation sind unabhängig, wenn sie vom Thema des Coachings nicht betroffen sind. Bei externen Coachs ist diese Außenposition noch deutlicher. Das Gesprächs-Setting beinhaltet:
Freiwilligkeit,Auftrag der ratsuchenden Person,partnerschaftliche Beziehung.Die Bezeichnung dieses Settings (als Coaching, Supervision oder Beratung) halte ich für zweitrangig, solange die Rollen geklärt sind. In der Einzelbegleitung wird diese Rollenklarheit leichter zu überprüfen sein als in Teamcoaching und Teamentwicklung, da dort der Auftrag meist von der Teamleitung kommt. Eine wesentliche Herausforderung im „Profi-Coaching“ sehe ich darin, dem Auftrag treu zu bleiben und einen neuen Auftrag zu vereinbaren, wenn sich das Ziel im Gespräch verändert.
2. Coaching-Aspekte in Lehrveranstaltungen
Trainerinnen und Trainer, Lehrende, pädagogisch Tätige begleiten „coachend“:
Fragen nach persönlichen Zielen,individuelle Betroffenheit,konkrete Umsetzung von Gelerntem,selbstständige Arbeit, z.B. in einer Diplomarbeit.Diese Begleitung kann im Sinne von Coaching angeboten werden, wenn Freiwilligkeit und Eigenverantwortung für Ergebnisse besteht. Für viele Lehrbeauftragte ist dies ein selbstverständlicher Teil ihrer Kompetenz, in der sie den Rollenwechsel vom Vortragen (und vom Bewerten von Lernfortschritt) zum Begleiten bewusst vollziehen.
Bei Wissenserarbeitung hingegen ist die Ergebnis-Offenheit deutlich reduziert. Wenn Vortragende während des Vortrags Fragen stellen, passiert es oft, dass sie nur erwünschte Antworten beachten. Dabei kann eine Atmosphäre entstehen, in der den Lernenden lediglich die Rolle zukommt, Lückentexte im Vortragenden auszufüllen. Dies hat nicht das Geringste mit coachendem Begleiten von Eigenverantwortung zu tun.
3. Begleiten in Privatbeziehungen
In freundschaftlichen oder familiären Gesprächen wird Coaching-Kompetenz ein wertvoller Beitrag sein, der von vielen einfühlsamen Menschen ganz selbstverständlich eingebracht wird. Auch besteht die Möglichkeit, eine Art spontane Rollenvereinbarung zu treffen, z.B.:
„Ich möchte dir von meinem Problem erzählen, magst du mich beim Nachdenken begleiten?“ oder aus der Perspektive des Zuhörens:„Wenn du willst, spiele ich jetzt Coach.“Auch wenn der Rollenwechsel nicht angesprochen wird, ist Rollenbewusstheit wertvoll. Sinnvollerweise wird es sich bei dieser Begleitung auch unter Profis um Mini-Sequenzen handeln, mit einem Blick auf die Grenzen dessen, was in diesem Setting angemessen ist: Denn sobald eine Beziehung außerhalb des Coachings besteht, sind wir gefährdet, subjektiv zu sein und einen Standpunkt zu beziehen, oft auch unbewusst und subtil. Dies jedoch behindert Ergebnis-Offenheit. Solche Grenzen zu wahren, ist wesentlicher Teil der Kompetenz.
4. Coaching-Kompetenz in der Führung
Die Führungskraft ist kein Coach.5
Wenn eine Führungskraft Lösungsfindung von Teammitgliedern in Wertschätzung begleitet, ohne inhaltlich mitzureden, lebt sie Coaching-Kompetenz und nutzt Coaching-Elemente als Führungsinstrument.6 Sie begleitet dabei z.B.:
wie eine vorgegebene Aufgabe erfüllt wird,welche Fortbildung ein Teammitglied wählt,wie eine Anforderung bewältigt werden kann.Eine Führungskraft ist kein Coach im engeren Sinn, denn auch das Kontrollieren, Abgrenzen, Aufträge erteilen sind wichtige Führungsaufgaben und erfordern, dass die Führungskraft die Lösungsfindung eines Teammitgliedes beeinflusst oder bewertet. Dieses Eingreifen ist der Gegenpol zum coachenden Begleiten, auch wenn es wertschätzend gestaltet wird. Die Verantwortlichkeit von Vorgesetzten für Ziele und Ergebnisse begrenzt die Möglichkeiten des ergebnisoffenen Begleitens.1+2
Wertschätzend begleiten als Führungskraft
Ein erfahrener Manager erzählt: „Das Begleiten individueller Lösungsfindung erweitert das Spektrum des Führungsverhaltens, um bei Teammitgliedern die Fähigkeiten zur selbstständigen Problemlösung und Aufgabenbewältigung zu fördern. Die wesentliche Qualität ist Wertschätzung. Ich habe immer wieder erfahren, wie diese wertschätzende Grundhaltung und der Glaube an die Lösungskompetenz mein Team beflügelt hat, mit Freude engagiert zu sein. Mitarbeiterentwicklung ist ein Prozess, der Zeit braucht, denn Menschen, die gewohnt sind, dass ihre Vorgesetzten ihnen Entscheidungen abnehmen, können mit Freiräumen wenig anfangen.“
Führungskräften stellt sich die beachtliche Herausforderung, zwischen zwei Rollen bewusst zu wechseln: zwischen der Rolle des Führens durch Erteilen von Aufträgen und der Rolle des coachenden Begleitens individueller Entscheidungen im Rahmen der vorgegebenen Ziele. Wenn ich als Führungskraft eine Idee eines Teammitgliedes nicht zulassen möchte, dann halte ich es für sinnvoll, dies direkt auszudrücken. Jemanden mittels Fragetechnik zu einem bestimmten Ergebnis „hinzucoachen“, wäre Manipulation, insbesondere, wenn dabei suggeriert wird, die geführte Person könne frei entscheiden.
Eingeschränkt werden die Möglichkeiten des Coachings wesentlich auch durch die Vorstellungen der Ratsuchenden, viele Teammitglieder würden nicht wagen, „Coaching“ durch einen Vorgesetzten abzulehnen und tendenziell erwünschte Antworten geben. Somit ist Freiwilligkeit und Ergebnis-Offenheit eingeschränkt.
Coaching ist Haltung und Prozess
Zusätzlich zum wertschätzenden Zuhören und zur Fragetechnik gehört wesentlich noch die Struktur des Prozesses.
Wenn eine Führungskraft als Coach bezeichnet wird, verschwimmt die Unterscheidung zum Coaching durch externe Profis: In der Begleitung durch externe Coachs werden anspruchsvollere methodische Angebote möglich, der zeitliche Rahmen wird eher als Freiraum erlebt und die Beziehung zu Coachs wird durch einen Arbeitsvertrag geregelt, indem die ratsuchende Person bezahlt: „Wer zahlt, schafft an.“
Die Beziehung von Teammitgliedern zu Vorgesetzten ist jedoch eine hierarchische Beziehung. Ich erlebe auch, dass Leitende zur Durchsetzung von Zielen (wohlgemeint) Coaching-Fragen einzusetzen versuchen, dabei wird die Fragetechnik tendenziell suggestiv.
Rollenklarheit
Eine besondere Stärke, zusätzlich zur kommunikativen Kompetenz, ist die Bewusstheit, in welcher Rolle ich mich gerade befinde. Diese Rollenbewusstheit beinhaltet die Kompetenz, quasi von außen auf mich und das, was ich tue, hinzuschauen, gewissermaßen als Meta-Kompetenz. Diese Kompetenz leben Eltern, wenn sie spontan entscheiden: Ist es gerade angemessen, mein Kind eigene Lösungen finden zu lassen, oder bin ich gefragt, Grenzen zu ziehen, um Halt und Sicherheit zu geben?
Rollenklarheit erkennt die Qualitäten eines Settings und der eigenen Position zum Beispiel daran, dass externe Coachs nicht Teil des Systems sind, in dem die ratsuchende Person handelt.
„Coachendes“ Begleiten
Für Führungskräfte, Lehrende, Eltern oder Fachberatung ist Coaching-Kompetenz eine wertvolle Möglichkeit, solange diese Kompetenz bewusst in Freiräumen eingesetzt wird, in denen Ratsuchende tatsächlich frei entscheiden und individuelle Lösungen eigenverantwortlich umsetzen können. Beteiligende, wertschätzende Führung, ärztliche Begleitung, Fachberatung, Seminarleitung, pädagogische Arbeit verwendet Instrumente des Coachings und übt sich in der Haltung, ein Maximum an individueller Lösungsfindung zuzulassen. Sie achtet sorgfältig darauf zu klären, ob eine Gesprächsbegleitung gewünscht wird („Auftragsklärung“). Oft will jemand ein Problem ansprechen, ohne in ein weiterführendes Gespräch einzusteigen. Unangenehm erlebte ich in einem Vortrag, wie ein Teilnehmer einen Konflikt ansprach, worauf die Vortragende ohne jede Rückfrage dies als Beispiel nutzte, um den Betroffenen zu einer Lösung „hinzucoachen“.
Meist wird sich die Begleitung der individuellen und autonomen Lösungsfindung in Lern- und Arbeitssystemen auf einen Teilaspekt beschränken. Dieser Unterschied scheint mir wie der zwischen der Schifffahrt auf einem Fluss, die durch dessen Ufer begrenzt ist, und dem Segeln auf dem Meer. Ebenso leben wir Coaching-Kompetenz in unterschiedlichsten Settings und können dort die jeweils besonderen Herausforderungen und Chancen wahrnehmen. Eine besondere Kompetenz dabei ist, situativ ein möglichst hilfreiches Setting zu gestalten.
Setting-Qualitäten
Je mehr von den folgenden Setting-Qualitäten erfüllt sind, umso umfassender und tiefgehender kann sich der Prozess der eigenverantwortlichen Lösungssuche gestalten:
Bewusstheit der Möglichkeiten und Grenzen im verfügbaren Setting ist ein Aspekt von Kompetenz. Die folgenden Beschreibungen von Setting-Aspekten werden in der Grafik dargestellt.
Wenn eine Führungskraft, ein Verkäufer, eine Fachberaterin, eine Ärztin als Teil professioneller Gesprächsführung beispielsweise für 10 Minuten coachend begleitet, so bedeutet dies einen Rollenwechsel, z.B. vom Kontrollieren oder Informieren zum Begleiten. Dies kann ein wertvoller Beitrag für Beziehungsqualität und für ein gutes Ergebnis sein.
Wenn Vortragende oder Lehrpersonen eine Arbeitssequenz gestalten, in der Lernende ihre individuelle Umsetzung planen, dann ist diese Phase wohl etwas länger, doch auch hier besteht ein Rollenwechsel der Leitung vom Präsentieren zum Begleiten.
Eine gute Gelegenheit für geplante Coaching-Sequenzen zwischen Teammitglied und Führungskraft bietet das regelmäßige Mitarbeitergespräch.
Auch bei der Beauftragung zur Begleitung eines Teamprozesses an externe Coachs erlebe ich unterschiedliche Erwartungen und Vorstellungen bezüglich der Rolle des Coachens, zum Teil einfach deswegen, weil der Auftrag meist von der Führung kommt und Teammitglieder in die Planung oft wenig einbezogen werden.
Am eindeutigsten empfinde ich die Rolle des Coachens in einem längerfristigen Prozess, etwa über fünf Gesprächstermine, wenn eine ratsuchende Einzelperson bewusst diese Form von Unterstützung sucht und dazu in die Praxis einer entsprechend ausgebildeten Person kommt. Diese Prozesse werden unterschiedlich bezeichnet, als Coaching, Supervision oder Kurzzeit-Therapie.8
Die vertikale Achse der folgenden Grafik bezieht sich auf die Eindeutigkeit der Coaching-Rolle, die horizontale Achse auf die Dauer des Prozesses.
Coachend begleiten: inhaltlich enthaltsam9
Indem ich darauf verzichte, Ratschläge zu geben, fördere ich Eigenverantwortung.
Wir verwenden den Begriff Coaching für einen Prozess der Begleitung, in der die gecoachte Person (die/der Coachee) ausschließlich selbst für Lernen, Bewerten und Entscheiden verantwortlich ist. Viele Erfahrungen zeigen, dass Coaching dann am effektivsten ist, wenn sich Coachs ganz auf den Prozess konzentrieren, indem sie Fragen stellen, aktiv zuhören und ganz bewusst darauf verzichten, eigene Ideen, Bewertungen, Ratschläge und Vorstellungen einzubringen.10
Wenn ich als Coach in die Rolle des Lieferanten von Ratschlägen wechsle, wird eigenverantwortliche Lösungssuche beeinträchtigt. Menschen fragen zwar um Rat, geben manchmal auch gerne die Verantwortung ab, verleiten Coachs (meist unbewusst) dazu, Tipps zu geben oder sehen Coachs als Experten, die wissen, wie es geht: Ratschläge zu befolgen ist jedoch meist weniger effektiv als eigene Lösungsfindungsprozesse.
Risiken beim Ratschläge geben
Wenn ich als Coach Tipps gebe, besteht die Gefahr,
dass ich Coachees Chancen wegnehme, eigene Ideen zu entwickeln,dass Coachees mich mit dem Tipp identifizieren, mir Erfolg oder Misserfolg zuschreiben,dass ich mich mit meiner Idee identifiziere, für diese werbe, mich geschmeichelt fühle, wenn meine Idee angenommen wird, vielleicht sogar für meine Idee (gegen Coachees) kämpfe, sodass dies meine Außenperspektive einschränkt, ich zu einem Teil des Systems werde,dass ich in Lösungs-Tipps versteckte Macht lebe, mich als Schattenführungskraft fühle.Zugleich kann es dabei leicht geschehen, dass die gecoachte Person sich mir als Coach unterordnet, eigene Lösungsideen und Erfahrungen weniger nutzt,den Ratschlag mir zuliebe probiert, auch wenn dieser nicht passend ist, odersich gegen die Tipps wehrt: „Ja, aber … das funktioniert sowieso nicht!“So kann es passieren, dass wir andere durch Hilfe schwächen.
Für eigenverantwortliches Lernen, für die persönliche Motivation, für die Erweiterung von Kompetenzen ist der Coaching-Prozess ohne Ratschlag eine besonders wirksame Möglichkeit. Andere Formen des Leitens, wie z.B. Anweisungen geben, sind nicht schlechter, wirken jedoch anders.
Wenn Coachees um Rat fragen:
Fragen zeigen oft einen wichtigen Aspekt auf, z.B. Coachee A: „Aber was soll ich tun, wenn xy eintritt?“ Als Coach antworte ich: „Du suchst also eine Lösung, die auch für xy passt.“ Ich spiele den Ball zurück und die ratsuchende Person kann mehr über xy erzählen.
Auf der Prozessebene denken!
Als Coach übe ich, anstatt inhaltlich („Welche Lösung ist möglich?) auf der Prozessebene zu denken: „Wie kommt die Person zu ihrer Lösung?!“ Beispiel – Coachee A:
A: „Ich hab einfach keine Idee, was ich da tun soll, was würden Sie denn da tun???“ Coach:
C: „Wenn Sie sich vorstellen, da ist etwas, das Ihnen den Blick auf Lösungsideen nimmt, was könnte das sein?“ Oder:
C: „Ich kann dazu nichts sagen, ich bin ganz damit beschäftigt, dich zu unterstützen, eine eigene Lösung zu finden.“ Oder auch:
C: „Was glauben Sie, wie würde ich an diese Sache herangehen?“
Diese Frage lädt zum Perspektivenwechsel ein: Die ratsuchende Person versetzt sich in eine Person, die sie für kompetent hält.
Unzufriedenheit als Falle für Coachs
Ein Coach rutscht leicht in die Ratgeberrolle, wenn er/sie unzufrieden mit dem Gesprächsverlauf ist, weil z.B. die Lösungssuche zu einem Anliegen (scheinbar) ins Stocken gerät. Auch dieses Empfinden kann ich einbringen, z.B.:
C: „Ich hab den Eindruck – und bin neugierig, wie du das siehst –, dass du es bei diesem Thema jetzt dabei belassen möchtest und dass es für dich derzeit nicht darum geht, eine Lösung zu erarbeiten?“
Auch so spiele ich den Ball zurück und die ratsuchende Person entscheidet, ob sie über dieses Thema weiter nachdenken will.
Die Ausnahme: als Coach Ideen einbringen
Spezielle Situationen bilden Ausnahmen, z.B. Krisen, wenn ich mir sicher bin, dass rasches Handeln wichtiger ist als der Prozess der Lösungssuche, oder weil ich einen Buchtipp oder eine Kommunikationstechnik anbieten möchte. In diesem Fall biete ich Alternativideen an oder füge meine Idee den bereits erarbeiteten Ideen hinzu. So bleibt Auswahl und Bewertung der Inputs bei den Coachees.
Wesentlich dabei ist meine Haltung.
Coaching-Haltung
Coachende Begleitung wird wirksam durch gelebte Haltung: Die Haltung trägt die Methode. Hier eine Zusammenstellung von förderlichen Werthaltungen für die Reise zur Lösung.11
Neue Lösungen enthaltsam begleiten
Im Rahmen meiner Werte und Grenzen als Coach stelle ich mich zur Verfügung, den selbst gewählten Weg eines anderen Menschen zu begleiten.Ich bin neugierig, höre zu, stelle meine Sichtweisen und Ideen zurück und übe mich, meine eigenen Lösungsvorstellungen loszulassen.Wenn es angemessen erscheint, hinterfrage ich Konventionen und verfestigte Bilder.Ich begleite, um die Anzahl der Denk- und Handlungsmöglichkeiten zu vergrößern.Ich begleite für begrenzte Zeit, schließe den Prozess bewusst ab und übe mich, freizugeben (auch wenn es gut tut, gebraucht zu werden).Annehmend und wertschätzend
Meine Wertschätzung unterstützt Selbstvertrauen und ermutigt. Ich respektiere persönliche Lernwege auch in Konflikten und Krisen, würdige individuelle Lebensgeschichten (es ist zweitrangig, ob ich diese verstehe).