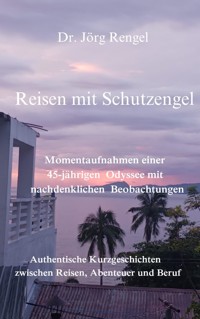
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Mit 21 beginnt Jörg mit dem, was er sich für den Ruhestand vorgenommen hatte: die Welt zu bereisen. Ohne seinen Schutzengel, so sagt er selbst, hätte er all die körperlichen Zerreißproben und gefährlichen Konflikte kaum überlebt. 1980 kauft er sich in New York ein Motorrad und legt damit 80.000 Kilometer zurück. Es folgen Jahre auf unsicherem Terrain – durch Krisengebiete am Nil, in Mittelamerika, in Ostasien, Papua-Neuguinea, Neukaledonien, Südamerika. Auch fährt er mit dem Auto quer durch Russland bis nach Südkorea. Und dann wieder Afrika – dort, wo er neun Jahre lang, Tag für Tag, mit einer bitteren Wahrheit konfrontiert wird: Hilfe – die Helfer kommen. In seinen authentischen Kurzgeschichten bewegt er sich zwischen Reisen, Beobachtungen und beruflichem Alltag oft an der Grenze des körperlich und geistig Erträglichen. Die Realität, wie er sie vorfindet, ist selten bequem. Aber genaues Hinsehen ist unerlässlich – besonders, wenn man ein Land wirklich verstehen oder glaubwürdig über den Unsinn von Hilfsorganisationen und deutschen Behörden berichten will. Doch darum geht es beim Reisen: nicht nur Postkartenmotive zu betrachten. Sondern die Menschen. Ihre Geschichten. Und die Wirklichkeit dahinter. Zu seinem Renteneintritt nun dieses außergewöhnliche Buch über Reisen, Abenteuer und unbequeme Tatsachen. Alles ist wahr - nur Personennamen wurden geändert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 560
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Texte: © 2025 Copyright by Dr. Jörg Rengel
Umschlaggestaltung: © 2025 Copyright by Evelyn Gbekeborsu
Verlag:
Dr. Jörg Rengel
Allerberg 32
37130 Gleichen
Herstellung: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Nordamerika
New York, 26. März 1980 – Die erste Nacht
Taxi? fragt eine Stimme aus dem Nichts. Ich bin 21 Jahre alt und stehe zum ersten Mal auf amerikanischem Boden. Es ist tief in der Nacht. Der Bus vom Flughafen John F. Kennedy hat mich in Manhattan abgesetzt – Endstation. Kein Mensch weit und breit. Nur kalter Asphalt, Neonlicht, und das Flackern einer Straßenlaterne, die mehr Schatten wirft als Licht. Zwischen den Häuserschluchten fühle ich mich wie bestellt und nicht abgeholt – im wahrsten Sinne des Wortes.Mein Blick wandert immer wieder nach oben, zu den endlos aufragenden Fenstern der Wolkenkratzer. Ich komme mir klein vor. Sehr klein und sichtbar. Der Seesack mit dem Aufkleber der Fluglinie, das ratlose Umherblicken – man erkennt sofort, dass ich nicht von hier bin: ich bin ein Tourist. Im Seesack: alles, was ich für ein Abenteuer brauche. Kleidung, Ausrüstung, und 20.000 DM in bar, etwa 10.000 Euro. Über meiner Schulter hängt das Gewicht von Aufbruch und Risiko. Meine Vorfreude wird von einer mehr als unheimlichen Atmosphäre gedämpft. Die Luft ist eisig. Aus den Kanaldeckeln steigen Dämpfe auf, weißlich, zischend und geisterhaft. Sie kriechen wie Nebel über den Asphalt und verwandeln sich in trügerische Schwaden, die jede Kontur verschlucken. In meiner Fantasie nehmen sie Formen an – Fratzen, Schatten, etwas Unheimliches. Ich zittere. Ist es ein Zittern, als ob ich einen Edgar-Wallace-Film mit grusseliger Nachtatmosphäre sehe? Nein - denn als die Stimme ertönte, stieg der Adrenalinspiegel an. Panik machte sich breit. Ein Zettel mit der Skizze von hier bis zur Pension ist meine Orientierung. Der muss ausreichen, um der Bedrohung zu entkommen. Doch das Zittern der Hände ist nicht zu übersehen. Meine Angst ist sichtbar.
Dann wieder: Taxi? – diesmal näher, mit dunklerem Klang.
Eine Gestalt löst sich aus der Dunkelheit. Ein Mann. Mein Atem stockt. Er sieht aus, wie jemand, dem man - egal wo, nachts nicht begegnen möchte. Wie viel kostet die Fahrt bis zur Pension? frage ich. 20 Dollars antwortet er knapp. Viel zu viel für vier Blocks und eine Querstraße, denke ich. Ich bin plötzlich hellwach. Der Jetlag? Weg. Die Müdigkeit? Verschwunden. Ich spiele auf Zeit, versuche, mit meiner Mimik keine Unsicherheit zu zeigen, doch innerlich rattert es. Denk nach und gewinne die Kontrolle zurück. Und dann das: Eine zweite Gestalt tritt aus dem Nebel. Sie stellt sich seitlich vom anderen und versperrt mir den Weg. Ich mache einen Schritt zurück und bringe beide in mein Blickfeld. Ich weiß, dass sie merken, dass ich hilflos bin. Also bluffe ich. Ich habe keine 20 Dollar bei mir, sage ich ruhig. Mein Freund wartet im Hotel. Er wird die Fahrt bezahlen. Kein Zittern war in meiner Stimme. Die Antwort, selbstbewusst und mit aller Entschiedenheit, überraschte nicht nur die Männer, sondern auch mich. Sie klingt glaubwürdig. Ohne Protest drehen sich die Männer um und verschwinden in der Dunkelheit, aus der sie gekommen sind.
Ich bin wieder allein. Zitternd, aber entschlossen. Die Skizze zwischen den Händen – handgezeichnet von einer freundlichen Mitarbeiterin am Flughafen – ist jetzt mein einziger Anhaltspunkt. Doch sie reicht aus. Ohne Umwege führt sie mich durch die Nacht zu einer kleinen Pension. Dort hatte man mir ein Bett reserviert. Ich komme an, spät, müde und immer noch aufgewühlt, aber heil.Dies war meine erste Nacht in den USA und dazu noch meine erste Bewährungsprobe. Vielleicht habe ich dieses Glück dem erfundenen Freund zu verdanken. Vielleicht auch einem Schutzengel. Vielleicht nur einem klaren Kopf im richtigen Moment. Aber wer auch immer dieser Freund war – ich habe das Gefühl, ich werde ihn auf meinen Reisen noch oft brauchen. Es ist beruhigend so einen Freund zu haben.
Streiks und ein Nummernschild
Im März 1980 zeigte sich New York City (NYC) von einer Seite, die man so gar nicht mit der Metropole in Verbindung brachte. Manhattan lag im Chaos. Wegen eines Streiks der Müllabfuhr türmte sich der Abfall an den Straßenrändern. Es war bitterkalt, die niedrigen Temperaturen verhinderten, dass der Müll zu stinken begann. Dennoch, der Anblick war unvorstellbar. Der Müll verschlang die Straßen, so dass ich nur an den Ampelübergängen, die als einzige freigehalten wurden, die Straßenseiten wechseln konnte. Ich konnte das bunte Manhattan kaum erkennen. Es war wie ein Schleier aus Abfall, der die Stadt verhüllte. Und da, im Schatten des Chaos, fanden sich Menschen, die im Müll nach Essbarem suchten. Es war ein Anblick, der mich erschütterte, etwas, das ich mir in dieser Stadt, die für ihre schillernde Pracht bekannt war, damals nie hätte vorstellen können.
Im April 1980 setzte sich das Chaos fort. Jetzt war es der öffentliche Verkehr, der lahmgelegt wurde – Busse und U-Bahnen standen still. Die Straßen waren voll mit Autos, und es gab kaum noch Platz zum Atmen. Die Regeln waren kurios: Autos durften voll besetzt nach Manhattan fahren, was das Chaos nicht minderte. Einen Lichtblick gab es: Die reservierten Straßenabschnitte für Rollschuhfahrer. Hier sausten Geschäftsleute in schicken Anzügen mit Akten und mit geputzten Schuhen in der Hand auf Inline-Skates von einem Termin zum nächsten. So viel Energie mitten im Stillstand. Doch der tägliche Verkehrsstau setzte allen zu. Auch die Parkgebühren. Sie erreichten eine astronomische Höhe von 20 Dollar pro halbe Stunde.
Trotz all dieser Unannehmlichkeiten hatte NYC etwas, das mich in seinen Bann zog: Ihr pulsierendes Leben und die Vielfalt der Kulturen. Der Central Park, Little Italy, die 5th Avenue, das Empire State Building, und der Broadway – all das war New York. Auch die Freiheitsstatue, die für mich als das Symbol für die Werte der Freiheit stand.
Doch nach dem 11. September 2001, als die Live-Bilder des Einsturzes der Twin Towers um die Welt gingen, hatte sich die Stadt verändert. Der Schock der Terroranschläge saß tief, und die Leichtigkeit, die einst in der Luft lag, war einer nachdenklichen Stimmung gewichen. Aber eines war sicher: Den Glauben an die Werte der Demokratie konnten die Attentäter den New Yorkern nicht nehmen. Die Frage, inwieweit die Demokratie ab 2025 unter Trump gefährdet sein könnte, bedarf jedoch einer genauen Beobachtung.
Am 27.03.1980, noch während des Müllstreiks, verkauft mir ein Motorradhändler eine neue wassergekühlte 500er Honda. Sie wurde für 11 Monate mein treuer Begleiter auf der Reise durch 40 Staaten der USA, Kanada und Mexiko. Mit ihr werde ich fast 80.000 Kilometer zurücklegen. Und als ein Stück Heimat zierte ein deutsches Nummernschild das hintere Schutzblech. Das Schild war außergewöhnlich und ich wurde deshalb oft darauf angesprochen.
Staub und Diners
Nationalparks wie Redwood, Grand Canyon, Death Valley Sequoia Trees und Yellowstone waren ohne Zweifel einige Highlights meiner Reise. Und doch, so beeindruckend sie auch waren, ließ sich der wahre Hauch vom ursprünglichen Amerika nicht in Besucherzentren oder auf Asphaltstraßen finden. Wer den wilden Westen spüren will, muss dorthin, wo der Winter die Straßen verschließt und der Sommer nur ein kurzes Zeitfenster für Abenteuer öffnet.Wyoming war einer dieser Orte. Nie wieder hat Motorradfahren so viel Spaß gemacht. Die staubigen, verlassenen Schotterpisten zogen sich durch eine weite, fast vergessene Landschaft. Der Staub tanzte im Rückspiegel, der Horizont flimmerte, und jeder Kilometer fühlte sich an wie ein kleiner Sieg über die Zeit. Es war, als würde ich nicht nur durch Amerika fahren – sondern durch ein Amerika, das längst vergangen schien. Und in meiner Fantasie tauchten Cowboys auf, die mit ihren Pferden über die Tafelberge galoppierten, rechts und links von mir. Ich war Teil eines Westernfilms, durch den ich raste – der Wind sauste durch mein Haar, der Motor sang unter mir, und die Freiheit war zum Greifen nah.
In dieser Einsamkeit war Campen ein Geschenk. Abseits der großen Routen gab es einfache, ausgewiesene Flächen, oft mit frischem Wasser und einem Grillplatz. Am Abend knisterte das Feuer, der Himmel war weit, die Stille tief und friedlich. Kein Lärm, keine Hektik – nur ich, das Zelt, der Himmel, die Sterne. Und doch war ich nie wirklich allein. In kleinen Dörfern, irgendwo zwischen Nichts und dem Nirgendwo, fand ich das Herz des Landes. Urige Diner – meist ein willkommener Treffpunkt der Einheimischen – wurden zum Mittelpunkt meiner Etappen. Dort gab es nicht nur Burger und Kaffee, sondern auch Geschichten. Die Menschen waren neugierig, direkt, herzlich. Sie servierten mir nicht nur gutes Essen, sondern auch Insider-Tipps, die kein Reiseführer kannte. Dank ihnen entdeckte ich Seiten Amerikas, die nur dann sichtbar werden, wenn man sich wirklich auf die Landschaft, auf die Menschen und auf die Langsamkeit einlässt. Wyoming hat mich nicht nur einfach beeindruckt – es hat mich auch verändert.
Mit Vollgas und Verstand
Kaum hatte ich New York City hinter mir gelassen, zog es mich mit aller Macht in den sonnigen Süden – Richtung Key West, Florida. Möglichst schnell und möglichst direkt. Doch außerhalb der Ortschaften gilt: 55 Meilen pro Stunde. Gesetzlich. Praktisch? Nun ja. Auf einer schier endlosen Fernstraße schloss ich mich dem Windschatten eines Autos an, das mit knapp 96 Meilen pro Stunde wie ein Geschoss durch die Weite rauschte. Ich nahm an, dass der Fahrer über ein Frühwarnsystem für Radarfallen verfügte. Ein Irrtum. Kaum unterfuhr ich eine von vielen Brücken, blinkte, wie in einem amerikanischen Roadmovie, plötzlich Blaulicht im Rückspiegel. Eine Polizeistreife raste mit Martinshorn an mir vorbei, schnitt uns beide ab und zwang sowohl den „Schrittmacher“ als auch mich zum Anhalten. Der Beamte – groß, sonnenbebrillt, mit prüfendem Blick – kam ganz gemächlich auf mich zu. Mit ruhiger Stimme erklärte er, dass ich 20 US-Dollar Strafe zahlen müsse. Sofort. Oder - andernfalls - würde es beim nächsten Mal teurer werden. Oder, so schlug er grinsend vor, ich könnte auch einfach den Bundesstaat von Georgia dauerhaft meiden. Als er hörte, dass ich Deutscher bin, scherzte er. Sie fahren wie auf der deutschen Autobahn?Da gibt’s wohl immer noch keine Tempolimits, oder? Und dieses Nummernschild – wow, das ist mal was! Er fand es einfach klasse. Dennoch - 20 US $ und eine Quittung später war ich stolzer Besitzer meines ersten „Speeding Tickets“. Es liegt heute noch in meinem Büro als ein Souvenir meiner ersten Begegnung mit der Highway Patrol.
Danach wurde ich vorsichtiger. Kaum weitere Kontrollen, aber eine skurrile Radarvermeidungsstrategie lernte ich kennen – unfreiwillig. Auf der Interstate von Salt Lake City nach Reno etwa blockierten mich immer wieder Lkws, die andere LKWs langsam überholten. Genau diese Fahrweise zwang mich zum Abbremsen, was zwar frustrierend, aber in gewisser Weise kostensparend war. Ohne es zu wissen, hielten diese Aktionen mich davon ab, in eine der nächsten Radarfallen zu donnern. Ironischerweise wurde ich dank der Lkws nicht erneut geblitzt. Ich begann, ihnen mit einer gewissen Dankbarkeit zu begegnen – ihre Fahrweise war meine finanzielle Rettung.
Und dann war da noch Arizona. Auf einer sehr schmalen Landstraße Richtung Grand Canyon donnerte ich mit über 80 Meilen pro Stunde dahin – bis mich ein Sheriff stoppte. Kein Blaulicht, keine große Show – nur sein Blick. Dieser eine Blick reichte. Er sagte nicht viel, aber was er sagte, traf: Bei solch einer Geschwindigkeit sieht man Sie mit dem Motorrad viel zu spät. Und dann war’s das. Keine Strafe, nur eine Warnung – aber sie brannte sich ein. Ich nickte nur, fuhr langsamer weiter – nachdenklicher, aber nicht weniger frei. Denn genau das ist es: Trotz aller Regeln und Strafen, trägt mich dieses Land. Es fängt mich ein mit seiner Weite und dem unbeschreiblichen Gefühl von Freiheit.
Florida – Willkommen im Reich der Waschbären
Gleich hinter der Staatsgrenze Floridas erwartet mich ein erstes Willkommenszeichen: ein Informationszentrum, das kostenlos frisch gepressten Orangensaft serviert. Ein süßer Auftakt, der Hoffnungen auf sonnige Tage und tropisches Lebensgefühl weckt. Doch schon bald zeigt sich die andere Seite des Sunshine State – vor allem nachts, im Zelt. Das Campen in den State Parks ist weniger ein entspannendes Naturerlebnis, sondern ein tägliches Katz-und-Maus-Spiel oder besser gesagt: Mensch gegen Waschbären. Als ich nach einem langen Tag zu meinem Zelt zurückkehre, stelle ich fest, dass die Seitenwand aussieht, als hätte sie jemand mit einem Messer aufgeschlitzt. Einbruch? Ein versuchter Diebstahl? Nicht ganz.Ein Rascheln im Zelt, ein kurzer Moment der Spannung – und dann sehe ich den Täter: ein Waschbär. Mit geschickten Pfoten knabbert er seelenruhig an meinem Brot. Als er mich bemerkt, sieht er mich an und verschwindet blitzschnell. Ein Meisterdieb mit Maske.
Am nächsten Abend folge ich dem Rat meiner erfahrenen Campingnachbarn. Ich hänge meine Lebensmittel an einem Seil hoch in die Bäume, gut verpackt in einer Plastiktüte. Ein simpler, aber bewährter Trick – dachte ich. Doch dieser Plan geht schief.Am nächsten Morgen finde ich mein Frühstück über den Boden verteilt. Die Waschbären hatten sich offenbar wie Akrobaten am Seil herabgelassen, ein Loch in die Tüte genagt und sich dann bedient. Gnadenlos. Effizient. Erfolgreich. Ich gebe auf. Ab sofort gibt es das Frühstück und Abendessen nicht mehr im Camp, sondern an der Quelle amerikanischer Esskultur: Imbisse, Diners, Fast-Food-Ketten. Überraschenderweise eine günstige und schmackhafte Alternative. Doch leider zeigt sich bald eine Konsequenz. Die tägliche Dosis von Burgern, Pommes und Donuts bleibt nicht ohne sichtbare Wirkung. Der Zeiger der Personenwaage steigt mit beeindruckender Zuverlässigkeit – ein schweres Andenken der Waschbärennächte.
Key West – Verregnete Träume und 40 Inseln
Der Weg nach Key West klingt wie ein Versprechen: 200 Kilometer über eine Kette von 40 Inseln, verbunden durch schmale Brücken, umgeben von türkisblauem Wasser und tropischer Wärme. Doch was ich erlebe, ist ein einziger Vorhang aus Regen. Es gießt unaufhörlich, als würde der Himmel mir etwas sagen wollen. Die Sicht ist mehr als nur verschwommen, die Straße gleicht einer Wasserbahn. Von der sagenumwobenen Schönheit der Keys ist kaum etwas zu erkennen – keine Palmen, keine Sonnenstrahlen, kein Horizont. Auch in Key West selbst: gähnende Leere. Die Straßen sind wie ausgestorben, der Strand verlassen, die Fenster verschlossen. Die in Reiseführern beschworene tropische Leichtigkeit - Ernest Hemingway lässt grüßen - bleibt für mich ein leeres Versprechen, das im Dauerregen untergeht.Die Atmosphäre ist so trist, dass es mir nicht schwerfällt, noch am selben Tag die Insel zu verlassen – klatschnass, durchgeweicht, enttäuscht. Key West? Ein Traum, der für mich leider ins Wasser gefallen ist.
Everglades – Tanz der Mini-Vampire
Es wird wieder tierisch – und diesmal geht es richtig zur Sache. In den Sümpfen Floridas, in den Everglades, lauert die nächste Plage. Klein, aber gnadenlos: Moskitos. Ein Ranger hatte es mir vorhergesagt, mit der Ernsthaftigkeit eines Mannes, der schon viele Opfer gesehen hat – nicht durch Alligatoren, sondern durch die winzigen, fliegenden Blutsauger. Ich ließ mich nicht abschrecken. Kaum hatte ich mein Motorrad an meinem Zeltplatz geparkt, begann der Tanz der Vampire. Innerhalb von Sekunden war ich das Ziel, ein Festmahl für Hunderte hungriger Moskitos. Es war, als wäre ich plötzlich mitten in einem Horrorfilm, ein Horrorfilm, der mir die Hauptrolle zuschreibt. Und dass der Protagonist, der sich durchkämpfen muss, in diesem Fall ich selbst bin. Und meine Gegner sind winzige Monster. Ich baue mein Zelt in Rekordzeit auf. Mein Lederkombi bietet immerhin eine Art Schutzpanzer. Das Gesicht ist mit Insektenschutzcreme eingeschmiert. Dennoch, der Helm bleibt auf dem Kopf – auch wenn er sich unter der Hitze wie ein Backofen anfühlt. Jeder Tropfen Schweiß wird zur Qual, aber ich weiß: Sobald ich den Helm abnehme, bin ich verloren. Der einzige Zufluchtsort auf dem Campingplatz ist ein von Moskitonetzen umgebener Aufenthaltsraum. Eine kleine Gruppe Camper hat sich hier schon versammelt – erschöpft, zerstochen, aber kampfbereit. Sie haben nur ein einziges Gesprächsthema. Moskitos. Jeder hat seinen Geheimtipp parat. Von ätherischen Ölen über spezielle Armbänder bis zu Wunderkerzen – alles wird ausgetauscht, jede noch so bizarre Methode wird diskutiert. Danach flüchten sie wieder in ihre Zelte. Ich auch. Die Moskitos sind unbarmherzig, das stimmt. Aber auch darin liegt eine Wahrnehmung einer Reise: Die Natur, wie sie wirklich ist. Wild. Hart. Herausfordernd. Und manchmal auch einfach: stechend echt.
Wildwasser in den Smoky Mountains
Tage später – nach vielen einsamen Stunden auf meinem Motorrad – kam die ersehnte Abwechslung: eine rasante Schlauchbootfahrt auf einem sehr wilden, schäumenden Gebirgsfluss. Veranstaltet wurde das Ganze von NantahalaOutdoor, einem Anbieter in den Smoky Mountains. Und geleitet wurde die Tour damals von einem ehemaligen Olympiateilnehmer der Münchner Sommerspiele – allein das versprach echtes Abenteuer. Unsere Gruppe war bunt gemischt, vor allem ältere Teilnehmer, aber allesamt wild entschlossen und bestens ausgerüstet mit Schwimmwesten, Helmen und einer gehörigen Portion Wagemut. Kaum im Boot, wurde klar: Der Fluss war kein stiller Begleiter. Er lebte. Er tobte. Schon nach wenigen Metern riss uns die Strömung in ihr Spiel aus Wellen und Wirbeln. Das Wasser war eiskalt. Jeder Spritzer traf uns wie ein Weckruf. Unser Bootsführer, der Olympionike, war Ruhe in Person – mit lauter Stimme, knappen Kommandos und seinem überaus messerscharfen Gespür für die tückischsten Stellen des Flusses. Wir paddelten, duckten uns, rutschten, stießen mit dem Bug auf, drehten uns im Kreis – und jedes Mal, wenn wir dachten, wir kentern, waren wir doch wieder auf Kurs.
4 Stunden dauerte das wilde Treiben – ein Tanz zwischen Adrenalin und Koordination, Schweiß und eiskaltem Gischt-Wasser. Ohne die Erfahrung und Ruhe unseres Bootsführers wären wir wahrscheinlich wie Treibgut durch den Fluss gewirbelt worden. Aber wir hielten durch. Alle und gemeinsam. Am Abend saßen wir am Lagerfeuer, eine bunt zusammengewürfelte Truppe mit roten Wangen und leuchtenden Augen. Die Rentner lachten. Jeder hatte seinen Moment, seine Stromschnelle, seinen Schreckensruf und seine Erleichterung. Diese Tour war mehr als bloß ein Abenteuer, sagte einer von ihnen. Sie war ein Beweis, dass wir noch leben. Und ich konnte nur nicken. Der Tag hatte uns zusammengeschweißt. Es war, als hätte uns der Fluss kurzzeitig in eine Crew verwandelt – eine, die nie wieder gemeinsam paddeln, aber den Moment für immer teilen würde. Beim Fertigschreiben dieses Buches bin ich gerade Rentner geworden. Den Beweis, dass ich noch lebe, würde auch ich jetzt gerne in den Smoky Mountains erbringen, auf einer Wildwassertour mit Rentnern. Seine Träume sollte man leben und erleben. Never give up.
Region um Chicago
Je näher ich Chicago kam, desto beklemmender wurde das Gefühl. An den Tankstellen standen sichtbar bewaffnete Männer. Mit Stolz präsentierten sie ihre Waffen, als seien sie mehr als nur ein Accessoire. Die Straßen wirkten leerer, die Blicke fremder und schärfer. Es lag etwas in der Luft – nicht eine Bedrohung im klassischen Sinn, sondern eine Art Misstrauen. Ein Gefühl, nicht gerade willkommen zu sein. Vielleicht war es übertrieben, vielleicht nur ein Produkt der Fantasie, gespeist von Vorurteilen und Geschichten. Aber der Drang, nicht länger in diese Richtung zu fahren, wurde übermächtig. Also gab ich Gas. Raus aus dieser Stimmung, raus aus dem Schatten der Stadt. Chicago blieb für mich ein weißer Fleck auf der Landkarte – nicht aus Desinteresse, sondern aus Instinkt.
Washington, D.C. – Stille, Würde, Geschichte
Ganz anders als Chicago empfing mich Washington, D.C. – nicht mit der rauen Härte einer Großstadt, sondern mit einer kraftvollen, beinahe elektrisierenden Energie. Die Hauptstadt der USA strahlte Offenheit, Einladung und eine spürbare Intellektualität aus. Besonders beeindruckte mich das kulturelle Angebot: Unzählige Museen, die kostenlos zugänglich waren, machten die Stadt zu einem Paradies für Wissbegierige und Entdecker. Ein Moment, der sich tief in meine Erinnerung brannte, war der Besuch am Grab von John F. Kennedy. Als ich davorstand, spürte ich nicht nur die Schwere der Geschichte, sondern auch eine erhabene Stille. Ich fragte mich, ob dieser Ort für die Menschen ein Symbol der Hoffnung oder des schmerzhaften Verlusts ist. In der Nähe finde ich auch das Grabmal des unbekannten Soldaten, ein Denkmal für all jene gefallenen US-Soldaten, deren Identität nie geklärt werden konnte. Alle Beobachter schweigen, während die Ehrenwache, Schritt für Schritt, in präziser, würdevoller Ruhe und mit Entschlossenheit ihre Bahn zieht. Eine Parade, die niemals endet. Keine Musik, kein Applaus, nur der Klang der Stiefel. Eine Geste – und doch eine der eindrucksvollsten Ehrenbekundungen, die ich je erlebt habe. Es war, als würde der Lärm der Welt für diesen einen, ehrfürchtigen Moment schweigen.
Neuenglandstaaten – Elche und wilde Natur
Die 4 Neuenglandstaaten empfingen mich mit unberührten Wäldern, endlosen Hügellandschaften und großen Elchen, die majestätisch durch die Dämmerung schreiten. Bei mir hinterließ East Bridgewater einen bleibenden Eindruck: ich übernachtete in einem ausrangierten Schlafwagen, der als Jugendherberge diente. Der knarrende Boden, das matte Licht der Abteile, der Geruch nach altem Metall, es fühlte sich an wie eine Zeitreise in die Vergangenheit, wie ein Ort voller Geschichten, deren Stimmen noch zwischen den Wänden zu flüstern schienen. Im Nebengebäude war eine Mumie. Ausgestellt wie in einem Kuriositätenkabinett. Eine bizarre, fast surreale Erinnerung daran, wie nahe hier Geschichte und Gegenwart beieinanderliegen – als würde die Zeit selbst hier keine klare Linie mehr ziehen.
Auch der berühmte Appalachian Trail lockte mich – ein Pfad, der sich über 3.000 Kilometer von Georgia bis in den hohen Norden nach Mount Washington zieht. Ich wagte mich auf eine Etappe, mit dem Ziel, den Gipfel des Mount Washington zu erklimmen. Doch dieser Berg, berüchtigt für sein tückisches Wetter, zeigte mir seine unberechenbare Seite. Der Himmel verdunkelte sich, der Wind peitschte mir ins Gesicht, die Luft wurde schneidend kalt. Nur fünf Kilometer vor dem Ziel zwang mich der Wetterumschwung zum Umkehren. Es fühlte sich an, als wolle der Berg mich prüfen – doch die Natur sprach ein klares Nein, auch der stechende Schmerz im Fuß. Meine Motorradstiefel waren alles andere als geeignet für Trecking-Touren. Noch lange erinnerte mich dieser Schmerz an meine Grenzen – und auch daran, diese akzeptieren zu müssen.
Nach 9.700 Meilen auf dem Motorad-Sattel erreichte ich Lincoln, ein verschlafenes Städtchen vor der kanadischen Grenze. Ich übernachtete in einem Wohnwagen-Anhänger, offiziell eine Jugendherberge. Als ich in den Schlaf sackte, spürte ich Erschöpfung und Neugier auf das, was jenseits der Grenze auf mich warten würde. Kanada – das große Unbekannte, das nächste Kapitel meines Abenteuers.
Kanada – Ein Land wie ein Versprechen
Am 1. Juni 1980 überquerte ich mit meinem Motorrad die Grenze von den USA nach Kanada. Es war mehr als nur ein geografischer Wechsel – es fühlte sich an wie der Eintritt in eine neue Welt. Die Landschaft weitete sich, die Luft war frischer, klarer, als hätte Kanada mir ein Versprechen auf größere Freiheit und neue Abenteuer gegeben.
Durch die Provinzen New Brunswick und Nova Scotia führte mich mein Weg weiter nach Neufundland – eine raue Schönheit im Atlantik, wo das Leben vom Rhythmus der Gezeiten geprägt ist. In einem Ort namens Saint Joseph’s traf ich auf einen Fischer, der mich mit einem Blick voller Verwunderung und Ehrlichkeit musterte. Als ich ihm von meiner Weltreise auf dem Motorrad erzählte, schüttelte er den Kopf. Dies ist doch verrückt, murmelte er, dann griff er in seine Tasche, zog einen 5-Dollar-Schein hervor und drückte ihn mir in die Hand. Für die Reise sagte er. Es war keine große Geste im materiellen Sinn – aber eine, die mich tief berührte. Für mich war dieser Moment unbezahlbar.Den Schein habe ich nie ausgegeben. Heute hängt er noch eingerahmt in meinem Büro als Zeugnis einer Begegnung, die mir zeigt, wie ein einfaches Stück Papier den Wert menschlicher Verbindung symbolisieren kann. Und jedes Mal, wenn mein Blick auf den Schein fällt, spüre ich den kanadischen Wind, der mich immer weitergetragen hat.
Ich setzte meine Reise über die Insel Prince Edward Island und die raue Schönheit der Gaspé-Halbinsel fort, bis ich schließlich Quebec City erreichte. Diese Stadt, zweifellos eine der Schönsten Kanadas, wirkte wie ein Stück Europa, wie ein Stück Heimat. Mit ihren kopfsteingepflasterten Gassen, den historischen Fassaden, den steilen Treppen und den charmanten Cafés schien es mir, als ob die Zeit dort langsamer vergehe. Besonders der Blick vom Alten Stadtviertel, über den St. Lawrence River hinterließ einen sehr starken Eindruck. Nach ein paar Tagen des Flanierens und Staunens zog es mich weiter. Ich durchquerte Ontario. Danach fuhr ich schnurgerade durch die weiten Ebenen von Manitoba und Saskatchewan – ein endloser Horizont der sich wie ein ruhiger Atem durch das Herz Kanadas zog. Der Wind, das Rauschen der Felder und amerikanische Bisons – all das hatte eine beruhigende Wirkung, die ich nach den Eindrücken verschiedener Städte sehr zu schätzen wusste.
Südlich von Calgary, in Alberta, fand ich eine andere Art von Begegnung: Ich konnte viele Tage auf einem Reitstall verbringen. Der Besitzer, ein passionierter Pferdemensch, hatte viele europäische Springreiter zu Gast – auf eigene Einladung, auf eigene Kosten. Es war ein privates Turnier. Und seine Atmosphäre war magisch: Elegante Pferde, die kraftvoll durch den Parcours galoppierten. Es war, als würde die Präzision der Reiter mit der Weite des Himmels wetteifern. Für einen Moment fühlte ich mich nicht nur als Gast, sondern als ehemaliger Springreiter als Teil der Szene – ein stiller Beobachter eines besonderen Augenblicks.
Weite, Wildnis und ein unerwarteter Pokal
Nach den Pferden in Calgary wurde es noch wilder: Ich setzte meine Reise fort und nahm die Forestry Trunk Road – eine Route, die sich wie ein staubiges Versprechen durch die abgelegenen Wälder schlängelte und mich in den hohen Norden Kanadas führte. Über den Yukon hinweg erreichte ich schließlich Alaska. Die Landschaft wurde mit jedem Kilometer rauer, ursprünglicher, ehrlicher. Hier war der Mensch nur ein kleiner Punkt auf der Landkarte der Natur. Und das machte den Reiz aus. Kein Lärm, kaum Städte – nur die Straße, das Motorrad und ich. Die Rückfahrt nach Kanada führte mich durch die atemberaubenden Weiten von British Columbia bis hinunter nach Vancouver Island, wo ich die Hafenstadt Victoria besuchte. Doch bevor ich dorthin gelangte, machte ich einen Halt in Chilliwack – ein kleiner Ort, der an einem Wochenende im Zeichen eines Motorradtreffen stand. Ich hatte von der Veranstaltung nur am Rande erfahren, aber irgendetwas zog mich dorthin. Was dann geschah, konnte ich kaum glauben: Ich wurde aufgerufen – der Snoopy’s Challenge Cup für die weiteste Anreise auf zwei Rädern ging an mich. Der Pokal steht in meinem Büro, etwas eingestaubt, aber mit einem Hauch von vielen schönen Erinnerungen. Eine Erinnerung anderer Art zeichnete sich damals auf einer sehr einsamen Strecke ab: Ein dramatisches Abenteuer mit einer Bärenfamilie.
3. August 1980 Carmarcks nach Frances Lake
Endlos zieht sich die Schotterpiste bis zum Horizont. Die Landschaft ist fast surreal in ihrer Weite – kein anderes Fahrzeug, kein Anzeichen von Leben, nur die raue Natur. Trotz perfekt eingestellter Stoßdämpfer spüre ich jedes Schlagloch, jeden Stein wie einen Hieb durch den Körper. Es ist schmerzhaft, aber auch ein faszinierendes Spiel mit der Grenze des Machbaren. Mein Motorrad, wie von einer unsichtbaren Hand gelenkt, beschleunigt auf 80 km/h. Je schneller ich werde, desto gefährlicher wird die Fahrt. Die Bodenhaftung der Räder ist auf ein Minimum reduziert. Ein falscher Moment, ein großer Stein, und ich würde von der Piste abkommen. Ein sicheres Ausweichen bei dieser Geschwindigkeit wäre purer Zufall. Das Motorradfahren in diesem Stil bedeutet, meine Grenzen auszuloten.
Trotz der Gefahr versuche ich, das Gefühl der Freiheit zu genießen. Der Regen, der von Westen heranrollt, zwingt mich zu diesem rasanten Tempo. Doch dieser Tanz mit der Gefahr könnte jederzeit in einer Katastrophe enden. Die Natur zieht wie ein Film, der viel zu schnell abgespielt wird, an meinen Augen vorbei. Das ständige Rütteln auf der Schotterpiste raubt mir zunehmend die Geduld, und die viel zu hohe Geschwindigkeit lässt die Büsche neben mir zu einer einzigen unüberwindbaren Wand verschmelzen. Das Motorrad gleitet nun wie ein Bobschlitten durch einen Eiskanal. Die Geschwindigkeit steht in keinem rationalen Verhältnis zur Gefahr: Jedes Tier, das auf die Fahrbahn springen könnte, würde mir mit brutaler Geschwindigkeit begegnen. Die Gefahr ist stets präsent, doch stundenlang habe ich nur Einsamkeit gespürt. Das monotone Vibrieren des Motors treibt mich voran. Um via Ross River, Watson Lake zu erreichen, muss ich 800 Kilometer Wellblechpiste und Wildnis pur durchqueren. Der Regen hat nachgelassen, und die Sonne zeigt sich – endlich. Das Leben scheint mir eine Atempause gönnen zu wollen.
Die Piste ist schnurgerade. In der Ferne überquert ein Bär mit zwei Jungen im Laufschritt die Straße. Meine Augen folgen dem Bärentransit. Ein Stein fällt mir vom Herzen, als die Bären wieder im Dickicht verschwinden. Im Norden Kanadas sind Begegnungen mit Bären keine Seltenheit. Auf Campingplätzen kann man oft beobachten, wie Bären Mülltonnen nach Essensresten durchwühlen und nach einer nicht artgerechten Mahlzeit friedlich davonziehen. Als eine Gegenmaßnahme stellen Mitarbeiter der Forstbehörden nun bärensichere Abfallbehälter auf. Sie sollen verhindern, dass die Bären durch Abfälle angelockt werden und sich ungesund ernähren. Die Behälter tragen auch dazu bei, das Risiko eines Bärenangriffs auf Menschen zu verringern.
Mein Motorrad rast mit hoher Geschwindigkeit auf die Stelle zu, an der die drei Bären den Weg gekreuzt haben. Plötzlich ertönt ein fürchterliches Geräusch – es klingt wie das Bellen eines angreifenden Hundes. Ich mag meinen Augen kaum trauen. Aus dem Dickicht springt ein Bär – und er versperrt mir nicht nur den Weg, sondern galoppiert, immer schneller und flacher werdend direkt auf mich zu. Ein Albtraum! Der GAU schlechthin in dieser Gegend. Das furchterregende Brüllen des Bären lähmt mich. Es ist, als würde mein Gehirn in Zeitlupe verfallen – fast unmöglich, klar zu denken, geschweige denn zu reagieren. Wie zwei duellierende Ritter zu Pferden rasen wir aufeinander zu. Der Blick auf den Tacho zeigt 80 km/h. Ein Ausweichen ist ausgeschlossen. Die zwei Bio-Wände verhindern dies. Ein Zusammenstoß scheint unvermeidlich.Das Brüllen wird immer lauter. Es beginnt ein Teufelskreislauf. Krampfhaft zerrt meine Hand am Gasgriff. Die Beschleunigung reißt mich vom Lenker, die Fingerspitzen drohen abzurutschen. Der Versuch, mich wieder an den Lenker zu ziehen, dreht den Gasgriff in Richtung Beschleunigung – und das Spiel beginnt von vorne. Ich gebe unwillkürlich Gas und werde schneller. Jeder Reflex in meinem Körper schreit: Bereite dich auf den Zusammenprall vor. Mein Unterbewusstsein befiehlt mir, den Druck auf die Fußrasten zu verstärken, um mich bei Kontakt mit dem Bären vom Motorrad abstoßen zu können. Dies könnte mein Leben retten. Der Bär ist zum Greifen nah. Doch dann geschieht etwas Unvorstellbares: Sekundenbruchteile vorm Zusammenstoß, Mensch gegen Tier, springt der Bär ins Gebüsch und lässt mich unverletzt passieren. Aber zum Verschnaufen bleibt keine Zeit. Kaum habe ich den Bären hinter mir gelassen, springen die beiden Jungen aus dem Dickicht. Sie blockieren die Schotterpiste.
Ich hupe. Obwohl es nicht lauter werden kann, drücke ich gegen jede Logik immer fester auf den Knopf der Hupe. In letzter Sekunde machen die jungen Bären den Weg frei.
Ich fahre und fahre. Das Grün der unberührten Natur duftet intensiv, die frische Luft ist ein willkommener Kontrast zur Anspannung der letzten Minuten. Keine Menschenseele ist mir begegnet. Gegen Abend stelle ich mein Zelt am Frances Lake auf, ganz allein, auf hohem Moos. Es fühlt sich an wie ein unsichtbares Bett, das die Erde mir bietet. Als ich mich hinlege, wird mir die ganze Situation erst richtig bewusst. Die Stunden der Anspannung, der Kampf mit der Gefahr, der Herzschlag, der noch immer in meinem Kopf pocht, all das kommt jetzt mit voller Wucht. Der Körper ist erschöpft und von Angstgefühlen überflutet. Ich kann das Zittern nicht unterdrücken. Die Erinnerung an das Duell mit dem Bären, verfolgt mich, auch wenn er längst verschwunden ist. Ich zittere, nicht nur von der Kälte, sondern auch von der inneren Anspannung, die sich erst jetzt löst. Dass ich das Abenteuer unverwundet überstanden habe, erscheint mir fast wie ein Wunder. Der Gedanke, dass es in diesem Moment das Ende hätte sein können, und der Gedanke an die schmale Grenze zwischen Leben und Tod, wird mir in der Stille klarer als je zuvor. Es ist auch das Gefühl von Respekt vor der Wildnis und vor den Kräften der Natur. In dieser Nacht kommt mein Körper, eingehüllt im trockenen Schlafsack, dennoch zur Ruhe. Der Moosboden fühlt sich an wie ein Wolkenbett. Die Stille und die Dunkelheit um mich herum wiegen mich in einen tiefen Schlaf.
US-Westküste bis Daytona Beach
Mein Motorrad schlängelt sich seit Oktober 1980 entlang der Küstenstraße von Washington State über San Diego, nach Mexiko. Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung. Nach Mexiko geht es ab 1981 über Los Angeles nach Daytona Beach. wo ich mich dem Ende meiner Reise nähere. Auf dem Weg, in der Nähe von Albuquerque, übermannt mich die Kälte. Erschöpft und starr vor Frieren schlafe ich, direkt neben dem heißen Auspuff meines Motorrads, in meinem Schlafsack ein. Die Trucker um mich herum lassen ihre Diesel-Motoren die ganze Nacht laufen, aus Angst, dass der Treibstoff einfriert. Am Morgen, als ich die Augen öffne, bin ich dankbar, dass ich ohne Erfrierungen aufwache.
In Daytona Beach endet meine Motorradreise – nach dem fünften Motorschaden. Ein Schrotthändler kauft es mir ab und organisiert mir einen Flug nach New York City. Jeder, der so ein Motorrad gefahren ist, kennt dessen Eigenheiten und Kinderkrankheiten. Trotz all der Pannen war die Reise eine pure Freude, sie war von der Lust am Motorradfahren geprägt, der Freiheit, die das Fahren auf diesen endlosen Straßen mit sich brachte.
Doch wenn ich heute an andere US-Reisen zurückdenke, fallen mir vor allem die sozialen Brennpunkte auf, die ich oft unterwegs erlebte. Der Umgang mit den Ureinwohnern, das Fallenlassen von Soldaten, die in verlorenen Kriegen gekämpft haben – all das sind Eindrücke, die die einst reine Lust am Reisen bald überschatteten. Es war nicht mehr die Freiheit des Fahrens, die mich beschäftigte, sondern auch die Erkenntnis, dass hinter jeder Straße, hinter jedem Ort, mehr steckt. Ein erschütterndes Beispiel, das mir bis heute im Gedächtnis bleibt: 1985, Phoenix in Arizona
Mitfahrer im Schatten eines Krieges
Ein zwiespältiges Gefühl beschleicht mich, als mich in Phoenix ein sichtlich verwirrter Fahrer beim Trampen ins Auto einsteigen lässt. Er sitzt fahrig am Steuer, und seine Bewegungen sind unkontrolliert, sein Blick ist unstet. Zum ersten Mal in meinem Leben schreibe ich – noch bevor ich in ein Tramper-Auto steige – heimlich das Kennzeichen auf meine Hand. Schon nach wenigen Minuten wird klar: Der Fahrer ist schwer traumatisiert. Als junger Soldat kämpfte er in Vietnam und hat den Krieg - zumindest geistig - nie verlassen. Die Grausamkeiten, die er dort erlebt oder selbst ausgeübt hat, verfolgen ihn bis heute. Täglich sagt er. Ohne jede psychologische Betreuung hat er etwas Grundlegendes verloren: die Fähigkeit, Töten nur als eine Ausnahme zu begreifen. Ich spüre es sofort – bei diesem Mann gibt es keine Hemmschwelle mehr. Die Droge Krieg hat ihn fest im Griff. Immer wieder prahlt er mit seinen Erlebnissen. Doch es ist nicht nur Stolz, was aus ihm spricht – es ist Freude. Ungefilterte, beängstigende Freude am Töten. Ich kann kaum fassen, mit welcher Begeisterung er mir davon erzählt.Instinktiv lasse ich meinen Pass unauffällig unter der Fußmatte verschwinden. Nur für den Fall. In diesem Moment weiß ich: Ich muss hier raus. Und zwar bald.
Bei einem Zwischenstopp in einem Restaurant überlege ich fieberhaft, wie ich wohl unbemerkt an meinen Rucksack im Kofferraum komme, um den unberechenbaren Fahrer so schnell wie möglich loszuwerden. Noch bevor mir ein Plan einfällt, steht er plötzlich auf – und verschwindet. Wortlos.
Er lässt mich am gedeckten Tisch zurück, als wäre ich Luft. Und mit ihm: mein Rucksack, mein Geld, und all meine Reiseschecks – alles weg. Mir bleiben nur eine Handvoll Dollars in der Hosentasche. Zu wenig, um die gepfefferte Rechnung zu bezahlen. Als die Polizei gerufen wird, kippt die Situation. Man bezichtigt mich der Zechprellerei. Der verschwundene Fahrer, so wird mir unterstellt, sei ein guter Freund von mir und wir hätten gemeinsam flüchten wollen – ohne zu zahlen. Ich zeige der Polizei das Kennzeichen, des Autos, das ich mir auf die Hand geschrieben hatte. Doch - niemand scheint sich dafür zu interessieren. Erst nach wiederholtem Drängen notiert sich einer der Beamten die Nummer – mit vager Zusage, weitere Nachforschungen anzustellen. Erst als ich eine Kontaktadresse in den USA angebe, darf ich gehen.
Ich mache mich zu Fuß auf den Weg zum Flughafen von Phoenix. Der lange Weg tut gut. Er hilft mir, den Ärger über meine eigene Dummheit zu verarbeiten: Wie konnte ich nur den Rucksack mit all den Wertsachen im Kofferraum des Psychos zurücklassen? Am Flughafen finde ich zwar keine bequeme, dafür aber kostenlose Schlafgelegenheit auf den harten Sitzen der Wartehalle.
Warten und hoffen
Am nächsten Morgen fliege ich für nur neun Dollar nach Los Angeles. Es ist Wochenende – und wie zu erwarten: Die Behörden haben geschlossen. Dann folgt auch noch ein Feiertag. Was bleibt, ist Warten. Drei Tage ohne Geld, ohne Dusche, ohne Bett. Ich improvisiere, schlafe versteckt im einem der Gebäude des LAX- Flughafens. Gewaschen wird notdürftig – auf den Toiletten, zwischen Papierhandtuch- und Seifenspendern. Drei Tage Katzenwäsche zwischen Gate und Gepäckband.Drei Tage Unsichtbarkeit.
Endlich öffnet das Konsulat. Die Hoffnung: Einen Anruf nach Hause tätigen zu dürfen, um Vater um Hilfe zu bitten. Doch das Anliegen wird abgewiesen. Kalt. Und ohne jedes Mitgefühl. Zum Telefonieren braucht man Geld. Wenn man kein Geld hat, braucht man einen Ausweis, um etwas Hilfe zu bekommen. Ich habe beides nicht. Die Bescheinigung über den Diebstahl scheint wertlos. Man interessiert sich nicht dafür. Mein Hinweis, dass ich den Anruf so schnell wie möglich bezahlen werde, der verhallt ungehört. Was bleibt, ist ein Paradoxon: Ohne Geld kein Anruf. Ohne Pass kein Geld. Ohne Geld und ohne Pass keine Hilfe. Ich stehe fassungslos da – ein Mensch ohne Pass, ohne Bargeld und ohne Stimme – einfach abgewiesen. Meine Erfahrungen mit Behörden haben einen neuen Tiefpunkt erreicht.
Angefressen verlasse ich kopfschüttelnd das Konsulat. Ich besuche einen Freund, bei dem ich meinen Vater anrufen kann. Das kurze Gespräch hat aber alles verändert. Am nächsten Tag betrete ich eher zufällig das Konsulat. Doch diesmal ist nichts wie zuvor. Die Stimmung hat sich jetzt komplett gewandelt. Man empfängt mich mit Bedauern und ausgesuchter Höflichkeit. Schade, dass Sie nicht früher gesagt haben, wer Sie sind, heißt es. Ich bin fassungslos. Offenbar hat mein Vater direkt nach unserem Telefonat das Konsulat kontaktiert – und nun geht alles, was vorher nicht möglich war, ganz schnell. Ich bekomme Geld und einen Blankopass angeboten – einzig ein aktuelles Passbild fehlt noch. Meine Verwunderung über dieses Verhalten kann ich kaum verbergen. Ich schüttele ungläubig den Kopf. Geht es in diesem Konsulat darum, nur denen zu helfen, die auch Beziehungen oder Einfluss haben?
Genau in diesem Moment, informiert eine Polizeistelle das Konsulat: Der Fahrer des Autos, mit dem ich unterwegs war, wurde identifiziert. Damit habe ich plötzlich alles, was ich brauche – ohne auf die Gnade der Beamten angewiesen zu sein. Ich verlasse das Konsulat, – ohne den Blankopass und ohne das angebotene Bargeld, aber mit Würde und fliege noch am selben Tag zurück nach Phoenix.
Dort informiert mich die Polizei, dass der ermittelte Fahrer – jener Vietnam-Veteran – behauptet, sich nicht erinnern zu können, mich jemals mitgenommen zu haben. Weil er ein ortsbekannter Millionär ist, glauben ihm die Beamten. Ich bin nur ein Tramper. Man durchsucht dennoch das Auto, findet aber nichts von mir. Ich bitte einen Polizisten, die Fußmatte auf der Beifahrerseite anzuheben. Er zögert und ist dann sprachlos: Mein Reisepass liegt noch dort. In der Garage entdeckt man nun auch meinen Rucksack – samt Geld und Travellerschecks. Der Millionär wirkt handzahm. Er bietet mir Geld an - als Entschädigung. Wir einigen uns auf ein Flugticket nach Mexiko.
Fast zwanzig Jahre später höre ich im TV den deutschen Verteidigungsminister sagen: Unsere Sicherheit wird auch am Hindukusch verteidigt. Starker Tobak. Wenn es erlaubt ist, würde ich fragen, ob er damals bei der Entscheidung, Soldaten in den Krieg zu schicken, auch daran gedacht hat, was danach mit ihnen passiert.Ob sie nach den Einsätzen psychologisch betreut werden oder - wie jener Veteran, mit dem ich einst fuhr - allein gelassen werden. Ob sie, mangels Hilfe, auf ewig von der Droge Krieg abhängig bleiben.
Seit Phoenix musste ich nie wieder ein Autokennzeichen aufschreiben. Nie wieder meinen Pass unter einer Fußmatte verstecken. Und ich hoffe, dass nie jemand durch einen Soldaten in Gefahr gerät – einen, der längst zurückgekehrt ist, aber innerlich nie heimgekommen ist.
Mexiko mit dem Motorrad
Nach 34.400 Meilen überquert mein Motorrad in Tijuana die Grenze nach Mexiko. Nur ein Steinwurf trennt mich von den USA und doch liegen Welten zwischen den beiden Seiten. In Mexiko stehen verfallende Holzbaracken, ohne Wasseranschluss, umgeben von Müll. Direkt dahinter, auf US-Terrain: gepflegte Vorstadthäuser, deren Rasen mit kostbarem Trinkwasser bewässert wird.
Trotz allem: Die Halbinsel Baja California war für mich ein pures Erlebnis. Die Mexikaner lachen mit der Sonne um die Wette. Das Essen? Köstlich – auch wenn mir kleine, unscheinbare Paprikaschoten fast den Mund weggebrannt hätten. Scharf – schärfer - Gaumen fast taub. So was habe ich kein weiteres Mal erlebt. Auf der nächtlichen Überfahrt mit einer Fähre von La Paz nach Mazatlán begleitet mich ein kanadischer Motorradfahrer. Jedes Jahr kauft er sich eine neue Harley Davidson – doch weiter als bis Mazatlán traut er sich nicht. Während er sich ein erstes-Klasse-Ticket gönnt, schlafe ich draußen auf einer Holzbank unter dem Sternenhimmel. Wegen der Kälte legt er mir heimlich eine Decke über den Körper – eine Geste, die ich nie vergessen werde. Am 27.12.1980 verlasse ich schon wieder Mexiko. Hinter mir liegen Orte wie Palenque, Puerto Vallarta, Acapulco, Mexico City, Oaxaca, Puerto Escondido, Tulum, Chetumal, Puerto Morelos und Cancún. Der Abschied fällt schwer. An der Grenze - Matamoros und Brownsville - blicke ich mit Wehmut zurück. Doch ich bin mir sicher: Mexiko wird meine Wege noch öfters kreuzen.
22.01.1982 - Unbelehrbare
Irgendwo zwischen Puerto Escondido und Acapulco stoppt uns eine Straßensperre. Ein Soldat tritt ans Fahrzeug und fordert uns zum Aussteigen auf. Es ist eine der Kontrollen, vor denen ich den Fahrer und seine Freundin gewarnt hatte. Ein Jahr zuvor war ich in der Gegend mit einem Motorrad unterwegs gewesen – das Militär hatten damals das Gepäck und meine Maschine akribisch nach Drogen durchsucht. Ich weiß also, wie ernst sie es hier meinen.
Ich bin mit einem Pärchen unterwegs. Sie sprechen kaum Spanisch, besitzen aber ein Auto. Ihr Angebot, mich nach Acapulco mitzunehmen – im Tausch gegen meine Dienste als Dolmetscher – klang auf den ersten Blick akzeptabel. Eine Bedingung hatte ich gestellt: keine Drogen im Auto. Natürlich kann der Einsatz bestimmter Substanzen sinnvoll sein – in Bolivien etwa kauen viele Indios in großen Höhen Kokablätter zur Linderung von Schmerzen. Doch ich lehne den Transport illegaler Drogen strikt ab – besonders dann, wenn dadurch Menschen wie ich gefährdet werden.
Die Kontrolle beginnt. Die Soldaten durchsuchen das Auto, öffnen Fächer, heben Sitze an. Ich beobachte das Paar. Was anfangs wie Gelassenheit wirkte, schlägt langsam in eine Art Nervosität um. Die Militärs bemerken es ebenfalls – und intensivieren ihre Suche. Dann greift ein Soldat in den Spalt zwischen Lehne und Fahrersitz. Er zieht einen Beutel mit Marihuana hervor. Zu groß, um ihn unauffällig ins Auto geschmuggelt zu haben – das hier ist ein Zufallsfund. Die Gesichter meiner Begleiter erstarren. Eben noch freundlich und sorglos, sind sie jetzt zu starren Masken geworden. Noch heute läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken, wenn ich daran denke. Die Waffen klicken. Gewehrläufe richten sich auf uns. Ich strecke instinktiv die Hände über den Kopf – sie zittern. Einer der Soldaten erklärt mir, dass eine Flucht aus dem Gefängnis aussichtslos wäre.
Dann ist mein Rucksack an der Reihe. Ich bin vorbereitet – vor der Reise hatte ich mein Gepäck gründlich kontrolliert. Die Durchsuchung dauert eine gefühlte Ewigkeit. Nach etwa fünfzehn Minuten erklärt man mir, dass ich als freier Mann weiterreisen darf. Das Paar bleibt stumm. Ich spüre Wut, Enttäuschung, auch Erleichterung. Und ja – meine Gedanken, dass das Paar im Gefängnis versauern sollte, sind nicht unangenehm. Aber die beiden tun mir leid. Wir versuchen zu erklären, dass diese Drogen vom Vorbesitzer des Wagens stammen könnten – man hatte das Auto erst vor zwei Wochen gekauft. Und ich kann ehrlich auf die Bibel schwören, dass während der Fahrt niemand Marihuana konsumiert hat. Das reicht den Soldaten. Sie behalten das Marihuana und lassen uns ziehen. Die Weiterfahrt verläuft wortlos. Das Vertrauen ist zerbrochen. Am Abend tauchen die Lichter Acapulcos auf. Wortlos verabschieden wir uns. Ich hoffe, dass dieser Tag für beide ein Wendepunkt war – ein Moment der Erkenntnis. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Zwischen Grenzzaun und Gesetzlosigkeit
Der Drogenhandel an der mexikanisch-US-amerikanischen Grenze hat sich zwischen den Drogenclans immer mehr zu einem tödlichen Bandenkrieg entwickelt. Die Grenzstadt Ciudad Juárez – direkt gegenüber von El Paso in Texas – gilt seit Jahren als eine der gefährlichsten Städte der Welt. Allein im Jahr 2009 wurden dort täglich bis zu zwanzig Menschen ermordet. Doch die Ohnmacht der Behörden ist nicht neu. Schon 1982 konnte man in Tijuana beobachten, wie Drogenkuriere im toten Winkel der Kameras Päckchen über den Grenzzaun in die USA warfen. Ich selbst war Zeuge solcher Szenen und war erstaunt, dass keiner der Grenzbeamten eingriff oder versuchte, die offensichtlich genutzte Schmuggelroute auszutrocknen. Ob es Zufall war, dass ein Großteil des mexikanischen Grenzpersonals 2009 wegen Korruption ausgetauscht wurde, bleibt offen. Aber es wirft Fragen auf. Fragen, auf die man in dieser Region wohl selten eine ehrliche Antwort bekommt.
27.01.1982 - unterm Kühlcontainer
Die Sonne hängt tief über dem mexikanischen Culiacán, als ich einen Güterzug finde, der mich Richtung US-Grenze bringen soll. Der Lokführer – ein schweigsamer Mann wirft mir nur ein knappes Nicken zu. Ich darf mitfahren. Unter einem aufgebockten Kühlcontainer finde ich meinen Platz. Dessen Stahlstützen sind ausgefahren und so besteht keine Gefahr, dass der Koloss über mir zusammenbricht. Doch aus dem Kühlaggregat tropft Wasser. Um trocken zu bleiben, forme ich mit einer Plastiktüte und Sand einen Wall gegen das Tropfen. Er sieht wie eine Improvisation eines Kindes inmitten einer erschütternden Realität aus.
Langsam setzt sich der Zug in Bewegung. Bei jedem Halt wird er länger und schwerer. Die Nacht wird kälter. Ich krieche in den Schlafsack, mein einziger Schutz vor dem Wind. Der Zug, so scheint es, ist für viele Menschen die letzte Hoffnung. Bei Einbruch der Dunkelheit tauchen sie auf: Menschen aus Guatemala, El Salvador, Nicaragua und Honduras - mit Rucksäcken, mit leerem Blick – und dem Kopf voller Träume. Tagsüber verstecken sie sich in der Wüste und nachts springen sie auf die Waggons. Vor jeder Stadt springen sie wieder ab – denn dort patrouilliert der bewaffnete Zugführer den Zug. Ich kann bleiben.
Nur einmal, hinter einer Stadtgrenze, blicken mir vertraute Gesichter entgegen. Sie haben es geschafft – sind zu Fuß um all die Kontrollen herumgeschlichen und wieder auf meinen Waggon gesprungen. Jetzt sitzen wir zusammen und teilen, was wir haben: ein paar Kekse, den Schlafsack und unsere Geschichten. Jede ist anders. Und doch ähneln sie sich. Sie erzählen von Kriegen, von korrupten Regimen, Missernten, menschenverachteten Kommunismus und von Verlust. Und von der Hoffnung in den USA, eine lohnende Arbeit zu finden. Mit dem Einkommen wollen sie zu Hause ein Geschäft eröffnen oder ihre Familien unterstützen.
Die Kälte presst sich wie ein Extra-Passagier zwischen uns. Ich bin nur ein Reisender auf der Durchreise – und doch fühle ich mich in dieser Nacht fremden Menschen so nah wie nie zuvor. Es ist, als zögen wir, gemeinsam durch die Dunkelheit der Nacht, hinein in eine ungewisse Zukunft. Diese Nacht werde ich niemals vergessen.
Bereits 1982 löste eine Debatte um die illegale Migration politische Spannungen aus. Heute, unter Präsident Trump, wird es noch schwieriger, in die USA einzuwandern. Doch eines bleibt klar: Ohne die Arbeitskräfte aus Lateinamerika könnten viele der Landwirte – vor allem jene in Grenznähe – ihre Felder nicht wirtschaftlich betreiben. Die Politik mag sich wandeln: ihre Gesichter, ihre Parolen. Doch für die Menschen, die wie ich einst auf einem der Güterzüge gen Norden reisen, bleibt der Kurs derselbe – dorthin, wo sie nicht nur überleben, sondern wirklich leben wollen.
Afrika
Kenia 1982
Reise dritter Klasse – Nachtzug nach Mombasa
Die Tickets für die 1. und 2. Klasse im täglichen Nachtzug von Kenias Hauptstadt Nairobi in die Hafenstadt Mombasa am Indischen Ozean sind seit Wochen restlos ausverkauft. Ganz anders die dritte Klasse: Am 23. Juli 1982 gab es noch viele preiswerte Fahrkarten - ohne Sitzplatzreservierung und jeglichen Komfort. Statt Ruhesitze oder Schlafabteil erwarteten uns schlichte Holzbänke – hart, unbequem und rückenfeindlich. Schon kurz nach der Abfahrt wurde klar: Wer so reist, muss leiden. Wir rutschen unentwegt auf dem glatten Holz hin und her, auf der Suche nach einer weniger schmerzhaften Sitzposition. An Schlaf ist bei weitem nicht zu denken.Auch das ständige Kommen und Gehen an den Bahnhöfen trägt zur Unruhe bei. Bei jedem Halt wechseln die Sitznachbarn, fremde Gesichter tauchen auf, andere verschwinden. Instinktiv halten wir unsere Rucksäcke und unser Zwei-Mann-Zelt fest – als müssten wir uns an etwas Vertrautem klammern. Merkwürdig erscheint uns, dass viele Plätze im Waggon leer bleiben, während sich um uns herum eine Menschenmenge drängt. Die Einheimischen kleben förmlich an uns. Deren Bedürfnis nach Nähe wirkt ambivalent: Es kann freundlich gemeint sein, aber auch fordernd, bedrängend. Der Kontakt mit der fremden Kultur bringt Unsicherheit mit sich – auch Ängste. Vielleicht ist es die Fremdheit, die uns ein unterschwelliges Unbehagen spüren lässt. Und obwohl wir es nicht wollen, geben wir diesem Gefühl widerwillig nach. Nicht aus Überzeugung, sondern weil wir es noch nicht ganz abschütteln können. Wir fragen uns: Ist es Neugier? Oder steckt mehr dahinter – etwa die Hoffnung, dass wir etwas geben könnten? Geld vielleicht, Medikamente? Wir wissen es nicht. Doch das Interesse an uns ist riesengroß. Es werden Fragen gestellt, leere Medikamentenschachteln gezeigt und Geschichten erzählt – tragische und eindringliche. Sie machen die Nacht weniger eintönig, aber dafür auch anstrengender. Mit jeder Stunde wird der Kampf gegen die Müdigkeit erbitterter, die Augenlider schwerer. Mein Kopf kippt immer häufiger nach hinten, nur um dann – wie aus dem Nichts – ruckartig hochzuschnellen, als hätte mich ein Alarm geweckt. Immer wieder taste ich im Halbschlaf nach dem Vertrauten: Zelt da? Rucksack da? Alles noch bei mir? Durchatmen. Und dann taucht sie auf: die Frage, wer wir sind – in diesem Zug, in diesem Land, in dieser Nacht. Fremde in der dritten Klasse. Beobachter – und zugleich Beobachtete.
Im Sommer 1982 fragte mich Kurt, ob ich mit ihm in den Ferien nach Afrika reisen wolle. Die Entscheidung fiel schnell: Kenia, Tansania und Zaire sollten es sein – drei Länder, drei Abenteuer. Gesagt, getan. Mit Impfungen wie Tetanus, Polio, Diphtherie, Typhus, Cholera, Hepatitis A (per Immunglobulin) und Gelbfieber und den nötigen Visa für Tansania und Zaire, machten wir uns am 21.07.1982 voller Vorfreude auf den Weg. Unser Ziel: der Kibo – mit 5.895 Metern der höchste Gipfel des Kilimandscharo und zugleich das Dach Afrikas. Doch bevor wir uns auf dieses Abenteuer einließen, führte uns der Weg zunächst an die Küste. Mombasas Strände empfingen uns mit Hitze und warmen Wasser - und mit dem Gefühl von Leichtigkeit. Ein starker Kontrast zur Herausforderung, die noch vor uns lag.
Die Ruhe vor dem Sturm
Meine Reise durch Afrika begann auf eine Art und Weise, die ich damals nicht ernst nahm und die ich nie vergessen werde. Am 22.07.1982 warnten uns ugandische Studenten an der Universität in Nairobi eindringlich: Wir sollten die Stadt so schnell wie möglich verlassen. Gerüchten zufolge, die sich über den Buschfunk verbreiteten, stünde ein Putsch gegen Präsident Daniel arap Moi unmittelbar bevor. Doch was wussten wir schon? Politisch noch sehr unerfahren und ohne einen echten Bezug zur Lage im Land, kamen uns diese Warnungen wie Spekulationen vor, übertrieben und erfunden. Denn in den geschäftigen Straßen des Zentrums deutete nichts auf Unruhen hin. Die Menschen gingen ihren Alltagspflichten nach, Händler boten ihre Waren an, Autos hupten und das Leben pulsierte. Für uns wirkte dies alles vollkommen normal. Darum taten wir die Warnungen als Übertreibung, als bloßes Gerede und als Angeberei ab. Ein folgenschwerer Fehler wie sich herausstellen sollte. Unsere Haltung war von einer Arroganz - gepaart mit Naivität, die eigentlich weh tun hätte müssen. Im Rückblick erscheint es mir wie ein klassisches Beispiel für Hochmut vor dem Fall. Denn wenige Tage später sollten wir erkennen, dass wir uns – ohne es zu wissen bzw. wahrhaben zu wollen – mitten in der sprichwörtlichen Ruhe vor dem Sturm befanden.
Mombasa – Malaria - Schicksale
Am 24.07.1982, morgens, erreichen wir völlig übermüdet und durchgesessen den Bahnhof im Herzen von Mombasa. Die Nacht im Zug auf den harten Holzbänken steckt uns in den Knochen. Beim ersten Spaziergang durch die Stadt fällt uns sofort das Wahrzeichen von Mombasa ins Auge: zwei gigantische, in Beton gegossene Elefantenstoßzähne, die sich bogenförmig - wie ein monumentales Eingangstor - über die Straße spannen. Sie wirken majestätisch und für ein Postkartenmotiv fotogen.Gegen Mittag steigen wir in einen Bus, der uns Richtung Küste bringt – dort, wo uns der Indische Ozean lockt. Die Strände, die wir besuchen, blenden in zweifacher Hinsicht: Zum einen lässt der feine, weiße Sand das Sonnenlicht so grell reflektieren, dass die Augen ohne eine Sonnenbrille schmerzen. Andererseits überrascht uns das flache, türkisfarbene Wasser. Man muss daher weit hineinlaufen, um etwas schwimmen zu können. Auf dem Weg dahin lauern Seeigel mit spitzen Stacheln. Wer keine Plastiksandalen tragen will, riskiert das Risiko von Verletzungen, Und hier zeigt sich Kenia erstmals von seiner touristisch-kommerziellen Seite: denn dieses Muss an Strandzubehör kann nur in den nahegelegenen Läden weit überteuert erstanden werden.
Die Gefahr, in Kenia an Malaria zu erkranken, wurde für mich früh real. In der Nähe unseres Campingplatzes lag schwer erkrankt eine deutsche Krankenschwester in einer einfachen Holzhütte. Aus Angst vor den Nebenwirkungen, wie sie in dem Beipackzettel ihrer Medikamente standen, hatte sie auf eine Prophylaxe verzichtet. Und jetzt kämpfte sie mit den Symptomen einer schweren Malariainfektion ums Überleben. Ein Arzt kümmerte sich aufopferungsvoll um sie, doch ihr Zustand war kritisch. Diese Begegnung war für mich ein Wendepunkt. Von da an nahm ich meine Malariatabletten streng nach Plan – auch die Wochen nach meiner Rückkehr. Zusätzlich trug ich Insektenschutzmittel auf, um das Risiko der Übertragung durch Mückenstiche so gering wie nur möglich zu halten.
Kurt hingegen nahm es nicht ganz so genau. Kaum zurück in Deutschland, setzte er die Prophylaxe sofort ab. Als er im Winter mit Fieberschüben zum Arzt ging, wurde sein Zustand als grippaler Infekt diagnostiziert. Erst als er den Aufenthalt im Malariagebiet erwähnte, wurde der wahre Auslöser der Fieberschübe erkannt. Durch diesen Hinweis konnte eine gezielte Diagnose und auch eine entsprechende Behandlung eingeleitet werden.
Immer wieder liest man von Reisenden, die nach ihrer Rückkehr aus den Tropen an Malaria versterben – einfach, weil kaum jemand an die Erkrankung denkt. Malaria muss nicht immer plötzlich und dramatisch verlaufen – sie kann auch über Jahrzehnte im Körper schlummern. Ein Beispiel dafür erlebte ich 1997 in einer Arztpraxis in Sachsen. Ein Rentner litt an wiederkehrenden grippeähnlichen Schüben – seit Jahren, und niemand dachte an Malaria. Er selbst konnte sich an keinen Auslandsaufenthalt außerhalb der DDR erinnern. Doch als der Arzt beiläufig erwähnte, dass sein Patient im II. Weltkrieg in Süditalien stationiert war, erinnerte ich mich an ein Seminar über Krankheiten in den Tropen: Dort wurde in einem alten Film über Malariafälle in Süditalien während des II. Weltkrieges berichtet.Dieses erworbene Wissen führte zur richtigen Diagnose und einer effektiven Behandlung. Die Lebensqualität des Mannes verbesserte sich daraufhin deutlich. Ohne den Hinweis auf den Einsatzort wäre er wahrscheinlich noch jahrelang an einer Malariaform erkrankt geblieben. Am Rande sei nur erwähnt: 2006, bei einem Aufenthalt in Manila, wurde mir eine Mitarbeiterin einer Malariaorganisation vorgestellt – und wir erkannten uns auf den ersten Blick. Sie war damals die Doktorandin gewesen, die den Film in dem Seminar vorgeführt hatte. Wir kennen uns doch, sagten wir fast gleichzeitig, lachten und staunten. Ob man sich vielleicht doch zweimal im Leben trifft?
Gescheiterter Aufstieg
Die Besteigung des Kilimandscharo sollte beginnen – doch schon vor dem ersten Schritt war sie vorbei. Am 31. Juli 1982 stoppten uns tansanische Grenzposten kurz vor dem Grenzübergang. Wegen aktueller Grenzstreitigkeiten war der Übergang für Ausländer ohne eigenes Fahrzeug von Kenia nach Tansania geschlossen worden. Trotz gültigem Visum, aber ohne Auto, blieb uns nichts anderes übrig, als zu Fuß umzukehren. Der Kilimandscharo lag hinter uns, majestätisch, aber unerreichbar. In brütender Hitze stapften wir kilometerweit über eine staubige Straße, die sich durch ein endloses Sisalfeld zog, zurück zur Grenze Kenias. Wat mutt, dat mutt, sagten wir uns – und wanderten weiter.
Die Anreise zur Grenze war schon alles andere als einfach gewesen: Irgendwo in der Steppe hatte der altersschwache Bus den Geist aufgegeben. Zwölf Stunden lang standen wir in der Hitze, während unser Fahrer, der das Fahrgeld zwar eingesammelt, aber nicht bei sich hatte, den Bus reparierte. Mit kaum Werkzeug, aber mit handwerklichem Geschick brachte er den Bus schließlich zum Laufen. Hut ab – vor dieser bemerkenswerten Improvisationskunst.
Zurück auf Kenia-Seite war unsere Stimmung bedrückt. Die Reisekasse an Kenia Money war knapp, da wir mit der Einreise nach Tansania gerechnet hatten. Und der Gedanke, dass unsere Winterkleidung für den Kibo unnötig Platz im Gepäck wegnahm, verstärkte die Enttäuschung. Aufgeben? Das kam nicht in Frage. Wir fassten einen Plan: möglichst schnell nach Nairobi, um dann über Uganda nach Tansania einzureisen. Mit unserem letzten lokalen Geld konnten wir noch zwei Zugtickets nach Voi lösen. Dort endete die Fahrt. Direkt gegenüber dem Bahnhof stand das Polizeigebäude. Die Beamten zögerten nicht – sie boten uns an, die Nacht in der Wache zu verbringen, zu unserer eigenen Sicherheit. Eine unerwartete Geste der Fürsorge. Am Vortag hatten sie uns schon vor der geschlossenen Grenze gewarnt – wie auch andere Reisende, deren Hinweise wir kalt ignorierten. Rückblickend war dieses Verhalten eine üble Verkettung von Missverständnissen, Fehleinschätzungen und, ehrlich gesagt, einer gehörigen Portion Überheblichkeit. Denn wir hielten die Warnungen für übertrieben, glaubten es besser zu wissen. Es brauchte noch einige weitere grenzwertige Erfahrungen, bis ich begriff, wie wichtig es ist, auf die Menschen zu hören – ihre Hinweise ernst zu nehmen, statt sie vorschnell abzutun. Auf Reisen lauern schließlich viele unberechenbare Überraschungen. Zum Glück begleitet mich – so fühlt es sich zumindest an – eine Art Schutzengel. Dank ihm endeten manche Beinahe-Katastrophen nicht im völligen Desaster, sondern in kleineren Tragödien und sie werden zu Lektionen fürs Leben und Überleben.
Der Putsch – Mango und Waffen
Soldaten stoppen uns mit vorgehaltenem Gewehr. Vor uns, mitten auf der Straße, steht ein brennender Kleinbus – das Logo der Swiss Air prangt gut sichtbar auf der zerbeulten Karosserie. Normalerweise werden mit solchen Bussen Flugzeugbesatzungen vom Flughafen in Hotels gebracht. Jetzt ist er nur noch ein flammendes Wrack. Wir befinden uns in der Nähe des Flughafens Nairobis. Überall brüllen Soldaten - durcheinander, nervös, überfordert. Sie fuchteln mit Pistolen, Gewehren und Uzis herum – ein Anblick, der Angst macht. Die Lage scheint instabil - unübersichtlich. Immer wieder hören wir Schüsse und Explosionen, deren Ursprung nicht zu lokalisieren ist. Alles wirkt wie kurz vor einem Kollaps. Und plötzlich wird uns klar: Die Polizisten von Voi hatten recht.
Schon am Morgen des 01.08.1982 hatten sie uns gewarnt. Über das Radio waren die ersten Berichte über Unruhen in der Hauptstadt gesendet worden. Die Beamten rieten uns eindringlich, Nairobi zu meiden – ja, sogar, auf der Wache zu übernachten. Die Möglichkeit, hier zu bleiben, sei bei weitem besser, als jetzt nach Nairobi zu fahren. Aber wir, jung, naiv und voller Tatendrang, schlugen alle Warnungen in den Wind. Stattdessen trampen Kurt und ich los – von Voi Richtung Nairobi. Ein alter Lkw, beladen mit Mangos, nimmt uns auf seiner Ladefläche mit. Zum ersten Mal in meinem Leben esse ich Mango – süß, saftig und köstlich. Damals wusste ich noch nicht, dass ich diesen Geschmack nie wieder würde genießen können. Seit diesem Tag löst der Geschmack von Mango bei mir einen Tunnelblick aus – eine körperliche Reaktion auf ein seelisches Trauma.
Je näher wir an Nairobi kommen, desto greifbarer wird die Bedrohung. Die Straße füllt sich mit stehenden LKWs – eine endlose Kolonne. 50 Kilometer vor der Stadt beginnt der Stillstand. Die Fahrer warten. Alle. Niemand weiß, was vor uns liegt. Verschiedene Gerüchte machen die Runde, sie werden lauter, dichter, konkreter: Ein Militärputsch soll im Gange sein. Soldaten der Luftwaffe, heißt es, versuchen gerade, den Präsidenten zu stürzen. Doch anstatt zu warten, trampen Kurt und ich weiter - stur - und unbelehrbar. Ein britisches Ehepaar hält an und nimmt uns mit. Auch sie wiegen sich offenbar in falscher Sicherheit. Gemeinsam fahren wir weiter – hinein in eine Situation, die niemand von uns erwartete. Etwa 5 Kilometer vor der Abzweigung zum Airport überholen wir ein Polizeifahrzeug – an Bord: schwer bewaffnete Beamte. Minuten später eskaliert alles.
Bewaffnete Soldaten reißen uns aus dem Auto. Schreie, Rufe und gezückte Waffen. Wir werden gezwungen, uns nebeneinander aufzustellen. Ein Exekutionskommando? Die Gewehre sind durchgeladen. Die Mündungen auf uns gerichtet. Die Blicke der Soldaten – kalt, ohne erkennbare Regung. In diesem Moment scheint alles möglich. Auch das Schlimmste.Der Motor unseres Autos läuft noch, schnurrt leise wie ein letztes Lebenszeichen. Dann – völlig unerwartet – taucht der Polizeiwagen wieder auf, den wir kurz zuvor überholt hatten. Ein Ruck geht durch die Szene. Die Soldaten springen hinter ihre Barrikaden, werfen sich in Deckung – als würden sie selbst zur Zielscheibe. Ein Moment des Stillstands. Dann ein kurzes Nicken, kaum wahrnehmbar – und die Geste: Wir dürfen zurück ins Auto.





























