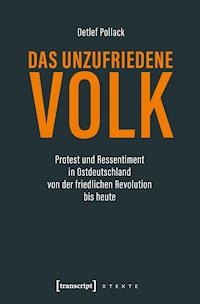Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Religion und Moderne
- Sprache: Deutsch
In vielen Ländern Europas und außerhalb Europas hat sich in den vergangenen Jahren die soziale Bedeutung von Religion deutlich verringert. Inwieweit sind Religion und Moderne miteinander vereinbar? Inwieweit besitzen Religionsgemeinschaften Potenziale, mit deren Hilfe sie dem Säkularisierungstrend wirksam begegnen können? Anhand ausgewählter Länder – darunter Deutschland, Italien, die Niederlande, Polen, Russland, USA, Südkorea und Brasilien – gehen Detlef Pollack und Gergely Rosta in dieser aktualisierten 3. Auflage ihres Standardwerks dem Verhältnis von Modernisierung und religiösem Wandel im 20. und 21. Jahrhundert nach. Auf neuestem Datenstand fußend, entwerfen sie Theorieperspektiven, die dazu beitragen können, die Abschwächung religiöser Bindungen in der Moderne zu erklären, aber auch in der Lage sind, ihre Stärkung verständlich zu machen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1185
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Detlef Pollack, Gergely Rosta
Religion in der Moderne
Ein internationaler Vergleich
3., aktualisierte und erweiterte Auflage
Campus VerlagFrankfurt/New York
Über das Buch
In vielen Ländern Europas und außerhalb Europas hat sich in den vergangenen Jahren die soziale Bedeutung von Religion deutlich verringert. Inwieweit sind Religion und Moderne miteinander vereinbar? Inwieweit besitzen Religionsgemeinschaften Potenziale, mit deren Hilfe sie dem Säkularisierungstrend wirksam begegnen können? Anhand ausgewählter Länder – darunter Deutschland, Italien, die Niederlande, Polen, Russland, USA, Südkorea und Brasilien – gehen Detlef Pollack und Gergely Rosta in dieser aktualisierten 3. Auflage ihres Standardwerks dem Verhältnis von Modernisierung und religiösem Wandel im 20. und 21. Jahrhundert nach. Auf neuestem Datenstand fußend, entwerfen sie Theorieperspektiven, die dazu beitragen können, die Abschwächung religiöser Bindungen in der Moderne zu erklären, aber auch in der Lage sind, ihre Stärkung verständlich zu machen.
Vita
Detlef Pollack ist Seniorprofessor am Exzellenzcluster »Religion und Politik« der Universität Münster.
Gergely Rosta arbeitet als Associate Professor an der Katholischen Péter-Pázmány-Universität in Budapest.
Übersicht
Cover
Titel
Über das Buch
Vita
Inhalt
Impressum
Inhalt
Danksagung
Einführung
Teil I Theoretische Überlegungen
1.
Überlegungen zum Begriff der Moderne
1.1.
Der Kern der Modernisierungstheorie
1.2.
Diskussion einiger Einwände gegenüber der Modernisierungstheorie
1.3.
Entwurf einer Theorie der Moderne
2.
Überlegungen zum Religionsbegriff
2.1.
Allgemeine Überlegungen zur Definierbarkeit von Religion: Probleme der Religionsdefinition
2.2.
Unterschiedliche Religionsbegriffe
2.2.1.
Substantielle Definitionen
2.2.2.
Funktionalistische Definitionen
2.2.3.
Religion als Diskurs
2.3.
Versuch einer Religionsdefinition
2.3.1.
Die funktionale Perspektive
2.3.2.
Die substantielle Herangehensweise
2.4.
Fazit
3.
Leitende Fragestellungen, methodologische Vorbemerkungen
3.1.
Leitende Fragestellungen
3.2.
Methoden und Quellen
Teil II Religiöser Niedergang in Westeuropa?
Einleitung
4.
Zwischen Entkirchlichung und religiöser Persistenz: Westdeutschland
4.1.
Deskription
4.1.1.
Zugehörigkeitsdimension
Der Wandel der Konfessionszugehörigkeit in Westdeutschland seit dem Zweiten Weltkrieg
Kirchenaustritte
Kircheneintritte, Kirchenmitgliedschaftsmotive
Taufen
Mitgliedschaft in evangelischen Freikirchen und anderen kleinen Religionsgemeinschaften
4.1.2.
Praxisdimension
Der sonntägliche Gottesdienstbesuch
Teilnahme an anderen kirchlichen Veranstaltungen außerhalb des Sonntagsgottesdienstes
Kasualien
Private Religionspraktiken
4.1.3.
Die Dimension der religiösen Vorstellungen, Überzeugungen und Erfahrungen
Der Glaube an Gott und an andere christliche Transzendenzvorstellungen
Formen außerkirchlicher Religiosität
4.2.
Erklärungsversuch
4.3.
Immigrantenreligiosität in Westdeutschland
5.
Eine Hochburg des Katholizismus: Italien
5.1.
Die Dominanz des Katholizismus nach 1945
5.2.
Der Rückgang der kirchlichen Integrationsfähigkeit seit der zweiten Hälfte der 1950er Jahre
5.3.
Anhaltende religiös-kirchliche Vitalität zwischen den 1980er und den 2000er Jahren
5.4.
Die katholische Hochburg im Niedergang?
6.
Religion im freien Fall: Die Niederlande
6.1.
Die Entstehung konfessioneller Milieus und ihre Auflösung
6.2.
Der Sonderfall des niederländischen Katholizismus
6.3.
Religiöser Aufschwung außerhalb der Kirche?
Fazit
Teil III Renaissance des Religiösen in Osteuropa?
Einleitung
7.
Russland: Wiederkehr der Religion
7.1.
Die Russisch-Orthodoxe Kirche – tief verwurzelt in der russischen Kultur?
7.2.
Erklärung des religiösen Aufschwungs in Russland nach 1990
8.
Ostdeutschland: Säkularisiert wie kein anderes Land der Welt
8.1.
Die Folgen der repressiven Kirchenpolitik der SED
8.2.
Weitere Ursachen des Bedeutungsverlusts von Religion und Kirche
8.3.
Keine Trendwende nach 1989
9.
Polen: Unerwartete Vitalität nach dem Fall des Kommunismus
9.1.
Die zunehmende Stärke der katholischen Kirche Polens in der Zeit des Staatssozialismus
9.2.
Die katholische Kirche nach dem Systemumbruch
9.3.
Der Sonderfall Polen – ein Erklärungsversuch
9.4.
Neueste Entwicklungen
Fazit
Teil IV Religiöser Wandel im außereuropäischen Raum: Drei Fallbeispiele
Einleitung
10.
Religion und Religiosität in den USA: Ein Kontrastmodell zu Europa?
10.1.
Deskription
10.1.1.
Zugehörigkeitsdimension
10.1.2.
Die Überzeugungsdimension
10.1.3.
Praxisdimension
10.2.
Explanation
11.
Südkorea: Die Gleichzeitigkeit von Modernisierung und Christianisierung
11.1.
Deskription
11.2.
Explanation
12.
Pfingstlerische und evangelikale Bewegungen in Westeuropa, den USA und Brasilien im Vergleich
12.1.
Kennzeichen evangelikaler und pfingstlerisch-charismatischer Gruppierungen
12.1.1.
Merkmale evangelikaler Gruppierungen
12.1.2.
Merkmale pfingstlerischer und charismatischer Gruppierungen
12.1.3.
Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den evangelikalen und pfingstlerischen Gruppierungen
12.2.
Anmerkungen zur Verbreitung evangelikaler und charismatischer Gruppierungen in Westeuropa, den USA und Lateinamerika
12.3.
Theoretische Ansätze zur Erklärung des Wachstums der neuen religiösen Bewegungen
12.4.
Ergebnisse der empirischen Analyse
12.5.
Bedingungen des Wachstums charismatischer und evangelikaler Gruppen
Teil V Systematische Perspektiven
13.
Makro- und mikrosoziologische Erklärungen im Ländervergleich
13.1.
Kirchlichkeit und individualisierte Religiosität als abhängige Variablen: eine Mehrebenenanalyse
13.2.
Kirchlichkeit und individualisierte Religiosität als unabhängige Variablen
14.
Muster und Bestimmungsgründe des religiösen Wandels in der Moderne: Auf dem Weg zu einer multi-paradigmatischen Theorie
14.1.
Theorie und Empirie
14.2.
Theoretische Generalisierungen der empirischen Befunde
14.3.
Schlussfolgerungen und Zusammenfassung
Verzeichnis der Grafiken
Verzeichnis der Tabellen
Literatur
Personenregister
Sachregister
Danksagung
Dieses Buch, das hier in dritter, aktualisierter und erweiterter Auflage vorliegt, wäre anders ausgefallen, hätten sich neben den Autoren nicht auch andere daran beteiligt. Viele Kolleginnen und Kollegen haben Teile des Buches gelesen und mit kritischen Kommentaren versehen. Wir möchten uns bedanken bei Olaf Müller, Münster, Johannes Berger, Berlin, Hedwig Richter, München, Michael Hainz, Frankfurt/M., Jörg Haustein, Heidelberg, Hugh McLeod, Birmingham, Erik Sengers, Amsterdam, Kersten Storch, Amsterdam, Andreas Wöhle, Amsterdam, Wolf Wagner, Berlin, Gert Pickel, Leipzig, Klaus Große Kracht, Hamburg, Mark Chaves, Duke University, Peter Beyer, Ottawa, David Voas, London, Jörg Stolz, Lausanne, sowie bei Thomas Kern und Insa Pruisken, beide Bamberg. Von ihren kritischen Bemerkungen und Ergänzungsvorschlägen hat die Argumentation des Textes stark profitiert. Zu bedanken haben wir uns auch bei Frau Angelika Reerink, Münster, die am Personen- und Sachregister mitgearbeitet hat. Bei den Formatierungsarbeiten hat uns Paul Seidel, Münster, geholfen. Ein besonderer Dank geht an Anne Schlüter, Münster, die erst als Studentische und später als Wissenschaftliche Hilfskraft mit außerordentlichem Einsatz und bemerkenswertem Scharfsinn darauf gedrängt hat, die Kohärenz der Argumentation zu stärken. Beharrlich hat sie daran gearbeitet, Ungenauigkeiten und Widersprüchlichkeiten aufzudecken und auch noch die kleinste Uneindeutigkeit zu beheben. Darüber hinaus hat sie aber auch keine Mühe gescheut, die mannigfachen empirischen Aussagen des Buches zu überprüfen. Für die dritte Auflage haben uns Marta Shmendel, Münster/Chapel Hill, und Leonie Hannah Stoyke, Münster, bei der Aktualisierung der Daten, der Überprüfung der Referenzen sowie der orthografischen Durchsicht geholfen. Auch an sie geht unser Dank. Ebenso wie an Christoph Roolf, Düsseldorf, und Nele Marie Burghardt, Müns-ter, für die Aktualisierung des Personen- und Sachregisters. Außerdem möchten wir uns auch bei Thomas Großbölting (†), Hamburg, Barbara Stollberg-Rilinger, Berlin, und Ulrich Willems, Münster, sowie bei den Mitgliedern des »Centrums für Religion und Moderne«, Münster, für die Aufnahme des Bandes in die Reihe »Religion und Moderne« bedanken. Die Arbeit mit dem Campus Verlag war äußerst angenehm und konstruktiv. Wir danken Frau Judith Wilke-Primavesi, Herrn Jürgen Hotz und Herrn Joachim Fischer vom Campus Verlag für ihr Engagement und ihre Geduld im Umgang mit allen auftauchenden Fragen.
Das Buch wäre wohl kaum entstanden, wenn die Arbeit an ihm nicht die Unterstützung des Exzellenzclusters »Religion und Politik: Dynamiken von Tradition und Innovation« an der Universität Münster erfahren hätte. Der intellektuell anregenden Atmosphäre, den Diskussionen im Kollegenkreis und auch den kritischen Bedenken gegenüber dem von uns verfolgten Ansatz verdankt das Buch viel, zu schweigen von der finanziellen Unterstützung durch das Cluster, die uns die Konzentration auf das Schreiben des Textes ermöglicht hat.
Die dritte Auflage des Buches unterscheidet sich erheblich von der ersten. Wir haben nicht nur die empirischen Aussagen, soweit es die Datenlage zuließ, aktualisiert, sondern auch die Interpretation der Daten – auch aufgrund der eingetretenen religiösen Veränderungen – in vielfacher Hinsicht umgestellt. Insbesondere die noch deutlicher als vor zehn Jahren zutage getretenen Tendenzen der Säkularisierung, selbst in so hochreligiösen Ländern wie Polen, Italien oder den USA, mussten dabei Berücksichtigung erfahren. Aber auch den religiös aufgeladenen politischen Konflikten, die trotz der sich unübersehbar verstärkenden Säkularisierungstendenzen anhalten, haben wir höhere Aufmerksamkeit geschenkt. Darüber hinaus haben wir auch der Auseinandersetzung mit den evangelikalen Gruppierungen in den USA, mit dem religiös konnotierten Nationalismus in den ost- und ostmitteleuropäischen Ländern sowie mit der Religiosität der muslimischen Zuwanderer nach Westeuropa mehr Raum gegeben. Gleichzeitig haben wir darauf Wert gelegt, die Verklammerung zwischen theoretischen Überlegungen und empirischer Evidenz, die uns auch in der ersten Auflage bereits am Herzen lag, zu stärken.
Münster, Oktober 2024
Detlef Pollack, Gergely Rosta
Einführung
Die Säkularisierungstheorie ist in den Geistes- und Sozialwissenschaften hochumstritten. Und das mit gutem Grund. An ihrer Geltung entscheidet sich nicht nur, welche soziale Signifikanz der Religion als einer kulturgeschichtlichen Macht sondergleichen heute noch zukommt. In ihrem Medium werden auch philosophisch aufgeladene Kontroversen über das Selbstverständnis der westlichen Moderne ausgetragen. Handelt es sich bei der europäischen Moderne um eine materielle und geistige Emanzipation von der alle Gesellschaftsbereiche umspannenden Dominanz der Religion, wie das etwa Hans Blumenberg (1974) in seiner These von der Legitimität der Neuzeit behauptet? Oder ist es angemessener, gerade umgekehrt in modernen Ideen wie dem Fortschrittsglauben oder der Souveränität des Staates oder der Menschenwürde Produkte einer Transformation christlicher Gehalte in säkulare Vorstellungen zu sehen – eine Argumentation, die sich in den Arbeiten von Karl Löwith (1953) und Carl Schmitt (1932) findet und von Blumenberg (1974: 35 ff.) scharf kritisiert wird.1 Sollte die Moderne mit Hegel (1955: 62) gar als die vernunftgemäße Verwirklichung ihres christlichen Ursprungs verstanden werden? Oder ist die Moderne weder das Ergebnis einer Befreiung vom Christentum noch das eines Abfalls von diesem und auch nicht seine kongeniale Realisierung, sondern eine Verkehrung der Prinzipien sowohl des Christentums als auch der Vernunft, die unausweichlich in die Katastrophe führt?2 Solche und weitere Sinnbezüge sind aufgerufen, wenn das Stichwort Säkularisierung fällt.
Der religionssoziologische Diskurs hat sich von den kulturphilosophisch aufgeladenen Bedeutungen, die diesem Stichwort anhaften, nie ganz freihalten können. Immer ging es um mehr als nur um die Frage nach dem religiösen Wandel in modernen Gesellschaften: um die triumphalistische Aufwertung der westlichen Moderne zum Ziel und Maßstab der Geschichte und die Bestreitung ihrer Einzigartigkeit, um die Herabsetzung der Religion als eine bloß traditionale Macht der Vergangenheit und ihre Rettung als dynamische Ressource, um die Behauptung ihrer Überflüssigkeit und ihrer sozialen und personalen Notwendigkeit. Kritiker der Säkularisierungstheorie wie Talal Asad, José Casanova, Charles Taylor oder Hans Joas haben sich zumeist nicht damit begnügt, die soziologische Unzulänglichkeit dieser Theorie herauszuarbeiten, vielmehr kam es ihnen immer wieder auch darauf an, das mit ihr verbundene fortschrittsoptimistische Pathos zu Fall zu bringen.3 Sie reagierten damit auf westliche Überlegenheitsansprüche, wie sie der Säkularisierungstheorie seit den Tagen Auguste Comtes eingeschrieben sind, und versuchten sich an ihrer Umkehrung. Dass das Ringen um die Gültigkeit der Säkularisierungstheorie einen so kontroversen Charakter angenommen hat, erklärt sich zu einem großen Teil aus ihren geschichtsphilosophischen Implikationen.
In der religionssoziologischen Säkularisierungsdiskussion besetzten die kulturphilosophischen Fragen gleichwohl nicht den gesamten und vielleicht noch nicht einmal den größten Raum. Im Zentrum der religionssoziologischen Debatten standen vielmehr zwei andere Fragen: Was sind die dominanten Tendenzen des religiösen Wandels in modernen Gesellschaften? Und: Wie lassen sie sich sozialwissenschaftlich erklären? Das zentrale Problem bestand darin herauszufinden, ob und inwieweit die Säkularisierungstheorie geeignet sei, diese beiden Probleme angemessen zu bearbeiten. Über viele Jahre – seit den 1990er Jahren bis zum Beginn der 2010er Jahre – lautete die entschiedene Antwort: Nein.4 Für diese Phase der religionssoziologischen Analyse stehen die revisionistischen Arbeiten von Karl Gabriel (1992, 2008a, b), José Casanova (1994, 2015), Grace Davie (1994, 2002), Rodney Stark und Roger Finke (2000), Danièle Hervieu-Léger (2000, 2004), Friedrich Wilhelm Graf (2004), Paul Heelas und Linda Woodhead (2005), Ulrich Beck (2008) und Hubert Knoblauch (2009), die vor allem aus dem Lager der Individualisierungstheorie sowie der ökonomischen Markttheorie kamen. Inzwischen aber hat sich die Diskussionslage geändert. Die Zustimmung zu den revisionistischen Ansätzen hat stark abgenommen, während die säkularisierungstheoretisch inspirierten Analysen an Reputation gewonnen haben. Maßgeblich ist diese Wende durch die Studien von Pippa Norris und Ronald Inglehart (2004; Inglehart 2021), Alasdair Crocket und David Voas (2006; Voas 2009), Jörg Stolz (2013, 2016, 2020), Mark Chaves (2011, mit Voas 2016), Gert Pickel (2009, 2010, 2014) sowie nicht zuletzt auch durch die Sechste Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung (EKD 2023) beeinflusst worden.
Der Grund für den Umschwung der Diskussionslage liegt nicht darin, dass die Säkularisierungskritiker ihre Auffassungen widerrufen hätten und eine Läuterung ihrer Ansichten eingetreten wäre. Es ist vielmehr zu einer so dramatischen Veränderung der sozialen religiösen Situation gekommen, dass der Rückgang der religiösen und kirchlichen Bindungen, der sich in den letzten beiden Dekaden in vielen Regionen der Welt vollzogen hat, unübersehbar geworden ist. Selbst Länder, die traditionell als Hochburgen von Religion und Kirche behandelt wurden, blieben von den Einbrüchen nicht verschont. So weisen etwa die USA, die jahrzehntelang als Paradebeispiel zur Entkräftung der Säkularisierungstheorie herangezogen wurden, seit der Jahrtausendwende deutlich wahrnehmbare Säkularisierungstendenzen auf. Der Anteil der Konfessionslosen, der sich im 20. Jahrhundert noch durchgehend im einstelligen Prozentbereich bewegte, ist auf knapp 30 % gestiegen (Pew Research Center 2024: 6; GSS 2022). Ebenso wuchs der Anteil der Amerikaner, die angeben, niemals den Gottesdienst zu besuchen, von unter 10 % im Jahr 1972 auf 30 % im Jahre 2018 (GSS 1972–2018). Auch das Niveau des Glaubens an Gott, obwohl immer noch deutlich höher als in Westeuropa, hat sich abgesenkt (vgl. Grafik 10. 1) Die Veränderung der religiösen Lage in den USA wird unter dem Label Säkularisierung inzwischen breit diskutiert (Kasselstrand/Zuckerman/Cragun 2023; Cragun/Smith 2024).
Im Unterschied zu den USA gelten die Länder Westeuropas schon seit langem als eine Region mit hohem Säkularisierungsgrad. In den letzten Jahren hat sich das Tempo der religiösen Rückgänge in den westeuropäischen Ländern allerdings noch einmal verschärft. In Westdeutschland etwa, wo sich zum Zeitpunkt der Staatsgründung ungefähr 90 % der Bevölkerung zum Glauben an Gott bekannten und die Zustimmung zum Gottesglauben jahrzehntelang zwischen 60 und 70 % pendelte, werden die Gottesgläubigen inzwischen zur Minderheit. Heute sagen nur noch 20 % der Westdeutschen, dass sie an einen persönlichen Gott, und weitere 30 %, dass sie an eine höhere Macht glauben (KMU VI, f50). Die Rückgänge sind auch in den traditionell hochkatholischen Ländern wie Irland, Italien oder Spanien beträchtlich. Gegentendenzen zeichnen sich kaum ab.
Anders allerdings sieht es in Ostmittel- und Osteuropa aus. In Russland, Bulgarien, Weißrussland, Armenien, der Ukraine, Albanien, Rumänien und Georgien sind die Religiositätsindizes seit dem Fall des Kommunismus gestiegen (WVS 1981–2020). Doch auch dort gibt es Länder wie Tschechien, Estland, Lettland, Litauen, Ungarn oder Slowenien, in denen sich die religiösen Bindungen abschwächen. Nach Jahren einer beachtlichen religiösen Stabilität ist inzwischen auch Polen von einem tiefgreifenden Prozess der Säkularisierung erfasst. In keinem der 106 in einer Studie des Pew Research Centers (2018a: 37) einbezogenen Länder fällt die Differenz in der Wichtigkeit, die die Bevölkerung der Religion im eigenen Leben beimisst, zwischen den Jüngeren und den Älteren so hoch aus wie in Polen. Der Anteil derer, die der Religion eine sehr hohe Bedeutung zuschreiben, liegt bei den Jüngeren 23 Prozentpunkte unter dem der Älteren. Das Vertrauen in die Kirche fiel in Polen im Jahr 2019 erstmals seit den 1990er Jahren unter die 50-Prozentmarke (CBOS 2022: 1). Allein zwischen 2015 und 2021 ist der wöchentliche Gottesdienstbesuch, der auch nach dem Ende des Kommunismus noch relativ hoch war, um etwa zehn Prozentpunkte zurückgegangen (Grabowska 2023).
In den westlichen Offshoots Australien, Neuseeland und Kanada vollziehen sich seit Jahren ähnliche Säkularisierungsprozesse wie in Westeuropa. Aber auch mehrheitlich muslimische Länder sind nicht frei von diesen Tendenzen. In der Türkei, in der die die Moscheen kontrollierende Religionsbehörde Diyanet in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut wurde (Sen 2020), entwickelt sich trotz der staatlich forcierten Islamisierung der Gesellschaft – oder auch gerade deswegen – die religiöse Bindung der Bevölkerung rückläufig. Sowohl der Moscheebesuch als auch das Vertrauen in die Moscheegemeinde sowie die Zentralität von Religion im eigenen Leben sind von 2001 bis 2018 deutlich zurückgegangen – bei der Einschätzung von Religion als sehr wichtig beispielsweise von 80 % auf 60 % (çokgezen 2022: 361). Besonders weit vorangeschritten sind die Prozesse der Säkularisierung im Iran. Einer Online-Befragung zufolge verstehen sich nicht, wie die offiziellen Zahlen suggerieren, über 99 % der Iranerinnen und Iraner als muslimisch, sondern nur etwa 40 % (Arab/Maleki 2020; Röther 2021). Etwa 22 % sagen, sie würden keiner Religion angehören, 9 % definieren sich als Atheisten. Nach dieser Befragung, an der etwa 40.000 Iraner teilnahmen, erklärten 47 %, sie hätten ihre Religion aufgegeben, aber nur 6 %, sie wären religiös geworden.
Rückläufig entwickeln sich die Religiositätsindizes auch in anderen Ländern der islamischen Welt. Einer Befragung des Arab Barometer (2019a) zufolge hat sich besonders in Nordafrika der Anteil der Menschen, die sich als nichtreligiös bezeichnen, erhöht. Im Durchschnitt der untersuchten Länder – unter ihnen Tunesien, Libyen, Algerien, der Libanon, Marokko, Ägypten, Jordanien und andere – stieg er allein in den letzten fünf Jahren von 8 auf 13 %, bei den unter 30-Jährigen sogar auf 18 %. In Tunesien, als dem liberalsten Staat in der Region, definieren sich inzwischen 31 % als nicht religiös; bei den 18–29-Jährigen beläuft sich ihr Anteil auf fast die Hälfte (Arab Barometer 2019b). In Ägypten fiel die Unterstützung für die Scharia in den Jahren zwischen 2011 und 2016 von 84 % auf 34 % (The Economist, 4 Nov 2017). Ebenso ging der Anteil derer, die täglich beten, zurück, bei den über 55-Jährigen von 90 % auf unter 80 %, bei den 19–24-Jährigen von 70 % auf unter 40 %. Im Libanon und in Marokko halbierte sich von 2011 bis 2016 die Zahl derjenigen, die täglich Koranrezitationen hören (ebd.).
Auch in Ostasien laufen Prozesse der Säkularisierung ab. Ian Reader (2012: 36) kommt aufgrund einer umfassenden Sichtung verfügbarer Religiositätsindikatoren zu dem Ergebnis, dass in Japan nichts weniger als eine »rush hour away from the gods« stattfinde. Japan sei eine Gesellschaft, »in which ›religion‹ in terms of faith and adherence appears to be not just on the wane but highly unpopular«. In Südkorea, wo das religiöse und kirchliche Wachstum über Jahrzehnte hinweg von Prozessen der Demokratisierung und Wohlstandsanhebung begleitet war, hat sich der religiöse Aufschwung inzwischen in einen Rückgang verkehrt (Pollack/Rosta 2022: 449 ff.).
In einer großangelegten Studie über die religiösen Trends in 103 Ländern kommt Louisa Roberts (2023) zu dem Ergebnis, dass sich Säkularisierungsprozesse weltweit nachweisen lassen, nicht nur in den Ländern des Westens, sondern auch in Lateinamerika, in Teilen Ostmitteleuropas und seit kurzem auch im Mittleren Osten und Nordafrika. Die von ihr verwendeten Daten sprechen auch für religiöse Rückgänge etwa in Ruanda, Ghana, Pakistan, Bangladesch, Thailand, Malaysia, Singapur, den Philippinen, Südkorea, Hong Kong, Taiwan und Japan (Roberts 2023: 661). Dennoch hält sie die empirische Evidenz nicht für ausreichend, um einen generellen Abwärtstrend in Afrika und Asien zu konstatieren (ebd.: 648). Den Daten des World Value Surveys (WVS 1981–2020) zufolge bleiben die Religiositätsindizes im subsaharischen Afrika auf einem hohen Niveau weitgehend stabil.
Viele der hier aufgezeigten Trends sind in der quantitativ arbeitenden Religionssoziologie seit langem bekannt. Obwohl sie sich in den letzten 10–15 Jahren noch einmal verstärkt haben, sind Kritiker der Säkularisierungstheorie oft aber nach wie vor nicht bereit, von ihren Positionen abzurücken. Exemplarisch zeigte sich das jüngst in den aufgebrachten Reaktionen auf die ernüchternden Ergebnisse der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung – einer von der Evangelischen Kirche in Deutschland verantworteten Studie, die seit fünf Jahrzehnten im Zehnjahresabstand regelmäßig durchgeführt wird und deren letzte Welle den dramatischen Rückgang der religiösen und kirchlichen Bindungen bestätigte. Manche Kritiker der Säkularisierungstheorie weigern sich schlichtweg, die empirischen Daten zur Kenntnis zu nehmen. Befragt nach seinem Umgang mit empirischen Daten, die die infrage gestellten religiösen Rückgänge belegen, erklärte zum Beispiel Charles Taylor (2018: 18), die religiöse Welt sei so komplex, dass sie sich nicht mit Statistiken abbilden ließe; das Leben sei »viel zu groß und chaotisch für die Statistik«. Und Hans Joas (2017b) gab auf die Frage, warum sich die Kirchen am Sonntag immer mehr leerten, zur Antwort, dort, wo er in die Kirche gehe, sei diese »nie leer«. Wie ein Blick auf die Arbeiten von Thomas Luckmann, Friedrich Wilhelm Graf, Peter L. Berger, Grace Davie, Ulrich Beck oder auch Talal Asad zeigt, pflegten die Kritiker der Säkularisierungstheorie schon seit langem ein eher lockeres Verhältnis zur Empirie und etablierten eine Art armchair sociology, die zwar in der Lage ist, interessante Thesen aufzustellen, aber wenig Bedarf dafür sieht, diese durch den systematischen Bezug auf empirische Daten auch zu testen.
Pauschale Zurückweisungen der Säkularisierungstheorie ohne empirische Evidenz lassen sich bis in die jüngste Zeit finden (Edwards 2019; Knoblauch 2022; Schlette/Hollstein/Jung/Knöbl 2022). Charakteristisch für die Kritik an der Säkularisierungstheorie ist auch die selektive Verwendung von solchen Ergebnissen der empirischen Analyse, die der Säkularisierungstheorie widersprechen. International zeichnet sich die Tendenz ab, auf die unübersehbaren und immer wieder aufgewiesenen Abbrüche in den religiösen Bindungen durch eine Aufweichung und Preisgabe des Religionsbegriffs und den Verzicht auf definitorische Vorannahmen zu reagieren. Unter dem Label ›Lived Religion‹ wird nicht mehr mithilfe religionssoziologischer Kategorien nach Religiosität gefragt, sondern danach, was den Menschen persönlich wichtig ist. Es ist dann den Interviewten selbst überlassen, ob sie dabei auch auf Religion zu sprechen kommen (Ammerman 2007, 2016; Hall 1997; McGuire 2008, Knibbe/Kupari 2020). Mit seinem unbestimmten Religionsverständnis und seiner Konzentration auf das Selbstverständnis des Individuums schließt das Konzept der ›Lived Religion‹ sowohl in methodologischer als auch inhaltlicher Hinsicht an Kernelemente der Individualisierungsthese an.
Über drei Jahrzehnte haben sich die Kritiker der Säkularisierungstheorie in ihren revisionistischen Argumentationsmustern bequem eingerichtet, ohne die verfügbaren empirischen Daten ernsthaft zur Kenntnis zu nehmen. Die Säkularisierungskritik, die sich die Dekonstruktion der modernisierungstheoretischen Großerzählung des Säkularisierungstheorems auf die Fahnen geschrieben hatte, wurde selbst zu einem Meisternarrativ (so auch Ziemann 2009: 32; Haustein 2011a: 552).5 Die Säkularisierungstheorie, so konnte man hören, sei allenfalls noch als Ausdruck des Selbstverständnisses der Epoche von Bedeutung, deren Entstehung sie sich verdanke. Sie sei ein aus der Aufklärung stammendes eurozentrisches »concept of modernity«, so Callum Brown (2003: 39 f.), ein in den Kulturkämpfen des 19. Jahrhunderts entstandenes grand récit der westlichen Moderne (Borutta 2005: 16; 2010), eine sich den spezifischen Umständen der 1960er Jahre verdankende Meistererzählung (Kippenberg 2007: 50), habe uns inhaltlich aber nichts mehr zu sagen (Asad 2003; Graf 2004: 96 f.; Borutta 2005: 16; 2010: 347; Knöbl 2013: 78 ff., 111). Ihre Infragestellung war zu einer beliebten rhetorischen Übung geworden, und viele bezogen sich auf sie nur noch wie auf einen toten Hund (Stark 1999: 273; Miller/Yamamori 2007: 38; Pfleiderer/Heit 2013).
Teilweise lehnten empirisch und historisch arbeitende Sozial- und Geisteswissenschaftler die Säkularisierungstheorie ausdrücklich ab, obwohl sie im Verlauf ihrer konkreten Arbeit feststellen mussten, dass sie ohne sie nicht auskommen können, wenn sie nicht jede Erklärung schuldig bleiben wollen. So vertrat Hugh McLeod – einer der besten Kenner der modernen Religionsgeschichte in Europa – in seinen Veröffentlichungen aus den 1990er und 2000er Jahren trotz aller verbalen Distanzierungsversuche letztendlich eine säkularisierungstheoretische Position. Er weist zwar zunächst die von der Säkularisierungstheorie aufgestellten Globalthesen über den Zusammenhang von Industrialisierung, Urbanisierung sowie Wohlstandsanhebung und Entkirchlichung zurück und spricht der Säkularisierungstheorie explizit die explanatorische Kraft ab (McLeod 1997; 2007: 16); dann aber macht er doch »the impact of affluence« als den »most important« Faktor der religiösen Krise der 1960er Jahre aus (McLeod 2007: 15). Auch bei Michael Hochgeschwender geht die rhetorische Ablehnung der Modernisierungstheorie mit ihrer Inanspruchnahme einher. Obwohl er behauptet, die Modernisierungstheorie sei normativistisch und anachronistisch (Hochgeschwender 2007: 17), hält er Konzepte wie Modernität, Modernisierung, Moderne für die analytische Erklärung für »unverzichtbar« (ebd.: 258, Anm. 27). Selbst einem so scharfen Kritiker der Säkularisierungstheorie wie Peter van Rooden (2004a: 21) fällt zur Erklärung der in den 1960er Jahren einsetzenden dramatischen Dechristianisierung in den Niederlanden nichts anderes ein, als auf »the sudden growth in wealth and the emergence of a mass consumer society« zu verweisen. Bei aller verbalen Abgrenzung bleibt die neuere Zeitgeschichtsschreibung der Säkularisierungsthese stark verhaftet (vgl. auch Damberg 2011: 30 f.). Die Säkularisierungstheorie ist offenbar so stark diskreditiert, dass viele nicht unter ihrem Label wahrgenommen werden wollen.
Doch was sind die sachlichen Einwände, die die revisionistischen Ansätze gegenüber der Säkularisierungstheorie vorbringen? Worin besteht ihr inhaltlicher Kern? Die Kritik an der Säkularisierungstheorie betrifft einmal die in ihr vorgenommene Entgegensetzung von Religion und Moderne bzw. von Tradition und Moderne und zielt damit auf ihren evolutionären und fortschrittsoptimistischen Charakter, der mit dieser Entgegensetzung impliziert ist. Religion werde nur als traditionale Macht, als eine abhängige Variable, die den weltumgestaltenden Kräften der Moderne passiv ausgeliefert sei, behandelt, nicht aber als eine dynamische Ressource, die selbst in der Lage sei, Prozesse der Modernisierung, der Individualisierung und Selbstermächtigung anzustoßen (Warner 1993; Casanova 1994: 217 ff.; 2001; Graf 2004: 55 ff.; Gabriel 2008b; Beck 2008: 225, 228; Hellemans 2010: 15, 35). Des Weiteren richtet sich die Kritik gegen die Behauptung, dass Modernisierung unweigerlich zur Säkularisierung führe, also gegen den angeblich deterministischen, teleologischen und einlinigen Argumentationsstil der Säkularisierungstheorie (Graf 2004: 11, 26, 70, 104 u.ö.; Gorski/Altinordu 2008: 55, 59 u.ö.; Joas 2012: 23–42). Vor allem aber wird Kritik an der Verwendung eines institutionell verengten Religionsbegriffes geübt (Knoblauch 2002; 2009: 17; Graf 2004; vgl. bereits Luckmann 1960: 320, 325; Matthes 1969: 93). Darüber hinaus lautet ein Einwand, dass die Säkularisierungstheorie die Vergangenheit als golden age of faith idealisiere (Stark/Finke 2000: 63–67; Kippenberg/Stuckrad 2003: 132; Joas 2004: 36 f.).6
Berechtigt an diesen Vorbehalten ist, dass Säkularisierungstheorien in der Tat dazu neigen, die Aktivitätspotentiale religiöser Gemeinschaften und Organisationen auszublenden und Religion lediglich als abhängige Variable zu behandeln. Immer wieder fragen sie lediglich danach, inwieweit sich religiöse Wandlungsprozesse aus Modernisierungsindikatoren wie Urbanisierung, Bildung, Wohlstand, Ungleichheit, Rechtsstaatlichkeit, Religionsfreiheit erklären lassen, aber kaum danach, ob und auf welche Weise religiöse Gemeinschaften ihre Integrationskraft und Attraktivität selbst zu beeinflussen und externe Effekte zu erzielen vermögen. Um der Einsicht in die Handlungsmacht von religiösen Gemeinschaften, Bewegungen und Organisationen sowie ihren politischen Mobilisierungspotentialen Rechnung zu tragen, bedienen sich neuere Ansätze unterschiedlicher Konzepte, etwa dem des Sozialkapitals, mit dem die zwischenmenschliches Vertrauen und soziale Netzwerke stärkenden Effekte von Religion erfasst werden können (Putnam 2000; Pickel/Gladkich 2011; Traunmüller 2009), oder auch dem der politischen Theologie sowie der institutionellen Unabhängigkeit von Religion und Politik (Toft/Philpott/Shah 2011).
Ebenso ist es berechtigt, säkularisierungstheoretisch beeinflusste Untersuchungen dafür zu kritisieren, dass sie sich auf konventionelle Religiositätsvariablen wie Kirchenzugehörigkeit, Kirchgang und Gottesglauben konzentrieren. Dies sind häufig die Standardindikatoren für Religiosität. In den letzten Jahren hat sich das Instrumentarium zur empirischen Erfassung von religiösen Bindungen jedoch beträchtlich erweitert. In der deutschen Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (Allbus) wird seit zwei Jahrzehnten außerkirchliche Religiosität durch eine Vielzahl von Variablen erhoben, zu denen Theosophie, Magie, Spiritismus, Okkultismus, Pendeln ebenso gehört wie Edelsteinmedizin, Astrologie, Tai Chi, Qi Gong oder Ayurveda. Auch in internationalen Surveys finden Formen nichtchristlicher Religiosität immer stärker Berücksichtigung (vgl. zum Beispiel ISSP 1991, 1998, 2008, 2018).
Nicht gerechtfertigt ist die Kritik, wenn der Säkularisierungstheorie und ihren empirischen Anwendungen ein deterministischer Bias unterstellt wird. Die säkularisierungstheoretisch beeinflussten statistischen Untersuchungen können, auch bei Einbeziehung einer Vielzahl von Faktoren, stets nur eine begrenzte Varianz der zu erklärenden Variablen aufklären und sind sich der Grenzen ihrer Erklärungskraft vollständig bewusst, ja können den Grad der aufgeklärten Varianz sogar berechnen. Sie treffen Wahrscheinlichkeitsaussagen und verzichten auf jeden Determinismus (Norris/Inglehart 2004: 16; vgl. bereits Wallis/Bruce 1992: 27).
Ebenso lässt sich die Gültigkeit der Säkularisierungstheorie nicht außer Kraft setzen, indem man ihr Aufkommen auf sie begünstigende Kontexte zurückführt. Geltungsgrund und Entstehungsgrund sind zu unterscheiden. Selbst wenn die Säkularisierungstheorie ein aus der Aufklärung stammendes Konzept sein sollte, was sie nicht ist, oder aus den Kulturkämpfen des 19. Jahrhunderts hervorgegangen sein sollte, was ihre Geschichte eher trifft, besagt das noch nichts über die Gültigkeit ihrer Annahmen. Falsifizieren lassen sich diese nur anhand des Gegenstandes, auf den sie sich beziehen, also nur auf der Grundlage empirisch zu rekonstruierender Fakten. Es ist die empirisch fundierte Aufhellung der sozialen Gestalt von Religion und ihres Wandels, um die es gehen muss. Daran entscheidet sich, inwieweit die Aussagen der Säkularisierungstheorie aufrechterhalten werden können oder nicht.
Die empirische Basierung soziologischer Aussagen ist freilich weitaus voraussetzungsvoller als so manch einer meint, der sich sozialwissenschaftlicher Daten bedient. Zur empirischen Fundierung soziologischer Aussagen reicht es keineswegs aus, gelegentlich empirische Forschungsergebnisse heranzuziehen, um mit deren Hilfe eine These zu stützen oder zu erschüttern. Ein selektiver Gebrauch empirischer Daten bleibt instrumentalisierbar. Oft dient er lediglich dazu, Behauptungen, die unabhängig von der empirischen Arbeit gewonnen wurden, zu untermauern und gegen Infragestellungen abzuschirmen.7 Säkularisierungstheoretiker etwa lieben es, auf fallende Kirchgangsraten hinzuweisen, um den Bedeutungsrückgang von Religion zu belegen, Kritiker der Säkularisierungstheorie hingegen bevorzugen den Verweis auf das gestiegene Interesse an Esoterik, Spiritualität und Pilgerfahrten als Indizien für den Bedeutungsgewinn von Religion, und beide mögen sich in ihren Deutungen durch die beigebrachten Belege bestätigt sehen. Empirische Evidenz für eine These lässt sich jedoch nicht durch Einzelnachweise erbringen, sondern nur dadurch, dass man die vertretene These auf eine breite empirische Grundlage stellt und abwägt, welche Quellen gegen und welche für sie sprechen. Die Empirie muss die Chance haben, eine aufgestellte These zu Fall zu bringen. Deshalb ist es erforderlich, das in Frage stehende Phänomen in seiner Gesamtheit in Blick zu nehmen und alle seine wesentlichen Merkmale der empirischen Analyse auszusetzen. Sich allein auf Kirchgangsraten oder allein auf Esoterikmessen zu verlassen, wenn es darum geht, Prozesse des religiösen Wandels zu untersuchen, würde auf eine einseitige Verzerrung des Gegenstandsbereichs hinauslaufen. Das heißt, es ist nötig, den Analysen einen umfassenden und trennscharfen Religionsbegriff zugrunde zu legen, der klarstellt, was in den als Religion definierten Bereich fällt und was nicht.
Theoretische Überlegungen sind aber auch deshalb unausweichlich, da sich die Wirklichkeit nicht im Direktzugriff erfassen lässt. Immer sind unsere Beobachtungen standpunktabhängig. Kulturelle Kontextbedingungen, politische Interessen, wissenschaftsstrategische Abgrenzungen drängen sich, ob wir das wollen oder nicht, in den Erkenntnisprozess und beeinflussen ihn mit. Empirisch gewonnene Daten sind mithin nicht als solche aussagekräftig. Bei ihnen handelt es sich stets um hergestellte Fakten und interpretierte Wirklichkeiten, um sinnhafte Rekonstruktionen, die nicht unabhängig von kategorialen und theoretischen Vorannahmen produziert werden können. Schon die Entscheidung darüber, welche Fakten zählen sollen und welche nicht, fällt auf der theoretischen Ebene. Es ist die Theorie, die festlegt, was wir überhaupt beobachten können, sagte Albert Einstein. Theoretische Überlegungen sind daher für die empirische Arbeit nicht nur insofern unumgänglich, als sie den Gegenstand in seinen wesentlichen Merkmalen bestimmen und eingrenzen, sondern auch insofern, als nur sie es erlauben, die richtigen analytischen Fragen zu stellen und herauszuheben, welche Phänomene von Belang sind und welche nicht.8 Sie geben den Rahmen ab, der über die Signifikanz aufgedeckter Fakten und Zusammenhänge entscheidet. Nur allzu oft gehen Empiriker jedoch von Fragen aus, die ihnen die verfügbaren Daten zu beantworten erlauben, und legen sich die theoretischen Annahmen so zurecht, dass sie durch die verfügbaren Daten bestätigt oder widerlegt werden können. In der Forschung von theoretischen Annahmen auszugehen und diese empirisch zu überprüfen, ist völlig legitim und letztendlich unausweichlich. Eine solche Methode untersucht, welche Effekte theoretisch unterstellte Ursachen empirisch nachweisbar haben. Ergänzt werden muss ein solches Vorgehen jedoch durch eine Herangehensweise, in der zwar Wirkungen bekannt sind, nicht aber die sie bedingenden Ursachen. Der Suche nach effects of causes muss die Suche nach causes of effects an die Seite gestellt werden (Goertz/Mahoney 2012).9 Nur dann lassen sich theoretisch nicht bedachte Einsichten generieren. Selbstverständlich schließt auch ein pragmatischer Umgang mit Theorieannahmen die Gewinnung interessanter und relevanter Forschungsergebnisse nicht aus. Die Wahrscheinlichkeit, zu überraschenden Erkenntnissen zu kommen, steigt allerdings, wenn die empirische Analyse der Theorie nicht einfach folgt, sondern von ihr strenger unterschieden ist und so die Chance hat, sich nicht nur von ihr anleiten zu lassen, sondern sie auch zu stimulieren, zu korrigieren und zu erweitern. Deswegen werden wir in unserer Untersuchung viele empirisch gearbeitete Einzelfallanalysen vorlegen, die es erlauben, sowohl nach effects of causes als auch nach causes of effects zu fragen.
Die hier vorgelegten Studien verzichten weitgehend auf die Einbeziehung qualitativer Forschungsergebnisse. Die qualitative Religionsforschung tritt mit dem Anspruch auf, genau diese in quantitativen Analysen oft vermissten innovativen Erkenntnisse zu liefern. In einem ergebnisoffenen Forschungsprozess erkunde sie, so wird behauptet, das religiöse Feld, ohne durch standardisierte Methoden bereits auf Hypothesen und erwartbare Ergebnisse festgelegt zu sein. Gewiss ist die Verknüpfung quantitativer und qualitativer Methoden der Königsweg einer religionssoziologischen Analyse. Wenn es wie hier allerdings darum geht, Prozesse des religiösen Wandels zu rekonstruieren und internationale Vergleiche anzustellen, dann bedarf es der Benutzung standardisierter Verfahren. Nur wenn die Maßstäbe des Vergleichs, handele es sich nun um zeitliche oder regionale Vergleiche, konstant gehalten werden, können historische Veränderungen und regionale Unterschiede erfasst werden. Die Erkenntnis von Varianz setzt einen einheitlichen Maßstab voraus. Soll zum Beispiel der Wandel des Gottesglaubens abgebildet werden, muss seine Ausprägung zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit exakt gleichlautenden Fragen gemessen werden. Zudem ist es erforderlich, die mit Hilfe quantitativer Methoden gewonnenen Erkenntnisse ebenso sinnverstehend zu interpretieren wie diejenigen, die auf qualitativen Zugängen beruhen. Auch die quantitativ ansetzenden Analysen können sich nicht mit bloßen Häufigkeitsauszählungen und dem Aufweis statistischer Korrelationen begnügen. Auch ihnen kommt es darauf an, die hinter den Häufigkeitsverteilungen und statistisch nachweisbaren Zusammenhängen liegenden Sinnmuster zu erhellen, die Weltinterpretationen der Akteure und ihre Eigenperspektiven, ihre Weltdeutungsschemata und Diskursuniversen. Die Rekonstruktion der Bedeutungsebene des Sozialen ist unverzichtbar, sowohl für die qualitativen als auch für die quantitativen Ansätze. Quantitativ vorgehende Untersuchungen sind zur Rekonstruktion dieser Sinnwelten durchaus fähig, denn in Bevölkerungsumfragen werden auch Fragen zu den Haltungen, Einstellungen, Wahrnehmungen und Deutungen der Befragten gestellt. Dabei sind sie in der Lage, repräsentative und verallgemeinerbare Ergebnisse zu erzielen, die Weltinterpretationen und Selbstbilder der Akteure auf die sie prägenden sozialstrukturellen, politischen, ökonomischen und rechtlichen Kontextbedingungen zu beziehen und auf diese Weise die Ebene der denkenden, fühlenden und handelnden Individuen und die der Gesellschaft miteinander zu verklammern.
Ebenso wenig wie der qualitativen Methode folgen die hier vorgelegten Studien dem modischen Interesse an Entdifferenzierungsphänomenen, Entgrenzungen, Hybriden, Ambivalenzen, Paradoxien, Ungleichzeitigkeiten und Synkretismen. Das poststrukturalistische Denken bestreitet die Möglichkeit, Regelmäßigkeiten und Muster erkennen zu können und behauptet stattdessen die Inkommensurabilität des Wirklichen. Es löst das Wirkliche in Diskurse über die Wirklichkeit auf, Strukturen in Praktiken und allgemeingültige Aussagen in die Kontingenz des einzelnen Falls. Ihm geht es um die Destruktion bisher erworbenen Wissens, nicht um die Gewinnung neuer Erkenntnis. Wo bislang Grenzen und Zäsuren wahrgenommen wurden, da werden nun Kontinuitäten behauptet; wo man bisher von Einheiten ausging, da entdeckt man interne Differenzen und Brüche. In dem Versuch, erreichte Einsichten zu Fall zu bringen und durch Umkehrung zu überbieten, lagert das poststrukturalistische Denken sich parasitär an diese an, bleibt aber vage und unterbestimmt in dem, was es stattdessen zu sagen hat. Während brave Wissenschaftler froh sind, wenn es ihnen gelingt, eine schmale Lichtung in das Dickicht der Wirklichkeit zu schlagen, bezieht der postmoderne Denker Befriedigung vor allem daraus, die Lichtung wieder einzureißen und erneut ins Zwielicht zu tauchen. Die postmoderne Begeisterung für unscharfe Grenzen kann distinkte Begrifflichkeiten jedoch nicht ersetzen. Vielmehr werden Unschärfen, Grenzverwischungen, Entdifferenzierungen, fließende Übergänge als solche überhaupt erst sichtbar, wenn man die Grenzen bestimmt, die angeblich überschritten oder zum Verschwinden gebracht werden. »Wir brauchen allgemeine Begriffe«, erklärt Friedrich Wilhelm Graf (2004: 237), um ein soziales Feld »von anderen Feldern abgrenzen zu können. […] Das kulturell Besondere oder Individuelle [ist] nur dann zu beschreiben, wenn uns allgemeinere Begriffe zur Verfügung stehen, mit denen sich die spezifische Differenz dieses Besonderen erfassen lässt.« Selbst die Überschreitung der Struktur bedarf der Struktur, um als solche überhaupt erkennbar zu sein.
Gleichfalls sehen die hier versammelten Studien davon ab, Religionssoziologie unter den Gesichtspunkten der Globalgeschichte zu betreiben. Das Recht des globalgeschichtlichen Ansatzes soll nicht bestritten sein. Es besteht kein Zweifel daran, dass Europa nicht zum Maßstab der Analyse gemacht werden darf. Gerade im Hinblick auf Prozesse des religiösen Wandels muss der Horizont Europas überschritten werden, denn wenn die Säkularisierungstheorie anhand des europäischen Falls entwickelt worden ist, dann ist es für eine kritische Prüfung ihrer Aussagen unausweichlich, sich auch mit der außereuropäischen Welt zu beschäftigen. Insbesondere die USA stechen hier als Präzedenzfall ins Auge und sind als religiös hochvitales und als gleichzeitig wirtschaftlich weit entwickeltes Land besonders geeignet, die Untersuchung des Verhältnisses von Religion und Moderne voranzutreiben.
Die europäische Perspektive zu überschreiten kann aber nicht darauf hinauslaufen, Europa nur noch aus einem externen Blickwinkel zu beobachten und zum Ausnahmefall zu erklären (Davie 2002), denn das hieße, anstelle des europäischen einfach nur einen neuen normativen Maßstab der Beurteilung zu wählen und nun diesen zentral zu setzen (vgl. Torpey 2010: 154). Die postkoloniale Polemik gegen die Dominanz des Westens bestreitet in kritischer Absetzung von der Modernisierungstheorie zwar, dass der Westen das Subjekt der Geschichte sei; doch selbst »das Projekt der Provinzialisierung Europas«, wie es Chakrabarty (2002: 308 f.) und andere Vertreter postkolonialer Ansätze verfolgen, kann die Moderne nicht einfach zurückweisen, sondern muss »in sich selbst seine eigene Unmöglichkeit erkennen«, denn auch die Kritik an der Zentralstellung Europas ist, wie Chakrabarty (ebd.: 308) einräumt, »nicht unabhängig von jener Globalität, die durch die europäische Moderne geschaffen wurde«. Auch die Globalgeschichte, die das westliche Narrativ der Moderne durch den Aufweis der Abhängigkeit des Westens von anderen Teilen der Welt überwinden will, kommt immer wieder auf Europa zurück – und sei es via negativa, indem sie die europäische Kolonialherrschaft als den primären Sündenfall des Westens thematisiert (Richter 2013b). Europa war eben auch für die außereuropäischen Regionen, insbesondere im langen 19. Jahrhundert, ein wichtiger Player, von dem sich nicht absehen lässt. Es wäre, schreibt Jürgen Osterhammel (2009: 20), ein »Ausdruck kapriziöser Willkür, eine Geschichte ausgerechnet des 19. Jahrhunderts zu entwerfen, die von der Zentralität Europas absähe. Kein anderes Jahrhundert war in einem auch nur annähernden Maße eine Epoche Europas«, und das nicht nur, weil in dieser Zeit »die westliche Halbinsel Eurasiens derart große Teile des Globus beherrscht und ausgebeutet« hat, sondern auch weil »die europäische Kultur – weit jenseits der Sphäre kolonialen Zugriffs – dermaßen begierig aufgenommen« wurde. So überrascht es nicht, dass auch in den Augen der Globalgeschichtler die »Königsfrage der Weltgeschichtsschreibung« nach wie vor die nach dem Sonderweg Europas ist (Conrad 2013: 163).
Wenn aber die historischen Argumentationen im globalisierungstheoretischen Diskurs immer wieder auf Europa verweisen, dann ist man gut beraten, die Abwertung der Bedeutung Europas nicht zur Voraussetzung der Beschäftigung mit Europa zu machen. Zwischen einem normativen und einem heuristischen Eurozentrismus ist vielmehr zu unterscheiden. Der erste erhebt Europa, und insbesondere Westeuropa, zum wertenden Beurteilungskriterium der Untersuchung, der zweite benutzt Europa, um im Vergleich mit anderen Regionen etwas über die jeweiligen Spezifika Europas und der anderen Regionen herauszufinden. In unseren hier vorgelegten Analysen beschäftigen wir uns daher zunächst einmal mit Westeuropa sowie aus Vergleichsgründen auch mit den USA, deren politische, rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen in vielerlei Hinsicht denen in Westeuropa ähneln. Auch wenn der Vergleich westeuropäischer Länder untereinander und mit den USA den Kern unserer Analysen bildet, gehen wir dann aber auch darüber hinaus, indem wir äußerst unterschiedliche Fälle, wie etwa Länder Osteuropas, Südkorea und Brasilien, einbeziehen.10
Der Argumentationsgang unserer Untersuchung folgt einer systematischen Logik, auch wenn wir gleichzeitig jede Überdetermination vermeiden wollen. Nach der Diskussion der beiden für die Untersuchung zentralen Begriffe – Religion und Moderne – stellen wir die prominentesten Theorieangebote vor, die sich mit dem Verhältnis von Religion und Moderne beschäftigen, um auf der Grundlage dieser Auseinandersetzung die leitenden Fragen der Untersuchung formulieren zu können. Auf den theoretischen folgt der empirische Teil, der den größten Teil des Buches einnimmt. Am Anfang des empirischen Teils stehen die Analysen zum religiösen Wandel in West- und Osteuropa. Aus Gründen des Vergleichs folgen darauf Einzelanalysen zu ausgewählten außereuropäischen Fällen (USA, Südkorea) sowie die Untersuchung der globalen Ausbreitung des Evangelikalismus und der Pfingstbewegung – nicht nur in Europa und den USA, sondern auch in Brasilien. Anhand der ausgewählten Fallbeispiele, die auf die Analyse des sozialen, politischen und ökonomischen Kontextes religiöser Veränderungen ebenso Wert legen wie auf die Erfassung der religiösen Eigendynamik und religionshistorischer Pfadabhängigkeiten, sollen Muster sowie Bestimmungsgründe des religiösen Wandels in modernen und sich modernisierenden Gesellschaften identifiziert werden.
Um die Erkenntnis übergreifender Zusammenhänge und Regelmäßigkeiten voranzutreiben, verlassen wir daraufhin die Ebene der Einzelfallanalyse und schließen weitere moderne und sich modernisierende Staaten in die Untersuchung ein, die unter Aufnahme der zugrunde gelegten theoretischen Modelle und der bereits gewonnenen empirischen Einsichten einer systematischen Untersuchung sowohl auf der Individual- als auch auf der Makroebene unterzogen werden. Der Bogen der Argumentation wird geschlossen, indem wir am Schluss unseres Buches auf die eingangs angestellten theoretischen Überlegungen zu Religion und Moderne zurückkommen und in einer theoretisch-empirischen Verdichtung den Erkenntnisgewinn festzuhalten versuchen.
Es ist unser ausdrückliches Anliegen, erst nach der Durchführung der empirischen Fallanalysen verallgemeinernde theoretische Schlussfolgerungen zu ziehen. Nachdem die Argumentation von theoretisch abgeleiteten Fragestellungen ihren Ausgang genommen hat und durch die empirische Detailanalyse hindurchgegangen ist, geht es abschließend darum, die bestimmenden Faktoren und übergreifenden Muster aufzuzeigen, die hinter den beobachteten religiösen Veränderungen liegen. So soll gesichert werden, dass empirische Beobachtungen die theoretischen Einsichten steuern und nicht umgekehrt diese jene.
Ein solches induktives Vorgehen wird wohl kaum zu einem allumfassenden und kohärenten Modell des religiösen Wandels in modernen Gesellschaften führen. Das Ziel unserer Analyse besteht denn auch nicht in dem Entwurf eines geschlossenen Modells. Vielmehr wollen wir eine empirisch fundierte, multi-paradigmatische Perspektive einnehmen, welche unterschiedliche theoretische Elemente enthält und es erlaubt, diese zur Erklärung religiöser Veränderungen flexibel miteinander zu kombinieren.
Teil I Theoretische Überlegungen
1.Überlegungen zum Begriff der Moderne
1.1.Der Kern der Modernisierungstheorie
Das Bewusstsein des radikal Neuen gehört unausweichlich zur Moderne. »Nur und erst die Neuzeit hat sich als Epoche verstanden und dadurch die anderen Epochen mitgeschaffen«, sagt Hans Blumenberg (1974: 135). Natürlich steht der Anspruch, einen radikalen Bruch mit der Tradition zu vollziehen, in einem Missverhältnis zur Realität der Geschichte, die nie von Grund auf neu anfangen kann. Gleichwohl ist die Moderne ohne diesen Anspruch nicht vorstellbar. Ob wir an Kant (1911, AA III: 12) denken, der in der Vorrede zur zweiten Ausgabe der »Kritik der reinen Vernunft« seinen transzendentalphilosophischen Ansatz mit der kopernikanischen Wende vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild vergleicht, oder an Hegel (1981: 318, § 273), der als Prinzip »der neuern Welt« »die Freiheit der Subjektivität« definiert und »den Standpunkt der modernen Welt« in Kontrast setzt zu den traditionellen Gesellschaften Asiens, die im Substantiellen oder Statarischen verharrten (Hegel 1939: 46, 158, 163, 169; 1981: 162, § 136) – immer setzt sich das moderne Denken in scharfen Kontrast zu allem Vorhergehenden. Es feiert sich als epochalen Durchbruch zur Vernunft, vor deren Forum sich jede Überlieferung und jede Autorität, selbst die Heilige Schrift, zu verantworten hat, verkündet die ins Unendliche gehende praktische Verbesserbarkeit der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse und stellt anstelle einer göttlich begründeten Weltordnung die menschlichen Interessen und Bedürfnisse in den Mittelpunkt, auf die sich die sozialen Zustände immer neu auszurichten hätten.
Es verwundert nicht, dass diese auf Abgrenzung von allem Vorangegangenen, bloß Traditionalen und Autoritativen bedachte Fortschrittskonzeption schon bald ihre radikale Umkehrung erfährt. Bereits Nietzsche entdeckt die machttheoretischen Implikationen der Subjekt/Objekt-Dialektik der Aufklärung und entlarvt das neuzeitliche Prinzip der subjektiven Freiheit als eine Form des Machtwillens, deren sich das moderne Subjekt bedient. Macht ist für Nietzsche nicht mehr die irrationale Gegeninstanz zur Vernunft, sondern im Wesen der Vernunft selbst verankert (Schelkshorn 2009: 18 f.). Heidegger, Horkheimer und Adorno folgen ihm darin und entdecken im übermächtigenden Erkenntnisstreben des Subjekts gleichfalls den Keim von Unterdrückung, Verdinglichung und Entsubjektivierung. Mit seinen Analysen zur Disziplinargesellschaft und zur Biomacht zieht in jüngerer Zeit Michel Foucault die machttheoretischen Implikationen der Modernetheorie weiter aus. Gerade die bloße Umkehrung des neuzeitlichen Subjektivitätsprinzips führt aber über den aufklärerischen Fortschrittsoptimismus nicht hinaus, denn sie bleibt dem aufklärerischen Pathos der Kritik und damit einer normativen Perspektive verhaftet (Richter 2013a; Reschke 2004). Da die machttheoretischen Konzeptionen der Moderne die Vernunft selbst als die entsubjektivierende Zerstörungsmacht begreifen, kann der Ausweg aus der Katastrophe, auf die die moderne Gesellschaft unausweichlich zusteuere, allerdings nur noch in einer unkonkret bleibenden Gegenutopie gefunden werden, in Formeln wie »Verwindung der Metaphysik« (Heidegger), »Mimesis« (Horkheimer, Adorno) oder »Ästhetik der Existenz« (Foucault). Obschon die Bewertung gegensätzlich ausfällt, bemüht sich unter dem Eindruck tiefgreifender soziohistorischer Veränderungen sowohl der aufklärerische als auch der gegenaufklärerische Diskurs darum, den Ort der Moderne zu bestimmen. Ob dabei die Realisierung der Freiheit von der Moderne selbst oder von ihrem Anderen erwartet wird, in beiden Fällen entspringt das einzigartige Epochenbewusstsein der Moderne offenbar dem aus dem umfassenden Umbruch der Verhältnisse resultierenden Bedürfnis nach Selbstvergewisserung (Schelkshorn 2012: 218).
Im Unterschied zu den philosophischen Standortbestimmungen zeichnen sich die soziologischen Überlegungen zur Moderne, auch wenn es ihnen gleichfalls um eine Bestimmung des Ortes der Moderne angesichts radikaler sozialer, politischer und ökonomischer Veränderungen geht, durch ein höheres Maß an Nüchternheit aus. Sie gedeihen zwar auf dem Boden des aufklärerischen Fortschrittsdenkens, verlassen diesen Boden aber auch. Wie dieses sind sie nicht selten normativ grundiert. Zugleich verzichten sie partiell darauf, die Moderne in ihrer Eigenart zum Maßstab der Kritik zu machen. Durkheim (1992) etwa beurteilt die moderne arbeitsteilige Gesellschaft auf der einen Seite als komplexer und leistungsfähiger als traditionale Gesellschaften, sieht andererseits aber auch die Bedrohung der modernen Gesellschaft durch anomische Tendenzen. Max Weber (1920: 1) wiederum schreibt den Kulturerscheinungen des Okzidents zwar eine Entwicklungsrichtung von universeller Bedeutung zu, räumt aber gleichzeitig ein, dass es sich dabei um eine beliebte Imagination des westeuropäischen Kulturbürgers selbst handelt. Und Parsons (1971: 56, 62 ff.), der evolutionäre Universalien wie Bürokratie, Marktorganisation, universalistische Normen und demokratische Assoziation als unabdingbare Bedingung für gesteigerte Anpassungsfähigkeit und Höherentwicklung definiert, schließt die Überlebensfähigkeit von Systemen auf niedrigerer Evolutionsstufe nicht aus.
Ebenso stimmen die soziologischen Modernekonzeptionen mit den Diskursen der Aufklärung in ihrer scharfen Kontrastierung von Vormoderne und Moderne überein. Sowohl Spencer (1887) mit seiner Unterscheidung zwischen militärischer und industrieller Gesellschaft als auch Durkheim (1981), der die arbeitsteilige moderne Gesellschaft klar von der segmentär differenzierten Gesellschaft abhebt, als auch Weber (1920), der die moderne Welt des Okzidents durch Prozesse der Rationalisierung charakterisiert sieht, als auch Luhmann (1997), der mit dem Umbau der primären Differenzierungsform von Stratifikation auf funktionale Differenzierung die Herausbildung der modernen Gesellschaft identifiziert, unterscheiden deutlich zwischen Tradition und Moderne. Gleichwohl markieren sie aber auch Übergänge zwischen beiden Epochen, so wenn Durkheim in seinem Spätwerk den Fortbestand religiöser Praktiken in der Moderne herausstellt oder Weber nach den protestantischen Wurzeln der kapitalistischen Wirtschaftsgesinnung sucht.
Anders als die aufklärerischen und idealistischen Diskurse entdecken die soziologischen Entwürfe die Spezifik der Moderne allerdings nicht mehr in einem einzigen Prinzip, etwa dem der freiheitlichen Subjektivität, das seinen Grundlagencharakter ohnehin nur aus seiner gesellschaftsfreien Konzipierung gewinnt, und fühlen sich daher auch nicht mehr herausgefordert, die Entlarvung dieses Prinzips zu betreiben. Vielmehr machen sie eine Vielzahl von Merkmalen aus, mit deren Hilfe sie moderne Gesellschaften charakterisieren und von denen keines die Bedeutung einer Letztbegründung besitzt. Tocqueville, der geniale Analytiker der politischen Macht, gibt den Ton vor. Überwältigt von der Einsicht in den unaufhaltsamen Siegeszug der Demokratie in Amerika und in Europa begreift er nicht nur, dass damit der Wert der Abkunft immer mehr sinkt. Er sieht auch, dass parallel zum Niedergang von Königtum und Adel und der Ausbreitung der Gleichheit zwischen den Menschen der Handel eine neue Quelle der Macht wird, dass Eigentum erwerbende Bürger und Finanzleute zu politischen Größen aufsteigen, dass mit der Ausbreitung der Geisteserziehung Wissenschaft und Bildung zu einem Mittel des Erfolgs werden, dass das Wohl des Staates und der Gesellschaft untrennbar mit der Gewährung politischer Rechte für alle Staatsbürger verknüpft ist und dass die Demokratie der aufrichtigen und tiefen Achtung des Gesetzes bedarf (Tocqueville 1976 [1835/40]: 6 f., 272 f.). In der ganzen christlichen Welt vollziehe sich »die gleiche Umwälzung« – eine Umwälzung, die dazu geführt habe, dass »die gesellschaftlichen Bedingungen der christlichen Völker sich heute mehr gleichen als irgendwann und irgendwo auf der Welt« (ebd.: 8).
So wie Tocqueville nehmen auch die Vertreter der Modernisierungstheorie an, dass die Moderne durch einen Satz miteinander zusammenhängender Eigenschaften charakterisiert sei. Daniel Lerner (1968: 387) sieht als »salient characteristics of modernity« fünf Merkmale an: ein sich selbst tragendes Wirtschaftswachstum, ein demokratisches Repräsentativsystem, die Verbreitung säkular-rationaler Normen, zunehmende Mobilität und die Ausprägung von empathischer Fremd- und individualistischer Selbstwahrnehmung. Anthony Giddens (1996: 75 ff.) – um einen neueren Entwurf der Modernisierungstheorie zu zitieren – hält Kapitalismus, Industrialisierung, Nationalstaat und das Machtmonopol des Staates für integrale Bestandteile der Moderne. Für Wolfgang Zapf (1991: 34) machen Konkurrenzdemokratie, Marktwirtschaft und Wohlstandsgesellschaft mit Massenkonsum und Wohlfahrtsstaat ihre Merkmale aus. Wie auch immer die Bestimmung der notwendigen Elemente der Struktur moderner Gesellschaften ausfällt, die Diagnose der Modernisierungstheoretiker lautet, dass die einzelnen Elemente nicht unabhängig voneinander auftreten können, sondern einen intrikaten Verflechtungszusammenhang bilden. Die Behauptung eines nicht-zufälligen Zusammenhangs von wirtschaftlichen, politischen, rechtlichen, kulturellen Veränderungen, wie zum Beispiel Wohlstandsanhebung, Demokratisierung, Menschenrechtsgarantie und Individualisierung, stellt den Kern der Modernisierungstheorie dar. Dieser Kern enthält in der Regel drei Implikationen. Mit der Qualifizierung eines solchen Systems interdependenter Variablen als spezifisch modern nehmen Modernisierungstheorien erstens eine Abgrenzung von der Tradition vor, zweitens vollziehen sie damit innerhalb der Gegenwart eine Unterscheidung von modernen und nichtmodernen Gesellschaften. Darüber hinaus ist mit der Identifikation eines interdependenten Variablensystems zumeist die These verbunden, dass sich dieses Variablensystem immer mehr durchsetzt und es zu einer zunehmenden Angleichung der Differenzen zwischen moderneren und weniger modernen Gesellschaften kommt.
Wenn es uns in diesem Buch darum geht, religiöse Veränderungen in der Moderne zu erfassen und zu erklären, dann müssen wir uns also auch mit der Frage beschäftigen, wie eng der religiöse Wandel mit Prozessen der Modernisierung verquickt ist. Wir wollen diese Frage allerdings von vornherein in zwei Richtungen öffnen. Zum einen unterstellen wir nicht, dass Modernisierung zwangsläufig einen negativen Effekt auf die Bedeutung von Religion in der Gesellschaft hat und automatisch zu Säkularisierung führt. Die Wirkungen der Modernisierung auf das religiöse Feld können auch positive sein. Zum anderen gehen wir nicht davon aus, dass die Rolle der Religion in modernen Gesellschaften allein von Prozessen der Modernisierung beeinflusst wird. Vielmehr können natürlich auch andere Faktoren, etwa politische Konflikte, Nationalgefühle, Migrationsbewegungen oder charismatische Führer, einen Einfluss ausüben. Um die Effekte abschätzen zu können, müssen wir allerdings genauer bestimmen, was wir unter modernen Gesellschaften verstehen. Der Entwurf eines Begriffes der Moderne ist unausweichlich, wenn wir in der Lage sein wollen, die religiösen Veränderungen modernisierungstheoretisch zuzurechnen oder aber auf andere Faktoren zurückzuführen. Modernisierungstheorien sind in der neueren sozialwissenschaftlichen und historischen Forschung allerdings alles andere als unumstritten. Bevor wir einen eigenen Versuch des Entwurfs einer Theorie der Moderne vorlegen, ist es daher geraten, auf die wichtigsten Vorbehalte gegenüber diesem klassischen Ansatz der Soziologie einzugehen und ihre Berechtigung zu diskutieren.
1.2.Diskussion einiger Einwände gegenüber der Modernisierungstheorie
1) Ein erster Einwand bezieht sich auf den makrosoziologischen Charakter der Modernisierungstheorie. Schon Clifford Geertz (1987: 30) – einer der frühen Kritiker der Modernisierungstheorie – wandte sich dagegen, in der ethnographischen Analyse mit der Interpretation ganzer Gesellschaften einzusetzen. Auch wenn die ethnographische Analyse die Untersuchung umfassender Zusammenhänge nicht ausschließe, so nähere sich der Ethnologe – anders als der Historiker, Ökonom, Politikwissenschaftler oder Soziologe – den großen Realitäten wie Macht, Legitimität, Modernisierung, Konflikt, Integration und Struktur doch nicht von oben, sondern von unten: mikroskopisch. Nur durch akribische Feldforschung könne man diesen »großen Worten, die uns allen Angst machen«, jene Feinfühligkeit verleihen, die man braucht, wenn man mit ihnen konkret und schöpferisch arbeiten will (ebd.: 31).
Tatsächlich verbleiben Modernisierungstheorien zumeist auf der makrosoziologischen Ebene und begnügen sich damit, makrosoziologische Zusammenhänge, etwa den zwischen Wirtschaftswachstum und Demokratieentwicklung oder den zwischen Nationsbildung und Bürokratisierung, aufzuzeigen, ohne die Frage aufzuwerfen, wie sich ein solcher Zusammenhang im Denken, Handeln und Erleben der Individuen darstellt und welche kausalen Mechanismen für die Herstellung dieses Zusammenhangs im Zusammenspiel zwischen makro- und mikrosozialen Faktoren verantwortlich zu machen sind. Um dieses Defizit zu beheben, dürfte es erforderlich sein, unterschiedliche Konstitutionsebenen des Sozialen zu unterscheiden, mit deren Hilfe sowohl die wechselseitigen Bezüge zwischen diesen Ebenen als auch ihre relative Unabhängigkeit voneinander Berücksichtigung finden können (vgl. Luhmann 1975), und der Analyse der Beziehungen zwischen den makrosoziologischen Prozessen und Strukturen eine akteurstheoretische Fundierung zu geben. Dieser Vorschlag läuft nicht darauf hinaus, makrosoziologische Theorien durch mikroskopische Feldforschungen zu ersetzen, sondern darauf, beides zu relationieren, denn natürlich ist die Erfahrungs- und Lebenswelt der Individuen von makrosoziologischen Kontextbedingungen nicht unabhängig.
2) Ein zweiter Einwand ist mit dem ersten eng verwandt und betrifft den hohen Generalisierungsgrad der Modernisierungstheorien. Hier wird Kritik an dem Anspruch der Modernisierungstheorien geübt, verallgemeinerbare Aussagen formulieren zu können, die auf jeden Einzelfall anwendbar sind. Zu Recht wird dagegen eingewandt, dass es immer Ausnahmen von der Regel gebe und generalisierte Aussagen dazu tendierten, die Besonderheit des einzelnen Falles zu negieren. Es liegt in der Logik dieses Arguments, dass Wolfgang Knöbl (2007) seinen Gegenentwurf zur Modernisierungstheorie »Die Kontingenz der Moderne« nennt und vor allem darum bemüht ist, die Unmöglichkeit der Entwicklung von Ansätzen mit hoher Verallgemeinerbarkeit und Reichweite nachzuweisen. So richtig es ist, die historische Besonderheit des einzelnen Falles zu berücksichtigen, so unsinnig wäre es allerdings auch, auf die Erkenntnis von Regelmäßigkeiten und Strukturen zu verzichten. Wenn es solche regelmäßigen Muster in der sozialen Welt nicht gäbe, dann ließen sich auch keine Abweichungen erkennen, ja, dann wäre wissenschaftliche Analyse ausgeschlossen. Nur vor dem Hintergrund von Regelmäßigkeiten und Mustern können wir Abweichungen und Brüche überhaupt ausmachen. Diejenigen, die die Kontingenzen der Moderne aufdecken wollen, bedürfen einer Definition der Struktur der Moderne (Schwinn 2009a: 820). Die Ausarbeitung einer überarbeiteten Modernisierungstheorie muss eine solche Definition folglich zu einer ihrer Prioritäten machen.
3) Der Vorwurf, die Modernisierungstheorie stelle den Prozess der Modernisierung als unausweichlich, irreversibel, einlinig und deterministisch dar (Gorski/ Altinordu 2008), muss ernst genommen werden, denn in vielen Abhandlungen aus den 1950er und 1960er Jahren bestand dazu tatsächlich eine unübersehbare Neigung. Inzwischen aber haben sich neuere modernisierungstheoretische Entwürfe von diesem Notwendigkeitsdenken gelöst. Schon 1992 erklärten zwei jüngere Modernisierungstheoretiker: »Nothing in the social world is irreversible or inevitable« (Wallis/Bruce 1992: 27). Und auch Pippa Norris und Ronald Inglehart (2004: 16), als zwei weitere Vertreter der Modernisierungstheorie, wollen ihre Argumentation in Abgrenzung von mechanistischen Versionen der Modernisierungstheorie als »probabilistic, not deterministic« verstanden wissen.
Die neueren Vertreter der Modernisierungstheorie erkennen die Möglichkeit des Rückfalls hinter einen einmal erreichten Entwicklungsstand also an. Mit Bezug etwa auf den Prozess der Demokratisierung verweisen sie charakteristischerweise auf Beispiele wie Deutschland nach dem Ende der Weimarer Republik, Spanien oder Kambodscha. Ihre Behauptung lautet dabei nicht, dass sich die Moderne zwangsläufig durchsetzt, sondern dass es für ihre Durchsetzung eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, die Rückschläge und Umwege nicht ausschließt: 1906 gab es weltweit etwa acht Demokratien, zu Beginn der 1920er Jahre war in rund 25 Ländern mit allgemeinen, gleichen und freien Wahlen das prozedurale Minimum demokratischer Systeme installiert, 1944 waren es wieder nur noch elf, die diesem Kriterium genügten. Heute ist die Zahl der Demokratien weltweit auf etwa 100 angestiegen.11 Es sind solche Beobachtungen, die die Modernisierungstheoretiker dazu bringen, Wahrscheinlichkeitsaussagen über die Richtung der globalen Demokratieentwicklung und den säkularen Modernisierungstrend zu machen.
Was die Entstehung der Moderne betrifft, so ging die Modernisierungstheorie noch nie von einer unausweichlichen Entwicklung aus. Im Gegenteil. Hier rechnet sie eher mit der hohen Unwahrscheinlichkeit der Emergenz von Modernisierungsprozessen. Schon Max Weber (1920) warf bekanntlich die Frage auf, welche Verkettung von Umständen dazu geführt hat, dass auf dem Boden des Okzidents und nur dort Kulturerscheinungen von universeller Bedeutung aufgetreten sind. Auch andere Modernisierungstheoretiker vertreten die Überzeugung, dass sich die Moderne unter einzigartigen historischen Umständen herausgebildet hat – sie sprechen von Pioniergesellschaften (Bendix 1971) – und fragen nach den besonderen Bedingungen ihres Entstehens (Luhmann 1997: 707). Zwischen der Entstehung der Moderne und ihrer Ausbreitung muss also unterschieden werden. Während es bei der Ausbreitung der Moderne in früheren modernisierungstheoretischen Ansätzen eine gewisse Neigung gab, Unaufhaltsamkeit zu unterstellen, gilt der Durchbruch zur Moderne seit den Anfängen der Modernisierungstheorie als in hohem Maße kontingent und erklärungsbedürftig.
4) Der Vorwurf des Ethnozentrismus – für einen Anthropologen zweifellos das härteste Wort, das er zur Bezeichnung eines moralischen Fehltritts vorzubringen vermag – ist unter allen Kritikpunkten der schwächste. Sofern damit gemeint sein sollte, dass modernisierungstheoretische Kategorien aufgrund ihrer westlichen Herkunft auf außerwestliche Länder nicht anwendbar seien, so ist mit Shalini Randeria (2009), einer Vertreterin einer explizit nicht-westlichen Perspektive, darauf hinzuweisen, dass der Verzicht auf die Benutzung westlicher Kategorien und die Übernahme indigener Begrifflichkeiten wohl nur in begriffstechnische Konfusionen führen kann. Sozialwissenschaftler sollten die Eigenperspektive der Betroffenen in ihren Analysen natürlich nicht übergehen, sich von ihr abhängig zu machen, aber hieße, kontextuelle Gesichtspunkte unterzubelichten und die Möglichkeiten der sozialwissenschaftlichen Analyse einzuschränken.
Sofern mit dem Ethnozentrismus-Vorwurf die Kritik an der Behauptung eines westlichen Überlegenheitsanspruches gemeint sein sollte, so lässt sich dieser leicht entkräften, denn viele Modernisierungstheoretiker – man denke nur an Emile Durkheim, Max Weber oder Georg Simmel, aber auch an Peter L. Berger, Jürgen Habermas oder Richard Sennett – sind sich der dunklen Seiten der Moderne sehr wohl bewusst und stellen in ihren Analysen nicht nur die produktiven, sondern auch die destruktiven Züge der Moderne heraus. In den 1950er Jahren galten die USA vielfach noch als Zielgesellschaft der Modernisierung; diese Position wird inzwischen nicht mehr aufrechterhalten (van der Loo/van Reijen 1992). Die These von der Überlegenheit des Westens findet sich heutzutage denn auch weniger bei westlichen Proponenten der Modernisierungstheorie als bei Repräsentanten nichtwestlicher Gesellschaften (Bayly 2008: 78). In diesen Gesellschaften ist der Wunsch weit verbreitet, an den Leistungen der Moderne zu partizipieren, wovon nicht zuletzt auch die Richtung der internationalen Migrationsströme beredtes Zeugnis ablegt. Selbst dort, wo die westliche Kultur als dekadent, als konsumistisch oder gewalttätig kritisiert wird, schwingt in ihrer Abwehr noch häufig ein Gefühl ihrer Bewunderung mit. Man sollte sich von der um Selbstbehauptung bemühten Depotenzierung der westlichen Moderne, auf die man vor allem bei Intellektuellen außerhalb des Westens immer wieder stößt, nicht täuschen lassen. Insbesondere in den Ländern, die von der westlichen Moderne ausgeschlossen sind, besitzt diese oft selbst unter ihren Kritikern eine hohe Attraktivität. Und wenn Ethnologen, Soziologen und Historiker aus dem europäischen Kulturkreis so großen Wert auf die Vermeidung eurozentrischer Vorurteile und Überlegenheitsansprüche legen, so kann man eine solche Haltung selbst noch als eine Manifestation der typisch modernen Tendenz zur Selbstrelativierung und Selbstkritik lesen.
5) Das Zentrum der Modernisierungstheorie wird mit der Behauptung getroffen, dass sich die in ihr unterstellte Unterscheidung zwischen traditional und modern nicht aufrechterhalten lasse, denn die Annahme von Prozessen der Modernisierung setzt die Behauptung einer Differenz zwischen Vormoderne und Moderne voraus. Bereits in den sechziger Jahren stellte Joseph R. Gusfield (1966) die These auf, dass Tradition und Moderne sich nicht ausschließen würden, zwischen beiden vielmehr ein Verflechtungszusammenhang bestehe und Traditionen vielfach sogar selbst Mittel der Modernisierung darstellten. Die von Marion J. Levy (1952) und anderen behauptete Antithese zwischen askriptiven, partikularistischen und funktional diffusen Normen in traditionalen Gesellschaften und leistungsbezogenen, universalistischen und funktional spezifischen Rollenmustern und Werten in modernen Gesellschaften müsse überwunden werden. Vormoderne Gesellschaften seien nicht statisch, homogen, undifferenziert, sondern flexibel, konfliktreich und differenziert; und moderne Gesellschaften definierten sich nicht einfach aus dem Gegensatz zur Tradition, vielmehr überlebten traditionale Verhaltensweisen, Normen, Werte und Institutionen auf vielfache Weise auch in der Moderne. Die Blaupause des Dualismus zwischen einer homogenen Vormoderne und einer differenzierten Moderne sei, wie Andreas Reckwitz (2008: 227) zu Recht feststellt, die Unterscheidung, die bereits Ferdinand Tönnies zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft zieht. Letztendlich geht sie zurück auf Durkheim mit seiner Differenzierung zwischen mechanischer und organischer Solidarität. Die Unterscheidung von Gemeinschaft und Gesellschaft nimmt Talcott Parsons in seinen pattern variables auf, die dann von den frühen Modernisierungstheoretikern, unter anderem von Marion J. Levy, benutzt wurden, um moderne von traditionalen Gesellschaften abzugrenzen. Dass diese Abgrenzung in die Irre führe, wird bis in die jüngste Zeit hinein behauptet (Eisenstadt 2000b; Joas 2004: 36 ff.; Graf 2005: 239).
Obschon es zweifellos richtig ist, dass die Moderne vielfach traditionale Elemente enthält und die Tradition sogar selbst zu einem Medium der Modernisierung werden kann, ist doch wohl kaum bestreitbar, dass wir in den westlichen Ländern heute in einer Welt leben, die mit der vor – sagen wir – 300 Jahren nicht vergleichbar ist. Wenn wir an den Zugang zu sauberem Wasser, den Schutz vor Naturkatastrophen und Hungersnöten, das Niveau der medizinischen Versorgung, den Ausbau des Rechts- und Sozialstaates, die Gewährung von politischen und bürgerlichen Freiheiten, den Zugang zu Bildungsinstitutionen oder auch an die Verfügung über Konsumgüter und Luxusartikel denken, so ist evident, dass sich die Lebensbedingungen des Menschen in den letzten 300 Jahren radikal transformiert haben. Die Menschen heute, soweit sie der westlichen Hemisphäre angehören, leben in einer Welt des nachhaltigen wirtschaftlichen Wachstums, der politischen Freiheit, der Rechtssicherheit, in der die Würde des Einzelnen geschützt ist. Die Menschen vor 300 oder 500 Jahren lebten – auch wenn ihre Gemeinschaften ihnen einen gewissen Schutz gegen ökonomische Unsicherheit und politische Willkür boten – in einer Welt der ökonomischen Knappheit, der politischen Abhängigkeit und Knechtschaft und der rechtlichen Unsicherheit. Die Idee der Würde des Menschen war noch nicht einmal geboren. Heute sind die Menschen westlicher Gesellschaften von körperlichen Schmerzen weitgehend befreit, vor 300 oder 500 Jahren gehörten Krankheiten, Epidemien, physisches Leiden und Tod zum Alltag. An dieser Stelle neigen die Vertreter der Modernisierungstheorie zur Emphase. Für manche von ihnen ist keine soziale Veränderung so tiefgreifend und weitreichend wie der Umbruch von der Vormoderne zur Moderne, nicht einmal die neolithische Revolution oder die Erfindung der Schrift (Freyer 1967: 81; Berger 2006: 201).