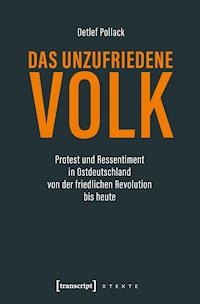12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Jenseits der Empörung. Ein Beitrag zum Verständnis der Gegenwart
Woher kommt das Unbehagen in der modernen Kultur? Warum suchen immer mehr Menschen nach Alternativen zum politischen und ökonomischen System des Westens? Detlef Pollack zeigt, wie die Moderne an ihren eigenen großen Versprechen von Freiheit, Wohlstand und Frieden irre wird, zumal angesichts von Kriegen und Krisen, die zu Verlusten, Wut und Enttäuschung führen. Sein Buch ist ein engagiertes Plädoyer dafür, trotz allem an der Moderne und ihren Erwartungen festzuhalten.
Nach 1789 fragten die Gebildeten in Europa, ob die Französische Revolution, die sie zunächst gefeiert hatten, wirklich Freiheit oder nicht vielmehr Terror, Despotie und Entfremdung gebracht habe. Doch bald schon wurde anerkannt, dass "die Gattung auf keine andere Art hätte Fortschritte machen können" (Schiller). Detlef Pollack zeigt in seiner kurzen Theorie der Moderne in a nutshell, dass der Moderne die Fähigkeit zu Selbstkritik und Selbstkorrektur von Anfang an eingeschrieben ist. Die großen Krisen der Gegenwart – neue militärische Bedrohungen, Klimakrise, Migrationsbewegungen und Rechtspopulismus – untergraben das Vertrauen in Freiheit und Demokratie. Die Sehnsucht nach neuer alter Einfachheit ist groß. Wir sollten ihr widerstehen. Denn die Moderne, so das erhellende Buch, ist mit ihrer Fähigkeit zur Selbstkorrektur noch längst nicht am Ende.
- "Die großen Erwartungen, mit denen die westliche Moderne gestartet ist, lassen sich durch die eingetretenen Enttäuschungen nicht austreiben." Detlef Pollack
- Freiheit, Frieden, Fairness, Wohlstand: Warum wir trotz Krisen und Enttäuschungen an den Versprechen der Moderne festhalten sollten
- Eine scharfsinnige Analyse gegen den Abgesang auf die westliche Demokratie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Detlef Pollack
GROSSE VERSPRECHEN
Die westliche Moderne in Zeiten der globalen Krise
C.H.Beck
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Einleitung
1. Der zeitliche Horizont der Moderne:Steigerung und Selbstbegrenzung
Ein neues Zeitregime
Die Begrenzung des Fortschrittsoptimismus
Reformen, Selbstkorrektur und Lernen
Große Erwartungen und Wirklichkeitsverlust
Ist Wachstum notwendig?
2. Die Sachdimension der Moderne:Autonomie und Abhängigkeit
Die Entkoppelung von Religion und Politik
Die Entflechtung von Politik und Wirtschaft
Die Autonomie von Philosophie, Kunst und Literatur
Semantische Codes als Differenzierungsmarker
Das Zusammenspiel der Teilsysteme
Die irritierte Gesellschaft
3. Die soziale Dimension der Moderne:Inklusion und Individualisierung
Die Auflösung feudaler Abhängigkeitsverhältnisse
Die Inklusion der Bevölkerung in die Gesellschaft
Moderne Wettbewerbsforen
Ebenen des Sozialen
Das Individuum als Maß aller Dinge
Ansprüche und Investments, Enttäuschungen und Ängste
4. Dilemmata der Moderne
Neue militärische Bedrohungen
Die Klimakrise
Rechtspopulismus
Fazit
Dank
Anmerkungen
Einleitung
1. Der zeitliche Horizont der Moderne:Steigerung und Selbstbegrenzung
2. Die Sachdimension der Moderne:Autonomie und Abhängigkeit
3. Die soziale Dimension der Moderne:Inklusion und Individualisierung
4. Dilemmata der Moderne
Fazit
Sachregister
Zum Buch
Vita
Impressum
Einleitung
Die Moderne ist ein Versprechen an die Zukunft, dessen Einlösung mehr und mehr Menschen in Gefahr sehen. Sie befürchten den Klimakollaps, das Ende der Demokratie, den Absturz immer größerer Teile der Bevölkerung in die Armut. Zugleich verfolgen die meisten unverdrossen ihre persönlichen Interessen und arbeiten an einer Verbesserung ihrer individuellen Lebenssituation, als stünde die Welt nicht kurz vor dem Abgrund. Im Schatten der befürchteten Katastrophe halten sie an ihren Lebenszielen fest und entwerfen neue Pläne, wenn alte in die Brüche gehen. Sofern es um unsere eigene Biografie geht, sind wir kaum bereit, den Kampf für eine bessere Zukunft aufzugeben. Und das durchaus mit guten Gründen. Diese liegen nicht einfach nur in unseren Ansprüchen auf Freiheit, Gleichberechtigung, Anerkennung und Erfolg. Sie liegen auch darin, dass wir uns viele unserer Wünsche nach wie vor erfüllen können, manche sogar besser als früher, wie etwa den Wunsch nach einem passenden Job, einem Urlaub in der Toskana oder Gesundheit im Alter. Treten individuelle Selbstverwirklichung und gesellschaftliche Gestaltungskapazität also zunehmend auseinander? Bestärkt diese wachsende Diskrepanz die Neigung vieler, sich auf ihr individuelles Glück zu konzentrieren? Oder stimuliert sie ganz im Gegenteil intensivere politische Aktivitäten zur Abwendung der drohenden Gefahr?
Die Zahl derer, die mit der Situation im Lande unzufrieden sind, sich entrüsten und der Regierung Untätigkeit vorwerfen, nimmt zu. Durch öffentlichkeitswirksame Aktionen versuchen sie, Druck auf die Verantwortlichen auszuüben. Manche sehen allein in gezielten Gesetzesverletzungen noch eine Chance, die Verantwortlichen aufzurütteln und zum Handeln zu bewegen. Andere fühlen sich gestört, halten die Protestaktionen derer, die sich auf Straßen festkleben, Konzerte unterbrechen, Kunstwerke und Denkmäler beschädigen und sich als «Letzte Generation» bezeichnen, für übertrieben, verteidigen ihre Gewohnheiten und wehren sich gegen vermeintlich elitäre Weltrettungsversuche verwöhnter Bürgerskinder. Ein Kulturkampf zwischen Veganern und Fleischessern, Lastenradfahrerinnen und SUV-Fahrern, Kosmopoliten und Heimatverbundenen scheint ausgebrochen zu sein. Auf der einen Seite stehen diejenigen, die in der zunehmenden kulturellen und ethnischen Vielfalt eine Bereicherung sehen, auf der anderen die, die sie als Bedrohung wahrnehmen. Die einen legen Wert auf die individuelle Freiheit zur Wahl der eigenen sexuellen Identität, die anderen sprechen von Gender-Gaga. Die Auseinandersetzungen haben eine Tendenz zur Polarisierung,[1] und angesichts der Vehemenz, in der die Auseinandersetzungen geführt werden, haben viele den Eindruck, die Möglichkeiten einer Verständigung rückten in immer weitere Ferne.
Es überrascht nicht, dass angesichts der Erhitzung der Debatte der allfällige Aufruf zur Besinnung auf gemeinsam geteilte Werte erfolgt. Klar ist aber auch, dass ein solcher Aufruf zu kurz greift, denn hinter den polemisch geführten Auseinandersetzungen stehen ernsthafte Probleme: das Erstarken populistischer Strömungen, die sich anbahnende Klimakatastrophe, zunehmende Migrationsbewegungen, militärisch ausgetragene internationale Konflikte. Der Begriff des Kulturkampfes ist selbst Teil der kontrovers ausgetragenen Debatten. Er wird gern eingesetzt, um der anderen Seite die Überzeichnung von Marginalien und die Ablenkung von den zentralen Problemen vorzuwerfen. Kulturkämpfe führen stets die anderen. Aber auch wenn Begriffe wie Kulturkampf, Lifestyle-Diskurs oder Cancel-Culture oft aus rein rhetorischen Gründen gebraucht werden, lässt sich nicht ausschließen, dass sich hinter den symbolisch aufgeladenen Kämpfen Spannungslinien verbergen, die eine soziale, politische, rechtliche und ökonomische Basis haben: die Spannung zwischen Kapital und Arbeit, Stadt und Land, Ökologie und Ökonomie oder auch zwischen Kosmopolitismus und Kommunitarismus. Solche Spannungen öffentlich zu diskutieren erhöht die Chance, sie wirkungsvoll bearbeiten und verringern zu können. Ihre rhetorische Aufladung verstärkt aber auch die Gefahr, sie zu vertiefen, die einander gegenüberstehenden Lager zu stabilisieren und mögliche Brücken einzureißen. Ein Wort gibt das andere, eine Anschuldigung provoziert den Gegenvorwurf, eine Übertreibung rechtfertigt die nächste. Auf einmal stimmen die Streitenden, die sich auf kaum etwas einigen können, in einem überein: dass der Bestand unserer rechtsstaatlichen Demokratie und unsere Art zu leben bedroht sind. Die einen begrüßen die Problematisierung unserer politischen und ökonomischen Ordnung und fordern ihren radikalen Umbau, vielleicht sogar den Ausstieg aus ihr. Die anderen arbeiten aktiv an ihrer Unterwanderung und freuen sich über jeden Akt ihrer Zersetzung. Und oft geben selbst die eifrigen Verteidiger des demokratischen Rechtsstaats mit ihren hilflos wirkenden Rechtfertigungs- und Bagatellisierungsversuchen noch ein Zeugnis davon, wie schlimm es um unsere Demokratie stehen muss.
Dass unsere öffentlichen Diskurse in eine solche Polarisierung hineingeraten sind, hat viel damit zu tun, dass die gebotene Kritik der Gegenposition oft mit deren Abwertung verbunden ist. Man verneint nicht nur die gegenteilige Meinung, sondern schon die Kompetenz der anderen, Lösungen finden zu können, und manchmal sogar ihre Bereitschaft, sie überhaupt finden zu wollen. Man garniert die Abgrenzung von der Gegenposition mit kopfschüttelndem Unverständnis, zur Schau getragener Geringschätzung und kaum verhohlener Häme. Die Verweigerung von Respekt kann in einer Gesellschaft, in der soziale Anerkennung zu einem Höchstwert aufgestiegen ist, nicht unerwidert bleiben und wird nicht selten ebenfalls mit Abwertung beantwortet. Aber auch die Stilisierung als Opfer von Benachteiligung und Nichtbeachtung kann beachtliche öffentliche Effekte erzielen. In jedem Fall führt die Herabsetzung des anderen zu einer Verschärfung der Kontroverse. In einer Eskalationsspirale richten die sich streitenden Parteien in einer Empörungsrhetorik ein, mit der sie selbst einen Beitrag zur Gefährdung der Demokratie leisten, um deren Bewahrung es ihnen angeblich doch geht. Im Zweifelsfall ist man erst einmal dagegen, Hauptsache man ist dabei.
Nichts ist in dieser überhitzten Diskussion dringlicher, als einen Schritt zurückzutreten, die eigene Position zu reflektieren und sich für andere Meinungen zu öffnen. Denn durch die Schärfe der Auseinandersetzung wird die Demokratie – das lehrt die Geschichte – tatsächlich gefährdet. Auch wenn wir heute keine Weimarer Zustände haben, der kompromisslose Kampf der demokratischen Parteien gegeneinander hat in der Weimarer Republik zweifellos zum Niedergang der Demokratie beigetragen.[2]
Wohlfeil sind Aufrufe zur Stärkung der Zivilgesellschaft, zu mehr Einsatz für die gute Sache der Demokratie, zum Aufstehen gegen rechts und zur Besinnung auf unsere Werte. Weitgehend unnütz sind auch Warnungen vor einer Verharmlosung der sich aufhäufenden Krisen, in denen wir stecken, oder niederträchtige Ermahnungen zum Realismus nach dem Motto «Schlaraffenland ist abgebrannt». Moralisierender Alarmismus reicht nicht. Er stößt in der Regel auf viel Zustimmung und bewirkt in der Sache wenig. Wenn wir nach Auswegen aus der Eskalationsspirale suchen, dann sollten wir nach Agenturen der Versachlichung Ausschau halten. Ein möglicher Kandidat könnten die Sozialwissenschaften sein, die mit ihrer methodologischen und theoretischen Kompetenz für eine empirische und reflektierte Bestandsaufnahme der sozialen Gegenwartssituation besonders gut gerüstet zu sein scheinen.
Die Angebote zur sozialwissenschaftlichen Deutung unserer Gesellschaft sind zahlreich. Sie reichen von Machtanalysen im Sinne Foucaults und Neuauflagen der Kritischen Theorie über neo-institutionalistische und individualisierungstheoretische Ansätze bis hin zu aktualisierten Adaptionen der Systemtheorie. Wie die öffentlichen Debatten begnügen sie sich in der Regel allerdings nicht mit einer Diagnose unserer Gegenwartsgesellschaft und ihrer Probleme, sondern verfangen sich in dem Versuch, ihre Diagnose mit Vorschlägen zur Bewältigung der Probleme zu verbinden. Ihr sozialwissenschaftliches Potential zur Gegenwartserforschung schöpfen sie auf diese Weise nur begrenzt aus. Sie setzen es vor allem ein, um ihren Veränderungsvorschlägen Gewicht zu verleihen. Ob Resonanz als Lösung für Probleme der ungezügelten Beschleunigung kapitalistischer Wirtschaftskreisläufe angeboten wird, Differenzdenken an die Stelle hierarchischer Harmoniekonzeptionen gesetzt wird oder Gemeinschaftlichkeit und Entprivatisierung an die Stelle überzogener Freiheitsforderungen treten soll, immer wieder laufen die soziologischen Analysen darauf hinaus, Strategien zur Bewältigung der ausgemachten Krisen anzubieten, und das selbst dann, wenn die Krisen letztendlich für unlösbar gehalten werden. Die angebotenen soziologischen Diagnosen sind nicht ohne Biss, doch stehen sie von Vornherein in der Gefahr, von den normativen Lösungsvorschlägen überformt zu werden und ihren nüchternen Blick zu verlieren.
Dieses Buch verzichtet demgegenüber auf Handlungsanweisungen. Es fragt nicht, was angesichts der vielen Herausforderungen zukünftig geschehen muss. Sein Beobachtungkriterium ist nicht die Differenz zwischen dem, was sein soll, und dem, was ist. An die Stelle der Differenz zwischen wünschenswerter Zukunft und betrüblicher Gegenwart tritt die Differenz zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Was unterscheidet heutige Gesellschaften von früheren? Worin liegen heute Probleme, die vormoderne Gesellschaften nicht hatten? Was macht die Dynamik moderner Gesellschaften aus, woraus resultieren ihre Gefährdungen, wo liegen ihre Stärken? Auch wenn es fließende Übergänge zwischen Vormoderne und Moderne gibt, versucht dieses Buch genauer zu bestimmen, worin die Besonderheiten der westlichen Moderne im Unterschied zur Vormoderne bestehen. Es will sich der heutigen Lage mit einem höheren Maß an Distanz, Gelassenheit und Zurückhaltung annähern und verzichtet daher ebenso auf den vielfach gepflegten Empörungsgestus wie auf jeden billigen Optimismus. Es möchte einen Beitrag zum Verständnis der Gegenwart leisten und schließt mit dem überraschenden Befund, dass die westliche Moderne in eine dilemmatische Situation geraten ist, die sie nur teilweise selbst verschuldet hat und in der zugleich völlig unklar ist, ob die ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu ihrer Bewältigung ausreichen.
Der Krieg, den Russland gegen die Ukraine und mit ihr gegen das westliche Demokratiemodell führt, mag zum Teil durch die Verteidigungsbereitschaft der NATO provoziert worden sein. Doch nicht der Westen, der sich jahrzehntelang für den Aufbau einer internationalen Friedensordnung eingesetzt hat, hat ihn begonnen, sondern ein diktatorisches Verbrechersystem, das den Kampf gegen den Westen zur Staatsdoktrin erhoben hat. Der Krieg fordert nun aber das westliche Verteidigungsbündnis militärisch, finanziell und friedensethisch heraus, und es ist offen, wie es diese Herausforderung besteht.
Die Migrationsbewegungen aus dem globalen Süden nach Europa haben viel mit dem Wohlstandniveau der westlichen Gesellschaften zu tun und auch mit ihrem kolonialen Erbe, das den globalen Süden nach wie vor prägt. Die soziale Not in den Staaten Afrikas, Asiens und Südamerikas, das Staatsversagen in diesen Ländern sowie die in ihnen verbreitete Korruption und soziale Ungleichheit sind allerdings auch hausgemacht. Mit den Migrationsbewegungen aus diesen Staaten ist Europa jedoch nicht nur logistisch überfordert, sondern vor allem auch moralisch, denn die Versuche der Abschottung bedeuten einen Verrat an den menschenrechtlichen Grundlagen der europäischen Wertegemeinschaft. Wie dieses Dilemma praktisch und moralisch zukünftig gelöst werden soll, ist nicht abzusehen.
Der Rechtspopulismus gehört als permanente Versuchung zur liberalen Demokratie und bedroht von innen her ihre Stabilität, und obwohl die demokratischen Parteien alles aufbieten, um ihn zurückzudrängen, breitet er sich weiter aus. Ob die demokratischen Parteien mit ihrer Politik nun den Wünschen vieler Wähler entgegenkommen oder den Menschen umgekehrt einiges zumuten, ob sie die rechtspopulistischen Parteien ausgrenzen oder mit ihnen kooperieren, ob sie deren Themen aufgreifen oder gerade vermeiden, kaum ein Mittel scheint geeignet zu sein, ihren Einfluss einzudämmen.
Die Klimakrise ist durch die fossile Basis der westlichen Art des Wirtschaftens verursacht worden. Wenn es aber darum geht, sie zu bewältigen, sind es die westlichen Staaten, die dazu am meisten beitragen. Sie sind bereit, Klimaziele vertraglich festzuschreiben, haben damit begonnen, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren, haben sich verpflichtet, in einem vereinbarten Zeitraum klimaneutral zu produzieren und legen Hilfsfonds auf, um andere Länder in ihren Anstrengungen zur CO2-Reduktion zu unterstützen. Zugleich bewegen sie sich aber in einer Welt, in der ihre Bemühungen von anderen Staaten nicht in gleichem Maße geteilt werden und in der der Anstieg der Durchschnittstemperatur auch dann weltweit über den Pariser Vereinbarungen liegen würde, wenn die europäischen Staaten die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreichen würden. Auch hier befinden sich die Länder der westlichen Welt in einer dilemmatischen Situation, die sie allein nicht bewältigen können.
Lösungen für diese teils selbstverschuldeten, teils extern bedingten Dilemmata sind schwer zu finden, und um sie geht es hier nicht. Das bescheidenere Ziel ist es, die westliche Moderne und die sie prägenden Werte möglichst ohne eigene wertende Vorannahmen zu analysieren.
Doch was ist die Moderne überhaupt? Um diese Frage zu beantworten, benötigen wir eine Theorie. Die Unübersichtlichkeit der modernen Verhältnisse lässt sich nicht gleichsam von unten allein durch empirische Feldarbeit aufhellen. Um einen Weg durch das Gestrüpp der Gegenwartsprobleme moderner Gesellschaften zu finden, bedarf es theoriegeleiteter Unterscheidungen, die unserem Suchen Ziel und Orientierung geben. Natürlich kann eine Theorie der Moderne von empirischen Einsichten nicht absehen. Doch geht ihre Ausarbeitung stets über diese hinaus, da sie ein Entwurf ins Ungewisse hinein ist – eine Konstruktion, die zwar immer wieder der empirischen Bewährung auszusetzen ist, sich zugleich jedoch nicht durchgängig empirisch herleiten lässt. Die Frage, die für oder gegen einen theoretischen Ansatz spricht, darf daher nicht allein lauten, ob er durch empirische Evidenz gestützt werden kann. Sie muss durch die weitergehende Frage ergänzt werden, ob man durch die Theorie etwas zu sehen bekommt, das man ohne sie nicht sieht.
Theorien der Moderne sind in Misskredit geraten. Sie gelten als deterministisch und teleologisch, als fortschrittsoptimistisch und eurozentrisch.[3] Gegen sie werden Globalisierungstheorien, postkoloniale Ansätze, Theorien der multiple modernities und ethnographische Kulturtheorien in Stellung gebracht, die die Einheit der Moderne bezweifeln,[4] auf die Verwobenheit der Moderne mit außereuropäischen Kulturen verweisen[5] und an die Stelle der Unterscheidung von Tradition und Moderne die Annahme mannigfacher historischer Überschneidungen und unscharfer Grenzen setzen.[6] Der mit Europa aufgerichtete Denkrahmen müsse gesprengt und prinzipiell umgebaut werden.
Die Frage, in welcher Welt wir in den westlichen Gesellschaften eigentlich leben, werden wir mit diesen grundsätzlichen Zweifeln an der Tauglichkeit des Modernebegriffs allerdings nicht los. Diese Frage ist von einem unmittelbaren Gegenwartsinteresse, weil wir Auswege aus den gegenwärtigen Krisen gar nicht erörtern können, wenn wir uns nicht zunächst über die Grundzüge unserer Gesellschaft Klarheit verschaffen. Und sie gewinnt noch einmal an Aktualität angesichts der gegenwärtigen Bedrohung des Westens durch autoritäre Regime in aller Welt und vor der unmittelbaren Haustür. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die Unterstützung oder Duldung, die Russland durch Länder wie China, Indien, Iran, Uganda oder Eritrea erfährt, haben noch einmal gezeigt, was den Westen ausmacht. Viele unter uns hatten das bereits vergessen. Ebenso offenbart die Terrorattacke der Hamas, die sich nicht nur gegen Israel, sondern ausdrücklich auch gegen die USA und seine westlichen Verbündeten richtet und die in der gesamten arabischen Welt nicht verurteilt wird, wofür der Westen steht. Gab es bisher eine starke Tendenz, den Westen für alle Probleme der Welt – seien es Armut, militärische Expansionen oder die Klimakatastrophe – verantwortlich zu machen, so sieht man jetzt, dass die nichtwestlichen Regime mit den Problemen der Welt nicht besser umgehen und oft sogar bereit sind, sie zu verschlimmern. Der Westen ist trotz des weitverbreiteten Unbehagens an seiner Dominanz und seiner Tendenz zur Kolonisierung von Mensch und Natur und trotz seiner Bedrohungen von innen noch am ehesten ein Ort von Freiheit, Frieden, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Dass er attackiert wird, macht die Verteidigungswürdigkeit seiner Werte sichtbar.[7] Und doch kann der Kampf gegen Europa und die USA, der viele der genannten Länder verbindet, nicht als Rechtfertigung dafür dienen, deren Angriff auf Freiheit und Menschenrechte als eine Selbstbestätigung des Westens zu nehmen und seine Überlegenheit zu postulieren. Umgekehrt: Die Kritik am westlichen Ordnungsmodell darf sich der Westen nicht aus der Hand nehmen lassen. Die Selbstkritik ist ein Bestandteil seines Selbstverständnisses, tief in seine Geschichte hineingelegt und vielleicht sein bester Teil.
Eine Theorie der Moderne sollte so einfach wie möglich sein und so komplex wie nötig. Sie sollte nicht versuchen, die Komplexität moderner Gesellschaften auf einen einzigen Begriff zu bringen, etwa auf den Begriff der Klassengesellschaft, der Risikogesellschaft, der Wissensgesellschaft oder der Entscheidungsgesellschaft.[8] Weder Klassenkampf noch Risikovermehrung noch Wissenserweiterung noch zunehmender Entscheidungsdruck noch auch Beschleunigung, Multioptionalität oder Rationalisierung stellen allumfassende Kennzeichen der Moderne dar.[9] Auch Verdinglichung oder durchdringende Machtdispositive charakterisieren die Moderne nicht vollständig. Theorien, die immer wieder darauf hinauslaufen, die Unbeherrschbarkeit der Situation, die Einmündung von Steigerungstendenzen in ausweglose Aporien zu proklamieren, neigen ebenso zur Übereindeutigkeit wie Theorien, die immer wieder die technische Gestaltbarkeit der Verhältnisse behaupten.
Wenn es uns hier darum geht, charakteristische Unterschiede zwischen Vormoderne und Moderne herauszuarbeiten, sollten wir nicht den Fehler begehen, die Moderne als ein sauber abgrenzbares Gebilde zu fassen. Die Moderne ist nicht aus einem Guss. Vielmehr ist sie eine spannungsreiche Ordnung, in der unterschiedliche Kräfte miteinander ringen, sich wechselseitig im Zaum halten, einander in vielfacher Hinsicht widersprechen und nicht auf ein letztes Prinzip zurückgeführt werden können.[10] Ein solcher Ansatz gibt den Anspruch nicht auf, die Spezifika der Moderne im Unterschied zur Vormoderne zu erfassen, vermeidet es aber, die Moderne als normatives Idealbild zu konstruieren. Derartige Konstruktionen tendieren dazu, alle konkreten Zustände in modernen Gesellschaften nur noch durch die Abmessung des Abstandes zu dem entworfenen Idealbild zu erfassen und immer wieder als ungenügend zu markieren. Eine Theorie der Moderne aber muss mehr sein als eine Kritik der Moderne, als eine Ausarbeitung des verbreiteten Unbehagens an der Moderne. Deshalb muss sie sich von jeder Idealisierung fernhalten, und das, obwohl die Moderne selbst als ein normatives Projekt verstanden werden kann.
Für den Entwurf einer Theorie der Moderne greife ich auf eine von Niklas Luhmann eingeführte dreifache Unterscheidung zurück, mit deren Hilfe er unterschiedliche Sinndimensionen bezeichnet: auf die Unterscheidung zwischen zeitlichem, sachlichem und sozialem Sinn. Ob diese Einteilung überzeugend ist, ob sie sich durch eine andere ersetzen oder durch weitere Sinndimensionen ergänzen ließe, etwa durch die Raumdimension,[11] kann man kritisch diskutieren. Als analytisches Werkzeug[12] hat sich die dreifache Unterscheidung für dieses Buch jedenfalls als hilfreich erwiesen. Alle drei Sinndimensionen sind durch charakteristische Spannungslinien gekennzeichnet, die, so die Hypothese, in modernen Gesellschaften signifikant anders ausfallen als in vormodernen.
1. Der zeitliche Horizont der Moderne:Steigerung und Selbstbegrenzung
Moderne Gesellschaften sind durch eine gesellschaftliche Steigerungsdynamik gekennzeichnet, die vormodernen Gesellschaften fremd ist. Ihr übergreifendes Kennzeichen ist das von Reinhart Koselleck diagnostizierte Auseinandertreten von Erfahrungsraum und Erwartungshorizont. Die Neuzeit lässt sich, so Koselleck, «überhaupt erst als eine neue Zeit begreifen […], seitdem sich die Erwartungen immer mehr von allen bis dahin gemachten Erfahrungen entfernt haben».[1] Für diese Öffnung des Erwartungshorizonts hält das ausgehende 18. Jahrhundert den Begriff des Fortschritts parat, den es positiv auflädt und als Chiffre für eine bessere Zukunft verwendet. Unter den vielen unterschiedlichen Ursachen der Steigerungsdynamik der Moderne – ökonomischen, politischen, wissenschaftlichen – ist dieses Auseinandertreten von Erfahrung und Erwartung selbst eine ihrer Antriebskräfte. Es lässt sich keine moderne Gesellschaft denken, die nicht durch die Spannung von Imagination und Wirklichkeit, Ideal und Faktizität und eine aus dieser Spannung resultierende Veränderungsdynamik geprägt ist. Zur modernen Gesellschaft gehört das normative Bild, das sie von sich entwirft, die Kritik an ihrer faktischen Unvollkommenheit und die Arbeit an ihrer Perfektionierung. Die Moderne ist ein Versprechen an die Zukunft.[2]
Die unerhörte Einmaligkeit dieser Emanzipation des Denkens von der Schwerkraft der Geschichte haben die Zeitgenossen bereits selbst wahrgenommen. «Solange die Sonne», so drückt Hegel seine Begeisterung über den mit der Französischen Revolution einsetzenden Anbruch des Neuen aus, «am Firmamente steht und die Planeten um sie herumkreisen, war das nicht gesehen worden, daß der Mensch sich auf den Kopf, das ist, auf den Gedanken stellt und die Wirklichkeit nach diesem erbaut.»[3] Und Immanuel Kant feiert die Einzigartigkeit der Französischen Revolution mit den Worten: «Ein solches Phänomen in der Menschheitsgeschichte vergisst sich nicht mehr.»[4]
Selbstverständlich dürfen wir uns in unserer Analyse des Zeitbewusstseins der Moderne nicht vom Selbstverständnis der damaligen Akteure abhängig machen. Der Anspruch, mit der Tradition radikal zu brechen, steht in einem Missverhältnis zur Realität der Geschichte, die nie von Grund auf neu anfangen kann. Der institutionelle und semantische Wandel, der die Moderne von der Vormoderne unterscheidet, war «ein verschlungener, vielgestaltiger Prozess»,[5] dessen Ergebnis von einer Vielzahl kontingenter Konstellationen beeinflusst wurde. Ihn zu einem revolutionären Akt zu erklären, ist eine Übertreibung. Gleichwohl gehört das Bewusstsein des radikal Neuen und seine positive Bewertung unausweichlich zur Moderne. «Nur und erst die Neuzeit hat sich als Epoche verstanden und dadurch die anderen Epochen mitgeschaffen.»[6]
Ein neues Zeitregime
Mit diesem Anspruch auf den Beginn von etwas Noch-nie-Dagewesenem, eines umfassenden Umbruchs in der Geschichte der Menschheit und des Anfangs einer unerhörten Zukunft wenden sich die Denker des ausgehenden 18. Jahrhunderts von der Tradition des christlichen Zeitverständnisses ab. Am Ende der Weltgeschichte erwartet den sündigen Menschen nicht mehr das göttliche Gericht, das dem irdischen Jammertal ein Ende bereitet und kurz bevorsteht. Die Zukunft ist offen und der Mensch in der Lage, sie zu seinen Gunsten zu verändern. Er muss sich nicht länger als ein Knecht der Sünde, der sich nicht selbst zu erlösen vermag, in das göttlich bestimmte Schicksal ergeben, sondern trägt als ebenbildliches Geschöpf des allmächtigen Gottes die Fähigkeit in sich, sein Leben zu beeinflussen und die ihn umgebende soziale Ordnung zu gestalten.
Das mittelalterliche Denken konnte sich Zukunft noch nicht als Zeitraum vorstellen. «Wann immer in mittelalterlichen Texten von ‹futura› die Rede ist, sind immer die ‹zukünftigen Ereignisse› gemeint, nie der Zeitraum der Zukunft als solcher.»[7] Der Blick reichte kaum über das unmittelbar Bevorstehende hinaus und war durch einen relativ stabilen innerweltlichen Erwartungshorizont, durch die Annahme der ewigen Wiederholung des Gleichen, geprägt, weshalb Abweichungen von den Normalitätsunterstellungen die Menschen besonders schwer trafen.[8] «In der modernen Gesellschaft dagegen werden die zukünftigen Ereignisse nicht mehr als unverrückbare Tatsachen verstanden, die seit Ewigkeit ins ‹Buch des Schicksals› ebenso fest eingeschrieben sind wie die Taten der Vergangenheit ins ‹Buch der Geschichte›. Die Zukunft ist in höherem Maße zum Gegenstand menschlicher Vorsorge und Verantwortung geworden, sie ist nicht mehr ‹Eigentum Gottes›, wie man früher sagte, sondern liegt zum guten Teil in unseren eigenen Händen.»[9] An die Stelle einer apokalyptischen Endzeitstimmung, wie sie die Zeit bis zum Dreißigjährigen Krieg noch weithin bestimmte, tritt die Hoffnung auf eine Verbesserung der Zustände, gepaart mit einem neuen Vertrauen in die Handlungsmacht des Menschen und einem ausgeprägten Gestaltungsoptimismus.[10]
Bereits im Jahr 1675 ersetzte Philipp Jacob Spener in seinen Pia desideria die Erwartung des baldigen Weltendes durch die Hoffnung auf bessere Zeiten.[11] Zwanzig Jahre später unterstrich er seine Hoffnung und sprach sogar die Vermutung aus, dass das Ende aller Zeiten so bald nicht eintreten werde. Noch weiter wurde der Zeithorizont von Johann Spalding gedehnt. Er sah die Bestimmung des Menschen erst jenseits des Weltendes als erfüllt an.[12] Die Erlösung des Menschen vollziehe sich in Form eines beständigen Hinaufsteigens bis hin zur himmlischen Vollkommenheit.[13] 1755 zog Immanuel Kant den Zeithorizont schließlich ins Unendliche aus und erklärte, dass die Welt niemals aufhören werde zu existieren. Nur wenige Jahre später stellte dann Gotthold Ephraim Lessing die Verbindung zwischen der Vorstellung von der Unendlichkeit der Welt und dem Weg des Einzelnen zu seiner Vervollkommnung her, indem er die Frage aufwarf, ob der Mensch nach seinem Tode nicht wieder und wieder auf die Erde zurückkehre, um dabei so viele neue Kenntnisse und Fertigkeiten anzuhäufen, als er zu erlangen geschickt sei.[14] Mithilfe der Einbeziehung der Seelenwanderungslehre in die Vorstellung vom geschichtlichen Fortschritt lud Lessing das diesseitige Leben des Menschen utopisch auf und verlängerte es bis in die jenseitige Welt. Geschichtliches und utopisches Denken schlossen sich im Zeitbewusstsein der Aufklärung nicht aus. Vielmehr eröffnete «das moderne Zeitbewusstsein einen Horizont […], in dem das utopische mit dem geschichtlichen Denken verschmilzt. Dieses Einwandern utopischer Energien ins Geschichtsbewusstsein kennzeichnet», so Jürgen Habermas, «den Zeitgeist, der die politische Öffentlichkeit der modernen Völker seit den Tagen der Französischen Revolution prägt.»[15]
Die Ausweitung des Zukunftshorizonts und seine positive Besetzung als ein möglicher menschlicher Gestaltungsraum hingen eng mit Prozessen des ökonomischen, technologischen und sozialstrukturellen Wandels zusammen, die sich im 18. Jahrhundert vollzogen. Ackerbaugebiete wurden neu erschlossen, die Bewirtschaftungsmethoden in der Landwirtschaft verbessert. Die gewerbliche Produktion expandierte. Befördert durch den Ausbau der Verkehrswege zu Wasser und zu Lande verstärkte sich der Austausch zwischen Landwirtschaft und produzierendem Gewerbe. An die Stelle der traditionellen bedarfsdeckenden Subsistenzwirtschaft traten zunehmend marktwirtschaftliche Beziehungen. Je mehr sich die Landwirtschaft spezialisierte und für externe Märkte produzierte, desto höher wurde die Kaufkraft auf dem Land zum Erwerb gewerblicher Güter; je mehr Menschen ausschließlich in der gewerblichen Produktion arbeiteten, desto mehr waren sie auf die Versorgung durch landwirtschaftliche Güter angewiesen, die sie nicht selbst erzeugten.[16] Mit der Spezialisierung verstärkte sich auch der Wettbewerb, was weitere Effizienzsteigerungen erzwang. Es erhöhte sich der materielle Lebensstandard, die Lebenserwartung stieg an, und allmählich änderte sich auch das Reproduktionsverhalten der Bevölkerung. Zuvor hatte vermehrtes Bevölkerungswachstum stets eine Verknappung der Nahrungsgrundlagen und ökonomischen Niedergang zur Folge gehabt, was wiederum zu einem Rückgang der Heiratsfrequenz und der Geburtenrate geführt hatte. Diese Wellenbewegung von Aufschwung und Krise wurde im 18. Jahrhundert erstmals außer Kraft gesetzt. Hungersnöte und Teuerungen nahmen ab. Das ökonomische Wachstum gewann an Dynamik, und mit der industriellen Revolution stabilisierte es sich sogar.