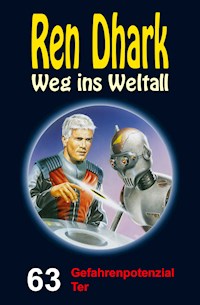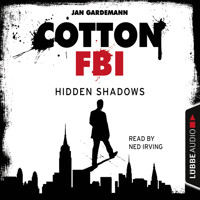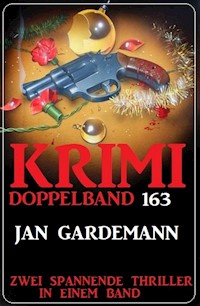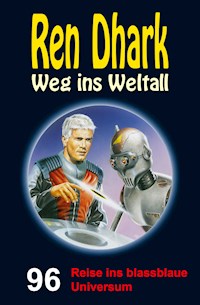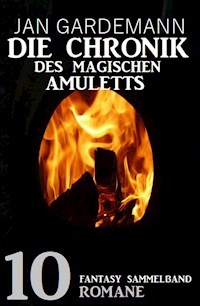Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Federheld
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In der Stadt Remburg, die unter einem Strahlenfeld liegt, das sämtlichen Funkverkehr behindert und sie einen Sonderstatus in der technisierten Welt einnehmen lässt, kommt der junge Journalist Michael Neustädter einer heißen Story auf die Spur. Er trifft auf Menschen mit ungewöhnlichen Begabungen, kommt dabei dem Remburger Verbrecherfürsten in die Quere und deckt die Machenschaften einer mysteriösen Gruppe auf, die sich das Konsortium nennt. Dabei hatte er doch eigentlich bloß über den Bau einer neuen Einkaufspassage berichten wollen, die jedoch der Schlüssel zu all den Rätseln zu sein scheint ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
REMBURG REPORT
I M P R E S S U M
Remburg Report
von
Jan Gardemann (Autor)
© 2017 Jan Gardemann
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung: Federheld.com
Inhaber: Jan Gardemann
Gänsekamp 7
29556 Suderburg
Titelgestaltung und Bild: Jan Gardemann
Lektorat: André Piotrowski
Weitere Informationen:
www.federheld.com
Facebook: Federheld.com
Zuerst veröffentlicht 2009 im Atlantis-Verlag; nominiert für den Deutschen Science-Fiction-Preis 2010.
Anja, meiner Frau und Lebensgefährtin gewidmet.
Mit Dank an all diejenigen, die zur Realisierung dieses Buches beigetragen haben.
Vervielfältigung und Nachdruck des Textes und des Covers (auch auszugsweise) nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors gestattet.
Kapitelübersicht
Prolog
Der Suizidententurm
Begabteneinsatzteam
Die Mafia räumt auf
Anders Mischer
Das gelbe Zimmer
In einem Mietshaus haben Wände Ohren
Abrechnung
Epilog
Prolog
»Jeder Ort hat seine Geschichte, man muss nur verstehen, sie herauszulesen.« Dieser Satz hat sich mir tief eingeprägt. Er half mir, meine Gabe besser zu begreifen.
Ausgesprochen hatte ihn Professor Doktor Armin Scheich während einer Vorlesung über Architekturjournalismus in der großen Aula der Remburger Universität. Dass er dabei ausgerechnet mich ansah und keinen der anderen Studenten, glaube ich mir nicht nur eingebildet zu haben.
Die Augen des Professors waren in ständiger Bewegung gewesen, während er hinter dem Pult stand und dozierte. Doch als er jenen Satz über Orte und die mit ihnen verbundenen Geschichten aussprach, haftete sein Blick fest und unverrückbar auf meinem Gesicht. Ich wurde rot und versuchte wegzusehen. Aber es gelang mir nicht. Zwischen all den Falten im Gesicht des Professors stachen seine Augen so deutlich ab wie zwei Pistolenkugeln, die nebeneinander in der Rinde einer Buche stecken. Eine Wolke weißer Albert-Einstein-Haare krönte sein Haupt. Mir war, als säße ich ganz allein in der Aula und als dozierte der Professor nur für mich.
Dieser Eindruck schwand allerdings sofort, als Professor Scheich seinen Blick wieder von mir abwandte und unstet über die Köpfe der Versammelten hinwegstierte. Was er sonst noch sagte, ist mir inzwischen entfallen. Wahrscheinlich war ich auf meinem Platz vor Aufregung sogar eingeschlafen. Das passiert mir ständig, denn ich leide an einer speziellen Form der Hypnosie, der Schlafkrankheit.
Während meiner Schlafzustände, die immer dann über mich kommen, wenn ich emotional erregt bin, verhalte ich mich sehr unruhig. Meistens schnarche ich laut und werde dann von Außenstehenden geweckt, weil sie sich durch mich belästigt fühlen. Während meiner Studienzeit ist es mir unzählige Male so ergangen.
Trotzdem konnte ich den Vorlesungen einigermaßen folgen, immerhin boten die Vorträge nicht allzu oft Anlass für einen Hypnosieanfall. In den anderen Fällen stießen mich meine Mitstudenten rüde mit dem Ellenbogen an oder rüttelten mich wach, weil mein Schnarchen ihre Konzentration störte oder den Dozenten veranlasst hatte, empört in seinem Vortrag innezuhalten. Meist sah ich dann verwirrt um mich, weil ich mich nicht erinnern konnte, was geschehen war, bevor der Schlaf mich übermannte.
Mein Name: Michael Neustädter. Ich habe das Journalismusstudium mit der Note »befriedigend« abgeschlossen. Aber wie gesagt: Dieses Mittelmaß resultiert nicht etwa aus Faulheit oder Bequemlichkeit heraus; oder weil ich die Nächte auf Partys verbracht hätte und dann tagsüber zu müde gewesen wäre, den Vorlesungen und Vorträgen folgen zu können. Die Ursache ist vielmehr in einer Anomalie des Zentralgebietes für den Schlaf in meinem Zwischen und Mittelhirn zu suchen. Dort ist es während meiner Pubertät zu einer von den Ärzten nicht näher bestimmbaren Verwachsung und Verschlingung gekommen, die es dem Schlafzentrum erlaubt, die Kontrolle über die Funktionen meines Körpers zu übernehmen und ihn auszuschalten.
Fatalerweise gehen vom Schlafzentrum naturgemäß die Hemmvorgänge aus. Sie werden vom Gehirn immer dann aktiviert, wenn das Gemüt in große Erregung versetzt wird und Überreaktionen – mögen sie nun physischer oder psychischer Natur sein – den Organismus zu schädigen drohen. Der Körper wird vom Gehirn kurzerhand paralysiert, um ihn daran zu hindern, sich während einer Panikattacke selbst Schaden zuzufügen. Diese sinnvolle Gehirnfunktion hat im Zusammenspiel mit meiner Anomalie zur Folge, dass ich in Situationen starker emotionaler Erregung dazu neige, urplötzlich einzuschlafen.
Welche Auswirkungen diese Krankheit auf mein Liebesleben hat, kann sich jeder selbst ausmalen. Mit meiner Karriere als Journalist sieht es jedenfalls nicht besser aus als in meinem Privatleben. Welche Zeitung kann es sich schon erlauben, einen Reporter einzustellen, der die wichtigsten Ereignisse vor Aufregung regelmäßig verpennt oder während eines Interviews mit einer vor Erotik sprühenden Schauspielerin unvermittelt eindöst? Ich arbeite daher auf freiberuflicher Basis – was bedeutet: Ich bin faktisch arbeitslos!
Ich habe als freiberuflicher Journalist versagt – das muss ich leider zugeben. Bis zu dem Zeitpunkt, da ich auf die Ereignisse aufmerksam wurde, die in meiner Reportage behandelt werden, war es mir nicht gelungen, auch nur eine einzige Story an eine Zeitung zu verkaufen. Die Versuche, über weniger spektakuläre Themen zu berichten, weil diese nicht die Gefahr bargen, bei der Recherche einzuschlafen, scheiterten an dem Desinteresse der Zeitungen für derartige Stoffe. Nicht einmal in den Lokalblättern, die Artikel nur deswegen abdrucken, um damit die Anzeigen zu garnieren, fanden meine Arbeiten Aufnahme.
Andere hätten in meiner Situation vielleicht erwogen, den Beruf zu wechseln, und ehrlich gesagt war ich auch nicht weit davon entfernt, es anderweitig zu versuchen. Ich brachte es dann aber doch nicht über mich. Und das habe ich Professor Doktor Armin Scheich und seinem Satz über die Geschichte zu verdanken, die ein jeder Ort für denjenigen bereithielte, der sie zu erkennen verstünde.
Ich bin derjenige, der genau dazu befähigt ist! Das Starren des Professors hat mir dies unmissverständlich zu verstehen gegeben. Dieses Wissen gab mir die Kraft, mich trotz der Niederlagen und Fehlschläge unermüdlich in der Kunst des Journalismus zu üben – und schließlich wurde meine Hartnäckigkeit auch belohnt.
Inzwischen habe ich einige wenige Artikel in Remburger Tageszeitungen unterbringen können. Meine erste längere Reportage liegt in diesem Moment vor mir auf dem Kaffeehaustisch und ist ziemlich umfangreich. Wenn alles glatt über die Bühne geht, wird das Manuskript mir ein hübsches Sümmchen einbringen und eine Menge Staub aufwirbeln. In einer Stunde wird es in die Hände von Mathias Gruenenwald, dem Chefredakteur der ›Remburger Woche‹, wechseln. Ich habe gestern mit ihm telefoniert und kurz umrissen, worum es in der Reportage geht: Der Remburger Verbrecherfürst Ader komme darin vor, ebenso Außerirdische, Drogen, Geister, korrupte Beamte, Menschen mit erstaunlichen Fähigkeiten, Mörder und Terroristen. All dies sei eng verbunden mit dem Bau der Ladenpassage im Luzidenweg.
Gruenenwald fragte, nachdem ich all diese Schlagwörter aufgezählt hatte, ob ich übergeschnappt sei und mir einen Scherz mit ihm erlauben wolle. Aber ich versicherte ihm, ich sei völlig gesund, was allerdings nicht ganz der Wahrheit entsprach.
Am Klang meiner Stimme musste Gruenenwald die Lüge erkannt haben. Er verkündete, er werde die Verbindung jetzt unterbrechen.
»Halt!«, rief ich verzweifelt und erklärte rasch, ich sei ein ausgebildeter Journalist und weit davon entfernt, mich über einen Chefredakteur lustig zu machen. Um meine Behauptung zu untermauern, nannte ich ihm hastig die Namen einiger Professoren und Dozenten, mit denen ich auf der Uni zu tun gehabt hatte.
»Sie kennen Professor Doktor Armin Scheich?«, hakte er nach.
»Sein Vortrag hat mich tief beeindruckt.« Diesmal sagte ich die Wahrheit.
»Beschreiben Sie mir den Mann«, forderte Gruenenwald.
Ich zögerte, kam seiner Aufforderung dann aber nach.
»Sie kennen ihn ja wirklich«, bemerkte Gruenenwald wie zu sich selbst, nachdem ich ihm das Aussehen des Professors geschildert hatte. »Das ist sehr erstaunlich.«
»Was soll daran erstaunlich sein?«, erwiderte ich. »Die meisten Journalismusstudenten kennen ihn. Die Aula war gerammelt voll, als er seinen Vortrag hielt. So wird es wohl jedes Mal gewesen sein, wenn er dozierte.«
»Es erinnern sich aber nur die wenigsten an Professor Scheich und den Inhalt seiner Vorträge. – Ist Ihnen das nicht aufgefallen?«
Jetzt, da er es sagte, fiel mir wieder ein: Keiner der Studenten hatte im Anschluss an die Vorlesung über den Vortrag des Professors gesprochen. Die üblichen Diskussionen waren aus einem unerfindlichen Grund ausgeblieben. Ich hatte diesem Umstand jedoch keine Beachtung geschenkt, weil ich zu sehr mit dem Satz beschäftigt gewesen war, den der Professor während der Vorlesung an mich gerichtet ausgesprochen hatte. Es fiel mir nun aber auch wieder ein, wie ich in den darauffolgenden Wochen vergeblich versucht hatte, Kontakt mit dem Professor aufzunehmen. Er war nicht aufzufinden gewesen. Sogar im Vorlesungsverzeichnis gab es keinen Eintrag unter seinem Namen.
Die Dozenten, die ich nach dem Professor fragte, zuckten nur mit den Schultern und erklärten, einen Professor mit diesem Namen nicht zu kennen. Wahrscheinlich handele es sich um einen dieser unsäglichen Gastdozenten, denen in der Universität überflüssigerweise eine Plattform für ihre kruden Vorlesungen geboten werde, bekam ich zu hören, nachdem ich ihnen erzählte, wovon der Vortrag gehandelt hatte.
Tatsächlich war ich auf den Vortrag von Professor Doktor Armin Scheich auch nur aufmerksam geworden, weil ich zwischen dem Zetteldickicht auf dem Schwarzen Brett der Kantine einen handgeschriebenen Wisch entdeckte, der den Vortrag in der großen Aula ankündigte. Da die Aula bis auf den letzten Platz voll gewesen war, hatte ich natürlich angenommen, auch auf anderem Weg sei für die Vorlesung geworben worden. Aber das schien nicht der Fall gewesen zu sein. Jedenfalls konnte ich nirgendwo auf den Fluren und Korridoren ein entsprechendes Plakat oder Hinweisschild entdecken. Obwohl ich in der Folgezeit die Zettel auf dem Schwarzen Brett immer wieder durchforstete, fand ich dort nie wieder eine ähnliche Ankündigung. Der Professor schien spurlos verschwunden.
Ich vergaß die Geschichte – schließlich hat ein Student noch andere Sorgen, als nach einem rätselhaften Professor zu fahnden. Professor Doktor Armin Scheich und sein Satz über Orte und ihre Geschichten sind mir trotzdem für immer in Erinnerung geblieben.
»Was ist nun mit Ihrer Reportage?«, sagte Gruenenwald in die Stille meiner Gedanken hinein.
»Haben Sie denn Interesse daran?«, fragte ich verblüfft.
»Aber sicherlich«, antwortete Gruenenwald zu meinem Erstaunen. »Ich schlage vor, wir verabreden uns irgendwo.«
Ich glaubte meinen Ohren nicht zu trauen. »Wie wäre es mit morgen?« Ich versuchte meine Aufregung zu unterdrücken, um keinen Hypnosieanfall zu provozieren. »Wir könnten uns im Café in der Luzidenpassage treffen. Dort findet zu diesem Zeitpunkt die Einweihung des neuen Einkaufszentrums statt.«
»Ausgezeichnet.« Die Stimme des Chefredakteurs klang aufgeräumt und unternehmungslustig.
Wir einigten uns auf eine Uhrzeit und verabschiedeten uns voneinander …
―
Auch jetzt, da ich an einem Kaffeehaustisch in der Ladenpassage sitze, und auf Mathias Gruenenwald warte, kann ich mein Glück noch immer nicht fassen. Knapp zwei Monate habe ich an dieser Reportage gearbeitet. Genauso lange ist es auch her, dass ich das erste Mal auf meine Begabung aufmerksam wurde, der ich das Zustandekommen dieses Textes letztendlich verdanke.
Ich hielt mich gerade im Foyer des Remburger Rathauses auf und wollte mir das Modell und die Pläne für die Einkaufspassage ansehen, die im Luzidenweg gebaut wurde. Es war Oktober, und in der Tasche meines Mantels steckte ein Diktiergerät, das ich mir kurz zuvor gekauft hatte. Ich wollte einen Bericht über das Bauvorhaben des Remburger Planungsamtes schreiben. Die Ladenpassage, die im Luzidenweg entstehen sollte, war das erste Projekt, das der neue Stadtplaner Egon Gratius ins Leben gerufen hatte, nachdem er den Posten von Peter Dormann, seinem Vorgänger, der ermordet worden war, übernommen hatte.
Das Projekt im Luzidenweg hatte eine Menge Unmut in der Bevölkerung erregt und den neuen Stadtplaner als kompromisslosen, hart durchgreifenden Mann entlarvt. Zum Zeitpunkt, da ich mit meiner Recherche begann, war der Rohbau der Ladenpassage fast fertiggestellt. Ich wollte die Entstehung dieses Gebäudes in einer Reportage rückblickend aufarbeiten. Die Vorkommnisse waren bereits Geschichte, und so hoffte ich, dass das Thema mich emotional nicht mehr so stark erregen konnte, dass ich bei der Recherche plötzlich einschlief. Die Chancen, den Bericht an eine Zeitung zu verkaufen, schätzte ich gar nicht mal so schlecht ein – vorausgesetzt, die Hypnosie machte mir nicht wieder einen Strich durch die Rechnung.
Um dem vorzubeugen, hatte ich mir das Diktiergerät zugelegt: Mit seiner Hilfe, so hatte ich mir gedacht, wäre es möglich, meine Gedanken bis zu jenem Zeitpunkt festzuhalten, da ich in bleiernen Schlaf hinüberdämmerte. Der krankhafte Schutzmechanismus meines Gehirns ging nämlich so weit, alle Erinnerungen an den Grund des Anfalls aus meinem Bewusstsein zu löschen. Ich konnte mich beim Erwachen nicht mehr daran erinnern, was den Schlafzustand ausgelöst hatte.
Dem wollte ich nun mit dem Einsatz des Diktiergerätes entgegenwirken. Falls ich einschlief, würde ich das Band später zu Hause in Ruhe abhören und entscheiden können, ob es sich lohnte, die Recherche fortzuführen. Sollte die Sache funktionieren, könnte ich die Story – schlimmstenfalls von mehreren Schlafzuständen unterbrochen – stückweise auf Tonband aufnehmen, bis sie komplett war!
Ich hatte mich in Bezug auf die Brisanz des Themas allerdings grundlegend geirrt und wahrhaftig gut daran getan, ein Diktiergerät anzuschaffen. Denn, noch während ich das in einer Glasvitrine präsentierte Modell der Ladenpassage betrachtete und meine Eindrücke auf das Band sprach, strömte auf einmal eine Gruppe Demonstranten in das Rathausfoyer.
»Von oben betrachtet gleicht der Gebäudekomplex einem jener geheimnisvollen Kornkreise, über deren Entstehung Wissenschaftler und UFO-Fanatiker immer wieder in heftigen Streit geraten.« Diesen Gedanken sprach ich gerade in das Diktiergerät.
Weiter kam ich nicht, denn die Demonstranten übertönten mich, indem sie ihre Parolen lauthals in die Eingangshalle brüllten und damit unverblümt zum Ausdruck brachten, wie sehr sie das Vorhaben des Planungsamtes missbilligten. Trotz massiver Proteste der Anwohner habe man die Bebauung des Luzidenwegs rücksichtslos vorangetrieben und so ein Stück Wohnkultur der Stadt zerstört. Eigenmächtigkeit und Bestechlichkeit wurden dem Leiter des Planungsamtes vorgeworfen.
Eine Frau in schwarzer Lederhose und mehreren Lagen löchriger T-Shirts über der Brust entrollte ein Spruchband. »Bestechliche Hände errichten in Remburg Wände!«, war darauf zu lesen.
Noch während ich überlegte, ob ich die Demonstranten interviewen oder lieber davonlaufen sollte, stürmten Polizisten in das Foyer. Ihre Knüppel hatten sie bereits gezückt – und sie zögerten nicht, sie gegen die Demonstrierenden einzusetzen, die es gewagt hatten, das Versammlungsverbot in der Bannmeile des Rathauses zu ignorieren.
Ich fühlte mich mit einem Mal matt. Wie aus weiter Ferne hallten die Schreie der Demonstranten zu mir herüber. Die Lider wurden mir schwer, die Beine knickten unter mir weg. Ich sank zu Boden; Schwärze fraß sich von den Rändern meines Blickfeldes ausgehend in die Szene prügelnder Polizisten und sich sträubender Demonstranten.
Ich schaffte es gerade noch, unter den Hohlraum der Vitrine zu kriechen, der mit einem Tuch verhängt war. Dann schlief ich ein.
―
Ich erwachte, als mich jemand unsanft am Arm rüttelte.
Ich solle rauskommen, und zwar sofort, wurde ich unwirsch angesprochen.
Ein Polizist kniete vor der Vitrine. Er hatte das Tuch gelüpft, den Oberkörper vorgeneigt und starrte mich unter dem Schirm seiner Uniformmütze verärgert an. Ob ich kein Zuhause hätte und ob ich mir eine Anzeige wegen groben Unfugs und ruhestörenden Lärms einhandeln wolle.
Wahrscheinlich hatte mein Schnarchen den Beamten auf mich aufmerksam gemacht. Benommen kroch ich unter der Vitrine hervor und stammelte Entschuldigungen, die der Polizist mit grimmiger Miene zur Kenntnis nahm. Ich versuchte gar nicht erst, ihm von der Hypnosie zu erzählen. Stattdessen verstaute ich das Diktiergerät, das ich im Schlaf krampfhaft festgehalten hatte, in der Manteltasche und sah mich in dem Foyer aufmerksam um.
Ich erinnerte mich vage, wegen der neuen Einkaufspassage ins Rathaus gekommen zu sein. Doch was den Schlafanfall schließlich ausgelöst hatte, wusste ich nicht. In dem altehrwürdigen Foyer des Rathauses sah zumindest alles friedlich und gewöhnlich aus.
Ich blickte auf meine Armbanduhr und stellte fest, dass ich eine Erinnerungslücke von etwa einer halben Stunde hatte. Aus Furcht, den Polizisten noch argwöhnischer zu machen oder womöglich wieder einen Anfall zu bekommen, verzichtete ich darauf, ihn zu fragen, was sich vor einer halben Stunde im Rathaus zugetragen hatte. Außerdem besaß ich ja das Diktiergerät. Ich wollte sofort in mein Apartment und das Band auswerten!
Von den finsteren Blicken des Polizisten begleitet, verließ ich das Rathaus. Ich eilte zur nahe gelegenen U-Bahn-Station, stürmte die Stufen hinab und sprang in den wartenden Zug. Die Fahrt nach Hause dauerte unerträglich lange, und die dreidimensionalen Werbespots, die durch das Abteil geisterten, erschienen mir mit ihren endlosen Wiederholungen noch unerträglicher und enervierender als sonst.
Endlich in meinem Apartment angekommen, hängte ich den Mantel an den Garderobenhaken und holte das Diktiergerät hervor. Es war während des Schlafzustandes auf Aufnahme geschaltet gewesen und das Band bis zum Ende durchgelaufen.
Ich drückte auf die Rückspultaste und schlenderte mit dem Gerät in der Hand ins Wohnzimmer. Das Tageslicht ließ das Sofa, den Couchtisch und die Regalwand mit den Büchern und Zeitschriften darin mal wieder trostlos und nichtssagend erscheinen. Während das Tonband munter vor sich hinschnurrte, schleuderte ich die Schuhe in eine Zimmerecke und warf mich aufs Sofa. Auf dem Couchtisch stand noch das Frühstücksgedeck. Ich goss Kaffee in einen Becher und drückte, nachdem ein Klacken das Ende des Rückspulvorganges angekündigt hatte, auf die Wiedergabetaste des Diktiergerätes.
Meine Stimme auf dem Band klang etwas verfremdet. Aber die Bemerkung über die Ähnlichkeit zwischen dem Grundriss des Gebäudekomplexes und den Kornkreisen war deutlich zu verstehen.
Dann vernahm ich im Hintergrund plötzlich Rufe. Es handelte sich um gereimte Parolen, wie sie in Remburg für gewöhnlich bei Demonstrationen verwendet wurden.
Schlagartig erinnerte ich mich, was sich im Rathaus abgespielt hatte. Das Schlafzentrum schien die Erinnerung an das Geschehen nur oberflächlich getilgt zu haben. In meinem Unterbewusstsein gab es noch eine Art Sicherheitskopie. Und diese Kopie wurde durch die Geräusche aus dem Diktiergerät nun in mein Bewusstsein geladen.
Die Schmerzensschreie der Demonstranten gellten schrill aus dem Miniaturlautsprecher, begleitet von den harten, bellenden Befehlen der Polizisten.
Der Tumult dauerte nicht lange. Die Demonstranten wurden anscheinend abgeführt. Ruhe kehrte ein. Nur mein regelmäßiges Atmen war noch zu hören – und entfernt hallende Schritte, die vermutlich von einem Regierungsbeamten herrührten, der mit einem Auftrag oder einem Schriftstück versehen durch die Korridore spazierte.
Nachdenklich trank ich aus meinem Becher. Der Kaffee war kalt und schmeckte bitter, aber das bemerkte ich kaum. Stattdessen lauschte ich neugierig in mich hinein. Doch ich fühlte mich weder matt noch müde. Auch sonst gab es keine Anzeichen, dass die Tonbandaufzeichnung mein Schlafzentrum aktivieren könnte. Die zeitliche und räumliche Entfernung, die ich zu den Ereignissen im Rathaus gewonnen hatte, verhinderte offenbar einen neuerlichen Hypnosieanfall.
Da gingen meine Atemgeräusche auf dem Tonband abrupt in ein nasales Schnarren und eine Art kehliges Schnorcheln über.
Ich schnarchte!
Meine erste Reaktion war Beschämung. Das Schnarchen klang entsetzlich hemmungslos und hingebungsvoll. Die Vorstellung, in der Universität auf ähnliche Weise geschnarcht zu haben, war beinahe unerträglich.
Doch dann wurde ich stutzig. Was ich da hörte, schien viel mehr als bloß ein gewöhnliches Schnarchen zu sein. Es kam mir eher vor, als hätte ich versucht, im Schlaf zu sprechen, allerdings ohne dabei die Stimmbänder zu benutzen. Stattdessen formte ich die Worte mit dem Rachen und dem Gaumensegel. Was da aus dem Lautsprecher des Diktiergerätes drang, klang wie eine Beschwörung aus dem Munde eines Neandertalers, dessen Wortschatz sich auf einige wenige Grunz und Schnarrlaute beschränkte.
Niemals hätte ich es für möglich gehalten, die Fähigkeit zu besitzen, derartige Laute von mir zu geben. Doch das Seltsame war: Das Schnarchen löste eine ganze Kette von Erinnerungen in mir aus. Es war, als könnte ich die archaische Sprache auf dem Tonband verstehen!
Hätte ich nicht zuvor auf der Couch Platz genommen, wäre ich nun wahrscheinlich vor Schreck auf den Boden geplumpst. Ich riss die Augen weit und krampfhaft auf und erwartete jeden Moment einen Anfall zu bekommen.
Aber nichts dergleichen geschah. Ich war hellwach. Statt dass ich einen Hypnosieanfall erlitt, manifestierten sich Bilder und Eindrücke in meinem Gehirn, offenbar hervorgerufen durch die Schnarchlaute aus dem Diktiergerät. Die Bilder gruppierten sich, bildeten eine Einheit – und schließlich eine komplette Geschichte.
Nichts von dem, woran ich mich schlagartig erinnerte, hatte ich selbst erlebt oder etwa durch Recherchen in Erfahrung gebracht.
Dafür gab es nur eine Erklärung: Die Bilder in meinem Kopf stammten aus einem Traum, den ich während des Schlafzustandes unter dem Modell der Ladenpassage geträumt hatte. Das Sensationelle daran war: Dieser Traum hatte einen Bezug zu dem Modell – und zu Egon Gratius, dem Leiter des Bauamtes! Ich erinnerte mich an Daten und Fakten, die ich unmöglich hatte wissen können.
Benommen stand ich auf und betrat mein Arbeitszimmer. Wie im Traum fuhr ich den Computer hoch und begann die fremden Erinnerungen aufzuschreiben.
Erst einmal in Gang gesetzt, produzierte mein Gehirn eine Fülle an Details, Dialogen und Namen. Je mehr ich aufschrieb, desto sicherer war ich, nicht bloß eine zufällige Abfolge von flüchtigen Erinnerungsbruchstücken aufzuschreiben, die meine Großhirnrinde im Schlaf abgespult hatte, um sich des Ballastes aus Tageseindrücken zu entledigen. Auch beinhaltete dieser Traum mit Sicherheit kein Symbolmaterial, das mein Unterbewusstsein mir geschickt hatte, damit ich mich und meine Psyche besser verstünde.
Was ich geträumt hatte, hatte wirklich stattgefunden! Es war ein Tatsachenbericht, das Gedächtnisprotokoll eines mir völlig fremden Menschen, vor mir im Traum niedergelegt!
Bis tief in die Nacht saß ich vor dem Computer und schrieb. Als der Text fertig war, gab ich ihm die Überschrift: Der Suizidententurm. In meiner Reportage steht er an erster Stelle, wo er, der Chronologie der Ereignisse folgend, auch hingehört.
Der Traum war erschütternd.
Und das nicht nur, weil ich ihn aus der Perspektive einer Frau erlebte, sondern hauptsächlich deswegen, weil die Ereignisse, die darin vorkamen, genug Zündstoff lieferten, um einen handfesten Skandal im Remburger Rathaus zu entfesseln.
Noch in derselben Nacht beschloss ich, die Story weiterzuverfolgen – auf meine Weise, mithilfe meiner besonderen Fähigkeit und meines Diktiergerätes!
»Jeder Ort hat seine Geschichte, man muss nur verstehen, sie herauszulesen!« Die Bedeutung dieses Satzes wurde mir in jener Nacht erst richtig bewusst. Mir war es gegeben, an Orte gebundene Geschichten träumend aufzuspüren. Wahrscheinlich vermochte ich es schon lange – so lange, wie ich unter Hypnosie litt. Jedes Mal, wenn der Schlafzustand mich überkam, hatte ich einen besonderen Traum. Nur hatte ich mich bisher nie daran erinnern können. Das hatte sich, dank meines Diktiergerätes, nun geändert.
Die kommenden Wochen verbrachte ich damit, Orte aufzusuchen, die mit den Ereignissen um das Bauprojekt im Luzidenweg in Zusammenhang standen. Nicht immer war es so einfach wie im Rathaus, wo mich die Auseinandersetzung zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften in den Schlaf katapultierte und ich mich unter der Vitrine verkriechen konnte. Es war ein hartes Stück Arbeit, bis ich das Material, das nun meine Reportage füllt, zusammengetragen hatte.
Die Ladenpassage im Luzidenweg ist inzwischen fertiggestellt. Ich sitze in diesem Moment in einem Café im ersten Stock des Gebäudes, dessen Modell mich so sehr an Kornkreise erinnert hatte. Vor mir steht ein Espresso. Ich versuche gelassen und ruhig zu bleiben, damit ich das Treffen mit Mathias Gruenenwald nicht vor Aufregung verschlafe.
Ich war an diesem Morgen früh aufgebrochen, um noch einen Platz in dem Café zu ergattern. Aber nur draußen in der Wandelhalle war noch ein Tisch frei gewesen. Hätte ich im Gästeraum sitzen können, würde ich nun durch das Panoramafenster auf den Flusslauf der Hade blicken. Stattdessen muss ich mit der Wandelhalle vorliebnehmen, was mir aber auch recht ist.
Die Halle ist mit Ketten und Reben aus Luftballons reich geschmückt; um die Schaufenster sind Lichterketten drapiert. Die aus Leuchtröhren geformten Schriftzüge der Geschäfte blinken und pulsieren. Dreidimensionale Abbildungen von Spielzeug, Parfümflakons, Uhren und anderen Waren drehen sich über den Köpfen der Passanten, die sich auf den Wandelgängen an den Geschäften und Schaufenstern vorbeischieben.
Hier und da nehmen die Dekorateure an den Posen der Schaufensterpuppen letzte Verbesserungen vor, drapieren noch eine Lichterkette über die Auslage oder justieren einen 3-D-Projektor.
Ein über zwei Meter großer Plüschteddy watschelt die Wandelhalle entlang. Sein Bärenkopf, der bei jedem Schritt wie ein Metronom nach rechts oder links ruckt, ragt grotesk aus der Menge hervor. Der Kerl unter der Verkleidung verteilt Süßigkeiten an die Kinder und Handzettel an die Erwachsenen: Heute ist Einweihung der Luzidenpassage. Luzidenpassage, so wurde das Einkaufszentrum in Erinnerung an die Straße benannt, die dem Bauvorhaben mitsamt den alten Mietshäusern hatte weichen müssen.
Einen besseren Zeitpunkt für die Übergabe des Manuskripts hätte es nicht geben können. Den Menschen sollen die Augen geöffnet werden. Sie sollen erfahren, wer die Einkaufspassage in Wahrheit bauen ließ – und warum der Protest der Bürger scheitern musste. Im Planungsamt werden ein paar Köpfe rollen – und man wird vielleicht sogar erwägen, den Gebäudekomplex für den Publikumsverkehr zu sperren und wieder abzureißen …
Ich schaue zu der dreidimensionalen Abbildung einer Uhr über dem Eingang einer Optikerfiliale empor. Mathias Gruenenwald wird erst in einer knappen Stunde eintreffen – falls er pünktlich ist (was bei dem Chefredakteur einer großen Wochenzeitschrift eigentlich nicht zu erwarten ist). Mir bleibt also Zeit, das Manuskript noch einmal durchzulesen und letzte Verbesserungen vorzunehmen …
Der Suizidententurm
Warm wehte der Abendwind die Uferböschung herauf und trug den Geruch nach Teer und Diesel mit sich. Er raschelte trocken in den Zweigen der Trauerweide, unter der Mark sein Cabriolet geparkt hatte. Mark hatte die Lichterketten in den Chromleisten seines Wagens ausgeschaltet; es war geheimnisvoll schummerig unter unserer Glocke aus Ästen und Zweigen.
Hin und wieder teilte eine Böe den uns umgebenden Laubvorhang und ich konnte einen Blick auf den Flusslauf der Hade erhaschen. Am gegenüberliegenden Ufer schwammen die hellen Fenster von Remburg wie Pixel in der Dämmerung und spiegelten sich tanzend auf dem Wasser. Die bunten Lämpchen an den Karosserien der Fahrzeuge, die die Uferstraßen rauf und runter fuhren, blinkten hektisch, als wollten die Fahrer uns Botschaften über den Fluss senden.
Eine Haarsträhne fiel mir ins Gesicht. Ich strich sie rasch hinters Ohr. Ich wollte Marks Gesicht betrachten, mich am Anblick seiner Augen weiden, die mich im Dämmergrau unter der Laubkuppel liebevoll ansahen.
Mark hatte für unser Rendezvous einen besonderen Platz finden wollen; darum war er mit mir zum alten Wasserturm gefahren und nicht in den Fischereihafen, wohin die Jungs gewöhnlich fuhren, um sich in den Autos mit ihren Freundinnen zu amüsieren.
»Man hat dort keine Ruhe«, hatte Mark verlegen aber mit Nachdruck erklärt. »Ständig hat man das Gefühl, beobachtet zu werden. Und erst diese Witzbolde, die zwischen den Fahrzeugen umherschleichen und den Liebespaaren Streiche spielen – genau dann, wenn es am unpassendsten ist …«
Ich hatte Mark gewähren lassen. Im Hafen stank es mir zu sehr nach Fisch und Teer. Außerdem fühlte ich mich zwischen Liebespaaren unwohl. Der Gedanke an die Szenen, die sich um mich herum in den Autos abgespielt hätten, hätte mich verunsichert.
Da legte sich ein Arm um meine Schultern und Marks Gesicht schob sich langsam auf mich zu. »Du zitterst ja«, stellte er fest und rieb mir mit der Hand fürsorglich über den Oberarm.
Ich versuchte zu lächeln. Aber ich brachte wohl nur eine Grimasse zustande. Mark sah mich verunsichert an, zog sich von mir zurück. Im Halbdunkeln wirkte sein Gesicht weich und markant zugleich – es hatte überhaupt keine Ähnlichkeit mit der starrenden Fratze meines Onkels, dessen Miene wie gemeißelt ausgesehen und sich dann zu dieser schrecklichen Parodie eines lustvollen Ausdrucks verzerrt hatte, als er mit Gewalt in mich eingedrungen war …
»Es ist alles in Ordnung«, sagte ich abrupt und hoffte, Mark würde die Lüge nicht bemerken. Meine Hände lagen wie Steine in meinem Schoß. Ich zwang mich, sie hochzuheben und sie mit den Handflächen nach außen gekehrt an Marks Brust hinaufgleiten zu lassen.
Tief sog ich den Moschusduft ein, den Mark verströmte, versuchte, den Gestank von Alkohol, Zigaretten und Schweiß zu tilgen, den mein Onkel ausdünstete und der sich wie eine Säure in meine Erinnerung geätzt hatte.
Ich seufzte und schaute verzagt auf meine Hände hinab: Sie waren wieder in meinen Schoß zurückgesunken. Mein Onkel würde jetzt schadenfroh kichern, wenn er mich hätte sehen können. Er würde mir ins Gesicht lachen und brüllen, niemand interessiere sich für mich. Ich könne froh sein, wenigstens ihn zu haben …
»Du bist wunderschön«, flüsterte Mark. Behutsam tastete er über mein Gesicht. Aber es wollte sich sträuben, zuckte wie unter nervlicher Anspannung und fühlte sich auf einmal ganz taub an. »Ich habe mich unsterblich in dich verliebt, Lena Klöckner. – Weißt du das eigentlich?«
Ich musste in diesem Moment wohl doch halbwegs glücklich ausgesehen haben, denn Marks Augen leuchteten plötzlich. Bevor ich es mir anders überlegen konnte, schlang ich meine Arme um seinen Nacken. »Ich liebe dich auch«, presste ich hastig hervor und verfluchte die Tränen, die jäh meinen Blick verschleierten.
Unsere Lippen berührten sich zaghaft. Doch Marks Kuss wurde rasch ungestüm und drängend. Seine Hände schlüpften unter meinen Pulli, streichelten meinen Bauch und glitten dann zu meinen Brüsten empor (die viel zu klein waren). Ich hätte Liliputanertitten, hatte mein Onkel krakeelt und sie gewrungen wie Lappen.
Mark berührte meine Brüste jedoch ganz sanft. Seine Hände schwebten fast darüber hinweg, dann drückte er mich fest und leidenschaftlich.
Ich hatte die Augen weit aufgerissen. Nur mühsam konnte ich den Impuls unterdrücken, Mark von mir zu stoßen. Stattdessen küsste ich ihn nur noch wilder und erbebte innerlich, als seine Daumen über meine Brustwarzen strichen.
Angestrengt starrte ich an seinem Gesicht vorbei und spähte verstohlen in den Schatten umher. Es war unter der Weide jedoch keine Menschenseele zu erblicken. Wir waren allein!
Ich lehnte mich im Beifahrersitz zurück, zog Mark mit mir und konzentrierte mich auf seine Hände. Der verwahrloste Platz beim Wasserturm war eine gute Wahl gewesen. Nachts traute sich niemand hierher, weil der Wasserturm als verflucht galt.
Trotzdem hatte ich befürchtet, Franca Feld würde während unseres Rendezvous auftauchen und alles verderben.
Als mein Onkel das erste Mal über mich hergefallen war, war auch Franca, deren Namen ich damals noch nicht kannte, in meinem Zimmer erschienen. Von einem Moment auf den anderen stand sie in der Ecke neben der Tür, als wäre sie aus einem Raumschiff dorthin gebeamt worden oder durch eine Dimensionsfalte direkt in mein Zimmer gestolpert. Ich wusste weder, wer sie war, noch was sie wollte. Sie hatte dunkles Haar, das glatt zu beiden Seiten ihres Gesichts herabhing. Sie trug ein Kleid. Es reichte ihr bis knapp über die Knie und war so nichtssagend wie ein Blick in den grauen Stadthimmel. Ihre Beine waren blass und fahl, genau wie die Arme und das Gesicht. Obwohl die Frau sehr jugendlich wirkte, lag dennoch ein seltsamer Ausdruck von Gleichmut und Entrücktheit auf ihrem Antlitz. Von ihren Augen war nur das Weiße zu sehen, wie bei jemandem, der die Augäpfel in Trance nach oben verdreht. Ihre Hände schwebten dicht über dem Bauch und die Finger spielten miteinander, ohne jedoch Anzeichen von Nervosität zu zeigen, eher so, als würde sie eine geheime Taubstummensprache sprechen.
All dies nahm ich in Sekunden und mit beängstigender Klarheit in mich auf. Mit ihren Milchaugen starrte sie auf das Bett herab, auf das mein Onkel mich geworfen hatte. Es kam mir vor, als hielte die Fremde das, was sich auf der Matratze abspielte, nur für etwas Flüchtiges, das jeden Moment wieder vergehen würde.
Irgendwie hatte diese Erscheinung mir meinen Onkel und das, was er mir antat, erträglicher erscheinen lassen. Anfangs hatte ich versucht, mich gegen ihn zu wehren. Aber es war zwecklos. Er machte sich über meinen Widerstand nur lustig. Schließlich schlug er mir ins Gesicht, schleuderte mich aufs Bett und warf sich auf mich. Ich hatte das Gefühl, unter seinem massigen Leib ersticken zu müssen.
Doch dann war Franca aufgetaucht. Aufrecht und gerade stand sie in ihrer Ecke. Kein Unglück, kein Verbrechen und keine Katastrophe konnten sie berühren, das schien sie mit ihrer Körperhaltung ausdrücken zu wollen.
Als sich mein Onkel befriedigt von mir wegwälzte, verschwand die Frauengestalt wieder. Sie schien sich in Luft aufgelöst zu haben oder war einfach mit den Schatten des Zimmers verschmolzen.
Maria Birkan, die Psychologin, die ich aufsuchte, nachdem mein Onkel Wochen später bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war und ich endlich über die Dinge sprechen konnte, die er mir angetan hatte, behauptete, die geheimnisvolle Fremde sei ein Produkt meiner Psyche, die sich auf diesem Weg eine Möglichkeit geschaffen hatte, das Verbrechen meines Onkels zu überleben.
Ich fand mich mit dieser Erklärung ab, obwohl sie mich nicht recht zufriedenstellte.
Nach der fünften Therapiesitzung entdeckte ich während der Auflösung des Haushalts meines Onkels auf dem Dachboden einen Karton für Damenschuhe. Er gehörte einer Mieterin, die vor meinem Onkel in der Wohnung gewohnt hatte, wie ich bald herausfand. In dem Karton lagen alte Farbfotos. Sie zeigten die Frau, die in meinem Zimmer erschienen war. Nur trug sie auf den Fotografien statt des Kleides einen schlichten Hosenanzug und hatte das Haar auf Schulterlänge gekürzt. Wie sie mit zusammengepressten Beinen und vor dem Bauch erhobenen Händen dastand und mit ihren braunen Augen schüchtern in das Kameraobjektiv blickte, wirkte sie sehr angespannt und verklemmt: keine Spur von Gelassenheit und über den Dingen stehen. Sie machte auf mich ganz und gar den Eindruck eines armen Würstchens.
Eine Nachbarin, die schon länger als mein Onkel in dem Mietshaus wohnte, und der ich die Fotos zeigte, erzählte mir, diese Frau habe Selbstmord begangen. Sie erinnerte sich sogar noch an ihren Namen: Franca Feld. Man fand ihre Leiche in dem Zimmer, das mein Onkel mir überlassen hatte, als ich zu ihm zog. Sie hatte sich mit dem Stromkabel ihres Föhns an einem Haken in der Zimmerdecke aufgehängt.
Ich war mir sicher, die Frau auf dem Foto noch nie zuvor gesehen und von ihr auch nie etwas gehört zu haben. Maria Birkan war trotzdem überzeugt, mein Unterbewusstsein hätte durch eine Bemerkung, der ich keine Beachtung geschenkt hatte, von Franca Feld erfahren und sich aus dem Aufgeschnappten ein Bild zurechtgeschustert, das mich vor dem Verbrechen meines Onkels retten sollte. Ich wollte ihr das gerne glauben. Aber es ging nicht. Ich hatte einen Geist gesehen – davon war ich fest überzeugt!
»Du bist nicht richtig bei der Sache, Lena.« Marks Stimme drang wie durch eine Menschenmenge hindurch in mein Bewusstsein. Er klang enttäuscht und gekränkt.
»Entschuldige«, murmelte ich. Die Erinnerung an meinen Onkel und Franca Feld hatte meinen Geist weit fortgetragen.
»Habe ich etwas falsch gemacht?«, erkundigte Mark sich vorsichtig.
»Sei nicht dumm.« Ich nahm seine Hände und schob sie unter meinen Pulli zurück. Franca Feld war nicht unter der Trauerweide erschienen – dies wertete ich als Zeichen dafür, dass ich Mark vertrauen konnte. Franca war ein Geist, eine Art Schutzengel. Sie tauchte nur dann auf, wenn mir Unrecht getan oder Leid zugefügt wurde, davon war ich überzeugt.
Ich küsste Mark und begann ihm das Hemd aus der Hose zu ziehen. Ich sehnte mich danach, seine Haut auf der meinen zu spüren und die Tätowierungen der Gewalt, die mein Onkel auf meiner Seele hinterlassen hatte, mit seiner Körperwärme auszulöschen.
Da wurde die Weide unvermittelt von Scheinwerferlicht erfasst; es wischte in zerrissenen Streifen über Marks Haar und die Armaturen. Dumpf drang das Dröhnen eines Motors zu uns herüber.
Erschreckt ließen wir voneinander ab. »Verdammt!«, fluchte Mark, während ich meinen Pulli hektisch in Ordnung brachte.
Wir konnten das Vehikel wegen des Vorhangs aus herabhängenden Zweigen nicht erkennen. Aber wir hörten den Kies unter den Reifen knirschen, während das Auto der Trauerweide immer näher kam. Schließlich hielt der Wagen neben uns an. Nur die herabhängenden Zweige trennten die Fahrzeuge voneinander. Der Motor erstarb, die Scheinwerfer und auch die Zierleuchten erloschen. Stille breitete sich aus, leise untermalt von dem fernen Rauschen der Stadt und dem Tuten der Hade-Barkassen.
»Mist!«, presste Mark zwischen den Zähnen hervor. »Gibt es in Remburg denn keinen Ort, wo man ungestört ist?«
Aus dem Wagen neben uns drangen Männerstimmen. Der Wind teilte die Zweige, und für einen flüchtigen Moment konnte ich einen Blick auf die Insassen des anderen Wagens erhaschen.
Ich sah zwei Männer. Die Lichter vom gegenüberliegenden Ufer der Hade beleuchteten ihre Gesichter. Sie redeten wild gestikulierend aufeinander ein und schienen das Liebespaar, neben dem sie parkten, gar nicht zu bemerken.
Ein neuerlicher Windstoß ermöglichte es mir, die Kerle genauer in Augenschein zu nehmen. Der Mann am Steuer war korpulent und hatte eine Halbglatze. Er trug eine Brille mit dickem schwarzem Rand und machte einen ziemlich durchschnittlichen Eindruck. Selbst der maßgeschneiderte Anzug ließ ihn nicht elegant erscheinen.
Der Mann auf dem Beifahrersitz hingegen wirkte drahtig und war wesentlich kräftiger als der Fahrer. Seine Wildlederjacke mit den Fransen am Arm und über der Brust ließ ihn wie einen Country-Club-Sänger aussehen. Die Falten in seinem Gesicht wirkten angeordnet wie Wellen auf einem See, in den jemand einen Stein geworfen hatte. Die Nase bildete dabei das Zentrum, von dem die Falten ringförmig ausgingen.
»Den Typ am Steuer habe ich schon einmal auf einem Zeitungsfoto gesehen«, flüsterte Mark. »Er ist Vorsitzender im Bauausschuss von Remburg und heißt Dormann.«
»Lass uns lieber von hier verschwinden«, sagte ich unbehaglich. »Der Kerl mit dem Faltengesicht ist mir nicht geheuer.«
Mark seufzte und warf mir durch die Dunkelheit einen sehnsuchtsvollen Blick zu. »Schade«, murmelte er. »Ich war mir so sicher, hier ungestört zu sein.«
»Wir könnten ja irgendwo tanzen gehen«, schlug ich vor.
»Ich dachte, du fühlst dich zwischen den vielen Leuten nicht wohl?«
»Wenn du bei mir bist, ist das anders«, erwiderte ich und lächelte. »Ich vertraue dir, Mark.«
Ein zufriedenes Grinsen machte sich auf Marks Lippen breit. Er wollte etwas erwidern, doch das Krachen eines Schusses kam ihm zuvor.
Entsetzt riss ich den Kopf herum und starrte durch die Zweige, die der Wind in diesem Moment wie einen Theatervorhang beiseiteschob.
Die Seitenscheibe des anderen Wagens war blutverschmiert. Das Gesicht des Fahrers lehnte dagegen. Es war verzerrt, der Mund leicht geöffnet und die Augen hinter der verrutschten Brille gebrochen. In der Stirn des Mannes klaffte ein daumennagelgroßes Loch, aus dem Blut sickerte.
Ein gellender Schrei durchschnitt die Nacht. Erst als Mark mir seine Hand auf die Lippen presste und der Schrei erstarb, gewahrte ich, dass ich es gewesen war, die ihn ausgestoßen hatte.
»Scheiße! Jetzt weiß der Kerl, dass er beobachtet wurde!« Zitternd packte Mark den Zündschlüssel. Er startete den Motor, rammte den Schaltknüppel in den Rückwärtsgang und gab Gas.
Die Lichterketten flammten auf und das Cabriolet machte einen Satz nach hinten. Ich schlug mit dem Gesicht fast gegen das Handschuhfach; Zweige peitschten über mich hinweg, als der Wagen rückwärts unter der Trauerweide hervorschoss.
Mark kurbelte an dem Steuer und das Cabriolet beschrieb eine enge Kurve. Kies spritze zu den Seiten weg. Ich prallte unsanft gegen Marks Schulter. Dann stand der Wagen still – die Kühlerhaube zielte auf die Ausfahrt des Wasserturmgeländes.
Hektisch riss Mark an dem Schalthebel der Automatik. Aber er schaffte es nicht mehr, einen Gang einzulegen, denn der Kerl mit der Wildlederjacke tauchte blitzartig vor uns auf. Mit einer elegant anmutenden, fließenden Bewegung richtete er seine Pistole auf Mark und feuerte.
Die Kugel durchschlug die Windschutzscheibe und fetzte ein Loch in die Schulterpartie von Marks Hemd.
Ich schrie, und Marks Hand ruckte zur verletzten Schulter empor. Dann sank er über dem Gangschaltungsknüppel zusammen.
Bevor ich irgendetwas tun konnte, tauchte der Killer an meiner Seite auf. Gelassen presste er mir den Lauf seiner Waffe gegen die Schläfe, zischte: »Keinen Mucks, Kleine! Oder es ergeht dir wie dem Kerl, dem ich gerade das Gehirn weggepustet habe.«
Er würde seine Drohung wahr machen – daran zweifelte ich keinen Moment. Voller Todesangst hob ich die Hände; sie zitterten wie die eines Junkies, der auf eine Spritze wartete. »Ich … ich bin ganz ruhig«, versicherte ich mit weinerlicher Stimme.
Der Mann beugte sich über mich. Stechender Schweißgeruch quoll unter seiner Wildlederjacke hervor. Die Pistolenmündung drückte schmerzhaft gegen meinen Kopf, während er den Zündschlüssel aus dem Schloss zog und der Motor absoff. Die lustigen Lichter an den Zierleisten erloschen.
Mark erhielt einen derben Stoß. Stöhnend kippte er gegen die Fahrertür, das Gesicht vor Schmerz verzerrt und die Augen fest geschlossen. Blut sickerte zwischen seinen Fingern hervor, die die verletzte Schulter hielten.
»Aussteigen!«, befahl der Killer. Er riss die Beifahrertür auf, packte mich am Pulli und zerrte mich brutal aus dem Wagen. Mit der Waffe dirigierte er mich um das Fahrzeug herum und öffnete die Fahrertür. Mark stürzte seitlich auf den Boden und blieb benommen liegen.
»Hilf ihm!«, herrschte der Killer mich an. »Wir gehen zum Wasserturm. Der Boss soll entscheiden, was mit euch geschieht!«
Wimmernd zog ich Mark auf die Beine, legte seinen Arm um meine Schultern und umschlang dann seine Hüften. »Geht es?«
Benommen drehte er dem Killer das Gesicht zu. »Bitte!«, flehte er. »Lassen Sie Lena gehen. Sie wird Sie bestimmt nicht verraten!«
»Halt die Klappe!« Der Killer schlug Mark den Pistolengriff quer über das Gesicht. Mark ging in die Knie, und ich wäre beinahe gestürzt. Mühsam richtete ich ihn wieder auf; Tränen liefen mir über die Wangen.
»Sei bloß still«, jammerte ich. »Der Typ wird dich sonst umbringen.«
Mark hob den Kopf. Sein Gesicht sah schrecklich aus: Die Oberlippe war aufgeplatzt und Blut rann das Kinn hinab. »Er – darf dir nichts tun«, presste er mit erstickter Wut hervor.
»Mir wird schon nichts passieren«, sagte ich zitternd.
Der Killer bohrte mir die Waffe in den Rücken. »Vorwärts«, befahl er, »sonst erledige ich euch auch ohne Anweisung vom Boss!«
Wie ferngesteuert setzte ich mich Richtung Wasserturm in Bewegung, sorgsam darauf bedacht, dass Mark mit mir Schritt halten konnte. Der Turm stand auf einem Hügel, ragte wie ein riesiger Phallus oder eine Mondrakete aus einer Baumgruppe in den Himmel. Seine Silhouette verdeckte die blassen, ängstlich blinkenden Sterne.
Mark hing schwer an meiner Seite. Er drohte immer wieder wegzusacken. Ich musste meine ganze Kraft aufbringen, ihn auf den Beinen zu halten. Wankend schleppten wir uns den Hügel hinauf. Das Unkraut war kniehoch; von den umstehenden Bäumen hingen Zweige herab, die wie Knochenfinger über meinen Kopf kratzten. Die vertrauten Laute der Stadt schienen endlos weit entfernt; ich konnte mir nicht vorstellen, je wieder Teil von ihr zu werden, durch ihre Straßen zu hasten oder müßig in einem Café zu sitzen. Remburg hatte mich abgeschrieben. Ich war so gut wie tot!
Als wir den Wasserturm erreichten, war ich schweißgebadet. Die Mauer nahm jetzt mein ganzes Blickfeld ein. In den Ritzen der Steine siedelten Birkensprösslinge und Flechten. Neben den Steinstufen lehnte eine Bretterwand, die der Form nach zu urteilen vor den Eingang gehörte, der schwarz in der Turmmauer gähnte.
Ich hatte in der ›Remburger Woche‹ gelesen, dass die Tore und Fenster des Wasserturms von der Polizei mit Brettern vernagelt worden waren. Die Bretterverhaue sollten Selbstmörder daran hindern, das Gemäuer zu betreten und aus den Fenstern des Dachgeschosses zu springen. Doch wenige Wochen später las man von Leuten, die trotzdem in den Turm eingedrungen waren und sich durch eine Luke in den leeren Reservoirbehälter gestürzt hatten. Der Behälter war dreißig Meter tief und bestand aus Kupfer. Der Aufprall eines Körpers soll ihm einen Ton entlocken, der dem Klang einer Kirchenglocke nicht unähnlich ist.
Der Killer dirigierte uns die Stufen hinauf auf den Eingang des Wasserturms zu. Kühle Luft, die nach Moder und Rost roch, strömte aus der Öffnung.
Zögernd blieb ich vor der Schwelle stehen. Der Killer zog unterdessen eine Taschenlampe unter seiner Wildlederjacke hervor, ließ sie aufflammen und richtete den Lichtstrahl ins Innere des Turms. »Worauf wartet ihr?«, knurrte er und versetzte mir einen Stoß in den Rücken.
Ich stolperte mit Mark vorwärts und fand mich in einem hohen Raum wieder. Er war mit Gerümpel und Unrat vollgestellt. Eisenträger verliefen kreuz und quer durch das Gewölbe. Zwischen den Stützpfeilern stapelten sich Müllsäcke; matt reflektierten sie das Licht der Taschenlampe. Einige der Beutel waren aufgeplatzt, ihr Inhalt hatte sich auf den Boden ergossen. Maden wanden sich in dem Unrat, Ratten brachten sich huschend vor dem Licht in Sicherheit.
Der Killer richtete den Strahl der Taschenlampe auf eine Leiter. Sie war vor Rost ganz schuppig und braun, führte steil die Wand empor und verlor sich über unseren Köpfen in der Dunkelheit und dem Gewirr aus Stahlträgern. Parallel zur Leiter verlief ein Dutzend Rohre und Leitungen in die Höhe. Lumpen steckten zwischen den Leitungen; inmitten des Rohrgeflechts huschten Schatten mit glühenden Augenpaaren, die mich anstarrten.
»Ihr klettert voran!«, schnauzte der Killer und deutete mit der Waffe auf die Leiter.
Zweifelnd sah ich Mark von der Seite an. Er atmete pumpend wie nach einem Hundertmetersprint. Wankend und mit nach vorn geneigten Oberkörper stand er da, seinen rechten Arm kraftlos auf meine Schulter gelegt, während der andere wie gelähmt an der Seite herabhing. Ich wollte ihn aufrichten, ihm in die Augen sehen und mit ihm sprechen. Aber sein Kopf sank auf die Brust zurück. Speichel troff zwischen den Lippen hervor, vereinigte sich mit dem Blut zu einem sämigen Faden und baumelte wie ein Parasit von Marks Unterlippe herab.
»Mark wird den Aufstieg nicht schaffen«, sagte ich an den Killer gewandt.
»Wenn er sich vor Augen hält, was ich mit ihm anstelle, sollte er schlappmachen, wird er wieder zu Kräften kommen«, erwiderte dieser kalt und trat Mark in den Hintern. Der wurde von meiner Seite gerissen und stolperte benommen auf die Leiter zu.
Unter großer Kraftanstrengung hob Mark die Arme und klammerte sich an den Sprossen fest. Mit lahmen Bewegungen schickte er sich an, die Leiter emporzuklettern. Er schaffte jedoch nur drei Sprossen, dann rutschte er mit dem Fuß ab und wäre wohl gestürzt, wenn ich ihn nicht gehalten hätte.
»Warum sind Sie so grausam zu uns?« Ich drückte Mark mit meinem Körper gegen die Leiter und starrte den Killer über die Schulter hinweg wütend an. »Wir haben Ihnen doch nichts getan!«
Da bohrte sich von hinten etwas Hartes zwischen meine Schenkel. Es war der Pistolenlauf. Der Killer presste die Waffe gegen meinen Schritt und drehte sie dann langsam hin und her.
Eiseskälte breitete sich in mir aus, fror jede Empfindung, jedes Gefühl in meinem Inneren zu einem tauben Klumpen zusammen. Der Killer stand jetzt dicht hinter mir; ich spürte seinen Atem im Nacken und den Lauf seiner Pistole zwischen den Beinen.
»Ich werd’ nachher ganz besonders nett zu dir sein«, versprach er ätzend. »Und dein Freund darf dabei sogar zusehen.«
»Lassen Sie Lena in Frieden«, keuchte Mark.
Der Killer zog die Pistole zurück und ließ sie wie ein Cowboy über seinem Kopf kreisen. »Mach, dass du nach oben kommst, du Held!«, rief er spöttisch. »Wenn du noch mal abrutschst, werde ich dich töten. Schließlich will ich von dir auf halber Leiterhöhe nicht in die Tiefe gerissen werden. Es ist noch eine verdammt lange Strecke bis nach oben zum Boss.«
»Ich – werde es schaffen!« Langsam, wie ein Faultier, erklomm Mark die ersten Sprossen. Ich folgte ihm dichtauf, um ihn halten zu können, falls er wieder abglitt. Marks Gegenwart flößte mir Zuversicht und Hoffnung ein, obwohl von ihm in seinem Zustand keine Hilfe zu erwarten war. Ich redete mir aber ein, wir könnten es irgendwie schaffen, heil aus dieser Sache herauszukommen, wenn wir nur zusammenblieben.
Sprosse für Sprosse erstiegen wir die Leiter. Jedes Mal, wenn der Killer unter uns beim Klettern nachfasste, zuckte der Strahl seiner Taschenlampe über unsere Köpfe hinweg, wischte über die Rohre und ließ die Augen der Ratten aufglühen, die auf den Stahlträgern umherturnten. Die Pistole in seiner anderen Hand schlug metallisch gegen die Sprossen; ein Laut, der kalt und hämmernd in dem Turm widerhallte.
Nach einigen Metern wichen die Rohre und Stahlträger der kupfernen Außenwand des Reservoirbehälters. Sie war mit Grünspan überzogen und schimmerte feucht. Wir passierten während des Aufstiegs mehrmals Plattformen aus Eisengittern, die kreisförmig um den Behälter herumführten. Werkzeuge und ölverschmierte Lumpen zeichneten sich auf den Gittern ab.
Mark zitterte vor Anstrengung am ganzen Körper, zog die Beine schwerfällig nach, wimmerte, fluchte und kämpfte sich trotzdem weiter, als würde am Ende der Leiter die Erlösung auf uns warten. Die Angst hatte uns beide fest im Griff. Jeder Gedanke an Gegenwehr war versiegt, wie einst das Wasser im Reservoir, als der Zuleitungshahn für immer zugedreht wurde.
Die Leiter schien endlos. Marks Keuchen über mir und das metallische Klacken unter mir bildeten einen hallenden Klangteppich, dem das Pochen meines Herzens einen treibenden Rhythmus verlieh. Da tauchte über uns eine gemauerte Decke auf. Darin klaffte eine rechteckige Öffnung, durch die die Leiter steil hindurchführte.
Wir hatten den Zugang zur obersten Plattform erreicht.
Mark kroch ächzend durch die Luke und verschwand aus meinem Blickfeld. Plötzlich war der Killer hinter mir. Er drängte sich an meinen Rücken und schob mich mit einer kraftvollen Bewegung nach oben. Nachdem wir die Öffnung passiert hatten, stieß er mich von sich und löschte die Taschenlampe.
Benommen rappelte ich mich auf und sah mich um. Wir befanden uns in der Turmspitze; über mir wölbte sich ein Kegeldach. Es war schadhaft. Sternenlicht sickerte durch die Löcher, fächerte schräg durch den Raum und malte fahle Flecken auf den staubigen Boden auf und die beiden Reservoirdeckel, die so groß wie Bistrotische und mit einem Ventilrad versehen waren. Eine der Luken stand offen.
Nur wenige Schritte entfernt von mir bemerkte ich Mark. Er kauerte am Boden und rang keuchend nach Atem, hustete, spuckte und wischte sich mit dem Ärmel Speichel und Blut von den Lippen.
Am liebsten hätte ich mich an ihn geschmiegt und mein Gesicht an seine Schulter gedrückt. Aber dafür war jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Außerdem hatte ich am gegenüberliegenden Ende des Raumes eine Gestalt bemerkt. Es handelte sich um einen massigen Mann, der auf einem Klappschemel saß und eine Zigarre zwischen den Lippen drehte. Die Glut hüllte das Gesicht in rötlichen Schimmer. Der Kopf war völlig haarlos und von wulstigen Adern durchzogen. In den Adern pulsierte es, sodass es den Anschein hatte, als würden sie sich wie Würmer unter der Haut winden und über das Gesicht kriechen.
Eine furchtbare Erkenntnis stieg unerwartet in mir auf: Ich hatte von diesem Mann gehört! Sein Name war Ader – und es hieß, niemand, der sein Gesicht gesehen hätte, bliebe lange genug am Leben, um anderen davon berichten zu können. Viele Schreckensgeschichten rankten sich um diesen Kerl. Er war das Oberhaupt der Remburger Unterwelt und führte in seiner Organisation ein hartes Regiment.
»Wie ist es mit Dormann gelaufen?« Die Stimme vom anderen Ende des Raumes klang volltönend und tief. Eine lauernde Ruhe schwang darin, wie bei einem Raubtier, das erst verhalten knurrte, ehe es sich auf seine Beute stürzte.
»Dormann wollte auf Ihre Forderungen nicht eingehen, wie Sie bereits erwartet hatten«, erwiderte der Killer sachlich. Er war ein paar Schritte auf seinen Boss zugegangen, dann aber auf halber Strecke stehen geblieben, als befürchtete er, dem Mann zu nahe zu kommen.
»Und was sollen die beiden jungen Leute hier?«, erkundigte sich Ader scheinbar gelassen.
»Sie haben gesehen, wie ich Dormann kaltmachte.« Das erste Mal vernahm ich so etwas wie Angst in der Stimme des Killers.
»Das war sehr unvorsichtig von dir, Rolf«, bemerkte Ader wie beiläufig. »Wirst du etwa nachlässig?«
»Ich bieg das wieder gerade«, versprach der Killer hastig.
Ader schüttelte den Kopf, wobei die Zigarre in seinem Mund rote Linien in die Dunkelheit zeichnete. »Dormanns Hinrichtung sollte eine Warnung für all diejenigen sein, die nicht willens sind, das Projekt im Luzidenweg zu unterstützen. Der Tod dieser beiden jungen Leute wird dem Ganzen einen üblen Beigeschmack verleihen und die Aktion dilettantisch und überstürzt erscheinen lassen.«
»Es wird alles nach Selbstmord aussehen«, versicherte Rolf. »Niemand wird auf die Idee kommen, es könnte ein Zusammenhang zwischen Dormanns Ermordung und dem Tod dieses Liebespaares bestehen. Ich werfe die beiden einfach in das Reservoir. Sie wären nicht die Ersten, die im Wasserturm auf diese Weise den Freitod suchten.«
»Du hast auf den jungen Mann geschossen, Rolf.«
»Ich werde die Kugel aus seiner Schulter puhlen, bevor ich ihn in die Tiefe stoße. Für das Loch in der Windschutzscheibe seines Wagens werde ich mir auch noch eine Lösung einfallen lassen.«
»Ich warne dich, Rolf. Sollte es noch einmal zu einem ähnlichen Zwischenfall kommen, sehe ich mich gezwungen, nach einem anderen Vertrauten Ausschau zu halten.«
Ader erhob sich. Dies geschah völlig geräuschlos und ohne jedes Anzeichen von Behäbigkeit. Er klappte den Schemel zusammen und klemmte ihn sich unter den Arm, wo er fast verschwand. Die Zigarre in seinen Mundwinkel schiebend, schritt er an mir vorbei auf die Leiter zu. Er gab sich völlig gelassen und würdigte die beiden Menschen, deren Todesurteil er soeben ausgesprochen hatte, keines Blickes.
»Meine Eltern würden niemals an einen Selbstmord glauben!« Erschreckt hob ich die Hand an die Lippen. Ich konnte nicht fassen, diese Worte wirklich ausgesprochen zu haben. Sie waren zudem gelogen, denn meine Eltern waren längst tot. Sie starben während eines Geiseldramas in einer Remburger Bank, als ich vierzehn war. Danach lebte ich vier Jahre bei meinem Onkel. Maria Birkan würde keinen Moment zögern, den Polizeibeamten, die Nachforschungen über meinen Tod anstellten, zu bestätigen, ich sei äußerst labil und selbstmordgefährdet gewesen.
Ader war vor der Bodenöffnung stehen geblieben, drehte sich langsam zu mir um. Die Glut seiner Zigarre warf einen rötlichen Schimmer auf seine Stirn, die gekraust war. Die Adern schnippten wie Gummischläuche unter der Haut hin und her.
Langsam kam Ader auf mich zu. Er nahm mein Kinn in seine Pranke und betrachtete mein Gesicht aufmerksam, während er meinen Kopf prüfend nach links und rechte drehte.
»Es ist schade um dich«, kam es leise über seine Lippen, als wären seine Worte nur für mich bestimmt. »Du bist etwas Besonderes, Mädchen. In dir schlummert eine Begabung. Ich wünschte, du müsstest nicht sterben.«
Er ließ mein Kinn wieder los, wandte sich ab und kehrte zur Leiter zurück. »Du hast gehört, was das Mädchen gesagt hat!«, rief er, ohne sich nach seinem Killer umzudrehen. »Lass es so aussehen, als hätte ihr Geliebter sie gegen ihren Willen mit in den Tod gerissen.«
Rolf kicherte. »Wird mir ein Vergnügen sein, Boss!«
Wie ein Schatten glitt Ader durch das Rechteck im Boden und verschwand. Ich wusste, dieser massige Mann stieg nun die Sprossen hinab. Aber es war kein Laut zu vernehmen.
Rolf stand mit einem Mal vor mir. Blanker Hass hatte die Falten in seinem Gesicht in Wallung versetzt. »Ihr habt mir eine Menge Ärger eingebrockt«, zischte er und starrte mich durchdringend an. »Du wirst verstehen, dass ich dir als Ausgleich etwas Gewalt antun muss. Ader hat befohlen, es so aussehen zu lassen, als wenn dein Geliebter dich gegen deinen Willen in den Reservoirbehälter gestoßen hat. Das Ganze wird überzeugender wirken, wenn an deinen sterblichen Überresten während einer späteren Obduktion Spuren entdeckt werden, die deinen Freund als einen brutalen Schurken entlarven.«
Blitzschnell schossen seine Hände vor. Er packte meinen Pulli am Ausschnitt und riss ihn mit einem kräftigen Ruck über der Brust entzwei.
Wegen Mark hatte ich an diesem Abend weder ein T-Shirt noch einen BH angezogen. Barbusig stand ich da; der Pulli hing in Fetzen von meinen Schultern herab. Rolf starrte mich mit lüsternem Blick an.
Panisch wich ich zurück. Rolf wollte mich packen. Doch da schoss ein Schatten auf ihn zu. Es war Mark! Mit letzter Kraft hatte er sich auf die Beine gekämpft und rammte Rolf mit gesenktem Oberkörper den Kopf in den Magen. Wie ein Ringer, der sich halb besiegt noch einmal aufgerafft hatte, um dem Kampf eine letzte Wendung zu geben, umklammerte Mark den Killer und schob ihn auf den offenen Reservoirdeckel zu.
Mit einem Aufschrei riss Rolf die Fäuste hoch und schmetterte sie Mark auf den Rücken. Die Beine knickten Mark unter dem Körper weg, aber er ließ nicht locker, klammerte sich noch entschlossener um die Körpermitte des Killers und versuchte ihn, auf den Knien rutschend, zur Luke hin zu drängen.
Rolf stieß ein Knie empor und rammte es Mark in den Magen. Er tat es immer wieder, bis Mark an Rolfs Beinen hinabglitt und zusammengekrümmt am Boden liegen blieb – nur einen halben Meter von dem offenen Reservoirdeckel entfernt.
Rolf trat noch ein paarmal zu, dann erst beruhigte er sich wieder und ruckte seine Wildlederjacke mit unwirschen Schulterbewegungen zurecht.
»Ich hätte Lust, dich gleich jetzt in das Reservoir zu werfen«, keuchte er atemlos. »Aber du sollst mit ansehen, was ich mit deiner Freundin anstelle!«
Er lachte und wirbelte zu mir herum.
Für einen Moment hatte ich wirklich geglaubt, Mark würde uns retten. Ich war wie versteinert gewesen und hatte den kurzen Kampf reglos verfolgt. Rote Schleier wallten vor meinen Augen. Ich sah Rolf erst, als er unmittelbar vor mir stand. Er grub seine Finger in das Fleisch meiner Schultern und schleuderte mich zu Boden. Ich versuchte wegzukriechen, aber Rolf packte meine Hosenbeine und begann daran zu zerren.
Instinktiv hielt ich die Hose fest. Aber Rolf verpasste mir eine Ohrfeige. Ich wurde auf den Boden zurückgeworfen, schmeckte plötzlich Blut auf den Lippen. Verzweifelt drehte ich den Kopf zur Seite und starrte in die Dunkelheit. Aber von Franca Feld war weit und breit nichts zu sehen!
Rolf hatte unterdessen meine Hose und meinen Schlüpfer an sich gebracht, schleuderte beides in Marks Richtung und lachte irre. Dann machte er sich an dem Reißverschluss seiner Hose zu schaffen. Sein steifes Glied schob sich daraus hervor wie eine Muräne aus ihrer Grotte.
Voller Panik warf ich den Kopf auf die andere Seite – und erstarrte.
Neben mir stand ein Mann in einem dunklen Anzug. Sein Gesicht, durch eine dickrandige Brille verunziert, wirkte seltsam entrückt und gleichmütig. Die Augäpfel hinter den Brillengläsern schimmerten weiß, sie besaßen weder Pupille noch Iris.
Ich erkannte den Mann sofort wieder. Es war Dormann, den Rolf vor wenigen Minuten unten im Wagen erschossen hatte!
»Unternehmen Sie doch etwas!«, flehte ich.
Rolf, der sich gerade anschickte, sich über mich zu beugen, hielt verstört inne. »Was soll der Quatsch?« Er schien Dormann nicht bemerkt zu haben, obwohl er direkt neben uns stand.
»Es liegt leider nicht mehr in meiner Macht, in das Schicksal der Lebenden einzugreifen«, hörte ich Dormann sagen. Eigentlich vernahm ich seine Stimme nicht wirklich. Es war vielmehr so, als wären seine Worte eine Erinnerung, die sich mit einem Mal in mir regte.
»Sie – sind ein Geist!«, dämmerte es mir. Obwohl die Angst bis in die letzte Faser meines Körpers hinein Besitz von mir ergriffen hatte, schoss mir dieser Gedanke mit seltsamer Klarheit durch den Kopf. Ich hatte mit meiner Vermutung richtig gelegen: Unter bestimmten Voraussetzungen konnte ich Geister sehen!
Bisher hatte ich angenommen, diese Fähigkeit würde sich nur auf den Geist von Franca Feld beschränken. Doch das war anscheinend ein Irrtum gewesen.
»Wirst du etwa hysterisch?« Rolf stierte angewidert auf mich herab. »Ich kann Verrückte nicht ausstehen, hörst du! Sie sabbern und reden Schwachsinn!«
Ich sah, wie Dormann den Kopf schüttelte. »Ich bin wohl noch nicht lange genug tot, um das Geschehen auf der Erde mit der gebührenden Gleichgültigkeit zu betrachten«, wehte seine Stimme durch meinen Kopf. »Ich verabscheue diesen Kerl. Stellen Sie sich vor, er hat seine eigene Mutter umgebracht, weil er es nicht ertrug, sie pflegen zu müssen. Sie war im Alter schwachsinnig geworden, darum erstickte er sie mit einem Kissen und verscharrte ihre Leiche im Keller ihres Hauses. Ich bin ihr begegnet, nachdem Rolf mir eine Kugel durch den Kopf gejagt hatte. Sie ist immer in seiner Nähe und beobachtet jeden Mord, den er verübt.«
Er deutete hinter sich. Da erst gewahrte ich die anderen Gestalten. In Gruppen standen sie beisammen und starrten mit ihren milchigen Augen zu mir herüber. Unmittelbar hinter Dormann hielt sich eine Frau mit schlohweißem, wirr abstehendem Haar auf. Sie trug ein Rüschennachthemd, das aus Nebel gewirkt zu sein schien. Ihr Gesicht war mit Falten überzogen, die konzentrische Kreise um die Nase bildeten.
Das musste Rolfs Mutter sein. Bei den anderen Gestalten handelte es sich vermutlich um die Geister von Rolfs Mordopfern – oder um die Selbstmörder, die in dem Wasserturm den Tod gefunden hatten.
Unerwartet wurde ich an den Haaren gepackt. Rolf zwang mich, ihm ins Gesicht zu sehen.
»Was ist los mit dir?« Speichel spritzte aus seinem Mund. »Es macht keinen Spaß, eine Verrückte zu ficken!«
»Ihre Mutter … Sie ist hier!« Meine Stimme klang rau und fremd.
Abrupt ließ Rolf mich los und starrte mich mit weit aufgerissenen Augen an. Sein Glied hing jetzt schlaff und zusammengeschrumpft aus dem Hosenschlitz.
»Ich weiß, was Sie Ihrer Mutter angetan haben«, fuhr ich fort und robbte rückwärts von ihm weg. »Sie haben sie umgebracht und im Keller verscharrt!«
Rolf sprang auf. Er sah sich um, als wollte er sich vergewissern, ob seine Mutter wirklich anwesend war. Aber sein Blick ging durch die Gestalten hindurch.
»All die Morde, die Sie verübt haben, hat Ihre Mutter miterleben müssen«, setzte ich nach. »Sie kennt jede Grausamkeit, jedes Verbrechen, das Sie begangen haben – weil sie immer bei Ihnen ist!«
»Du lügst!«, kreischte Rolf. »Du … du bist verrückt – genau wie meine Mamuschka!«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich sage die Wahrheit. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen Ihre Mutter beschreiben – sie steht gleich dort drüben.« Ich deutete mit einem Kopfnicken zu der Frau hinüber. »Sie sieht Ihnen sehr ähnlich, Rolf – die sonderbaren Falten in Ihrem Gesicht haben Sie von ihr.«
Rolf hob abwehrend die Hände und taumelte rückwärts von mir weg. »Nein!«, rief er. »Nein, nein, nein … Das glaube ich alles nicht!«
Im Zurückweichen stieß er mit der Ferse gegen Marks Körper. Entsetzt ruderte der Killer mit den Armen. Er konnte die Rückwärtsbewegung aber nicht mehr stoppen, stolperte über Mark hinweg und stürzte dann rücklings auf die offene Bodenluke zu, die ihn kurz darauf verschluckte.
Rolfs Schrei brach sich hohl an den Kupferwänden des Reservoirs. Das Brüllen riss im selben Moment ab, als ein voller, dröhnender Laut wie ein Glockenschlag aus der Tiefe des Kupferbehälters emporstieg und den Boden des Dachgeschosses erzittern ließ.