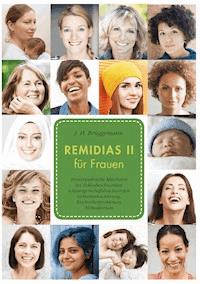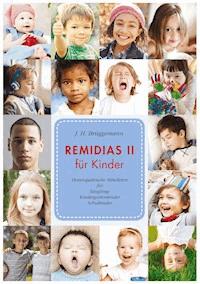
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
IIn diesem homöopathischen Mittellehre (Materia medica) beschreibt der Kinderarzt und Homöopath Dr. Jan Hein Brüggemann die Wirkung von mehr als 100 homöopathischen Arzneien die sich speziell bei Kinderbeschwerden bewährt haben. Der Autor hat bei der Arbeit an diesem Buch neben eigenen Erfahrungen, Fortbildungen und Vorträgen immer wieder die Quellen alter und neuer homöopathischer Meister im Hinblick auf kinderrelevante Themen textkritisch durchforstet und letztlich aus all diesen „Zutaten“ ein prägnantes gut lesbares Kompendium entwickelt und zusammengestellt. Die Homöopathie vermag, wie in der täglichen Arbeit immer wieder faszinierend zu beobachten, vielen Kindern da zu helfen, wo traditionelle Schulmedizin zwar wichtige akute Symptombekämpfung, aber keine echte Dauerheilung ohne langfristige Nebenwirkungen anbieten kann. Um nur einige Beispiele zu nennen: Wiederkehrende Infekte, Schlaflosigkeit, Neurodermitis, Schulschwierigkeiten, Ängste oder erhebliche Selbstwertprobleme. Diese Liste ließe sich beliebig verlängern. Quintessenz: Klassische schulmedizinische Erkenntnisse und komplementäre Medizinerfahrung wie etwa die traditionelle chinesische Medizin, Osteopathie und eben auch sehr häufig die homöopathische Behandlung ergänzen sich in vielen Bereichen außergewöhnlich gut und helfen unseren kleinen Patienten im Alltag deutlich besser als jeder theoretische Richtungsstreit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arzneimittellehre zurREMIDIAS-family-Repertorisierungssoftware Online homöopathische Mittel finden
Inhalt
Einleitung
Gedanken zur Homöopathie
Abrotanum (Eberraute, Compositae, Korbblütler)
Aconitum napellus (Sturmhut, Ranunculaceae, Hahnenfußgewächse)
Aethusa (Hundspetersilie, Umbelliferae, Doldenblütler)
Agaricus (Fliegenpilzfruchtkörper, Pilz)
Ailanthus glandulosa (Götterbaum, Simarubaceae)
Allium cepa (Küchenzwiebel, Liliaceae, Liliengewächse)
Aloe socotrina (Aloe, Liliaceae, Liliengewächse)
Alumina (elementares Aluminium)
Ambra grisea (Pottwalsekret, Tierprodukt)
Anacardium orientale (Indische Elefantenlausnuss, Anacardiaceae)
Antimonium crudum (schwarzer Spießglanz)
Antimonium tartaricum (Brechweinstein)
Apis mellifica (Honigbiene, Insekt)
Argentum metallicum (elementares Silber)
Argentum nitricum (Silbernitrat)
Arnica montana (Bergwohlverleih, Compositae, Korbblütler)
Arsenicum album (weißes Arsenik)
Arum triphyllum (Aronstab, Araceae, Aronstabgewächse)
Baptisia tinctoria (Wilder Indigo, Leguminosae, Hülsenfrüchtler)
Barium carbonicum (Bariumcarbonat)
Barium muriaticum (Bariumchlorid)
Belladonna (Tollkirsche, Solanaceae, Nachtschattengewächse)
Bellis perennis (Gänseblümchen, Compositae, Korbblütler)
Bismutum (Wismut)
Borax veneta (Natriumtetraborat)
Bromum (elementares Brom)
Bryonia (Zaunrübe, Cucurbitaceae, Kürbisgewächse)
Cadmium sulfuricum (Kadmiumsulfid)
Calcium carbonicum (Austernmuschelkalk)
Calcium muriaticum
.
Calcium phosphoricum (Kalziumhydrogenphosphat)
Calcium sulfuricum (Kalziumsulfat, Gips, Alabaster)
Camphora (Kampfer, Lauraceae, Lorbeergewächse)
Cannabis indica (Haschisch, Cannabaceae, Hanfgewächse)
Cannabis sativa (Hanf, Cannabaceae, Hanfgewächse)
Cantharis vesicatoria (Spanische Fliege)
Capsicum annuum (Spanischer Pfeffer, Solanaceae, Nachtschattengewächse)
Carbo vegetabilis (Holzkohle)
Carcinosinum (Krebsnosode)
Causticum (Ätzlauge)
Chamomilla matricaria (Kamille, Compositae, Korbblütler)
China regis (Chinabaumrinde, Rubiaceae, Kaffeegewächse)
Cicuta virosa (Wasserschierling, Umbelliferae, Doldengewächse)
Cina (Wurmsamen, Compositae, Korbblütler)
Cocculus indicus (Kockelkörner, Menispermaceae, Mondsamenfrüchte)
Coccus cacti (Echte Kochenillelaus, Coccidae, Schildläuse)
Coffea cruda (ungerösteter Kaffee, Rubiaceae, Kaffeegewächse)
Colchicum autumnale (Herbstzeitlose, Liliaceae, Liliengewächse)
Colocynthis (Koloquinte, Cucurbitaceae, Kürbisgewächse)
Corallium rubrum (rote Koralle)
Croton tiglium (Purgierbaum, Euphorbiaceae, Wolfsmilchgewächse)
Cuprum metallicum (elementares Kupfer)
Dolichos pruriens (Juckbohne, Leguminosae, Hülsenfrüchtler)
Drosera rotundifolia (Sonnentau)
Dulcamara (Bittersüß, Solanaceae, Nachtschattengewächse)
Echinacea angustifolia (Sonnenhut, Compositae, Korbblütler)
Eupatorium perfoliatum (Wasserhanf, Compositae, Korbblütler)
Euphorbium officinarum (Wolfsmilch, Euphorbiaceae, Wolfsmilchgewächse)
Euphrasia officinalis (Augentrost, Scrophulariaceae, Braunwurzgewächse)
Ferrum metallicum (metallisches Eisen)
Ferrum phosphoricum (Eisenphosphat)
Fluoricum acidum (Flusssäure)
Gallicum acidum (Gallsäure)
Gelsemium sempervirens (Jasmin, Loganiaceae, Brechnussgewächse)
Graphites (Reißblei)
Helleborus niger (Christrose, Ranunculaceae, Hahnenfußgewächse)
Hepar sulfuris (Kalkschwefelleber)
Hydrastis (Kanadische Gelbwurz, Ranunculaceae, Hahnenfußgewächse)
Hyoscyamus niger (Bilsenkraut, Solanaceae, Nachtschattengewächse)
Hypericum perforatum (Johanniskraut, Hyperiaceae, Sauergrasgewächse)
Ignatia amara (Ignatiusbohne, Loganiaceae, Brechnussgewächse)
Ipecacuanha (Brechwurzel, Rubiaceae, Rötegewächse)
Kalium bichromicum (Kaliumbichromat)
Kalium bromatum (Kaliumbromid)
Kalium carbonicum (Kaliumcarbonat)
Kalium phosphoricum
Kalium sulfuricum
Lac caninum (Rottweilermilch)
Lac humanum (Muttermilch)
Lachesis muta (Gift der Buschmeisterschlange)
Luffa operculata (Schwammgurke, Cucurbitaceae, Kürbisgewächse)
Lycopodium clavatum (Bärlappsporen, Lycopodiaceae, Bärlappgewächse)
Magnesium carbonicum (Magnesiumcarbonat)
Magnesium chloratum (Magnesiumchlorid)
Magnesium phosphoricum (Magnesiumphosphat)
Medorrhinum (Trippernosode)
Mercurius solubilis (elementares Quecksilber)
Mezereum (Seidenbast, Thymelaeaceae, Malvengewächse)
Muriaticum acidum (Salzsäure)
Natrium carbonicum (Soda)
Natrium chloratum (potenziertes Kochsalz)
Natrium sulfuricum (Bittersalz)
Nitricum acidum (Salpetersäure)
Nux moschata (Muskatnuss)
Nux vomica (Brechnuss, Loganiaceae, Brechnussgewächse)
Oleander (Rosenlorbeer)
Opium (Schlafmohnmilch, Papaveraceae, Mohngewächse)
Oxygenium (Sauerstoff, O2)
Palladium (Palladium)
Phosphorus (gelber Phosphor)
Phosphoricum acidum (Phosphorsäure)
Phytolacca (Kermesbeere, Phytolaccaceae, Kermesbeerengewächse)
Platina (elementares Platin)
Podophyllum pelatum (Maiapfel, Berberidaceae, Berberitze)
Psorinum (Krätzenosode)
Pulsatilla pratensis (Küchenschelle, Ranunculaceae, Hahnenfußgewächse)
Rheum (Rhabarber, Polygonaceae, Knöterichgewächse)
Rhus toxicodendron (Giftsumach, Anacardiaceae, Sumachgewächse)
Rumex crispus (Krauser Ampfer, Polygonaceae, Knöterichgewächse)
Ruta graveolens (Weinraute, Rutaceae, Rötegewächse)
Saccharum album (weißer Zucker)
Sambucus nigra (Holunder, Adaxaceae, Moschuskrautgewächse)
Sanguinaria (Kanadische Blutwurzel, Papaveraceae, Mohngewächse)
Sanicula aqua (Mineralwasserquelle)
Senna (Sennesblätter)
Sepia officinalis (Tintenfischsekret, Maritima)
Silicea terra (Bergkristall, Quarzkieselsäure)
Spongia officinalis (Meeresschwamm, Maritima)
Stannum metallicum (Zinn)
Staphysagria (Stephanskörner, Ranunculaceae, Hahnenfußgewächse)
Sticta pulmonaria (Lungenmoos, Stictaceae)
Stramonium (Stechapfel, Solanaceae, Nachtschattengewächse)
Sulfur lotum (sublimierter Schwefel)
Sulfuricum acidum (Schwefelsäure)
Symphytum (Beinwell, Boraginaceae, Raublattgewächse)
Tabaccum (Tabak, Solanaceae, Nachtschattengewächse)
Tarantula hispanica (Tarantel, Spinnenarznei)
Teucrium marum (Katzengamander, Labiatae, Lippenblütler)
Thuja (Lebensbaum, Coniferae, Zypressenartige, Kiefernartige)
Tuberculinum (Tuberkulosenosode)
Veratrum album (Weiße Nieswurz, Liliaceae, Lilienartige)
Zinkum metallicum (elementares Zink)
Zum Umgang mit
REMIDIAS
Zur Philosophie von
REMIDIAS
Einleitung
Homöopathische Arzneimittellehren (Materia medicae) sind Archive, in denen die Wirkungen getesteter Arzneien Symptom für Symptom von Kopf bis Fuß aufgelistet sind. Mit zunehmendem Wissen um eine homöopathische Arznei wächst natürlich der Datenbestand im Laufe der Zeit und droht für den Nutzer immer unübersichtlicher zu werden. Mittelsuche ausschließlich unter Zuhilfenahme von Arzneimittellehren ist zwar spannend, allerdings wegen der Informationsflut auch sehr zeitaufwändig.
Um dennoch geeignete Arzneimittel für ein „zu behandelndes Leiden“ zu ermitteln, benutzen Homöopathen daher üblicherweise zunächst eine Art „Rasterfahndung“ als Vorauswahl. Dabei werden relevante Symptome des Patienten mit allen zur Verfügung stehenden Arzneifacetten abgeglichen, übernommen oder verworfen. Auf diese Weise kann die Zahl der infrage kommenden Arzneien in einer Art Rangfolge auf etwa 5–10 Mitteln „eingedampft“ werden. Niemand sollte sich bei der Mittelbestimmung allerdings nur auf ein einfaches Ranking verlassen, sondern zusätzliche vergleichende Informationen heranziehen. Die „ähnlichste“ und daher (zurzeit) beste Arznei wird letztlich immer treffender mit Hilfe von Arzneimittellehren ermittelt, weil sie ein Gesamtbild der Arznei viel besser vermitteln kann als eine Tabelle.
Den Filtervorgang nennt man Repertorisierung, die Feinabstimmung wird Materia-medica-Abgleich genannt.
Unsere Online- und App-Repertorisierungssoftware heißt REMIDIAS® family. (Informationen im Anhang des Buches). Was fehlte, war eine korrespondierende, kompakte Arzneimittellehre, in der sich die dargestellten Informationen nur auf Kinder als „Zielgruppe“ konzentrieren und dadurch übersichtlich bleiben.
REMIDIAS für Kinder ist eine speziell auf Babys, Kleinkinder und Jugendliche zugeschnittene Arzneimittellehre.
Folgendes Vorgehen zum Auffinden der korrekten homöopathischen Arznei hat sich bewährt:
REMIDIAS
®
family
repertorisiert in einem ersten Schritt aus den momentan vorliegenden Symptomen des Patienten eine kleine Anzahl widerspruchsfreier (passender) homöopathischer Arzneien, die dem Prinzip „Gleiches möge durch Gleiches geheilt werden“ genügen. In der Regel werden 5–10 Arzneien ermittelt.
In einem zweiten Schritt ist mit Hilfe dieser
Materia medica für Kinder
mit überschaubarem Zeitaufwand ein Feinabgleich der infrage kommenden Arzneien möglich. Aus den von REMIDIAS vorselektierten Arzneien kann dann die
beste
im Arzneimittelvergleich schnell ermittelt werden.
Es soll mit diesem Buch bei weitem nicht den Anspruch erhoben werden, eine vollständige Arzneimittellehre erstellt zu haben. Dazu gibt es zu viele Arzneimittel und noch viel mehr Symptome zu jeder Arznei. Außerdem weist die homöopathische Literatur bereits jetzt eine wachsende Zahl beeindruckender Arzneimitteldarstellungen von großartigen Homöopathen auf.
Das Ziel war es also beileibe nicht, „das Rad neu zu erfinden“.
Ziel war es, aus jedem hier beschriebenen Arzneimittel relevante gesicherte und bestätigte Kindersymptome zu destillieren und diese in einem Fließtext so zu verdichten, dass für interessierte Eltern einerseits die Lesbarkeit (eines an sich sehr detailreichen trockenen Stoffes) gewährleistet bleibt und andererseits nichts Wesentliches unter den Tisch fällt.
Schließlich soll die „Idee“ von etwa 130 homöopathischen Kinderarzneien möglichst präzise dargestellt werden.
Um dem Benutzer bzw. der Benutzerin einen schnellen und zugleich differenzierenden Überblick zu ermöglichen, wurde mit mehreren Farben gearbeitet.
Modalitäten sind Befunde, die auf besondere Vorlieben oder Abneigungen des Patienten hinweisen. Diese patiententypischen individuellen Symptome sind deshalb sehr wertvolle Hinweise für eine Mittelfindung.
Blau hinterlegte Modalitäten entsprechen Verbesserungen, Verlangen (z.B. Zugluft, Zwiebel, Wärme)Rot hinterlegte Modalitäten entsprechen Verschlechterungen, Abneigungen (z.B. Hitze, Eier, Liegen)Auf diese Weise kann bereits auf den ersten Blick erfasst werden, ob die Modalitäten der Arznei mit denen des Patienten übereinstimmen. Sämtliche Modalitäten eines Arzneimittelbildes werden nur selten vollständig vorliegen, die vorliegenden sollten allerdings grundsätzlich stimmig zu den in dieser Arzneimittellehre aufgeführten sein. Bei Widersprüchen sollte nach vergleichbaren Arzneien gesucht werden.
Ähnliche Arzneien sind gelblich hinterlegt.Fettdruck entspricht besonders wichtigen Symptomen der Arznei.Für Leser mit weitergehendem Interesse wurden zu zahlreichen einzelnen Symptomen sorgfältig abgestufte Vergleichsmittel ausgesucht und mit Gründruck eingepflegt.
Wenn wir es schaffen würden, Ihr Interesse an dieser Arzneimittellehre zu wecken, würde uns das sehr freuen.
Begeistert wären wir natürlich, wenn Eltern regelmäßig auf REMIDIAS als Repertorium und REMIDIAS für Kinder als Nachschlagewerk zur Mittelfindung für ihre Kinder zurückgreifen würden.
Bedenken Sie bitte Folgendes:
Homöopathische Behandlungen mit C10/C12 schaden nie, allerdings:
Apathische, benommene oder appetitlose Kinder, trinkunwillige Säuglinge, Kinder, die mehrfach aus nicht erkennbaren Gründen erbrechen, über zunehmende Schmerzen klagen, offensichtlich Atemprobleme haben oder über längere Zeit fiebern, müssen vor einer homöopathischen Selbstbehandlung in jedem Fall ärztlich untersucht werden.
Ergibt die ärztliche Untersuchung momentan keinen Anhalt für ein tiefgreifendes, Problem ist eine Behandlung mit sogenannten Akutpotenzen gerechtfertigt.
Eine anhaltende Besserung des „Befindens“ (Appetit, Spiellaune) maximal innerhalb eines Tages zeigt den Behandlungseffekt.
Ist das nicht der Fall, ist eine erneute ärztliche Konsultation notwendig.
Gedanken zur Homöopathie
Die heutige Schulmedizin versteht sich im Grundsatz als exakte Naturwissenschaft und stützt sich folglich in Diagnostik, Behandlung und Statistik auf die mathematischen Gesetze der klassischen Physik und Chemie.
Beeindruckende Ergebnisse auf dem Gebiet der Genetik, der Immunologie, die großartigen Fortschritte in der Krebsdiagnostik oder grandiose Erfolge in der Behandlung von Frühgeborenen rechtfertigen diesen Ansatz ebenso wie spektakuläre Weiterentwicklungen auf chirurgischem Gebiet.
Wenig echte Fortschritte gibt es indes bei internistischen und allgemeinmedizinischen Fächern: Bei allem Wissenszuwachs leiden immer mehr Menschen unter Rheuma, Diabeteserkrankungen häufen sich, Grippewellen fordern Jahr für Jahr hohe Opferzahlen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen nehmen trotz aller medizinischen Raffinesse zu. Antibiotikaresistenzen werden zu einer großen Herausforderung, Allergien und Arzneimittelnebenwirkungen zu einem immer größeren Problem.
Trotz eines enormen finanziellen Aufwandes scheinen wir Ärzte uns zumindest bei pharmakologisch regulativen Therapien nicht so recht vom Fleck zu bewegen: Die alte internistische Weisheit Eine Erkältung dauert mit Behandlung 7 Tage und ohne 1 Woche gilt nach wie vor. Cortisonbehandlungen lindern zwar zahlreiche Beschwerden, bringen sie aber nur zeitweise zum Verschwinden, weil inzwischen jeder aufgeklärte Mitbürger weiß: Das gilt nur, solange ich die Arznei dauerhaft oder wiederholt einnehme.
Es ist kein Wunder, dass die Nachfrage nach alternativer Medizin bei einer gut informierten Gesellschaft angesichts dieser (und anderer) Probleme stetig steigt.
Homöopathie wird inzwischen von mehr als 6.000 Ärzten daher als sinnvolle Ergänzung (!) zu schulmedizinischen Behandlungsmethoden befürwortet und angewendet.
Im Gegensatz zur rein wissenschaftlichen Schulmedizin erfüllt die alternative homöopathische Medizin (besser: informativ induktive Medizin) wenigstens drei berechtigte Forderungen einer besorgten Bevölkerung:
Sie
integriert den Patienten
in den Heilungsprozess.
Sie ist
nebenwirkungsfrei
und belastet innere (infinitesimale) Regelkreise nicht.
Sie ist im
Einklang mit der Umwelt,
statt diese zu belasten.
Aber wirkt sie auch?
Die Antwort darauf ist oberflächlich sehr einfach: Ja, denn wenigstens der Placeboeffekt ist unbestritten. Das menschliche archetypische Verhalten von Zweck und Wirkung lässt allerdings bereits vermuten: Man muss dazu etwas annehmen (!) oder einnehmen, damit dieses Phänomen überhaupt eintreten kann.
Natürlich ist das kein Beweis für die Wirksamkeit der Homöopathie. Aber zumindest der Beweis dafür, dass selbst der letzte orthodoxe Kritiker mit der Behauptung Da ist ja nichts drin gleichzeitig das Paradoxon anerkennen muss, dass sich offensichtlich „mit Nichts“ eine gesundheitsfördernde Wirkung erzielen lässt.
Pragmatisch betrachtet wäre damit einigen Menschen also schon einmal ohne Nebenwirkung (und ganz ohne Grundsatzdebatte) einfach nur geholfen.
Das ist aber nur ein Teilaspekt, denn beobachtet man wahrhaftig weiter vorurteilsfrei, so ist tagtäglich zu erleben, wie nichtstoffliche Einflüsse etwa Licht, Musik oder Filme ganz offensichtlich in der Lage sind, individuelles Wohlbefinden deutlich zu beeinflussen, und teils massive Emotionen auslösen können. Jeder Therapeut weiß das in der Arbeit mit dem Patienten zu nutzen.
Die schulmedizinische Arzneimitteltheorie, nach der man in jedem Fall ein stoffliches (~ messbares) Präparat benötigt, um positive Veränderungen bei Menschen zu bewirken, ist also logischerweise nicht haltbar und durch alltägliche Beobachtung längst – und nicht nur in der Psychotherapie – widerlegt.
Jeder (Kinder-)Arzt kennt die große Zahl psychosomatischer Beschwerden und fragt sich, wie er den Knoten im Kopf seiner Patienten wohl wieder lösen könnte. Die Ursachenbeseitigung funktioniert nur selten mit Hilfe von Pharmazeutika, sondern nur über den Kopf des Patienten und seiner Zustimmung, an dem Prozess gemeinsam arbeiten zu wollen.
Ist Homöopathie mit seinem „ganzheitlichen Gesprächsansatz“ vielleicht nur eine originelle psychodynamische Behandlungsmethode, die – um Zugang zum Patienten zu finden – mit Kügelchen jongliert?
Die Wirksamkeit ist in der praktischen (!) Anwendung unbestritten.
Die Besserung störender Leiden nach homöopathischer Mittelgabe kann ja leicht nachgeprüft und kritisch hinterfragt werden (Appetit, Schlaf, Leistungsfähigkeit, Wärmehaushalt, Schmerzfreiheit, Angstfreiheit, Zwanglosigkeit …). Wesentliches Erfolgskriterium ist hierbei die persönliche Einschätzung:Ich fühle mich nach der Einnahme (wieder) deutlich besser. Die Erfassung des Wohlbefindens als signifikantes Kriterium für eine erfolgreiche Therapie ist wissenschaftlich betrachtet längst überfällig. Schließlich kommen doch die Patienten deshalb in die Praxen, weil sie sich „unwohl“ fühlen, etwas als störend empfinden und es ihnen deshalb „nicht gut geht“. Folglich geht es bei der täglichen ärztlichen Arbeit vorrangig auch um das Erreichen einer Beschwerdefreiheit auf allen Ebenen. Wer aber sollte das besser beurteilen können als die Betroffenen selbst.
Und da zeigt sich empirisch: Homöopathie ist praktisch betrachtet und warum auch immer mehr als ein Placeboeffekt. Um das zu erkennen, muss man sich allerdings schon einige Zeit mit der Methode beschäftigen, und das tun die wenigsten Kritiker.
Die Schulmedizin bestreitet dann auch den Effekt und begründet das pharmakologisch mit der zwingenden Logik: Wo nichts drin ist, kann auch nichts wirken.
So überzeugend das auch erscheint, so falsch ist die Aussage. Denn in der Urtinktur ist sehr wohl eine definierte Masse an Ausgangsstoff vorhanden und die kann auch durch noch so hohe Verdünnungen zwar unter die Nachweisgrenze fallen, aber nicht einfach verschwinden. Richtiger wäre also die Feststellung: Nach klassischem biochemischem Masse-Wirkung-Verhalten können Homöopathika aufgrund ihrer hohen Verdünnung keine Wirkung entfalten.
Aber gelten klassische Energiegesetze etwa bei Enzymreaktionen im Inneren jeder lebenden Zelle überhaupt? Die Antwort ist: Nein.
Um aber erst einmal in diesem lästigen theoretischen Richtungsstreit, wie richtig oder falsch eine Behandlungsmethode ist, quasi den Ball zurückzuspielen, sollte der Schulmedizin ihrerseits doch ein Problem zu denken geben: Ein Grundpfeiler exakter Wissenschaft ist nämlich nach gültigem Wissenschaftsverständnis die Vorhersagbarkeit.
Mit der Prognostizität in der Medizin ist das aber so eine Sache: Die Beantwortung der Frage, wie lange ein Infekt dauert, ob und wie eine Antibiotikabehandlung anschlägt, welche Konsequenzen ein Diabetes hat oder wie erfolgreich eine Tumortherapie verlaufen wird, kann redlich von keinem wissenschaftlich orientierten Arzt im Einzelfall vorhergesagt werden. Ehrlicherweise wird er zugeben müssen, das sei zu komplex und von Patient zu Patient verschieden.
Damit verlässt er aber den Boden exakter Wissenschaft.
Anders ausgedrückt: Offensichtlich ist Heilung als Ergebnis einer Hilfe von außen immer auch abhängig von einer inneren Mithilfe, einer persönlichen Verfassung.
Die alten Ärzte sprachen von „vis a tergo“, der Kraft aus dem Rücken, der homöopathische Urvater Samuel Hahnemann von „der Lebenskraft des Einzelnen“, andere von Konstitution, Anfälligkeiten oder Immunsystem.
Diese messtechnisch nicht erfassbaren mysteriösen Selbstheilungskräfte sind der Schulmedizin ein Gräuel. Und deshalb werden sie einfach ignoriert. Damit verfälscht man aber eine wahrhaftige „richtige“ Gesamtbetrachtung unserer Patienten. Und ohne Einbeziehung der Selbstheilungskräfte ist wiederum keine persönliche Prognose möglich.
Ist also die Grundausrichtung der heutigen anerkannten Medizin vielleicht gar nicht so wissenschaftlich, wie sie vorgibt? Ist sie eine zwar methodisch orientierte Lehre, aber im Alltag eben doch letzten Endes mehr Erfahrungswissenschaft denn exakte Naturwissenschaft?
Dann aber stände sie gleichrangig und ohne Absolutheitsanspruch neben anderen medizinischen Erfahrungswissenschaften wie chinesischer Medizin, Akupunktur, Kräutermedizin, Schamanismus oder eben Homöopathie.
Zurück zu den Enzymreaktionen.
Auf atomarer Ebene im Inneren einer Zelle, „wo alles anfängt“, also bei den hochenergetischen Stoffwechselumsätzen, enzymatischen Kettenreaktionen von Photosynthese, Atemkette, Energiegewinnung und Repairmechanismen, gelten die Gesetze der Quantenphysik. Die gebetsmühlenartige Kritik an der Homöopathie „Das ist wie ein Tropfen im Mittelmeer und kann deshalb nichts bewirken“ fußt auf der Dosis-Wirkung-Beziehung einer klassisch geprägten Alltagsphysik und blendet nachgewiesene quantenphysikalische Phänomene völlig aus. Die im Alltag beobachtbaren thermodynamischen Gesetze drehen sich jedoch im Quantenbereich energetisch ins Gegenteil (Tunneleffekte). Je weniger „drin“ ist, umso höher ist die Ordnung und umso wahrscheinlicher läuft auf der atomaren Reaktionsebene eine quantenphysikalisch beeinflusste hocheffiziente Molekülreaktion ab. Dieser quantengesteuerte Prozess gilt nach neueren Untersuchungen als gesichert für Photosynthese und die ATP-Energiegewinnung bei der enzymatischen Oxydationskette. Das Ordnungsprinzip mag eine Erklärung für die Beobachtung sein, warum homöopathische Hochpotenzen wegen ihrer „höheren Ordnung“ intensiver wirken als Tiefpotenzen.
Wirkt also die homöopathische Verschüttelung (und eben nicht der Tropfen im Mittelmeer) auf der entscheidenden quantenphysikalischen Ebene der Energiegewinnung als informativ induzierende Medizin? Entzieht sie sich gerade wegen (!) der hier geltenden Unschärferelation, also der Einflussnahme von Beobachter/Therapeut und Beobachtetem/Patient einer eindeutigen messtechnischen Bewertung? Erklärt diese Interaktion vielleicht sogar die teils spektakulären, teils frustrierenden Ergebnisse, weil klassische Störfelder den Quantenprozess stören?
Etwas passiert, so viel steht fest.
Vorläufige Konsequenz:
Kritik an homöopathischen und anderen sogenannten alternativen Therapien ist berechtigt, teilweise jedoch unbegründet oder gar unzutreffend. Das Gleiche gilt für die sogenannte Schulmedizin, die – wie im Text ausgeführt – in Wirklichkeit vielmehr eine Erfahrungswissenschaft denn eine exakte Wissenschaft ist. Aber selbst deren Modelle versagen allzu häufig im Geflecht komplexer zellulärer Reaktionen. Mit Nebenwirkungen ist zu rechnen.
Weitere Grundlagenforschung auf allen Gebieten ist daher nötig.
Der Grundsatzstreit um theoretische Modelle in der Medizin ist spannend, hilfreich und daher notwendig. Er sollte aber hinter dem dienenden Auftrag nach patientenorientierter Hilfe zurücktreten.
Alles, was wir tun können, ist mit Empathie und gesicherten Erkenntnissen der Befindlichkeit des Einzelnen näher zu kommen, zu beobachten, innere Verstrickungen zu hinterfragen und endlich wieder das Individuum selbst in den Fokus zu setzen, seine Bedürfnisse zu würdigen, seine Empfindungen zu berücksichtigen. Dabei sind Labor sowie Bildverfahren und Doppelverblindung als (unverzichtbare) Hilfen zu betrachten, aber sicher nicht unverrückbar zum einzigen „Goldstandard“ für Gesundheit oder Krankheit zu erheben.
Diese Annäherung an die leidende Person mit all ihren persönlichen Facetten, Vorlieben und Abneigungen, die in keinem Laborblatt auftauchen (können), entspricht den Beurteilungskriterien der reinen Homöopathie.
Schulmedizinisches Wissen und alternative Erkenntnisse könnten sich durch Informationsaustausch zwischen den behandelnden Ärzten wunderbar ergänzen.
1. Abrotanum (Eberraute, Compositae, Korbblütler)
Leitidee: Nabelblutung und Gedeihstörung, wenig Standfestigkeit
Organbezüge: Nabel, Entwicklung, Nerven, Darm
Trennung jeder Art, Gewalt oder Unterdrückung erzeugen bei Patienten, denen Abrotanum hilft, ein Gefühl von „haltloser Angst“, Abrotanum-Säuglinge wollen folglich ständig an die Brust „andocken“.
Die Durchtrennung der Nabelschnur, später auch das Abstillen oder die „Abnabelung“ vom Elternhaus e.a. verstärkt die Möglichkeit (!), den Halt zu verlieren. Abrotanum-Kindern können die Nahrung nicht halten. Es scheint, als ob der Organismus von der primären Versorgung „abgenabelt“ wäre. Bei den kleinen Patienten kommt es zu Erbrechen begleitet von unverdauten Stühlen und nachfolgender Gedeihstörung.
Körperlich „trennt“ sich dabei die obere Körperhälfte von der unteren. Zuerst atrophieren bereits beim Neugeborenen die Beine. Die Säuglinge geben quasi ihre „Standfestigkeit“ auf, weil sie von unten her abmagern, trennen sich also von ihrem eigenen Halt.
Bei Abmagerung der Kinder kommen folgende Arzneien infrage: Abrotanum, Sanicula aqua, Natrium chloratum, Iodum, Sulfur, Silicea, Calcarea carbonica, Lycopodium, Barium carbonicum, Psorinum und Tuberculinum. Kommt es zur Abmagerung trotz großen Hungers, sind Acetum acidum, Iodum, Abrotanum, Sanicula aqua, Magnesium carbonicum und Tuberculinum besonders zu berücksichtigen.
Abmagerung von unten nach oben (erst Beine)
Abmagerung von oben nach unten (erst Hals)
Abrotanum
Natrium chloratum
Iodum
Lycopodium
Tuberculinum
Sanicula aqua
Psorinum
Tabelle 1: Abmagerung
Abrotanum-Kinder sind eigensinnige, starrköpfige Kinder mit Neigung zum Widerspruch;
sie wirken reizbar, quengelig und oft sogar unfreundlich (Cina, Cham, Gal.ac, Sanic, Lyc, Tub, Mag.c, Acon, Calc.p, Rheum, Kali.br, Borx, Apis, Milchen, Jal, Hyos, Stram, Bell). Mit ihrem Schreien „binden“ sie die Energie der Eltern (Phos, Gal.ac, Sacch).
Sie können sich eben nicht trennen, was sie so klettenhaft macht.
Ihr Organismus ist nicht einmal in der Lage, die Nahrung aufzutrennen (~ unverdauter Stuhl), was sie wiederum unselbstständig und abhängig macht.
Die Folgen der Ernährungsstörung zeigen sich u.a. in Schwäche und Erschöpfung, insbesondere nach hektischem Fieber. Die Schwäche kann so groß sein, dass neben dem „Unvermögen zu stehen“ nicht einmal der Kopf gehalten werden kann (Aeth, Cic, Agar, Sulf, Calc.p, Gels).
Blaue Ringe unter den Augen, ein welkes runzeliges Gesicht und der magere dickbauchige Körper lassen die Kinder vorgealtert erscheinen (Arg.n, Lyc, Sep).
Abrotanum ist also eine Arznei mit zunehmender Schwäche und einem Verlangen nach abrupten, schnellen, jähen Symptomwechseln. Die Patienten sind ruhelos, sie mögen keine „Bremse“ und wollen immer etwas Neues: den Ort wechseln, eine neue Beschäftigung (Tub).
Abrotanum-Patienten zeigen eine verstärkte Blutungs- und Schwellungstendenz: Nasenbluten, Hämorrhoiden, Wasserbruch etc.
Werden die Symptome eines Durchfalls bei Abrotanum-Patienten unterdrückt, dann kommt es zu sogenannten metastasierenden Symptomen wie z.B. Gelenk-, Herz- oder Lungenbeschwerden (die Symptome drängen auf „tiefere“ Ebenen). Der Durchfall wird gestoppt ... aber zu welchem Preis.
Phosphor ist die wichtige Arznei bei Nabeleiterungen, Apis mellifica bei Nabelrötungen und Abrotanum und Calcium phosphoricum haben sich bei Nabelblutungen bewährt.
2. Aconitum napellus(Sturmhut, Ranunculaceae, Hahnenfußgewächse)
Leitidee: plötzlich, heftig „kalt erwischt“, hitzig, ängstlich, ruhelos
Organbezüge: Arterien, Herz, Kreislauf, Nervensystem, Brustkorb
Für den Patienten, der Aconitum benötigt, ist die „kalte Hand des Todes nicht weit“. So prophezeien etwa Schwangere, sie würden gewiss bei der Geburt oder im Wochenbett sterben. Man sagt ihnen nach, sie hätten prophetische Träume und hellseherische Fähigkeiten.
Dabei wirken Aconitum-Patienten im Alltag grundsätzlich erst einmal ziemlich robust: Sie sind „dem Leben zugewandt“, stehen für ein soziales Miteinander. Sie sind offen, gesprächig, hilfsbereit und mitfühlend wie Phosphor oder Sulfur, können aber auch wie Nux vomica heftig nervös und gereizt schon bei Kleinigkeiten reagieren.
Wie alle Vertreter der Pflanzenfamilie sind sie sensibel und empfindsam. Alle Formen von Emotionen wie Freude, Erregung oder insbesondere Schreck beeindrucken die Kinder.
Was Aconitum-Persönlichkeiten jedoch „umhaut“ (Bewusstlosigkeit) und völlig „aus der Fassung“ bringt, sind lebensbedrohliche Situationen wie Unfälleund Tod, plötzliche und unkontrollierbare Schicksalsschläge.
Aconitum gilt daher in erster Linie als „Notfallarznei“, die bei jeder Art von akuten Panikzuständen hilfreich wirkt, vorausgesetzt, der Patient ist nach einem Schockextrem ängstlich und unruhig.
Der (akute) Aconitum-Zustand taucht ausnahmslos plötzlich, vehement und angstbesetzt auf. Nachtschattengewächse wie Stramonium, Belladonna, Hyoscyamus oder Dulcamara zeigen ähnliche Reaktionen. Auch Arsenicum album ist in Grenzsituationen extrem unruhig, aber im Gegensatz zu Aconitum ausgesprochen fröstelig. Opium-, Gelsemium-, Veratrumviride-Patienten sind nach einem Schock eher apathisch.
Aconitum kann hilfreich sein bei plötzlich auftretender Erkältung, also etwa nach einem Frosteinbruch, nach starker Anstrengung gefolgt von plötzlicher Kälte, z.B. nach einem Wetterumschlag während einer Gebirgswanderung oder stark klimagekühlten Hotel-, Kinooder Restaurantbesuchen.
Aber auch eine überfallartige, schreckliche, lebensbedrohliche Erfahrung, wie z.B. ein Todesfall, ein heftiger Geburtsschock (mit erstickender Atmung und Ruhelosigkeit) oder als Kleinkind ein erstickender Kruppanfall mit reaktiver, heftiger, übersteigerter Atmung (Hyperventilation), kann mit Aconitum behandelt werden.
Immer geht es um den plötzlichen Entzug des kontrollierten Wohlbefindens.
Verständlich, dass sich Kinder in einem (drohenden) Aconitum-Zustand nicht dem Schlaf, dem kleinen Tod, hingeben wollen. Sie wollen abends trotz scheinbarer Beschwerdefreiheit nicht ins Bett, sind plötzlich unerklärlicherweise deutlich unruhiger als sonst oder überraschend ängstlich.
Im Schlaf wälzen sie sich hin und her und kommen ähnlich wie bei Coffea cruda, Kalium bromatum oder Phosphorus einfach nicht zur Ruhe. Mit Hilfe dieser Arznei verlieren die kleinen Patienten ihre große Todesangst oder die ruhelose Angst im Dunklen(Kali.br, Stram).
Aconitum wirkt im Anfangsstadium (meist Froststadium) eines heftigen Infektes, bevor sich lokale krankhafte Veränderungen wie Mandelrötungen, Schweiß oder Hautausschläge einstellen.
Das Begleitfieber setzt plötzlich ein, führt zum Schüttelfrost und treibt die Temperatur in kurzer Zeit an die 40-Grad-Grenze. Es entwickelt sich rasch eine aufsteigende trockene Hitze begleitet von großem Durst auf kalte Getränke.
Ein urplötzlich einsetzender Stockschnupfen wird nicht selten begleitet von bellendem, trockenem Husten, Heiserkeit (Krupphusten) und/oder Kopfschmerzen über den Augen.
Die heiße, trockene Haut strahlt starke Hitze ab.
Ein Farbwechsel im Gesicht (Röte bei Liegen, Blässe bei Sitzen), das Versiegen der Urinproduktion (bei Neugeborenen), pulsierende Empfindungen in Kopf und Zähnen, Ameisenlaufen (Kribbeln), das polare Symptom Taubheit der Haut oder auch Nabelbauchschmerzen sind typische Sturmhutzeichen.
Mit Beginn des Schweißausbruches ist homöopathisch die Wirkphase des Sturmhutes weitgehend beendet. Ein gutes nachfolgendes Mittel bei „Infekten mit dampfendem Schweiß“ (Ars.a, Cham, Ph.ac, Stram, Op, Veratr, Rhus.t, Bar.c)innerhalb plötzlich einsetzender Infekte ist dann häufig Belladonna (aber nicht immer!).
Aconitum-Patienten haben sehr häufig Angst vor offenen Plätzen und umgekehrt Angst in engen Räumen oder in einer Menschenmenge (Stram, Arg.n, Puls, Lyc, Calc).
Aconitum napellus
bei fieberhaften Infekten
Belladonna
bei fieberhaften Infekten
häufig abendlicher, mitternächtlicher Beginn
häufig nachmittäglicher Beginn
Einschlafen mit starker
unruhiger Ängstlichkeit
Auffahren aus dem Schlaf
Frost mit Angst, Todesangst
Fieberphantasien, erkennt niemanden
Furcht vor
Tod, engen Räumen
Furcht vor Hunden, Fratzen
starke
Hitze am gesamten Körper
Zentralisation,
kalte Hände, roter Kopf
trockene Haut
dampfende, schweißnasse Haut
Verlangen nach Entblößen, will sich aufdecken,
Zudecken nur bis zum Hals
frische Luft
starker Durst
Durst, aber
schmerzender Hals
berührungsempfindlich
licht- und erschütterungsempfindlich
enge Pupillen
weite Pupillen
Ferrum phosphoricum
bei fieberhaften Infekten
Stramonium datura
bei fieberhaften Infekten
kein besonderer Zeitpunkt
nachts
eher schlaflos, geräuschempfindlich
Auffahren aus dem Schlaf
weitgehend unbeeinträchtigt
trotz hohen Fiebers
heftigste
Erregungszustände, Fieberphantasien, klammert
Fieber
ohne Angstsymptome
Furcht vor angreifenden Tieren
Faszination von glänzenden Gegenständen
Hitzewallungen, häufiger
Wangenröte
Durst
Verlangen nach kaltem Wasser
Dunkelangst,
Verlangen nach Licht
begleitende
Ohrenschmerzen,
Durchfälle
Tabelle 2: Arzneien für plötzlich auftretende hochfieberhafte Infekte
3. Aethusa (Hundspetersilie, Umbelliferae, Doldenblütler)
Leitidee: Üben bis zum Erbrechen, heftige und erschöpfende Reaktion
Organbezüge: Magen, Verdauung, Enddarm
Ähnlich wie andere Doldenblütler und fast alle Milcharzneien vertragen die kleinen Aethusa-Patienten keine Milch und erbrechen diese schwallartig fast direkt nach der Aufnahme(Ant.c, Nat.c, Sanic, Sil, Ars.a, Bism, Phos, Nux.v). Erstaunlicherweise haben Säuglinge nach dem ersten heftigen Erbrechen der meist geronnenen sauren Milch aber sofort wieder Durst. Dennoch: Wiederholtes Erbrechen ist auf Dauer natürlich erschöpfend, so dass sie immer längere Ruhepausen benötigen.
Kinder, die Aethusa benötigen, sind regelhaft nach all dem Erbrechen „dösig“(Ant.t, Ip, Op).
Die Kinder werden muskelschwach, können sich kaum aufrecht halten, sie sind sogar unfähig den Kopf zu halten(Gels, Abrot, Calc.p) und schließlich so erschöpft, dass sie nach dem abermaligen Erbrechen in einen tiefen Schlaf verfallen. Beim Einschlafen während der Zahnungsperiode tendieren sie zu Zuckungen oder Kopfrollen.
Im Alltag spielen die Kinder gern „Hund“. Sie tollen umher, laufen auf allen vieren oder bellen wie Hunde. Tatsächlich können sie auch tollwütig werden: Einige von ihnen haben starken Speichelfluss, sie knurren und können unvermittelt beißen. Im nächsten Moment sind sie wieder brav und bereuen schnell (Lyss, Lac.c). Typisch Aethusa: heftiger Beginn und nachfolgende Erschöpfung, Reaktionsmangel oder Korrektur.
Ältere Aethusa-Kinder sind beherrschte, zurückhaltende Kinder, aber voller innerer Emotionen (Nat.m). Sie können Gefühle nur schwer ausdrücken, isolieren sich selbst, sind selbstgenügsam, führen Selbstgespräche und entwickeln nicht selten eine heftige Tierliebe.
Das Aufnehmen im Sinne von „Sich etwas reinziehen“ fällt auf allen Ebenen schwer oder ist gar unmöglich. So zeigen Aethusa-Kinder z.B. auf geistiger Ebene Lernstörungen infolge Konzentrationsproblemen, haben quasi ein „Brett vor dem Kopf“ und müssen alles beständig üben. Natürlich bedeutet das später auch Erwartungsspannung und Schulkopfschmerzen (s.u.) und natürlich haben sie auch Angst vor Prüfungen.
Es ist, als ob die Aufnahme von Gehaltvollem (Milch, Wissen etc.) nur durch stetiges Üben gelingen will, quasi nur so in „in Fleisch und Blut“ übergeht.
Die Patienten haben Angst davor, abends einzuschlafen, aus Furcht, morgens nicht mehr zu erwachen.
Zwischen 3 und 4 Uhr morgens geht es ihnen am schlechtesten.
4. Agaricus (Fliegenpilzfruchtkörper, Pilz)
Leitidee: zappelig, ungeschickt, unkonzentriert, übertreibend
Organbezüge: Rückenmark, Wirbelsäule
Ein Wesenszug aller Pilzarzneien ist ihr Unvermögen, Proportionen angemessen einzuschätzen. Die Größenverhältnisse scheinen zu changieren, die Orientierung im Hier und Jetzt ist erschwert (Anh, Cann.i). Kurz: Agaricus-Patienten fehlt ein realistischer, angemessener Überblick.
Alle Abläufe haben den Charakter des Unvorhersehbaren.
Agaricus-Kinder sind zappelig, vermitteln leicht einen unkoordinierten Eindruck (stolpern, fallen, ungeschickte Beine, schlechte Kopfkontrolle). Sie zittern an allen möglichen Körperstellen oder tendieren zu übertriebenen Bewegungen wie Tics(Bell, Hyos, Myg, Tarant, Aran, Plat, Psor, Mag.p, Cupr, Zink, Rhus.t), Zuckungenwie durch Stromstöße(Arg.m, Veratr, Säuren, Nux.m, Zink, Cupr, Alum), Grimassieren, Muskelspasmen oder ruckartigen Augenbewegungen. Bereits bei Neugeborenen pendeln die Augen hin und her (Nystagmus).
Die Kinder tendieren ihrem Wesen nach grundsätzlich zu Übertreibungen: Ein Husten ist z.B. begleitet von krampfhaftem Niesen. Während eines (Heu-)Schnupfens juckt es sie nicht nur in der Nase, sondern auch in den Ohren. Häufig kommt es zu unbeherrschbarem und krampfartigem Gähnen in allen Zusammenhängen. Sie blicken nicht einfach interessiert hierhin und dorthin, sondern sie rollen mit dem Kopf(Tarant, Bell, Sulf, Tub, Med). Auch besteht eine deutliche Neigung zu allergischen – also übertriebenen, überempfindlichen – Reaktionen (Heuschnupfen) und nicht selten übertreiben sie es sogar bei der Angst vor Krankheiten (insbesondere vor Krebskrankheiten und Tod). Andererseits sind sie häufig fasziniert von Themen wie Tod, Friedhof und Übersinnlichem.
Agaricus-Kinder sind eher willensschwache Personen, die sich gern verwöhnen lassen. Für sie sind Entscheidungen wie überhaupt jeder äußere Druck „belastend“, und genau den lassen sie sich nur allzu gern abnehmen (Lyc, Med, Bar.c, Nux.m, Cann.i, Coca). Übernehmen von Verantwortung ist nicht ihre Stärke.
Sie sind in der Regel nett und aggressionslos, aber mit großer Unsicherheit in Bezug auf sich selbst. Nicht selten sind sie daher auch (symbiotisch übertrieben) abhängig von anderen (Bar.c, Calc, Staph, Puls, Lyc, Phos, Stram).
Agaricus-Kinder sind meistens fröhlich, tanzen und stecken voller verrückter Ideen. Im Alltag wirkt das unbekümmert, impulsiv und ruhelos. Sie lachen viel, kichern herum „wie in einem Drogenzustand“, unternehmen interessante, verwegene Dinge und können sich weit treiben lassen, als ob sie keine Grenze kennen.
Sie genießen das Leben, theoretisieren viel (Cann.i, Sulf), wirken aber auf seltsam alberne Art an- und abhängig.
Sie neigen zu hochfliegenden (übertreibenden) Phantasien (Phos, Hyos, Stram, Bell, Cann.i, Coff, Anac …),geistige Anstrengung oder lange Konzentration ist indes nicht ihre Stärke (Hyos, Phos, Arg.n, Anac, Lyc, Nux.m).
In der Schule spielen sie gern „einfach so“ den Klassenclown. Ihr Redefluss und ihre neugierigen Fragen versiegen nie.
Sie können allerdings auch – vielleicht nach Tadel, Kritik oder Misslingen – wie ein Rumpelstilzchen (übertrieben) boshaft (Tarant, Apis, Hyos, Aur, Anac, Lyc, Calc, Puls, Merc) reagieren oder sich verwegen verhalten. Addiert man dazu ihr schlechtes Gespür für Abstände und eine mangelhafte Konzentrationsfähigkeit wird deutlich, dass die unruhigen und zappeligen Agaricus-Kinder ähnlich wie die verwegenen Medorrhinum-Kinder erhöhten Unfallgefahren ausgesetzt sind.
Gemütssymptome und Verhaltensweisen wechseln sich mit körperlichen Symptomen schnell ab. Gesprächsthemen werden schnell gewechselt, Schwindel wechselt mit Teilnahmslosigkeit, Euphorie mit Niesanfällen, nervöse Tics/Zittern/Zucken mit Albernheiten.
Die Fähigkeit, aus Schmerzen und Fehlern zu lernen, scheint zu fehlen: Die Patienten gehen furchtlos bis verwegen auf alle und alles zu und Schmerzen bekümmern sie in der Regel auch nicht sehr (Arn, Op, Aloe). Dann wieder klagen sie über Parästhesien, Kribbeln oder stechende, nadelstichartige Schmerzen.
Ihr Rücken ist besonders empfindlich. Manchmal beschreiben die Patienten, es sei, als ob Ameisen die Wirbelsäule entlang krabbeln würden. Andere berichten von Nadelstichen, als ob Eis die Haut berühren würde oder von einem Erfrierungsgefühl. Tatsächlich mögen Agaricus-Patienten keine frostigen Temperaturen oder nasskaltes Wetter(Nux.m, Rhod, Dulc, Am.c, Rhus.t, Puls, Sil, Calc, Med). Sie bevorzugen die Wärme.
So lebhaft Agaricus-Kinder auch tagsüber sind, nachts schlafen sie meist tief und fest. Einschlafzuckungen der Beine und Arme (wie Elektroschläge) hören – anders als bei Patienten, die Zinkum metallicum, Alumina, Argentum metallicum, Natrium muriaticum, Arsenicum album oder Kalium carbonicum benötigen – im Schlaf auf.
5. Ailanthus glandulosa (Götterbaum, Simarubaceae)
Leitidee: Bewusstseinstrübung, Blutvergiftung nach Scharlach
Organbezüge: Hals und Blut
Ailanthus-Patienten sind delirant, verwirrt, halb bewusstlos, aber dennoch ruhelos und können nicht schlafen(Agar, Bell, Hyos).
Die Arznei wird homöopathisch bei schwerkranken, bereits bewusstseinsgetrübten Patienten(Bapt, Gels, Ph.ac, Rhus.t), die unter einer zersetzenden Mandelentzündung leiden, eingesetzt. Diese Art von destruktiver Mandelentzündung wird praktisch immer von dunklen Hautausschlägen und Hautblutungen begleitet – ein fast sicherer Hinweis für Blutvergiftungen. Der Zustand erfordert zwingend die sofortige ärztliche Untersuchung.
Der äußere Hals sowie die umliegenden Drüsen sind berührungsempfindlich und schmerzhaft geschwollen. Der innere Hals ist dunkelrot. Natürlich ist das Schlucken erheblich beeinträchtigt. Der gebildete Schleim setzt sich auf den Zähnen fest.
6. Allium cepa (Küchenzwiebel, Liliaceae, Liliengewächse)
Leitidee: Zwiebelschnupfen, wundreizender Laufschnupfen
Organbezüge: Schleimhäute, Nase, Augen
Bei Kindern, die Allium cepa benötigen, kommt es bei nasskaltem Wetter zu reichlicher Absonderung eines brennenden, wundmachenden Nasensekretes(Ars, Merc, Cham). Wässrige Augen und ein milder Tränenfluss begleitet von heftigem Niesen unterscheidet die Zwiebel homöopathisch von Euphrasia officinalis, dem Augentrost. Gelegentlich besteht eine Heiserkeit (Sabad, Phos).
Kinder, welche die homöopathisch aufbereitete Zwiebel benötigen, bevorzugen frische, kühle Luft, erfrischendes Baden und Bewegung. Hingegen meiden sie warme Räume. Auch nasse Füße und feuchte, kühle Luft verschlechtern den Nasenbefund. Gelegentlich ist der Schnupfen durch stechende Ohrenschmerzen verkompliziert.
Diese Patienten verspüren neben dem Schnupfen häufig ein Blähungsgefühl im Darm. Nicht selten wirken sie – nicht unüblich bei Allergien – ein wenig schläfrig und benommen (Nux.m, Op).
Die Kinder neigen tatsächlich zu Heuschnupfen, besonders im Frühjahr. Die Neigung zu Allergien, eine wundgereizte Nase und die juckenden, gereizten Augen lassen auch an folgende andere homöopathische Arzneien denken:
Nr.
Homöopathische Arznei für Heuschnupfen
Seite
6
Allium cepa
23
17
Arsenicum album
36
91
Natrium chloratum
136
Sinapsis nigra
Sabadilla
123
Sulfur lotum
178
Kalium iodatum
67
Hepar sulfuris
106
18
Arum triphyllum
39
82
Lycopodium clavatum
122
4
Agaricus muscarius
21
59
Euphrasia officinalis
93
95
Nux vomica
142
117
Silicea terra
168
106
Pulsatilla pratensis
156
Tabelle 3: Heuschnupfenarzneien (Auswahl)
7. Aloe socotrina (Aloe, Liliaceae, Liliengewächse)
Leitidee: gallertartiger morgendlicher „Kotverlierer“
Organbezüge: Enddarm, Venen, Leber
Aloe-Patienten sind empfindlich und pingelig. Bei den Patienten drängen Stress oder andere emotionale Reize wie Zorn oder Frust (Cham, Colo, Lyc) Stuhl und Flatus aus dem Darm.
Im Darm rumpelt und gluckert es.
Der Patient beschreibt ein Abwärtsdringen im gefühlt überfüllten Enddarm, als ob sich ein Durchfall ankündigt. Dieser Zustand ist begleitet von Unruhe, Schwäche (Analprolaps) und einer großen Unsicherheit bzgl. der Stuhlkontrolle. Gelegentlich kommt es zu unfreiwilligem Stuhlgang beim Urinieren. Die Patienten leiden häufig unter Venenkrankheiten, insbesondere unter Hämorrhoiden.
Tatsächlich kommt es frühmorgensdirekt nach dem Essen zur Erschlaffung des Darmschließmuskels und gleich danach zum nicht aufzuhaltenden Stuhlgang mit gussweise wässrigem oder geleeartigem Stuhl. Andere Patienten berichten, der Stuhldrang „treibe“ sie regelrecht aus dem Bett(Sulf, Nat.s, Podo, Rumx, Agar).
Wegen vieler Symptomähnlichkeiten zu Schwefel wird Aloe auch das „pflanzliche Sulfur“ genannt.
Viele Symptome sind alternierend, z.B. wechselt austernstuhlartiger Durchfall im Sommer mit ständigen Kopfschmerzen im Winter oder Rückenschmerzen wechseln sich mit Kopfschmerzen ab.
Auch im psychischen Bereich pendeln Aloe-Patienten launenhaft zwischen Hyperaktivität und lethargischer Mattigkeit, zwischen Euphorie und resignativer Stimmung oder zwischen Wissensdurst und geistiger Erschöpfung. Prinzipiell haben Aloe-Patienten allerdings eine große Abneigung gegen geistige Arbeit.
Sie mögen keine Hitze, keine feuchtwarme Tropenluft. Im Sommer wird alles schlechter, Besserung verspricht kühle, frische Luft.
Bei Kopfschmerzen helfen kalte Umschläge.
Aloe hat eine reinigende Wirkung bei Hautverletzungen.
Phlegmatische, faule Kinder profitieren besonders von dieser Arznei, wenn die beschriebenen charakteristischen Darmsymptome vorliegen.
8. Alumina (elementares Aluminium)
Leitidee: zunehmende Inaktivität und Trockenheit auf allen Ebenen
Organbezüge: Gehirn, Nerven, Haut, Schleimhäute, Darm
Alumina-Patienten wirken uninspiriert, stumpf und inaktiv, sie antworten langsam und bekommen Beschwerden, wenn Hast oder Eile angezeigt oder erforderlich sind. Für Alumina-Kinder bedeutet das körperlich: Verstopfungstendenz ohne Stuhldrang(Graph, Calc, Lach, Op). Sie schwitzen nicht, ihre Haut ist trocken und rissig; kurzum: Alle Absonderungen werden zurückgehalten.
Die Inaktivität zeigt sich in Benommenheit, Dumpfheit und mentaler Langsamkeit. Sie können schlecht denken, schlecht sprechen und begreifen nur schwer (Bar.c, Hell, Nux.m, Phos, Plb), ihr Gang wirkt unsicher, sie leiden unter Schwindel und Taubheitsgefühlen wie bei Patienten mit langsam fortschreitenden neurologischen Erkrankungen (Borreliose, multiple Sklerose, Parkinson).
Die um sich greifende zunehmende Schwäche mündet in eine gewisse Ratlosigkeit beim Handeln und einem trotz aller Bemühungen scheiternden Denken, als ob der Kopf leer sei(Hell). Diese Situation ähnelt dem der Altersdemenz.
Die Neigung zu Infektionskrankheiten ist eine Folge der Trockenheit von Haut und Schleimhäuten (trockener Husten, Heiserkeit) sowie der zunehmenden Lähmung (Caust)vegetativer Funktionen wie erschwertem Schlucken, Blasenschwäche oder Kehlkopflähmungen.
Der Zustand von Alumina ist morgens deutlich schlechter als abends. Feuchtwetter(Caust) bessert und Bettwärme verschlechtert. Die Patienten vertragen kein Brot.
Alumina-Patienten können kein Blut sehen (Nux.v, Nux.m, Calc) oder erschrecken beim Anblick von Blut.
Trockener Husten infolge trockener Schleimhäute mit nachfolgender zäher Schleimbildung, begleitendem Würgereiz und ggf. Erbrechen findet sich auch bei:
Homöopathische Arznei
Wirkrichtung/Besonderheiten/Schnellabgleich
Aconitum napellus
trockene, kalte Luft und
Zugluft schlechter, ruhelose nächtliche Angst, plötzliche Symptomentwicklung, ohne Schweiß,
will kalte Getränke
Agaricus
leichtes Frieren, Wärme bessert
Alumina
Arnica montana
Hüsteln, Annäherung schlechter, betont „alles o.k.“
Arsenicum album
Frieren,
Wärme bessert,
Durst in kleinen Schlucken, brennende Empfindungen, Verlangen sich hinzulegen
Belladonna
Hüsteln und Räuspern
, Entblößen und Abkühlung schlechter, plötzlicher Husten und Fieber, Licht und erschütterungsempfindlich mit Schweiß
Bromum
Husten bei Hinlegen, trockene (Land-)Wärme, Bettwärme, Sommerwärme schlechter,
Seeaufenthalt
und kühle Getränke
deutlich besse
r
Bryonia alba
Hüsteln und Räuspern,
Durst,
trinkt in großen Zügen, Verlangen sich hinzulegen, mäßige Wärme und warme Getränke besser
Calcium carbonicum
Zugluft schlechter,
Hüsteln und Räuspern
Causticum
Hüsteln und Räuspern, trockene, kalte Luft und Zugluft schlechter,
Regen und Feuchtigkeit besser,
Wärme oder
Bettwärme schlechter, kalte Getränke bessern
Coccus cacti