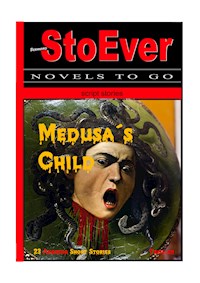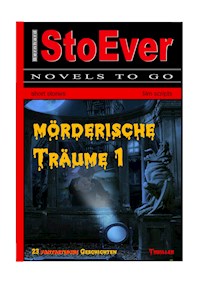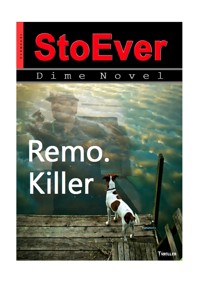
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Dime Novels
- Sprache: Deutsch
Moses lag mit gespreizten Beinen auf dem Boden, mit dem Rücken an den Fliesen der Pisswand gelehnt. Das Wasser der Spülung lief ihm über Kopf und Schulter. Seine weit aufgerissenen Augen starrten entsetzt ins Leere. Arme und Beine zuckten im Todeskampf. Er röchelte schwer. Aus seiner durchtrennten Kehle quoll in Schüben das Blut. Es platschte über sein Hemd, vermischte sich mit dem Wasser der Pissrinne und verschwand, kleine Kreise ziehend, im Abfluss. Sein Leben verschwand im Abfluss.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 92
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernhard StoEver
Remo.Killer
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Los Angeles 2010
Zaire, Kinshasa 1974, O´Maleys Erinnerungen I
Los Angeles, Memorial Hospital 2010
Los Angeles, Beverly Hills 2010
New York 1973 O´Maleys Erinnerungen II
Hamburg, Reeperbahn 2010
Südafrika, Johannesburg 2010
Los Angeles 2010
2010 Los Angeles Finale
Impressum neobooks
Los Angeles 2010
Für Helge
Fluchend kämpfte sich O´Maley durch die fiebrige Hitze, die Los Angeles seit Tagen wie ein Leichentuch umhüllte. Die säuerliche Brise aus Schweiß und Urin, die aus Poren und Kleidung dampfte, vermittelte ihm ein Gefühl der Vertrautheit. Für heute konnte er zufrieden sein, auch wenn zwei Kisten Obst, in Zeitungspapier verpackte Essensreste und ein Dutzend leere Flaschen, für die es auf dem Markt ein paar Cent an Pfand gab, als Altersvorsorge kaum ausreichten. Seine Hand fuhr prüfend über die schäbige Jacke, sie suchte die Flasche mit dem billigen Fusel, den ihm ein Ladenbesitzer in einem Brei aus Mitleid und Verachtung zugesteckt hatte. Alkohol machte ihn unempfindlich, selbst gegen physische Attacken. Auch das Bein schien ihm keinen Ärger zu bereiten, kein Schmerz, kein Ziehen, einfach nichts. Er hatte es im Krieg gelassen, zerfetzt durch eine Granate. Ein ganzes Dorf musste dran glauben. Und sein Bein.
Der Einkaufswagen, den er zielstrebig vor sich herschob, stoppte abrupt. Eine lose Steinplatte blockierte die Vorderräder, hart und absolut wie eine Wand aus Granit. Die oben liegenden Äpfel wurden nach vorne geschleudert und sprangen auf die belebte Straße. O`Maley reagierte instinktiv. Mit einer Geschwindigkeit, die man ihm nicht zugetraut hätte, humpelte er ungelenk hinterher.
Der heranrasende Pick Up ließ ihm keine Chance. Es knallte dumpf, sein Kopf touchierte die Motorhaube, und er schleuderte im hohen Bogen auf die Fahrbahn. Er war bereits bewusstlos, als sein Körper auf den Boden klatschte, das falsche Bein im rechten Winkel abgeknickt. Der kleine dunkle Fleck, der sich unter seinem Kopf ausbreitete, vermischte sich mit dem Alkohol aus der zerbrochenen Flasche zu einer hellroten Lache.
O´Maley riss die Augen auf. Das grelle Weiß, das sich explosions- artig in seinem Kopf ausbreitete, verblasste zu einem diffusen Grau, aus dem sich verschwommene Gestalten geisterhaft herausschälten. Stimmen durchdrangen in Wellen sein Bewusstsein und verschwanden wieder im Nichts. Der Boden öffnete sich, und er fiel zurück in ein tiefes, schwarzes Loch.
Trotz ihrer Jugend mangelte es der Stationsärztin nicht an Erfahrung. Sie hob behutsam ein Augenlid des Patienten und schüttelte verwundert den Kopf.
„Er träumt, muss über einen starken Willen verfügen. Erstaunlich, dass er solange durchgehalten hat.“
Die Nachtschwester an ihrer Seite nickte gleichmütig.
„Das Leben ist ein mächtiger Motor. Was soll mit ihm geschehen?“
„Er bleibt vorerst auf der Intensivstation, muss sich anstrengen, wenn er durchkommen will.“
Die beiden Frauen verließen das Krankenzimmer, ohne sich noch einmal umzusehen.
Der mit dem Tode ringende Patient bekam von dem Gespräch nichts mit. Er trieb hilflos im Strudel seiner Erinnerungen, bis längst vergangene Geschehnisse sein Bewusstsein überfluteten und Ereignisse von damals wieder zum Leben erweckten.
+
Zaire, Kinshasa 1974, O´Maleys Erinnerungen I
„Ali boma je“, „Ali boma je“!
Es war die Nacht zum 30. Oktober, die Nacht aller Nächte. Ein fahler Mond verblasste hilflos bei dem Versuch, das tief hängende Wolkenband zu durchdringen. Die dumpfe Hitze, Vorbote des nahenden Monsuns, senkte sich wie ein Schleier über die wehrlose Stadt. Eine zügellose Menschenmenge drängte bis an die Tore des seit Wochen ausverkauften Stadions. Andere umringten ungestüm die zahlreichen Reporter, die aus aller Herren Länder nach Kinshasa geströmt kamen, um Zaire für das kurze Aufflackern eines Augenblicks in den Fokus der Weltöffentlichkeit zu drängen.
Die Stimmung erreichte ihren Siedepunkt, als die Kontrahenten von einem, kaum noch der Sprache mächtigen Stadionsprecher angekündigt wurden. Das lange Warten hatte ein Ende, endlich war es gewiss. Selbst die letzten Skeptiker konnten befreit aufatmen, der Kampf der Giganten würde stattfinden, hier und jetzt, mitten im Herz des dunklen Kontinents.
O´Maley befand sich in der obersten Etage eines sechsstöckigen Gebäudes, mit freier Sicht auf das Stadion. Die feuchten Flecken auf seinem Hemd waren nicht nur der drückenden Hitze anzulasten, auch seiner Anspannung und, er musste es sich eingestehen, seiner Angst. Angst war der Motor aller Dinge.
Seitlich von ihm saß Dimitrij am geöffneten Fenster und blickte angespannt zum Stadion hinüber. Seine Hände umklammerten ein russisches Nachtsichtgerät. Das neueste Modell, sehr teuer, sehr effizient. Daneben lag in einem Gewehrkasten eine österreichische G69. Die Waffe eines Scharfschützen. Kein Profi würde sie mit dem Lauf an die Wand stellen. Dimitrij war Profi, ein argloser Profi, mit einem Verrat rechnete er nicht. Diesen Umstand machte O´Maley sich zunutze. Aber noch zögerte er, denn hatte er ihn erst getötet, gab es kein Zurück. Er wäre für immer ein Aussätziger, ein Paria, ständig auf der Flucht, mit einem vorbestimmten Ende.
Egal, er hatte keine Wahl, er musste so handeln. Nicht aus Überzeugung, auch nicht aus moralischen Bedenken. Genau genommen waren ihm auch die beiden Boxer egal, die sich gleich die Köpfe einschlugen. Und Mobuto, dieser Schlächter, hatte den Tod tausendfach verdient. Nein, das alles war es nicht. Es war viel banaler. Er handelte auf Befehl. Er war ein Söldner, ein unbedeutender Handlanger, der Diener eines Herren.
Jedes Leben braucht seine Zeit. Die jedoch stand auf seiner Seite. Irgendwann würde sie ihn vergessen lassen, sich für seine Taten zu verachten.
Der Armeerevolver in seiner Hand fühlte sich kühl an, als er ihn unbemerkt aus dem Holster zog, Dimitrij an den Kopf setzte und abdrückte. Der Schalldämpfer reduzierte den Knall auf ein leises Plopp, nicht lauter als das Öffnen einer Bierflasche. Die Kugel durchschlug den Schädel, hinterließ ein faustgroßes Loch an der Austrittsstelle und einen Brei aus Knochensplitter, Blut und Gehirnmasse an der Wand. Den leblosen Körper zerrte er unter die Treppe und bedeckte ihn mit einer Plane. Dann verwischte er die Schleifspuren und entfernte die Reste des Gehirns von der Mauer. Das Gewehr zerlegte er in seine Einzelteile und verstaute es zusammen mit dem Nachtsichtgerät im Rucksack.
Der zweite Scharfschütze hatte sich auf dem Dach des gegenüberliegenden Gebäudes postiert. Auch ihn musste er ausschalten, um unbemerkt entkommen zu können. Er hatte sich ein Motorrad bereitgestellt und hoffte, es noch ganz und fahrbereit vorzufinden. Die Chancen dafür standen gut. Mobutu hatte drastische Maßnahmen ergriffen, um Übergriffe und Diebstähle einzudämmen und die Sicherheit der ausländischen Besucher zu gewährleisten. Sein Land sollte sich im besten Licht darstellen. Bereits Wochen vor dem Kampf ließ er hunderte stadtbekannte Diebe, Räuber und Mörder verhaften und in den geheimen Kellergewölben unter dem Stadion an die Wand ketten. Jeden Zehnten ließ er köpfen. Die Katakomben schwammen im Blut, aber die Botschaft kam an: „Ich, Mobutu Sese Seko, der Leopard, kann jeden von euch, wann immer ich will, wo immer ich will und wie immer ich will, umbringen lassen.“
Unauffällig verließ O´Maley das Gebäude und mischte sich unter die ausgelassene Menge. Es roch nach Marihuana und billigem Fusel, der von geschäftstüchtigen Händlern in schmutzigen Plastikflaschen feilgeboten wurde. Das Zeug war pures Gift und setzte in den Köpfen ein Vakuum frei, das sich mit Wut und Aggression füllte. Schon zogen erste bewaffnete Banden randalierend durch die engen Gassen. Spezialeinheiten der Armee, die an strategischen Punkten bereitstanden, knüppelten die Eskalation nieder, bevor sie entstehen konnte. Kinshasa befand sich im Blickwinkel der Weltöffentlichkeit, keine Krawalle durften die so mühsam erpresste Illusion einer friedlichen und weltoffenen Stadt überschatten.
O´Maley fühlte sich benommen, sein Schädel dröhnte. Der Lärm um ihn herum drang nur als fernes Rauschen an sein Ohr. So war es nicht verwunderlich, dass er die hagere Gestalt nicht beachtete, die inmitten der schwankenden Masse bewegungslos verharrte und ihn misstrauisch beobachtete. Das Gesicht war vom Schatten eines breitkrempigen Hutes verdeckt.
Vorsichtig drängte sich O' Maley durch eine Horde torkelnder Kinder, die sich, vom billigen Fusel gepuscht, für unangreifbar hielten und verschwand im gegenüberliegenden Gebäude. Die mit Gitterstäben geschützte Tür war unverschlossen. Kaum hörte er sie hinter sich schließen, sprang sie bereits wieder auf und er bemerkte den Hageren, der gelangweilt zur Seite schaute, als er ihn misstrauisch beäugte. Das konnte kein Zufall sein. Unauffällig umklammerte O´Maley den Griff seiner Waffe, aber der Hagere kam ihm zuvor, geschmeidig verschwand seine Hand unter dem Hemd. Bevor O´Maley reagieren konnte, sah er in den Lauf eines kleinen, stupsnasigen Revolvers. Der dumpfe Knall des Schusses hallte im schmalen Gang und verlor sich im Nichts. Die Kugel verlor sich nicht, sie ratschte über seinen Oberschenkel und hinterließ einen blutigen Streifen. Bevor jedoch der Hagere ein weiteres Mal abdrücken konnte, jagte O´Maley ihm die Stahlmantelgeschosse seiner 45er in die Brust. Sofort war er bei ihm und entwand ihm die Waffe aus den sich verkrampfenden Fingern. Er spürte kaum Widerstand, die Löcher in der Brust waren zu groß. Doch noch bevor er ihm eine Frage stellen konnte, verlor der Hagere das Bewusstsein. Hastig durchsuchte O´Maley seine Taschen. Außer etwas Geld und einem internationalen Führerschein, ausgestellt auf den Namen Adrian Profiet, fand er keine weiteren Papiere. Das Geld und den stubsnasigen Revolver steckte er ein. Dann hielt er dem Sterbenden den Lauf seiner 45er an die Stirn und drückte ab.
Er verließ das Gebäude und verschwand in einer Seitengasse, wo das Motorrad noch unbeschädigt auf ihn wartete. Er hatte es unter einer Plastikfolie versteckt und durch eine schwere Metallkette gesichert. Nach zwei heftigen Tritten auf den Kickstarter sprang der Motor an und er jagte die Straße hinunter zum Fluss. Vorbei an stinkenden Abfällen, schäbigen Wellblechhütten und halbnackten Kindern, die seine halsbrecherische Fahrt johlend einige Schritte begleiteten.
Ein Fischerboot stand bereit, ihn nach Brazzaville überzusetzen. Ein gefährliches Unterfangen. Der Kongo war hier mehr als drei Kilometer breit und über achthundert Meter tief. Und die jetzt noch so lammfromm dahintreibenden Wassermassen würden sich unter dem Einfluss des Monsuns, der jeden Moment über das Land hereinbrechen konnte, in einen schäumenden Moloch verwandeln. Einem Moloch, der alle Übermütigen unerbittlich in die Tiefe reißen konnte.
Aber noch war alles friedlich und O' Maley hoffte inständig, dass es die nächsten Stunden auch so bleiben würde. Der Fischer, dem er hundert Dollar für die Überfahrt geboten hatte, wartete bereits. Er würde nichts unversucht lassen, ihn selbst gegen die Widrigkeiten der Natur lebend hinüberzubringen. Hundert Dollar waren ein Angebot, das man nicht einfach ausschlagen konnte.
Das Glück blieb O´ Maley auch weiterhin treu. Die Überfahrt verlief, abgesehen von der heftigen Schaukelei, die ihm seine Gedärme kosten ließen, ohne größere Zwischenfälle. Doch als die Dhau unter vollem Segel in den Hafen von Brazzaville rauschte, verdunkelte sich urplötzlich der Horizont. Es wurde rabenschwarz um ihn herum und noch bevor er in den maroden Zollbaracken Schutz suchen konnte, brach der Monsun aus und die Pforten des Himmels öffneten sich zu einem höllischen Inferno.
Die Flucht gelang, aber seinen Verrat würde man nicht tolerieren. Was das bedeutete, war ihm klar. Sein Leben war keinen Cent mehr wert. Die einzige Chance, die ihm blieb, war unterzutauchen, für immer zu verschwinden. Er musste wieder von vorne anfangen, außerhalb einer Gemeinschaft, allein auf sich gestellt. Aber damit konnte er umgehen, er kannte es nicht anders.
+