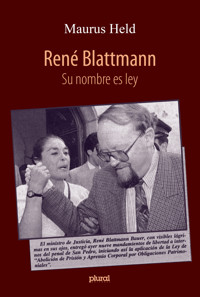Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rüffer & Rub
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Anfang 1994 erhält der schweizerisch-bolivianische Jurist René Blattmann spätnachts vom bolivianischen Präsidenten Gonzalo Sánchez de Lozada einen Anruf, der sein Leben maßgeblich verändert. In den folgenden drei Jahren setzt er als Minister für Justiz und Menschenrechte eine umfassende Reform des Rechtssystems unter anderem mit der »Ley Blattmann« (Lex Blattmann) durch, die vor allem der indigenen Bevölkerung, der Mehrheit des Volkes, zugute kommt. Diese war zuvor meist der Willkür der Justiz ausgesetzt. Dank der Reform genießt René Blattmann eine große Popularität im Land und so kandidiert er bei der nächsten Präsidentschaftswahl. Als er die Kandidatur zurückzieht, kehrt 1997 der ehemalige Diktator Hugo Banzer Suárez wieder an die Macht zurück – und mit ihm die alte Ordnung. Nachdem Blattmann die Menschenrechtsabteilung der zweijährigen UNO-Friedensmission in Guatemala geleitet hat, kandidiert er 2002 erneut für die Präsidentschaft in Bolivien – erfolglos. Den Höhepunkt seiner Karriere erreicht René Blattmann schließlich, als er 2003 zum Richter am neugegründeten Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gewählt wird. Er ist beteiligt am Verfahren und ersten Urteil des Strafgerichtshofes: Der kongolesische Warlord Thomas Lubanga Dyilo wird 2012 zu 14 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Heute lebt René Blattmann in der Nähe von Basel. Der Journalist Maurus Held zeichnet die spannungsreiche Geschichte René Blattmanns, dessen Leben zwischen Lateinamerika und Europa und seinen Einsatz für die Menschenrechte in einer literarisch überzeugenden Sprache nach.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maurus Held
René Blattmann
Sein Name ist Gesetz
Für Marianne
Der Verlag und der Autor bedanken sich für die großzügige Unterstützung bei
Annette Ringier-Stiftung
Elisabeth Jenny-Stiftung
Hamasil Stiftung
Der rüffer & rub Sachbuchverlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2024 unterstützt.
Erste Auflage Herbst 2023
Alle Rechte vorbehalten
Copyright 2023 by rüffer & rub Sachbuchverlag GmbH, Zürich
[email protected] | www.ruefferundrub.ch
E-Book-Konvertierung: Bookwire GmbH
ISBN 978-3-907351-20-8
eISBN 978-3-907351-27-7
Vorwort
001 Von Basel in den bolivianischen Dschungel
002 Mit einem Bleistift gegen das Böse
003 Die Farbe des Geldes
004 »Ein Land ohne Gerechtigkeit ist wie Erde ohne Wasser«
005 Bolivien hat mehr verdient: Das neue Justizministerium
006 Der Volksheld mit den Weihnachtsgeschenken
007 Spiel mit verdeckten Karten
008 »Der Weg entsteht beim Gehen«
009 Der Bohnenverkäufer aus Ituri
010 Zeugenaussagen, die unter die Haut gehen
011 Frieden durch Recht
012 Die Idealisten, sie werden gebraucht
ANHANG
Übersetzung Gedicht
Bildnachweis
Karten
Biografie des Autors
EN PAZ
Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida,
porque nunca me diste ni esperanza fallida,
ni trabajos injustos, ni pena inmerecida;
porque veo al final de mi rudo camino
que yo fui el arquitecto de mi propio destino;
que si extraje las mieles o la hiel de las cosas,
fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas:
cuando planté rosales, coseché siempre rosas.
… Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno:
¡mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno!
Hallé sin duda largas las noches de mis penas;
mas no me prometiste tan sólo noches buenas;
y en cambio tuve algunas santamente serenas …
Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.
¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!
Amado Nervo (1870–1919)
(Übersetzung im Anhang)
»Gárcia Márquez verwendet einen Stil namens Realismo mágico. In einem sonst realen Setting passieren plötzlich magische Dinge, die für den Leser unerklärlich sind, für die Figuren aber ganz normal. Und weißt du was? Es gibt einen Grund, warum der Stil mit Südamerika assoziiert wird …«
Ein schweizerisch-bolivianischer Staatsbürger, der fernab der Schweiz, in seiner zweiten Heimat, als Justizminister Tausenden von Indigenen die lang ersehnte Freiheit ermöglicht, zu einer populären Figur aufsteigt und später als Richter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag amtet – dieses Leben musste erzählt werden. Daran zweifelte ich keine Sekunde, vor allem, weil René und seine Errungenschaften hierzulande kaum bekannt sind. So schrieb sich das Porträt im Eiltempo, derart fasziniert war ich von all dem, was er mir erzählte und erklärte. Schon während des Schreibens wuchs in mir die Zuversicht, dass der Text einen Platz in »Charakterköpfe« finden würde, was sich dann auch bestätigen sollte. Das Buch erschien im August 2021. Das wahre Potenzial der Zusammenarbeit mit René wurde mir aber erst bewusst, als unser Porträt schließlich unter die Top 4 von insgesamt 28 gewählt und prämiert wurde.
»Wir haben wirklich gewonnen? Verflixt, Maurus, ich brauche einen Drink.«
»René, ich hab da eine Idee …«
»Weißt du, Maurus, wenn du meine Biografie schreiben willst, dann brauchst du keine Elemente des Realismo mágico zu verwenden. Mein Leben hat schon genug solche.«
Und so legten wir los. Wir recherchierten und durchstöberten Gerichtsakten, Gesetzestexte und Zeitungsartikel. Ich machte alte Wegbegleiter Renés ausfindig, schrieb diverse E-Mails und telefonierte nach Südamerika. Er gab mir einen Crashkurs in Jurisprudenz, lehrte mich das römisch-germanische Recht und das Common Law, vor allem aber die Geschichte des Völkerrechts. Da René diese als Richter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag mitprägte, enthält dieses Buch drei kurze, aber dennoch wichtige Exkurse zum Völkerrecht. Im ersten Kapitel enthalten ist auch eine Anekdote mit dem bolivianischen Notar Victoriano Hurtado. Dieser sollte der einzige Mensch sein, den René je antraf, der seinen Großvater Karl noch persönlich kannte. Mit Karl, der 1905 von Basel nach Bolivien auswanderte, beginnt die Geschichte der Blattmanns fernab der Schweiz – und folglich auch dieses Buch. Fortan wird das Leben seines Enkels chronologisch erzählt, wobei einzelne Rückblenden in seine Vergangenheit und jene seiner Familie ein auflockerndes Element darstellen.
Aus insgesamt 17 Tagen, verteilt über anderthalb Jahre – Corona sollte das eine oder andere Mal noch reinfunken –, sind rund 80 Stunden aufgenommenes Tonmaterial und gegen 50 Seiten kaum entzifferbare Notizen entstanden. Daraus resultiert letztlich diese Biografie, die Sie nun in den Händen halten. Eine Menge Geduld war gefragt, viel Ausdauer, Hingabe und Disziplin. Gelohnt hat es sich allemal.
»Maurus, und was ist mit den Elementen des Realismo mágico?«
»Aber René, du hast doch gesagt …«
Zu guter Letzt bleibt mir nur, Danke zu sagen. Gracias, René, für dein Vertrauen, für diese so spannende, lehrreiche und intensive Zusammenarbeit. Deine Biografie zu schreiben war mir eine große Freude und wird mir in bester Erinnerung bleiben, genauso wie die vielen Gespräche, Spaziergänge und Mittagessen abseits des Schaffens.
Dem rüffer & rub Sachbuchverlag möchte ich ebenfalls für die tolle und unkomplizierte Kooperation danken; Anne Rüffer für das Vertrauen in mich und mein Vorhaben, Felix Ghezzi für das Lektorat, Saskia Nobir für die Covergestaltung und das Layout. Großen Dank gebührt darüber hinaus Kathia Saucedo, Nelly La Mar, Arturo »Zorro« Yáñez Cortes und Godofredo Reinicke, die mir alle meine Fragen jeweils innert kürzester Zeit beantworteten, trotz der Zeitdifferenz zwischen Europa und Südamerika. Jan Müller und Sven Micossé danke ich für ihre diversen Impulse während des Schreibprozesses und bei der Covergestaltung, genauso wie meinen Eltern, meiner Schwester und Richi Hänzi. Ihm, aber auch Pablo Blattmann gebührt ein spezieller Dank: Besonders wegen ihrer Initiative ist die Idee zu diesem Buch überhaupt entstanden.
Wenige Monate zuvor, im Herbst des Jahres 1905, hatte Karl Blattmann, René Blattmanns Großvater, seine Schweizer Heimatstadt Basel verlassen und war einem Stellenangebot der französischen Firma Braillard & Co. nach Paris gefolgt. Braillard war ein Handelshaus, das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erkannt hatte, womit sich eine Menge Geld machen ließ, und zwar mit Kautschuk. Die natürliche Form dieses milchigen Stoffes wird aus dem gleichnamigen Baum gewonnen, und dieser Baum, dessen wissenschaftlicher Name Hevea brasiliensis lautet, wuchs zu jener Zeit einzig in den endlosen, tropischen Weiten des Amazonasbeckens. Bis anhin hatten die Überschwemmungsgebiete des Amazonas als ungeeignet gegolten, um Agrarkolonien zu errichten, weswegen nur wenige europäische Siedler ihr Glück in dieser Ecke der Erde versuchten. Die Entdeckung des Kautschuks sollte dies ändern. So entsandte Braillard Angestellte von Paris nach Brasilien, Bolivien und Peru, um zusammen mit ihren Stammhäusern vor Ort die Kautschukgewinnung voranzutreiben. Die enormen Kautschukmassen brachten sie auf den unzähligen Nebenflüssen des Amazonas zum Ozean, von wo aus schließlich der Transport nach Europa und Amerika arrangiert wurde. Um diese kommerziellen und logistischen Herausforderungen zu meistern, war das Unternehmen darauf angewiesen, erfahrene Männer anzustellen, die ihr Handwerk verstanden und zu den einheimischen Arbeitern einen guten Draht finden würden. Karl Blattmann sollte einer von ihnen sein. Der 23-Jährige hatte es stets gemocht, zu reisen, Neues zu sehen, das Bekannte zu verlassen, um dem Fremden zu begegnen, er war ein leidenschaftlicher Fotograf und lichtete mit seiner Balgenkamera alles ab, was ihn auf irgendeine Weise faszinierte. Und so hatte er ohne lange zu zögern die Offerte als Führungskraft in einer Filialverwaltung in Übersee angenommen. Ein paar Wochen später war er nach Paris aufgebrochen, von wo es nach Amsterdam ging und jetzt per Schiff nach Callao, Peru. Einmal angekommen, würden es nochmals rund 2000 Kilometer Landweg bis zur finalen Destination sein: Riberalta, Bolivien.
Riberalta liegt im tiefen Dschungel des bolivianischen Nordens, im Departamento Beni, nahe der Grenze zu Brasilien, dort, wo die beiden Flüsse Madre de Dios und Beni zueinanderfinden. Das Dorf war einst die Heimat der Pacahuara und der Chácobo, zweier Ureinwohnerstämme, denen es lange Zeit gelungen war, ihre Kommunen vehement gegen die Invasion der europäischen Siedler zu verteidigen und ihre Kulturen und Traditionen zu bewahren. Der Name Riberalta setzt sich aus den spanischen Wörtern ribera und alta zusammen und bedeutet »hohes Ufer«, doch bevor die Fremden, die den indigenen Schutzwall gegen Ende des 19. Jahrhunderts dann doch allmählich zu durchbrechen wussten, dem Dorf diesen Namen gaben, wurde es von seinen Einwohnern liebevoll Pamahuayá genannt, »Ort der Früchte«. Die Chirimoya, zu Deutsch Rahmapfel, oder die Jabuticaba, die Baumstammkirschen, wachsen hier überall, auf den Feldern, in den Gärten, entlang der beiden Flüsse, im Dschungel, und so wie diese Früchte seit jeher wachsen, so tun es die Kautschukbäume. Auf Quechua, der Sprache der Ureinwohner, bedeutet Kautschuk »weinendes Holz«, und rückblickend mag das eine traurige Vorahnung gewesen sein, denn die Ankunft der Handelsmänner aus Übersee markierte den Anfang des Untergangs von Pamahuayá und den Aufstieg von Riberalta, wie man es heute kennt. Offiziell als Dorf eingeweiht wurde der Ort im Jahre 1885 von Federico Bodo Clausen, einem Schweizer wie Karl Blattmann, der seinem Pioniergeist in die weite Welt gefolgt war, auf der Suche nach Glück und Wohlstand.
Nach 23 Tagen an Bord der »La Plata« erreichten Karl Blattmann und weitere Mitarbeiter der Firma Braillard den Hafen von Callao in Peru. Sogleich setzten sie ihre Reise über Arequipa und über die bolivianische Grenze via La Paz fort, den Yungas, einer Region aus tiefen, subtropischen Tälern entlang in Richtung Reyes und El Cerrito, bis sie endlich in Riberalta ankamen. Dort wurden sie von französischen, schweizerischen und anderen europäischen Händlern empfangen und sogleich mit der Infrastruktur vor Ort vertraut gemacht. Viele von ihnen hatten ihre Heimat schon Jahre zuvor verlassen und sich im bolivianischen Regenwald ein neues Leben aufgebaut. Die hohen Angestellten, die Ejecutivos, waren unschwer an ihrer eleganten Kleidung zu erkennen, denn sie trugen, wegen des tropischen Klimas, die meiste Zeit Weiß. Weiße Leinenhemden, weiße Hosen, weiße Schuhe. Wie Ärzte sahen sie aus, und manche von ihnen waren es auch, denn wegen der lästigen Moskitos, die man in Europa nicht kannte, erkrankte immer wieder jemand an Malaria oder am Denguefieber. Für diese Fälle hatte Braillard gar ein eigenes Krankenhaus errichtet. Karl und seine Mitarbeiter blieben die meiste Zeit unter sich, an den Wochenenden gingen sie mit ihren Hunden und dem Puma, den Karl als Haustier hielt, spazieren, oder sie ritten zu Pferd in die Weiten des Dschungels hinaus. Allzu großen Kontakt mit der indigenen Bevölkerung im Dorf pflegten sie nicht. Ihre Spanischkenntnisse waren, je nachdem, wie lange sie hier waren, noch nicht gut genug, als dass sie zu ihnen eine engere Beziehung hätten aufbauen können, oder die Indigenen sprachen selbst kein oder nur wenig Spanisch. Und selbst wenn die Sprachbarrieren aus dem Wege geschafft worden wären, so hätte den Fremden vonseiten der Indigenen immer noch eine gehörige Portion Misstrauen entgegengeschlagen. Die Ankunft der Conquistadores ab dem 16. Jahrhundert hatte sie gelehrt, dass der Verlauf der Geschichte durch Fremde von heute auf morgen in Bahnen gelenkt werden konnte, deren Tragweite sie gar nicht zu erahnen wussten. Dies war unweigerlich in ihr kollektives Gedächtnis eingebrannt.
Karl Blattmann war es nicht zuletzt deshalb ein besonderes Anliegen, denjenigen Einheimischen, die für Braillard arbeiteten, mit Anstand und Respekt zu begegnen und zu signalisieren, dass er ihnen gegenüber alles andere als feindselig gestimmt war. Er nahm sich ihrer an und brachte ihnen das Handwerk eines Kaufmanns bei, wobei er vor allem Wert darauf legte, sie typisch schweizerische Tugenden zu lehren: Genauigkeit, Pünktlichkeit und Disziplin. Diese, das hatte er schnell erkannt, waren den Indigenen nicht allzu sehr vertraut, was ihn als einer der Verantwortlichen seiner Filiale das eine oder andere Mal in die Bredouille brachte. So hatte sich ein junger Laufbursche namens Victoriano Hurtado einst nicht darum geschert, den Deckel seines Tintenglases zu schließen, wodurch die Tinte in der tropischen Hitze austrocknete. Blattmann scheute sich nicht davor, Victorianos abendliche Freizeitpläne zu durchkreuzen und ihm zu befehlen, das Versäumnis sogleich nachzuholen. Obschon sich dieser ungemein darauf freute, einem der größten Dorffeste des Jahres, der Dreikönigsfeier am 6. Januar, beizuwohnen und er sich hierfür bereits Stunden zuvor, gleich nach Dienstschluss, im Publikum eingefunden hatte, musste er, als das Fest nun endlich losging, seinen Platz nochmals verlassen und ins Büro zurückkehren. Der Laufbursche sollte verstehen, wie umständlich die Beschaffung von Gütern nach Riberalta war und dass mit ihnen stets bedächtig umgegangen werden musste. Danach blieb kein einziges Tintenglas geöffnet.
Jahre nach seiner Ankunft im Norden Boliviens hatte sich rumgesprochen, dass Karl Blattmann diese Tugenden nicht nur lehrte, sondern selbst lebte und zur Schau stellte. Er hatte sich in Riberalta einen Namen als fleißigen Geschäftsmann gemacht, der Handel lief gut, und so wurde er schließlich von der Casa Suárez abgeworben. Dieses Handelshaus befand sich in einer kleinen Siedlung namens Cachuela Esperanza, im Grenzgebiet zu Brasilien, rund hundert Kilometer weiter nordwestlich, und war, wie die Siedlung selbst, von den Gebrüdern Suárez Callaú gegründet worden. Sieben an der Zahl waren sie, ihr Anführer war Nicolás, der wohl erfolgreichste Kautschukbaron Boliviens, der zu Höchstzeiten beinahe das Monopol der Kautschukgewinnung besaß. Mit seinem Reichtum hatte er eben mal kurz gar eine eigene Armee ausgerüstet, bestehend aus Angestellten seines mächtigen Handelshauses, mit denen er um die Jahrhundertwende in einen Grenzkrieg gegen die Brasilianer zog und diese fortscheuchte, wodurch die ganze Region bolivianisches Territorium blieb. Nicolás Suárez Callaú, dieses unerschrockene Alphatier, erkannte Karl Blattmanns Potenzial, und so wurde dieser im Jahre 1913 in Cachuela Esperanza zum Gerente general, zum Geschäftsführer der Casa Suárez ernannt. Die harte Arbeit in Riberalta hatte sich bezahlt gemacht.
–––
Rund ein halbes Jahrtausend zuvor beherrschte 60 Kilometer von Basel rheinaufwärts ein Tyrann das Dorf Breisach. Breisach gehörte zum Herzogtum Burgund, das von Karl dem Kühnen (1433–1477) regiert wurde, und dieser galt als Inbegriff eines wahren Ritters. Er scheute sich vor keinem Kampf, verteidigte seine Territorien stets mit eiserner Härte und ließ kaum eine Chance ungenutzt, dem Volk seine Macht zu demonstrieren. Und so, wie der Herzog regierte, taten es seine Landvögte. Diese kümmerten sich um die alltäglichen Verwaltungsgeschäfte, die in den einzelnen Gebieten im Herzogtum anfielen, sodass sich Karl der Kühne gänzlich seiner Leidenschaft, dem Militär, widmen konnte. Einer dieser Landvögte war Peter von Hagenbach (1420–1474), und dessen Tyrannei sollte ihn einst teuer zu stehen kommen. Unter seiner Herrschaft wurden vor allem die Breisacher Frauen und Kinder konstant schikaniert und misshandelt, irrsinnige Steuern und Zölle wurden auf Lebensmittel und andere Güter erhoben, politische Oppositionelle willkürlich hingerichtet. So durfte es nicht verwundern, dass der Unmut innerhalb der Bevölkerung entlang des Rheins immer größer wurde, bis er schließlich in einem Aufstand mehrerer Dörfer mündete. Im April 1474 wurde Peter von Hagenbach gestürzt und gefangen genommen, und alsbald hatte er sich im Radbrunnenturm von Breisach vor Gericht zu verantworten. Zwei der insgesamt fünf Anklagepunkte lauteten auf Mord und Vergewaltigung.
Am Ende stand das Todesurteil, und dieses dürfte kaum ein großes Echo ausgelöst haben, waren Schuldsprüche solcherart zu jener Zeit üblich. Dennoch sollte der Gerichtsprozess gegen Peter von Hagenbach noch Jahrhunderte später nachhallen und von Historikern und Rechtsgelehrten als einer der Grundsteine des Völkerrechts erachtet werden, denn es handelte sich um den ersten internationalen Kriegsverbrecherprozess der Geschichte. Das eigens für dieses Verfahren einberufene Tribunal wurde mit 28 Richtern aus mehreren Teilstaaten des Heiligen Römischen Reichs besetzt, sie kamen aus verschiedenen Königreichen, Fürstentümern oder Grafschaften. Diese Transnationalität war ein Novum, begrenzten sich Gerichte bisher für gewöhnlich auf ein Zuständigkeitsgebiet innerhalb eines Staates. Darüber hinaus sahen die Richter in der Vergewaltigung, die unter Hagenbachs Obrigkeit geschah, ein Kriegsverbrechen und ahndeten sie entsprechend. Noch nie zuvor war ein Gerichtsurteil bezüglich sexueller, geschlechtsspezifischer Verbrechen ausgesprochen worden. Und was die sogenannte Vorgesetztenverantwortlichkeit betraf, wurde in Breisach ebenfalls ein Präzedenzfall geschaffen. Peter von Hagenbach argumentierte, er habe unmöglich über alle Verbrechen, die von seinen Untertanen verübt worden waren, Bescheid wissen oder diese rechtzeitig unterbinden können. Das Gericht hingegen war der Ansicht, dass genau das seine Pflicht als Vorgesetzter gewesen sei und er diese versäumt habe, woraufhin die Straftaten Hagenbach angelastet wurden, als hätte er sie selbst begangen. Für die Kriegsverbrecherprozesse während der Nachkriegszeit des 20. Jahrhunderts sollte dieses Rechtsverständnis fundamental sein. In vielen der Urteilsschriften finden sich Referenzen auf Peter von Hagenbachs Prozess.
–––
Pastor Oyola Ojopi war erzürnt, und wie! Er mochte zwar, obschon sein Vorname anderes vermuten ließ, nur ein einfacher Bürger aus dem Departamento Beni sein, doch das hatte nicht zu bedeuten, dass er nicht um seine Bürgerrechte wusste. Und diese sahen bestimmt nicht vor, das Opfer von zwei wild gewordenen, habgierigen und machtsüchtigen Verwaltungsbeamten zu werden, die in jenem Moment Amtsmissbrauch begingen, als sie ihn und eine Vielzahl seiner Mitbürger gewaltvoll misshandelten. Also reichte Pastor im Jahr 1893 bei der obersten Regierung in La Paz eine offizielle Queja ein, eine Klage, und dieser verpasste er die Überschrift »Zwei Monster im Beni«, sodass ja keine Zweifel bestanden, wofür er den Präfekten Samuel González Portal und dessen Unterpräfekten Rómulo Arano Peredo hielt. Letzterer war ausgerechnet der Gatte seiner Cousine, eine unglückliche Gegebenheit, für Pastor Oyola Ojopi allerdings noch längst kein Grund, nun scheinheilige familiäre Loyalität zu demonstrieren. Die beiden Präfekte sollten seiner Meinung nach unverzüglich ihrer Ämter und ihrer Immunität enthoben werden. »Anlässlich mehrerer unsäglicher Anschläge in Trinidad, der Hauptstadt des Departamento Beni, und in anderen Städten, wurden wir eingesperrt, schikaniert, ausgebeutet und letztendlich deportiert, viele unserer Nachbarn ohne jeglichen legalen Grund, ohne rechtmäßiges Verfahren und mit absoluter Übertretung der Grundrechte, die die Wohnung, das Eigentum und die Freiheit des Bürgers garantieren«, schrieb Pastor in seiner Klage an den Ministro de Gobierno, den Regierungsminister. Angeblich hätten er und seine Mitbürger gegen die verfassungsmäßige Ordnung rebelliert, doch der wahre Grund für die Verbrechen des Präfekten González Portal und dessen Unterpräfekten Arano Peredo sei schlicht und einfach deren Wunsch gewesen, sie aus den reichen Ländern des Beni zu vertreiben, aus einer Region, in der sie wohlgemerkt schon seit Generationen zu Hause seien. Tatsächlich war Pastors Großvater Hipólito Ojopi ein allseits geschätzter und wohlhabender Cacique, ein Stammeshäuptling der Baure, eine Volksgruppe aus dem Osten des Beni, und als dessen Enkel fühlte sich Pastor erst recht in der Pflicht, auf die Ausbeutung von Ureinwohnern aufmerksam zu machen. Die beiden Beamten seien hart zu bestrafen, forderte er, den Opfern seien die gestohlenen Güter inklusive Zinsen zurückzuerstatten. Für Pastor erbot sich in der Anklage aber nicht nur die Chance, die finanziellen Schäden zu tilgen, sondern auch die seelischen Wunden zu heilen, die er und seine Liebsten erlitten hatten. Soeben waren er und seine Gattin Eltern einer Tochter geworden, von Cristina, und an sie hatte er ununterbrochen denken müssen während seiner Gefangenschaft. Pastor Oyola Ojopi verlor beinahe den Verstand bei dem Gedanken daran, seine Tochter als Halbwaise zurücklassen zu müssen.
So weit kam es glücklicherweise nicht, denn die beiden Präfekte González Portal und Arano Peredo wurden alsbald von ihren Ämtern entbunden. Die Gerechtigkeit hatte gesiegt. So sah Pastor Oyola Ojopi seine Tochter Cristina über den Lauf der Zeit zu einer schönen jungen Frau heranwachsen. Für eine Baure charakteristisch, hatte sie kräftige Gesichtszüge, pechschwarze Haare und dunkle Augen, und eines Tages sollten diese Augen einen Kautschukhändler erblicken, der sich dem ruhigen und beinahe etwas melancholischen Ausdruck Cristinas nicht entziehen konnte und sich in sie verliebte. Karl Blattmann hieß der Mann, er war Schweizer und seit rund drei Jahren der Geschäftsführer und Bevollmächtigter der Casa Suárez in Cachuela Esperanza, an jenem kleinen Ort, wo im Jahr 1917 schließlich ihr gemeinsamer Sohn das Licht der Welt erblicken sollte. Sie tauften ihn René Carlos, und der Kleine kam ganz nach der Mutter, die Gene der Baure waren nicht von der Hand zu weisen. Renequito, wie er liebevoll genannt wurde, war Cristinas und Karls ganzer Stolz. Sie behüteten ihn mit viel Zuneigung, und wenn sie draußen auf den Feldern von Cachuela Esperanza beschäftigt waren, dann schaute stets eine Niñera, ein Kindermädchen, nach ihrem Sohn. In den ersten beiden Jahren nach René Carlos’ Geburt war dies ganz üblich.
Dann kam das dritte Jahr. Ein dreijähriges Kind ist natürlich noch viel zu jung, um die Dinge in all ihren Dimensionen bereits verstehen zu können, und dennoch registriert der Verstand mehr, als dies Erwachsene wohl für möglich halten würden. René Carlos musste aufgefallen sein, dass um seinen Vater herum plötzlich ein stets in Weiß gekleideter Mann zugegen war, zuerst in willkürlichen zeitlichen Abständen, bald aber immer regelmäßiger. Dieser Mann besuchte Karl Blattmann meist in dessen Schlafzimmer, was per se ein Kuriosum war, denn für gewöhnlich war er tagsüber bei der Arbeit und hielt sich nicht zu Hause auf, und jedes Mal, wenn der Mann in Weiß kam, nahm Cristina ihren Sohn bei der Hand und ging mit ihm ins Wohnzimmer nebenan. Erste Anzeichen und Symptome von Malaria tauchen üblicherweise ab dem achten Tag nach dem Stich einer infizierten Anopheles-Mücke auf, oft auch erst später. Zuerst mag man das Ganze für eine normale Grippe halten, man leidet unter Kopfschmerzen, Fieber, Gelenkschmerzen. Verdacht geschöpft wird oft erst, wenn man von Kälte, Zittern, Fieber und Schweißausbrüchen geplagt wird, und zwar in dieser Reihenfolge und in regelmäßigen Zyklen von zwei bis drei Tagen. Ein solcher Rhythmus kann aber auch anders verlaufen oder ganz ausbleiben, weswegen nicht der Fehler begangen werden sollte, dessen Absenz als Indiz für eine Nicht-Infektion zu sehen. Ein weiteres Symptom der Krankheit ist die Beeinträchtigung des Verstands bis hin zu Bewusstseinsstörungen, bei denen der Patient im schlimmsten Fall gar ins Koma fällt. Karl Blattmann blieb dieses Szenario zwar erspart, den Verstand aber, zumindest aus Sicht seiner Nächsten, die sich um ihn kümmerten, schien er dennoch verloren zu haben, als er, geplagt von Fieber und Schüttelfrost, den Entschluss fasste, nach Basel heimzukehren. Mit René Carlos. Ohne Cristina.
–––
Im Jahr 1807, knapp 400 Jahre nach dem Prozess gegen Peter von Hagenbach in Breisach, verabschiedete das Parlament Großbritanniens in London ein Gesetz, das auf dem gesamten Territorium des britischen Reichs den Sklavenhandel verbot. Diesem neuen Gesetz, dem Slave Trade Act, war die sogenannte Abolitionismus-Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei vorausgegangen, die im Verlaufe des Zeitalters der Aufklärung immer mehr Zuwachs verzeichnen konnte und von Vertretern der evangelischen Kirche unterstützt wurde. Für viele von ihnen war der internationale Handel mit Menschen nicht weiter vereinbar mit ihren ethischen und religiösen Überzeugungen. Hinzu kam, dass sich Großbritannien zu jener Zeit in einem ziemlich erfolglosen Krieg gegen die Franzosen befand. Deren Kaiser Napoleon Bonaparte hatte nach der französischen Revolution von 1789 bis 1799 den Sklavenhandel in seinen Überseekolonien wieder legalisiert, und so sollte die Einführung des Abschaffungsgesetzes der Briten auch die Botschaft an ihn und die Welt senden, dem Gegner zumindest moralisch überlegen zu sein. In London war man sich allerdings durchaus bewusst, dass der illegale Sklavenhandel weiterhin florieren und nicht halt vor einer neuen Gesetzgebung machen würde. Um dem entgegenzuwirken, unterzeichnete die britische Regierung im Laufe der Jahre mehrere Bilateralverträge mit den am meisten in den Sklavenhandel involvierten Kolonialmächten, in erster Linie mit den Königreichen Portugal, Spanien und den Niederlanden. Die Verträge beschlossen die Gründungen von sogenannten Mixed Commission Courts, von permanenten Strafgerichten, die sich in den Kolonien auf dem amerikanischen Kontinent befinden würden, dort, wohin Millionen von afrikanischen Frauen, Männern und Kindern auf Schiffen verschleppt wurden. In Rio de Janeiro, in Havanna oder in Surinam konnten nun, unter Verwaltung der einzelnen Königreiche, deren Entführer zur Verantwortung gezogen werden. Insgesamt wurden so rund 600 Fälle von Sklavenhandel untersucht, mindestens 80000 Afrikaner, die auf unrechtmäßigen Sklavenschiffen gefangen gehalten wurden, erlangten ihre Freiheit zurück, die Kapitäne und Besatzungen von etlichen gekaperten und in Häfen festgehaltenen Schiffen hatten vor Gericht zu erscheinen. Auf dem Heimatkontinent der Sklaven, in Sierra Leone oder in Kapstadt, errichtete das britische Königreich ebenfalls eigene Tribunale. Später traten auch Bolivien, das damals noch über einen Zugang zum Pazifik verfügte, und die Vereinigten Staaten der Koalition bei, nachdem sich Letztere anfänglich geweigert hatten, die bilateralen Verträge zu unterzeichnen.
War das Gesetz von den Kolonialmächten während Jahrhunderten, bis zum Inkrafttreten des Slave Trade Acts und ähnlichen Beschlüssen, immer wieder missbraucht worden, um den Menschenhandel zu legalisieren und zu rechtfertigen, so signalisierten die internationalen Antisklaverei-Gerichtshöfe entlang des Atlantiks den Beginn eines deutlichen Sinneswandels und einen weiteren denkwürdigen Meilenstein in der Entwicklung des Völkerrechts. Sie waren die allerersten Prozesse, denen Verträge zwischen zwei oder mehreren souveränen Staaten zugrunde lagen und die internationales Recht anwendeten. Dadurch ebneten sie den Weg für spätere internationale Gerichtsverhandlungen, konkret für jene nach dem Zweiten Weltkrieg. Dass die Prozesse den Sklavenhandel ahndeten, eines der größten Verbrechen gegen die Menschheit, macht sie rückblickend zu den erfolgreichsten zwischenstaatlichen Gerichtsprozessen in Bezug auf Menschenrechte.
–––
Er stand auf dem Deck der »MS Vulcania«, jenes Schiffes, das ihn nach Buenos Aires bringen würde. Es war spätabends, rund um ihn herum war es stockfinster, einzig die Reling vor ihm war zu erkennen sowie das weiß schäumende Meerwasser rund zwei Dutzend Merter unter ihm, das schwach beleuchtet wurde von ein paar Sternen, die vom Himmel herabstrahlten und ihn zu begleiten schienen. Das Schiff befand sich vor der Küste Spaniens. Demnächst würde es in die Straße von Gibraltar einbiegen, ehe es die Weiten des Atlantiks auf sich nahm.
Drei Jahre zuvor hatte der 20-jährige René Carlos eines Abends, er war gerade vom Handballtraining zurückgekehrt, seinen Vater leblos in dessen Bett vorgefunden. Nach fast zwei Jahrzehnten des Leidens war Karl Blattmann 1937 der Malaria erlegen, daheim in Basel. René Carlos war während all der Jahre nie von seiner Seite gewichen. Er hatte sich um die Einkäufe, um die Arztkonsultationen und um alle anderen Angelegenheiten gekümmert, als sein Vater keine Kraft mehr dazu hatte und aufgrund seiner nahezu vollständigen Erblindung nicht mehr zum Lesen und Schreiben imstande war. René Carlos hatte sich um ihn gesorgt, so gut es nur ging, während er selbst sein eigenes Leben zu meistern hatte, die Schule besuchte, sich einen Freundeskreis aufbaute, im Sportverein aktiv war, Handball spielte, Pubertät und Adoleszenz durchlebte, erwachsen wurde. Ganz ohne seine Mutter Cristina. War er, als sein Vater starb, offiziell zu einer Halbwaise geworden, so war er das irgendwie schon seit seinem dritten Lebensjahr, als er sie das letzte Mal in Bolivien gesehen hatte. Seither hatte er keinen Kontakt mit ihr, er wusste nicht, ob sie wieder geheiratet und weitere Kinder bekommen hatte, wie sie lebte, oder wo sie lebte. Ob sie überhaupt noch lebte. Diese Fragen stellte sich René Carlos immer wieder, und manchmal stellte er sie auch Karl, dessen vage, ausweichende Antworten allerdings nur noch mehr Fragen aufwarfen. Also beließ er es meist dabei und hakte nicht weiter nach. Stattdessen kümmerte er sich um seinen Vater, besuchte die Schule, spielte Handball, traf seine Freunde, und als der Vater starb, ging mit ihm die letzte Chance, etwas über seine Mutter zu erfahren. So verbrachte René Carlos auch die darauffolgenden Jahre in Basel. Schule, Handball, Freunde. Die Fragen aber blieben.
Je stärker ihn das Fernweh geplagt hatte, die Sehnsucht nach der Mutter und das Verlangen nach Antworten und Klarheit, desto deutlicher war in René Carlos der Entschluss gereift, Basel hinter sich zu lassen und an jenen Ort zurückzukehren, über den er die letzten 20 Jahre ständig sinnierte, an jenen Ort, der so weit weg schien und doch stets präsent war, der ihm kaum eine Erinnerung hinterließ und ihn als Menschen trotzdem zeichnete, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn er durch die Straßen Basels ging, fiel ihm immer wieder auf, wie er von Passanten merkwürdig angeschaut wurde oder die große Augen machten, sobald sie ihn in fließendem Baslerdialekt reden hörten. Er war zwar ein Blattmann, aber eben auch ein Baure, ein Indigener, und diesen dunklen Teint, die schwarzen Haare, die buschigen Augenbrauen, das alles kannte man in der Schweiz so nicht. Als er 1940 seine Heimatstadt verließ, fragte er sich, ob ihm im tropischen Norden Boliviens dasselbe widerfahren würde, ob sie ihn für einen Fremden halten würden oder aber für einen von ihnen.
Nach zwölf Tagen an Bord der »MS Vulcania« erreichte René Carlos den Hafen von Buenos Aires und setzte seine Reise per Bus nach Cachuela Esperanza fort, seinen Geburtsort, und als er ankam, begriff er schnell, dass Ersteres der Fall war. Seine Kleidung unterschied sich zwar nicht allzu sehr von jener der Angestellten der Casa Suárez, die, trotz ihrer offensichtlichen Vorliebe für die Farbe Weiß, den Stil ihrer Väter aus Europa größtenteils konserviert hatten und dadurch einen deutlichen Kontrast bildeten zu den traditionellen Kleidungsstücken der indigenen Bevölkerung. Was den jungen Mann aber definitiv als Fremden entlarvte, war sein Spanisch, das er mit schweizerdeutschem Akzent sprach, denn praktizieren konnte er die Sprache fast ausschließlich mit seinem Vater, und dieser hatte sie selbst erst in seinen Zwanzigern erlernt. So lauschten die Menschen in der Casa Suárez ganz gespannt seinen Worten, um zu erfahren, woher der junge Fremde kam und dass dieser auf der Suche nach seiner Mutter war. Die älteren unter ihnen mochten sich noch an Karl Blattmann erinnern, der einst ihr Chef gewesen war, andere stammten, wie René Carlos selbst, von schweizerischen und deutschen Übersiedlern ab und waren zu jung, um seinen Vater gekannt zu haben. Die Angestellten der Casa Suárez erzählten ihm Geschichten aus der alten Heimat, die schon ihre Väter erzählt hatten, wobei manch einer die Gunst der Stunde nutzte, um seine eingerosteten Deutschkenntnisse aufzupolieren. Die Menschen in Cachuela Esperanza waren äußerst gastfreundlich, sie kochten für ihn, sie lehrten ihn das Fischen im Río Beni, sie erklärten ihm den Kautschukhandel. Sie halfen ihm, wo sie konnten. Schnell schlossen sie René Carlos in ihre Herzen. Und nur zu gerne hätten sie ihm eine Antwort gegeben auf diese eine Frage, die er ihnen stellte.
Es war nicht so, dass sein Wunsch, Mutter Cristina endlich ausfindig zu machen, jemals nachgelassen hätte. Und doch verspürte René Carlos über die nächsten