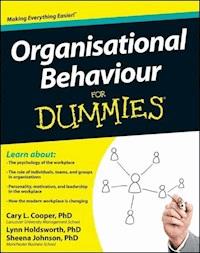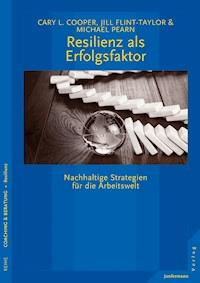
28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Junfermann Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Resilienz am Arbeitsplatz Wie kann man in der Arbeitswelt bestehen, selbst bei hohen Anforderungen und unter schwierigen Bedingungen? Was lässt Menschen Rückschläge und starken Stress verkraften? Die Autoren beschäftigen sich zunächst mit den Hauptstressoren im Arbeitsleben und gehen anschließend darauf ein, wie sich Resilienz aufbauen lässt, am Arbeitsplatz, aber auch in anderen Lebensbereichen. Es geht um nachhaltige Strategien, sich zu erholen und seine Performance zu verbessern. Das Buch richtet sich an Führungskräfte und im Coaching bzw. Training Tätige, die das Thema Resilienz in der Arbeitswelt etablieren möchten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Cary L. Cooper, Jill Flint-Taylor & Michael PearnResilienz als ErfolgsfaktorNachhaltige Strategien für die Arbeitswelt
Über dieses Buch
Resilienz am Arbeitsplatz
Wie kann man in der Arbeitswelt bestehen, selbst bei hohen Anforderungen und unter schwierigen Bedingungen? Was lässt Menschen Rückschläge und starken Stress verkraften?
Die Autoren beschäftigen sich zunächst mit den Hauptstressoren im Arbeitsleben und gehen anschließend darauf ein, wie sich Resilienz aufbauen lässt, am Arbeitsplatz, aber auch in anderen Lebensbereichen. Es geht um nachhaltige Strategien, sich zu erholen und seine Performance zu verbessern und zudem eine andauernde Gesundung zu erreichen. Der entscheidende Vorteil: die Stärke, die aus dem erfolgreichen Umgang mit belastenden Situationen entsteht.
Das Buch richtet sich an Führungskräfte und im Coaching bzw. Training Tätige, die das Thema Resilienz in der Arbeitswelt etablieren möchten.
Sir Cary L. Cooper ist Professor für Organisations psychologie an der Lancaster University. Seine Expertise zum Thema Gesundheit und Wohlbefinden, nicht nur am Arbeitsplatz, ist weltweit gefragt.
Jill Flint-Taylor und Michael Pearn
Copyright © der deutschen Ausgabe: Junfermann Verlag, Paderborn 2017
Copyright © der Originalausgabe: Cary L. Cooper, Jill Flint-Taylor und Michael Pearn 2013
First published in English by Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited under the title Building Resilience for Success by Cary Cooper, Jill Flint-Taylor and Michael Pearn. This edition has been translated and published under licence from Palgrave Macmillan. The authors have asserted their right to be identified as the author of this Work.
Übersetzung: Friederike Moldenhauer
Coverfoto: © Ruslan Grumble – fotolia.com
Covergestaltung / Reihenentwurf: Christian Tschepp
Alle Rechte vorbehalten.
Erscheinungsdatum dieser eBook-Ausgabe: 2017
Satz, Layout & Digitalisierung: JUNFERMANN Druck & Service, Paderborn
ISBN der Printausgabe: 978-3-95571-499-4
ISBN dieses E-Books: 978-3-95571-531-1 (EPUB), 978-3-95571-533-5 (PDF), 978-3-95571-532-8 (MOBI).
Einführung
Die Bedeutung von Resilienz und der Zweck dieses Buches
In diesem Buch geht es um die Stärkung individueller Resilienz oder – wie man sie auch nennt – der psychologischen, emotionalen oder persönlichen Resilienz. Wir verwenden diese Begriffe synonym. Was aber meinen wir genau mit Resilienz? Die offensichtlichste, wenn auch recht eng gefasste Antwort darauf lautet, dass diese Art der Resilienz die Fähigkeit beschreibt, sich von Rückschlägen zu erholen und auch angesichts hoher Anforderungen und schwieriger Umstände weiter effektiv zu handeln. Darauf aufbauend geht unsere Definition über die Erholung von anstrengenden oder potenziell anstrengenden Ereignissen hinaus und umfasst eine andauernde Gesundung und einen nachhaltigen Vorteil: die Stärke, die aus dem erfolgreichen Umgang mit solchen Situationen entsteht.1 Die Fähigkeit, die so entwickelt wird, hilft, mit alltäglichen Problemen ebenso umzugehen wie mit Herausforderungen – individuelle Resilienz ist keineswegs nur in Extremsituationen oder bei Heldentaten gefragt.
Unser Ziel war es, ein Werk zusammenzustellen, das Führungskräften, Fachleuten im Bereich der Personalentwicklung, Personen im Lehrbetrieb, weiteren Experten im Bereich Lernen und Entwicklung und anderen dazu dient, Maßnahmen zur Stärkung von Resilienz am Arbeitsplatz zu initiieren, zu entwickeln, umzusetzen und zu evaluieren. Wir beschreiben und diskutieren viele unterschiedliche Ansätze, Erkenntnisse und praktische Anwendungen, berichten von unseren eigenen Erfahrungen, machen Vorschläge und geben Empfehlungen ab. Es ist nicht unsere Absicht, eine Anleitung zur Selbsthilfe oder ein Handbuch für Trainer zu präsentieren. Stattdessen wollen wir eine breite Basis an Wissen, Ideen und Lösungen zur Verfügung stellen, die auf verschiedene Arten genutzt werden kann, um unterschiedliche Bedürfnisse zu decken und in Organisationen unter unterschiedlichen Bedingungen angewendet zu werden.
Zunächst stellen wir in Teil I die Entwicklungen des Themas in den letzten 20 Jahren dar. Dabei beziehen wir uns sowohl auf die Forschung als auch auf die Praxis. Basierend auf Theorie, empirischen Ergebnissen und Erfahrung präsentieren wir ein zweiteiliges Rahmenwerk, das dazu dient, innerhalb von Organisationen die Stärkung von Resilienz zu strukturieren und die Umsetzung zu erleichtern. Teil I stellt die Anwendung von Expertenwissen aus Forschung und Praxis dar, um ein stabiles Bezugssystem zu entwickeln, das in Organisationen angewendet werden kann. Interessierten bieten wir detaillierte Verweise auf die Forschung, die hinter unserem Ansatz steckt.
Danach schauen wir uns in Teil II genauer an, wie sich die praktischen Maßnahmen zur Stärkung von Resilienz im Laufe der Zeit aufgrund neuer Forschungsergebnisse und Theorien verändert haben. Dabei werden Beispiele gegeben, die aufzeigen, was sich im Kontext einer Organisation erreichen lässt, und es werden Vorschläge detailliert präsentiert. In diesem Abschnitt werden insbesondere verschiedene Techniken und Erkenntnisse aufgrund einzelner Erfahrungen von Personen und Organisationen reflektiert. Wo angemessen, verweisen wir auf wichtige Untersuchungen, doch liegt das Hauptaugenmerk auf praktischen Vorschlägen und Beispielen.
Schließlich geben wir in Teil III eine strategische Übersicht und zeigen einige wichtige Wege auf, wie die Stärkung von Resilienz im Kontext größerer Organisationsziele und Interventionen verankert werden kann. Dazu gehören die Förderung von Führungsqualitäten (Leadership Development), der Wandel in der Organisation und die Leistungsverbesserung.
Umgang mit Belastungen: individuelle Unterschiede
Wenn wir uns auf individuelle Resilienz beziehen, dann bleiben einige Fragen offen, da wir auf die Tatsache hinweisen, dass diese Fähigkeit bei Personen unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Viele Menschen haben sich vermutlich schon einmal gewundert, wie ruhig ein Politiker im Fernsehen angesichts eines gegen ihn gerichteten Proteststurms bleiben kann. Bei anderer Gelegenheit verwundert es vielleicht, dass ein Freund oder Kollege sehr verletzlich auf etwas reagiert hat, was einen selbst in derselben Situation weniger angegriffen hätte. Daher ist es wichtig, mehr darüber zu erfahren, wie Resilienz funktioniert. Worin bestehen diese persönlichen Unterschiede, und sind sie in Stein gemeißelt oder kann jeder mit der Zeit seine Resilienz verbessern?
Was die letzte Frage betrifft, lässt sich sehr gut belegen, dass Resilienz in der Tat entwicklungsfähig ist. Auf die Forschungsergebnisse kommen wir später zu sprechen und in einigen Kapiteln werden wir einige praktische Maßnahmen und Ansätze untersuchen, die dazu beitragen, dieses Ziel, Resilienz zu entwickeln, zu erreichen. Zunächst müssen wir uns jedoch genauer anschauen, warum einige Menschen besser mit Belastungen umgehen als andere und warum dies für Organisationen ebenso wie für deren Mitarbeiter wichtig ist.
Beschreiben wir eine Person als resilient, dann meinen wir damit häufig, dass er oder sie gut mit Druck umgehen kann. Manche Menschen scheinen in Belastungssituationen sogar aufzublühen. Das Gegenteil wird im Allgemeinen beschrieben als Tendenz, „verletzlich auf Stress, Rückschläge oder Enttäuschungen“ zu reagieren. Hier wird deutlich, dass Belastungen „positiv“ (eine Herausforderung, die einen Antrieb darstellt) oder „negativ“ (belastend) sein können. Um also Resilienz zu begreifen, ist es notwendig, das Wesen von Belastungen und Stress zu verstehen.
Zunächst müssen wir festhalten, dass ein und dieselbe Situation für eine Person eine positive Herausforderung darstellen kann, während sie für eine andere eine Anstrengung ist. Beispielsweise kann das passieren, wenn der Vertriebsleiter die Ergebnisse für das Quartal präsentiert und deutlich zu verstehen gibt, dass er mit der Leistung des Teams unzufrieden ist. Ein Teammitglied mag das anspornen, sich in der nächsten Woche stärker anzustrengen, während ein anderes besorgt reagiert und entmutigt wird. Noch komplizierter wird es, da dieselbe Person in der nächsten Woche vielleicht ganz anders reagiert, auch wenn die Aussage vom Vertriebsleiter mehr oder weniger dieselbe ist.
Für diese unterschiedlichen Reaktionen gibt es viele Gründe, die sowohl auf situativen als auch stärker intrinsischen Faktoren der Beteiligten basieren. Für einen Manager mögen diese Einflüsse offensichtlich sein, oder zumindest für das betreffende Teammitglied. Andere Einflüsse sind schwieriger nachzuverfolgen, doch sie wirken sich dennoch darauf aus, wie sich die betreffende Person fühlt und was sie als Nächstes tut. Richard Lazarus2 erklärte individuelle Unterschiede im Erleben und im Ausdruck von Gefühlen im Sinne eines Prozesses, den er „Bewertung“ (appraisal) nannte:
„Bewerten zwei Individuen dieselbe Situation unterschiedlich, werden sich ihre emotionalen Reaktionen unterscheiden. Und wenn sie unterschiedliche Situationen gleich bewerten, wird ihre emotionale Reaktion dieselbe sein. Auch Coping … funktioniert durch die Beeinflussung und Änderung der Art und Weise, wie ein Individuum die Bedeutung dessen bewertet, was gerade passiert, und wie man damit umgehen könnte.“ (S. 336)
Diese theoretische Position ist nur eine von vielen, die die Rolle subjektiver Wahrnehmung und Überzeugung betonen, wenn es darum geht zu bestimmen, wie wir auf ein Ereignis reagieren. Sie stimmt vollkommen mit unserer Definition von Stress überein, der nämlich entsteht, wenn die Belastung die selbst wahrgenommene Fähigkeit, eine Situation zu bewältigen, übersteigt.3 Richard Lazarus sprach über Emotionen im Allgemeinen, aber viele Forscher und praktizierende Psychologen nehmen einen ähnlichen Standpunkt ein, wenn es um Ängste, Depressionen und Stress im Besonderen geht. Aus diesem Gebiet der klinischen Psychologie und psychischen Gesundheit, dazu gehört auch die Erforschung von Belastungen am Arbeitsplatz, stammt unser Verständnis von Resilienz zum Großteil.
Glücklicherweise sorgte ein reges Interesse an den Ursachen und der Behandlung von Angststörungen und Depressionen dafür, dass immer mehr auf diesem Gebiet geforscht wurde, während lange Zeit der Trend in der akademischen Psychologie vorherrschte, die Erforschung von Emotionen als unzeitgemäß abzutun. Jedoch ist das derzeitige steigende Interesse an Resilienz als Aspekt eines normalen Lebenszyklus von Erwachsenen – außerhalb der klinischen Psychologie und psychischen Krankheiten – eine eher jüngere Entwicklung. Am Ende dieses Buches kommen wir zu dem Schluss, dass sich Resilienz, insbesondere im betrieblichen Kontext, von einer Kur gegen Schwäche zu einem Kompetenzträger entwickelt hat, der dabei hilft, Stärken noch weiter zu stärken. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, ein Verständnis dafür zu entwickeln, woher das Konzept stammt und warum der Bedarf an Resilienz immer noch einen negativen Beiklang hat.
Resilienz als etwas Normales anzusehen, zu akzeptieren, dass sie ein Teil des Alltags und Arbeitslebens für jeden ist, passiert zu einer Zeit, in der das Interesse an Positiver Psychologie steigt. Zweifelsfrei spielte eine jüngere Studie über „positive Emotionen und Erfahrungen“ eine wichtige Rolle dabei, den potenziell nützlichen stärkenbildenden Aspekt von „positiver Belastung bzw. Herausforderung“ hervorzuheben. Darüber hinaus bereicherte sie unser Verständnis davon, auf welchen unterschiedlichen Wegen Resilienz entwickelt werden kann.
Eine Einführung in die Stärkung von Resilienz am Arbeitsplatz
Zuerst richtete sich das allgemeinere Interesse an Resilienz auf das Themengebiet Arbeitsplatz. In den 1970er- und 1980er-Jahren begannen Forscher aus den USA zu untersuchen, welche Qualitäten einigen Managern bei der Bewältigung von Belastungen über einen längeren Zeitraum halfen.4 In den späten 1980er-Jahren begann der amerikanische Psychologe Martin Seligman, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie die Ergebnisse dazu genutzt werden könnten, Angestellten beim Umgang mit Herausforderungen am Arbeitsplatz zu helfen. Zuvor hatte sich Seligman viele Jahre lang mit der Erforschung von Angst und Depression beschäftigt. Er entwickelte ein eintägiges Resilienz-Training für Versicherungsvertreter, deren Arbeit neben Kaltakquise (unaufgefordert bei potenziellen Kunden anrufen) auch ein hohes Maß an Ablehnung beinhaltete.
Vom Erfolg von Seligmans Trainingskurs inspiriert, entwickelten Forscher des Institute of Psychiatry in London einen längeren und intensiveren Kurs, der in der Versicherungswirtschaft und mit Fachleuten und Führungskräften durchgeführt wurde, die länger als ein Jahr arbeitslos gewesen waren. Wieder waren die Ergebnisse sehr ermutigend und umfassten im Vergleich mit einer Kontrollgruppe, die ein anderes, aber themenbezogenes Training absolvierte, neben einem besseren allgemeinen Wohlbefinden und höheren Verkaufszahlen auch eine längere Verweildauer (in der Studie der Versicherungsbranche) und eine höhere Anzahl von Vorstellungsgesprächen und Jobangeboten (bei den arbeitslosen Teilnehmern).5
Diese Kurse zur Resilienz-Stärkung wurden als praktisch und effektiv wahrgenommen und das Design wurde von einigen Firmen und Verwaltungen übernommen. Jedoch gab es einige Hindernisse, die die weitere Verbreitung dieses Ansatzes erschwerten, sogar in den Organisationen, die aufgrund ihrer Teilnahme an der Forschung davon bereits finanziell oder anderweitig profitiert hatten. Denjenigen von uns, die sich in den 1990er-Jahren mit der Verbreitung der Trainings im Wirtschaftsbereich beschäftigten, wurde klar, dass die größte Hürde darin bestand, dass Wirtschaftsorganisationen noch nicht für diese Maßnahmen bereit zu sein schienen.6
Das war tatsächlich ein Problem, da man mittlerweile die Bereitschaft innerhalb der Organisation als eine der wichtigsten Voraussetzungen für die erfolgreiche Implementierung von innovativen Trainings- und Entwicklungsprogrammen hält. Die „Herzen und Köpfe“ der Budgetverantwortlichen und einflussreichen Interessengruppen waren durch Verkaufszahlen und Einsparungen leicht zu gewinnen, und diese rationalen und schlagenden Argumente erleichterten die Einführung von Resilienz-Trainings. Dennoch herrschte ein eher emotionales Misstrauen gegen Trainings mit einem „psychologischen“ Hintergrund vor. Ängste kamen hoch, wenn es darum ging, sich mit einem Thema zu beschäftigen, dass so eng mit Stress am Arbeitsplatz verbunden war. „Resilienz-Trainings“ waren einigermaßen stigmatisiert. Sie schienen sich an diejenigen zu richten, die nicht mit Belastungen zurechtkamen. Diese Wahrnehmung erschwerte es, dass die Entwicklung von Resilienz in Organisationen angenommen wurde, obgleich die finanziellen und anderen Vorteile gut belegt waren. Verbunden mit diesen Vorbehalten wurden die Programme zur Stärkung von Resilienz argwöhnisch betrachtet, weil man sie für einen manipulativen „Management-Trick“ hielt, der dazu angelegt ist, sicherzustellen, dass immer mehr Druck auf die Arbeitnehmer ausgeübt werden kann, um Output und Profit zu maximieren.
Während solche Vorbehalte immer noch deutlich werden, steht ihnen die wachsende Überzeugung entgegen, dass die Fähigkeit, Belastungen standzuhalten, eine wichtige Kompetenz am Arbeitsplatz darstellt. Auch wurde die Akzeptanz dadurch erhöht, dass Resilienz-Trainings weniger als Heilmittel, sondern als ein auf Stärken basierender Ansatz gesehen werden, dessen Wurzeln in der immer populärer werdenden Bewegung der Positiven Psychologie liegen. Darüber hinaus haben jüngste Untersuchungen und die Praxis gezeigt, dass es zwischen dem individuellen Wohlbefinden und den Ergebnissen der Organisation (dazu gehört auch die Produktivität) eine starke und unmittelbare Verbindung gibt.
Es besteht immer die Gefahr, dass ein Werkzeug oder eine Methode dazu benutzt wird, auf zynische Weise Menschen oder Ressourcen auszubeuten, aber das steigende Augenmerk auf das Wohlbefinden am Arbeitsplatz hilft sicherzustellen, dass solche Interventionen sowohl zum Wohle des Individuums als auch der Organisation eingesetzt werden.
In Kapitel 3 zeichnen wir eingehender nach, wie die Entwicklung von Resilienz über die letzten zwanzig Jahre Einzug in die Organisationen gehalten hat, wobei der Impetus mittlerweile so groß ist, dass Resilienz „als Idee, deren Zeit gekommen ist“ begriffen wird. Als Konsequenz suchen nun zukunftsgerichtete Führungsteams angemessene Entwicklungsmethoden für alle Mitglieder ihrer Organisation, Gruppen von Entscheidungsträgern oder diejenigen, die besonderen Belastungen ausgesetzt sind. Wir stellen eine größere Akzeptanz für diese Art von Unterstützung bei Führungskräften fest, wenn es auch vielen immer noch schwerfällt, sich das einzugestehen.
Die Geschichte von den zwei Vorstandsvorsitzenden
Wenn es um die Belastung geht, die ein Führungsposten mit sich bringt, dann besteht kein Zweifel, dass jeder Chef eines Unternehmens mit Herausforderungen konfrontiert wird, die manchmal unüberwindbar scheinen. Um überhaupt solch einen Posten zu bekommen, ist ein hohes Maß persönlicher Resilienz nötig, was aber nicht gleichzustellen ist mit Unverwundbarkeit. Mehr als ein CEO hat uns berichtet, dass die Ernennung zum Geschäftsführer die steilste – und einsamste – Lernkurve mit sich brachte, die sie oder er jemals durchgemacht hat.
Nehmen wir die beiden folgenden Geschichten: Die erste handelt von dem Gründer eines der weltweit erfolgreichsten Hi-Tech-Unternehmen, der unter Belastungen, die der Rest von uns sich kaum vorstellen kann, aufblühte, um dann einer Krebserkrankung zu erliegen, die gemeinhin als heilbar gilt. Gefragt, warum eine Operation aufgeschoben wurde, antwortete der Autor von Steve Jobs Biografie: „Ich glaube, er hatte irgendwie das Gefühl: Wenn man etwas ignoriert, von dem man nicht will, dass es existiert, können Gedanken Wunder bewirken. In der Vergangenheit stimmte das für ihn. Er hat es bereut.“7
Unsere zweite Geschichte handelt von dem CEO der größten Privatkundenbank in Großbritannien, der sich für längere Zeit krankmeldete, nachdem er unter „Erschöpfungszuständen aufgrund von Überarbeitung“ litt. Dennoch „sagen Kollegen von ihm, er ist detailbesessen, reagiert gelassen auf Belastungen und zeigt wenig Anzeichen von Stress.“8
Natürlich werden wir in beiden Fällen nie erfahren, was wirklich schiefgelaufen ist. Dennoch zeigen diese kurzen Anekdoten, dass persönliche Resilienz nicht einfach abzutun ist, dass auch die Stärksten eine Achillessehne haben und dass immer die Gefahr besteht, von just den Qualitäten und Haltungen beeinträchtigt zu werden, die viele Jahre lang die Basis unseres Erfolgs dargestellt haben.
Vor dem Hintergrund dieser beiden Geschichten werden fünf grundlegende Prinzipien deutlich:
Individuen unterscheiden sich sowohl in der Art als auch im Maß ihrer Fähigkeit, Belastungen und Rückschlägen gewachsen zu sein.
Psychologische Resilienz ist komplex und nicht eindimensional. Es ist keine Eigenschaft, die wir haben oder nicht haben – die meisten von uns sind in gewisser Hinsicht resilient, bei anderen Themen weniger.
Auch die Menschen mit sehr hoher Resilienz haben ihre Grenzen, obgleich sie sich dessen nicht unbedingt bewusst sind, wenn sie diese Grenzen erreicht haben.
Bestimmte Qualitäten und Haltungen, wie Optimismus oder Selbstvertrauen, können in den meisten Situationen unsere Resilienz stärken, können aber auch Schaden anrichten, wenn sie zu extrem sind.
Resilienz resultiert aus der Interaktion eines Individuums und einer Situation, es ist kein statisches Persönlichkeitsmerkmal und kann weiterentwickelt werden.
Übersicht über den Inhalt
Unser Ziel ist es, mit diesem Buch einen Rahmen zu schaffen, der die Integration von Entwicklungsmaßnahmen für persönliche Resilienz innerhalb einer breit angelegten Strategie erlaubt, um sowohl individuelles Wohlbefinden als auch die Leistung der Organisation zu verbessern. Dabei möchten wir zu einem Verständnis des Arbeitskontexts beitragen, insbesondere zu der Einsicht, was die Hauptursachen von Belastungen am Arbeitsplatz sind und wie Unterstützung aussehen kann. Ohne dieses Verständnis ist es schwer möglich, das Beste aus den Chancen zu machen, die das Stärken von Resilienz am Arbeitsplatz mit sich bringt. Doch ist es ein Kontext, der zu weit mehr Verbesserungen führen kann als das weitverbreitete Format einer kurzen, einmaligen Trainingseinheit.
Teil I
Resilienz verstehen
In Kapitel 1 geht es um die Frage, was die individuellen Unterschiede ausmacht, und es wird ein Bezugssystem aufgestellt, um die Stärken und Risiken persönlicher Resilienz einzuordnen. Wir präsentieren eine detailliertere Definition von Resilienz und geben eine Übersicht über die relevante Forschung sowie über verschiedene Diagnosemethoden und Ansätze.
Den Einzelnen in der Organisation schauen wir uns in Kapitel 2 an. Wir beschreiben die Hauptursachen für Belastungen am Arbeitsplatz und wie Unterstützung aussieht. Darüber hinaus diskutieren wir, wie beides Individuen unterschiedlich beeinflusst, bestimmt von der Beschaffenheit und dem Maß der individuellen Resilienz. Das Hauptaugenmerk liegt hier auf der Interaktion einer Person mit ihrer Arbeitssituation und der Art und Weise, wie die individuellen Resilienz-Ressourcen von dieser Interaktion gestärkt oder unterlaufen werden.
Kapitel 3 beschreibt die Geschichte „früher und heute“ für die Leser, die aus beruflichen Gründen den Hintergrund verstehen möchten, wie die Entwicklung der Resilienz-Forschung verlaufen ist, um sicherzustellen, dass es sich bei der Stärkung von Resilienz nicht nur um eine „Eintagsfliege“ in ihrer Organisation handelt.
Teil II
Resilienz stärken
Die Kapitel 4 und 5 behandeln die Dinge, die jeder Einzelne tun kann, um seine Resilienz zu entwickeln, sowohl allein als auch mit der Unterstützung seines Arbeitgebers. Die Betonung liegt hier darauf, dass die Stärkung der Resilienz das Streben des Einzelnen und ein „lebenslanges“ Unterfangen ist – auch wenn der Katalysator dafür und die Unterstützung im Berufskontext liegen. In Kapitel 4 geht es vor allem darum, die persönliche Ausgangssituation zu erkennen und zwei der wichtigsten Techniken für die Bildung von Resilienz anzuwenden, die sich dem Bedarf entsprechend auf eine Vielzahl von Situationen und in unterschiedlichen Kontexten anwenden lassen. Wie persönliche Resilienz innerhalb des Rahmens der vier Hauptelemente von Resilienz, die in Kapitel 1 vorgestellt werden, gestärkt werden kann, wird in Kapitel 5 beschrieben.
In Kapitel 6 und 7 konzentrieren wir uns darauf, was Manager und Beschäftigte tun können, um die Stärkung von Resilienz zu fördern. Zum einen geht es um Interventionen, die Resilienz fokussieren, wie Coaching und Resilienz-Workshops (Kap. 6), zum anderen um gute Verfahren und Strategien des Managements, die für die Entwicklung von Resilienz besonders relevant sind (Kap. 7). Wir differenzieren zwischen der Verbesserung der Resilienz auf individueller Ebene und auf der Ebene des Teams, dabei beziehen wir uns mit dem Begriff „Team-Resilienz“ auf einen eher vorübergehenden Zustand eines Kollektivs.
Teil III
Stärkung der Resilienz für zukünftigen Erfolg
In Kapitel 8 präsentieren wir eine Übersicht der Implikationen für Arbeitgeber und entwerfen darüber hinaus ein Bild, wie in Zukunft verschiedenartige Maßnahmen in Teams und Organisationen aussehen könnten.
Anhang
Anhang I bietet einen Leitfaden, um Ihren persönlichen Resilienz-Plan aufzustellen, und in Anhang II führen wir eine detaillierte Liste mit Themen auf, die in einem Resilienz-Training und bei dessen Entwicklung berücksichtigt werden können.
Schließlich müssen wir in dieser Einführung auch klarstellen, was wir in diesem Buch nicht behandeln werden. Da wir uns auf die Resilienz von einzelnen Personen beschränken, geht es nicht um Detailfragen über Resilienz in Gruppen oder Organisationen. Organisations-Resilienz ist viel mehr als die Summe der individuellen Resilienz von Angestellten, Managern und Führungskräften. Sie umfasst solch unterschiedliche Kompetenzen wie Notfallmaßnahmen für Technologie-Systeme oder langfristige Finanzplanung. So hängt die Resilienz von einzelnen Abteilungen und Teams als kollektive Charakteristik einer Gruppe von verschiedenen Faktoren ab wie Angemessenheit der Ressourcen, effektiven Kommunikationswegen, effizienten Strukturen oder einem konstruktiven Führungsstil.
Kurz gehen wir auf eine Art von Gruppen-Resilienz ein, die wir „Team-Resilienz“ nennen. Sie wird erreicht, wenn ein hohes Maß an Wohlbefinden die Fähigkeit des Teams stärkt, mit Rückschlägen umzugehen und auch angesichts großer Herausforderungen weiterzumachen. Team-Resilienz ist ein Produkt aus effektivem Management der Auslöser von Belastungen am Arbeitsplatz und entsprechender Unterstützung (s. Kap. 2), was auch einen großen Einfluss auf die individuelle Resilienz hat. Jedoch sind diese beiden Themen ganz unterschiedlich. Eine Darstellung von Team-Resilienz würde den Rahmen dieses Buches sprengen.
Kurzanleitung für die Nutzung dieses Buches
Hier folgt ein kurzer Leitfaden zum Gebrauch des Buches, um Ihre eigenen Interventionen zur Stärkung von Resilienz zu konzipieren:
Zusammenfassung des Kapitels
Relevanz für die Planung
1. Kapitel
beantwortet die Frage nach individuellen Unterschieden und entwirft einen Rahmen für das Verständnis der persönlichen Stärken und Risiken für Resilienz. Es wird eine Übersicht über die relevante Forschungslage präsentiert, ebenso wie verschiedene Diagnostikinstrumente und Herangehensweisen.
Bietet die wissenschaftliche Grundlage, um das Wesen individueller Resilienz und wie sie sich entwickelt zu verstehen und zu erklären.
Führt ein Modell mit vier Elementen ein, das zur Beschreibung und Bewertung individueller Resilienz-Ressourcen dient.
Einige der wichtigsten diagnostischen Messwerte werden vorgestellt, die bei dem Modul Selbsteinschätzung und Entwicklungsplan Ihrer Intervention wichtig sind.
2. Kapitel
Es geht um den Einzelnen in seinem Arbeitskontext. Die Hauptursachen von Belastungen und Unterstützung am Arbeitsplatz werden beschrieben sowie die Art und Weise, wie diese uns individuell unterschiedlich beeinflussen. Die Interaktion zwischen Person und Arbeitssituation wird untersucht, ebenso in welcher Weise die Resilienz-Ressourcen dadurch entweder gefördert oder unterminiert werden.
Verschiede Ursachen von Belastungen und Unterstützung am Arbeitsplatz werden anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse dargestellt.
Es wird erklärt, wie sich Resilienz am Arbeitsplatz entwickeln kann.
Präsentiert ein Modell mit sechs Elementen, mit dessen Hilfe der Einfluss von beruflichen Faktoren auf die individuelle Resilienz erhoben und gemanagt werden kann.
3. Kapitel
zeichnet die Entwicklung des Verständnisses von Resilienz nach, stellt den Hintergrund dieses Konzepts dar und vermittelt einen breit angelegten systemischen Ansatz. Es wird gezeigt, dass es sich bei der Stärkung von Resilienz nicht um eine vorübergehende Modeerscheinung handelt.
Vermittelt einen umfassenden historischen Abriss, um neue Maßnahmen zu entwickeln oder zu beauftragen.
Erklärt, warum Resilienz unternehmensweites Stress-Management und Programme zur Verbesserung des Wohlbefindens von Mitarbeitern ergänzt.
Beschreibt eingehender, wie das Wissen um Belastungen am Arbeitsplatz und der Einfluss von Vorgesetzten dazu genutzt werden kann, Resilienz und Wohlbefinden zu verbessern.
4. und 5. Kapitel
Was kann der Einzelne tun, um seine Resilienz sowohl selbst als auch mithilfe des Arbeitgebers zu fördern? Die Betonung liegt hier darauf, dass Resilienz das Bemühen des Einzelnen ist, das ein Leben lang währt, auch wenn der Arbeitskontext dieses Bestreben unterstützt.
Geben Details und Literaturempfehlungen zu den Techniken, die vom Einzelnen erlernt und angewendet werden können, sei es im Rahmen von Resilienz-Trainings im Unternehmen oder allein.
Präsentieren weitere Informationen über die beiden einflussreichsten und flexibel einsetzbaren Techniken für die Verbesserung von Resilienz.
Beschreiben Techniken, die sich besonders anbieten, jede einzelne Komponente von Resilienz (z. B. Zuversicht) zu verbessern.
6. und 7. Kapitel
Unterstützung von Resilienz durch Führungskräfte und Organisationen. Dabei geht es um Interventionen, die Resilienz unmittelbar verbessern sollen (wie etwa Workshops) sowie generell gute Führungspraxis, die dieses Ziel verfolgt. Es wird der Unterschied zwischen der Verbesserung der Resilienz des Einzelnen und besserem Wohlbefinden im Team (Team-Resilienz) erklärt.
Vor dem Hintergrund eines breiteren Kontexts von Führung und Organisationsentwicklung und anhand von Praxisbeispielen wird
erläutert, wie Manager und Vorgesetzte die Entwicklung von Resilienz bei ihren Mitarbeitern fördern können,
anhand von anerkannten bzw. bekannten Führungsmodellen beschrieben, wie die Stärkung von Resilienz in Führungskräftetrainings integriert wird,
illustriert, wie gutes Management und Führungspraxis dabei helfen, Resilienz zu fördern.
8. Kapitel
bietet eine Übersicht über die Implikationen für Arbeitgeber. Praktische Beispiele erklären die unterschiedlichen Ausprägungen von Interventionen für Teams und ganze Organisationen. Ein Leitfaden erklärt, wie man mithilfe dieses Buches Maßnahmen für das eigene Unternehmen entwickeln kann.
Es wird eine Übersicht über Schlussfolgerungen und Prinzipien gegeben.
Praktische Szenarien für resilienzfördernde Interventionen werden entworfen, Praxisbeispiele helfen dabei.
Anhang I
stellt einen Leitfaden für die Planung auf, um die eigene Resilienz zu stärken.
Anhang II
beinhaltet eine detaillierte Liste mit Themen für ein Resilienz-Training.
TEIL I: RESILIENZ VERSTEHEN
1. Die Einzelperson: individuelle Resilienz verstehen
1.1 Risiko- und Schutzfaktoren für Resilienz: vom Risiko-Management zur Kompetenz
Um die individuellen Unterschiede von Resilienz verstehen zu können, müssen wir uns von der Arbeitsdefinition, wie wir sie in der Einführung vorgestellt haben, lösen und uns anschauen, wie dieses komplexe Konzept definiert und erforscht wurde. In der Vergangenheit nahm die Erforschung von Resilienz im Rahmen der therapeutischen Unterstützung von Personen, die Schwierigkeiten hatten, Krisen, Verluste oder das Leben im Allgemeinen zu meistern, ihren Anfang. Um zu verstehen, warum einige Menschen besser mit Belastungen umgehen als andere, konzentrierte sich die Wissenschaft hauptsächlich auf Resilienz in der Kindheit und Jugend.
In jüngerer Zeit rückte die Forschung von Resilienz im Erwachsenenalter stärker in den Vordergrund. Eine starke Ausprägung von Resilienz wird nun als Vorzug oder Vermögen angesehen, weniger als die Lösung für ein Problem oder Milderung einer Krise. Es mehren sich auch die Belege, dass Resilienz vielleicht sogar den Normalfall darstellt und danach Menschen im Allgemeinen resilienter sind als frühere Studien angedeutet haben. George Bonanno behauptet, dass Resilienz das häufigste Ergebnis eines überwundenen traumatischen Ereignisses sei, nicht Zusammenbruch und Wiedergesundung.9 Er nimmt außerdem die sinnvolle Differenzierung zwischen Resilienz und der Überwindung länger anhaltender Krisen bzw. Umgang mit einem „zermürbenden“ Umfeld auf der einen und Resilienz angesichts einmaliger Ereignisse auf der anderen Seite vor.
Diese aktuelleren Entwicklungen der Forschung sind besonders für unser Ziel relevant, die Stärkung von Resilienz in umfassendere Maßnahmen zu integrieren, um das Wohlbefinden von Arbeitnehmern und die Produktivität des Unternehmens zu steigern. Durch diese Entwicklungen wird die Idee, Resilienz zu fördern, „gesellschaftsfähig“ und nicht länger in den „Weiße-Kittel“-Kontext von Krankheit, Therapie und Krisenmanagement gerückt.
1.2 Resilienz definieren: eine Herausforderung
Auf eine Aussage können sich alle einigen, nämlich, dass es keine allgemeingültige Definition von Resilienz gibt. In der Tat geschieht es nicht selten, dass man innerhalb ein und desselben Buches oder Artikels verschiedene Definitionen antrifft. Als Beispiel dient hier das Handbuch von John Reich und Kollegen10 (s. Kasten).
Definitionen und Beschreibungen von persönlicher Resilienz aus den Beiträgen in Handbook of Adult Resilience (2010)
„… Resilienz lässt sich am besten als das Ergebnis der erfolgreichen Anpassung an Widrigkeiten definieren. Die Charaktereigenschaften einer Person und die Besonderheiten der Situation können den Resilienzprozess beeinflussen, doch nur, wenn sie zu gesünderen Haltungen nach dem Erleben von widrigen Umständen führen“ (Zautra et al., S. 4).
„In der bisherigen Forschung hat Resilienz verschiedene Bedeutungen, doch im Allgemeinen bezieht sich der Begriff auf das Muster einer funktionierenden Indikation von ‚positiver Anpassung’ im Kontext von ‚Risiko‘ oder Widrigkeiten“ (Ong et al., S. 82).
„Resilienz ist ein Begriff, den Psychologen verwenden, um die Fähigkeit zu beschreiben, mit belastenden Ereignissen umgehen zu können und einen Sinn zu sehen, auf die Individuen mit einer sinnvollen intellektuellen Reaktion und unterstützenden sozialen Beziehungen reagieren müssen (Richardson, 2002).“ (in Mayer & Faber, S. 95)
„Resilienz bezieht sich auf die individuellen Unterschiede oder Lebenserfahrungen, die Menschen helfen, in positiver Weise auf Widrigkeiten zu reagieren, ihnen erlauben, in der Zukunft besser mit Stress umzugehen, und sie davor schützen, unter Belastungen mental-psychische Störungen zu entwickeln (Richardson, 2002).“ (in Skodol, S. 113)
„Resilienz ist ein breit gefasstes Konzept, das sich im Allgemeinen auf eine positive Anpassung in einem beliebigen dynamischen System bezieht, das sich einer Herausforderung oder Bedrohung gegenübersieht“ (Masten & Obradovic´, 2008).
„Menschliche Resilienz bezieht sich auf die Prozesse oder Muster positiver Anpassung und Entwicklung im Kontext von wesentlichen Bedrohungen des Lebens oder der Funktion einer Person“ (Masten & Wright, S. 215).
Es ist sogar umstritten, ob man Resilienz eher als Ergebnis, als Prozess oder als Reihe von Charaktereigenschaften sehen soll. Diese Meinungsverschiedenheiten schlagen sich in den vorhandenen Erhebungen von Resilienz nieder. Während einige Forscher den Begriff Resilienz verwenden, um den Prozess von den individuellen Charaktereigenschaften abzugrenzen, nutzen andere nur einen dieser Begriffe oder beide synonym.
Folgende Definitionen sind ebenfalls zu berücksichtigen:
Resilienz ist „das Phänomen, dass einige Individuen angesichts der Erfahrung von Risiken ein relativ gutes Ende erleben, obgleich man annehmen könnte, dass sie unter ernsten Spätschäden leiden sollten.“
11
„Das Konstrukt von Resilienz bezieht sich auf die Fähigkeit von Individuen, sich angesichts akuten Stresses, Trauma oder fortwährenden Widrigkeiten erfolgreich anzupassen und psychologisches Wohlbefinden und physiologische Homöostase zu behalten oder wiederzufinden.“
12
„Psychologische Resilienz bezieht sich auf das erfolgreiche Bewältigen und Anpassen trotz Verlustes, Mühsal oder Widrigkeiten.“
13
„Resilienz ist der Prozess, mit wichtigen Auslösern von Stress oder Trauma umzugehen, sie zu bewältigen und sich anzupassen.“
14
Die Vielzahl der Definitionen verwirrt und lässt aus akademischer Sicht Präzision vermissen, aber dem Praktiker bietet sie auch ein umfassenderes Verständnis der unterschiedlichen Perspektiven und Erkenntnisse. Wie die Psychologen Christopher Peterson und Martin Seligman in ihrem Buch über Charakterstärken und Vorzüge nahelegen, ist Resilienz kein einheitliches Konstrukt und ist am besten wohl als Überbegriff zu verstehen.15 Wir haben entschieden, es genau so in diesem Buch zu handhaben: Mit anderen Worten beschränken wir den Begriff Resilienz nicht auf ein spezifisches akademisches Konstrukt.
Unsere Haltung zeigt sich in der sehr weit gefassten Arbeitsdefinition, die wir in der Einführung vorgestellt haben: Resilienz ist die Fähigkeit, sich von Rückschlägen zu erholen und auch angesichts großer Herausforderungen und schwieriger Umstände weiterzumachen, dazu gehört auch eine nachhaltige Stärke, die daraus entsteht, mit herausfordernden oder belastenden Ereignissen fertigzuwerden. Unsere Beschreibung betont bewusst den prozess- und ergebnishaften Aspekt von Resilienz. Wir verstehen die Persönlichkeit und andere individuelle Charaktereigenschaften neben äußeren Umständen und Ereignissen als prädiktive Faktoren, die erklären, warum einige Menschen besser mit Krisen umgehen und am Ende stärkere Resilienz zeigen als andere. In diesem Kapitel erläutern wir unsere Sicht auf individuelle Charaktereigenschaften als die Faktoren, die Resilienz untermauern.
„Vier Wellen“ in der Resilienzforschung
In ihrer Zusammenfassung der wissenschaftlichen Erforschung von Resilienz sprechen Ann Masten und Margaret Wright16 von „vier Wellen in der Resilienz-Forschung“. Die erste Welle konzentrierte sich auf die Beschreibung, Definition und Erhebung von Resilienz. Sie brachte sehr konsistente Ergebnisse hervor, was die Charaktereigenschaften von Individuen, Beziehungen und Ressourcen angeht, die einen Schluss auf Resilienz zuließen (wenn nicht sogar hinsichtlich dessen, wie Resilienz definiert werden sollte!). Die zweite Welle beschäftigte sich mit den Prozessen, durch die Resilienz entsteht, während die dritte Welle versuchte, anhand des Verständnisses dieser Prozesse Maßnahmen für die Entwicklung von Resilienz zu entwerfen.
Die vierte Welle kombiniert die Erkenntnisse und Methoden verschiedener Gebiete, wie Psychologie, Genetik, neurobehavioristische Entwicklung und Statistik. Wie bereits erwähnt, liegt das Augenmerk mehr auf den positiven, die Stärken betonenden Aspekten von Resilienz. Dem Praktiker in Organisationszusammenhängen kommt dieser Ansatz sehr entgegen, denn er ermöglicht die Förderung von Resilienz in einem Kontext, wo Abhilfemaßnahmen mit Argwohn betrachtet oder in die Ecke der Arbeitsmedizin geschoben werden.
Was wissen wir also über die Prädiktoren von Resilienz? Aus der Untersuchung von Resilienz in der Kindheit sind folgende Faktoren als die kritischen hervorgegangen: Beziehungen (besonders die frühen Eltern-Kind-Beziehungen), individuelle Ressourcen (dazu gehören die Fähigkeit, Probleme zu lösen, Selbstmotivation, Selbstkontrolle und Optimismus bzw. positive Haltung) und kulturelle Einflüsse. Unter kulturellen Einflüssen ist die potenzielle Schutzfunktion von kulturellen oder religiösen Glaubenssätzen und Praxen zu verstehen. Beispielsweise zeigen in den USA lebende Lateinamerikaner einen ähnlichen Status physischer Gesundheit wie die nicht lateinamerikanischen weißen Amerikaner oder sogar einen besseren, obgleich erstere Gruppe einer ganzen Reihe sozioökonomischer und anderer Belastungen ausgesetzt ist.17 Kulturelle Unterschiede sind ein wichtiger Aspekt, der bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Resilienz-Stärkung am Arbeitsplatz berücksichtigt werden muss.
Christopher Peterson und Martin Seligman zufolge fehlt jedoch in der wissenschaftlichen Literatur „jegliche Diskussion darüber, welche Schutzfaktoren unter welchen belastenden Umständen und hinsichtlich der gewünschten Ergebnisse für wen wichtig sind.“18 Sie nehmen an, dass solcherlei Verbindungen eher allgemeiner denn hochspezifischer Natur sind, doch sollten wir bei unserer Sichtweise stärker die Umweltfaktoren berücksichtigen, wenn es darum geht, Menschen dabei zu helfen, ihre persönliche Resilienz einzuschätzen und zu verbessern.
Dies ist ein Aspekt, den wir bei unserem Ansatz der Resilienz am Arbeitsplatz berücksichtigen möchten – indem wir uns auf einen wissenschaftlich fundierten Rahmen der Hauptursachen für Belastungen und Unterstützung am Arbeitsplatz beziehen.19 Angesichts der Vielschichtigkeit von Resilienz beeinflussen zweifelsfrei verschiedene Belastungen am Arbeitsplatz jeden Einzelnen in unterschiedlicher Weise. Dies liegt nicht nur an der jeweiligen aktuellen Situation, sondern auch an dem Zusammenspiel von Schutzfaktoren, die die Basis für die individuelle Resilienz darstellen. Jedenfalls profitieren Teilnehmer einer Maßnahme zur Stärkung ihrer Resilienz mit größerer Wahrscheinlichkeit von einer Evaluation ihrer individuellen Resilienz-Stärken und -Schwächen, wenn sich die Analyse im Kontext typischer Herausforderungen und Belastungen bewegt, die sie im täglichen Arbeitsumfeld erleben.
1.3 Resilienz: individuelle Merkmale
Im folgenden Kapitel präsentieren wir den Rahmen, um die Ursachen von Belastungen am Arbeitsplatz sowie die Unterstützung („die Situation“) zu verstehen. Zunächst betrachten wir dabei die Seite des Individuums. Dabei geht es um die Frage, welche persönlichen Charakteristiken Resilienz untermauern oder vorhersagen. Tabelle 1.1 zeigt die Bandbreite der Erkenntnisse und Perspektiven zu diesem Thema auf. Die Ergebnisse stammen aus Studien, die sich u. a. mit der Entwicklung von Resilienz in der Kindheit und im Jugendalter beschäftigen sowie mit Resilienz bei Erwachsenen, genetischen und biologischen Determinanten, der sportlichen Leistungsfähigkeit, körperlicher Gesundheit, Therapie und Beratung sowie Umgang mit Wandel in der Organisation.
Autor / Wissenschaftler
Charaktereigenschaften, die mit Resilienz assoziiert werden
Literatur
Diane Coutu
Vermögen, Realität zu akzeptieren und sich mit ihr zu konfrontieren;
Fähigkeit, einen Sinn im Leben zu sehen;
Fähigkeit zu improvisieren
„How Resilience Works“ in: Harvard Business Review on Building Personal and Organizational Resilience20
Salvatore Maddi und Deborah Khoshaba
Widerstandsfähigkeit – ein Muster aus Einstellungen und Fertigkeiten
Resiliente Haltungen: Verpflichtung (Commitment), Kontrolle, Herausforderung
Lebensfertigkeiten: Umgang mit Übergangssituationen (um Probleme zu lösen), Interaktion mit anderen (um sozialen Rückhalt zu verbessern)
Resilience at Work: How to Succeed No Matter What Life Throws at You21
Dennis Charney
In der Kindheit und Adoleszenz wurde Resilienz entwickelt.
Schlüsselfaktoren aus der Forschung: „gute intellektuelle Fähigkeiten, effektive Selbstregulierung von Gefühlen und Bindungsverhalten, ein positives Selbstkonzept, Optimismus, Altruismus, Fähigkeit, die auf ein Trauma zurückgehende erlernte Hilflosigkeit in Selbstwirksamkeit umzuwandeln, und angesichts eines Stressfaktors ein aktiver Bewältigungsstil.“
Untersuchungen mit Erwachsenen (meist bei militärischen Missionen): „die Fähigkeit, sich einer Gruppe mit einer gemeinsamen Zielsetzung anzuschließen, Altruismus einen hohen Wert beizumessen und die Fähigkeit, ein hohes Maß an Angst zu tolerieren und dennoch effektiv Leistung erbringen zu können.“
Psychobiological Mechanisms of Resilience an Vulnerability: Implications for Successful Adaptation to Extreme Stress22
Timothy Smith
Resilienz gegenüber (physischen) Gesundheitsgefährdungen
Negativfaktoren: anhaltende Wut / Feindseligkeit; Neurotizismus / negative Affektivität wie Nervosität oder Traurigkeit; ein sozial dominanter Stil
Positivfaktoren: Optimismus, Gewissenhaftigkeit
„Personality as Risk and Resilience in Physical Health“23
Anthony Mancini und George Bonanno
Resilienz angesichts eines Verlusts: selbstverstärkende Einstellungen, Bindungsstil, repressiver Bewältigungsstil, A-priori-Glaubenssätze, Fortbestand und Komplexität der Identität und positive Gefühle
„Predictors and Parameters of Resilience to Loss: Toward an Individual Differences Model“24
Andrew Skodol
Resiliente Persönlichkeiten: Selbstbild (stark, differenziert und integriert), dazu gehören Selbstbewusstsein, Selbstachtung, Selbsteffizienz, Selbstverständnis und Selbstkontrolle
Soziale Kompetenzen: Geselligkeit, emotionale Ausdrucksfähigkeit und Verständnis für andere
aus Handbook of Adult Resilience25
Tabelle 1.1: Beispiele für individuelle Merkmale, die mit Resilienz in Verbindung stehen
In diesem Buch über individuelle Resilienz am Arbeitsplatz gehen wir nicht weiter auf die biologischen, kulturellen, familiären und umweltbedingten Faktoren ein, die einen Einfluss auf die Entwicklung in Kindheit und im Jugendalter nehmen und bestimmen, wie hoch das Niveau an Resilienz bei Belastungen im Job ist. Unser Augenmerk liegt darauf, bei der Evaluation und Entwicklung bestimmter Stärken, die jeder Mensch an seinem Arbeitsplatz mitbringt, zu helfen. Ebenso müssen die Schwierigkeiten berücksichtigt werden, die der Einzelne bewältigen muss, um resilient auf Belastungen im Berufs- und Privatleben reagieren zu können. Daher müssen wir den Zusammenhang zwischen den persönlichen Eigenschaften der Arbeitnehmer, die Hauptursachen für Belastungen ebenso wie Unterstützung am Arbeitsplatz und den Prozess verstehen, durch den Resilienz im Ergebnis entsteht (s. Abb. 1.1). Dieses Wechselspiel wird in der Psychologie häufig als die Interaktion zwischen dem Individuum und der Umwelt bezeichnet. Um zu erläutern, wie dies geschieht, ist ein Rahmen nötig, der das Individuum beschreibt, und ein weiterer für die Situation.
Wie bereits erwähnt, ist unser Bezugsrahmen für die Situation am Arbeitsplatz ein anerkanntes und valides Modell für die Hauptursachen von Belastungen am Arbeitsplatz sowie die unterstützenden Faktoren (s. Kap. 2). Für das Individuum nutzen wir das Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit26, (FFM, auch als Big-Five-Modell bekannt), dabei greifen wir, wo angemessen, auf andere Konstrukte wie die Fähigkeit zu logischen Schlussfolgerungen zurück. Indem wir der Persönlichkeit besondere Bedeutung beimessen, stimmen wir der Sicht von John Mayer und Michael Faber zu, die Persönlichkeit bezeichnen als „das wichtigste psychologische System des Einzelnen, [das] mentale Subsysteme, wie Motive, Gedanken und Selbstkontrolle, lenkt und organisiert.“27 Dieses System stellt das Produkt der Interaktion aus biologischen, umweltbedingten und anderen Faktoren in der Kindheit und im Jugendalter dar.
Abbildung 1.1: Rahmen zum Verständnis von Resilienz eines Arbeitnehmers bei Belastungen am Arbeitsplatz
Wir verwenden das FFM, um die Verknüpfung zwischen dem Individuum und der Arbeitssituation dazustellen, da das Modell gemeinhin als die robusteste und am gründlichsten erforschte Beschreibung der Persönlichkeitsstruktur von Erwachsenen gilt.28 Darüber hinaus haben wir selbst und andere viele Jahre den Zusammenhang zwischen Charaktermerkmalen des FFM auf der einen Seite und den Ergebnissen (dazu zählen Leistung und Wohlbefinden), die mit der Arbeit in Verbindung stehen, auf der anderen erforscht.29
Gründe für das FFM
Das Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit hielt 1991 Einzug in den Mainstream der Persönlichkeitsforschung aufgrund von zwei einflussreichen Studien.30
Beide
waren „Metaanalysen“, sie fassten die Ergebnisse kleinerer Studien zusammen und analysierten sie, indem sie eine breite Auswahl an Erhebungen von Persönlichkeitsmerkmalen verwendeten;bezogen sich unmittelbar auf die Validität von Persönlichkeitsmerkmalen für die Prognose von Arbeitsleistung;nutzten das FFM als den übergeordneten Rahmen, um unterschiedliche Persönlichkeitsmodelle, die von den kleineren Studien eingesetzt wurden, zu kombinieren;kamen zu einflussreichen Ergebnissen, was den Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Leistung am Arbeitsplatz anging.Das FFM wurde eingesetzt, weil es auf immer größeren Konsens unter Experten stieß, was auf diesem Gebiet noch nie da gewesen war. Diese Zustimmung bezog sich auf die Anzahl der Persönlichkeitsfaktoren (Cluster von Charakterzügen) und die beste Art, Persönlichkeit zu beschreiben und zu kategorisieren. Sogar überzeugte Unterstützer des 16-Persönlichkeits-Faktoren-Tests (16PF31), von Myers-Briggs32 und dem Occupational Personality Questionnaire (OPQ33) mussten in einer Reihe von Studien und Artikeln schnell feststellen, dass diese Instrumente der Struktur des Fünf-Faktoren-Modells unterlegen waren. In den 1990er-Jahren revolutionierten die Forscher, die das FFM einsetzten, daher die Einschätzung von Persönlichkeit, um die kompetenzbasierte Leistung und andere Arbeitsergebnisse vorherzusagen und weiterzuentwickeln.
In hohem Maße ungenutzt blieb dieses Potenzial jedoch, wenn es um die Auswahl und Bewertung in Arbeitszusammenhängen ging. Dafür gibt es eine Reihe von nachvollziehbaren Gründen, beispielsweise die Vormachtstellung gewisser kommerzieller Erhebungsmethoden für Persönlichkeitsmerkmale auf dem Markt. Außerdem ist die Wirkmächtigkeit des FFMs auf seine detaillierte Ausarbeitung zurückzuführen (wie beispielsweise die 36 Aspekte umfassende Skala seines renommiertesten Fragebogens, dem NEO PI-R), während die meisten populären Messinstrumente für die Anwendung am Arbeitsplatz sehr einfache und intuitive zusammenfassende Profile abbilden. Doch findet das FFM mit der Zeit immer weitere Verbreitung. Ursächlich dafür sind gut informierte Praktiker und einzelne Berichte auf Grundlage von Expertensystemen, die die Details zugänglicher und damit intuitiver nutzbar machen.34
Warnung: Die Bezeichnungen, die die Skalen typischerweise tragen (s. Abb. 1.2), suggerieren, es sei „besser“, sich einem Ende der Skala zuzuordnen als dem anderen, beispielsweise emotional stabil zu sein anstatt neurotisch. Schaut man jedoch hinter diese Begriffe, muss man feststellen, dass beide Pole der Skalen Gefahren bergen. Menschen, die einen sehr niedrigen Wert für die Ausprägung Neurotizismus haben, können sich und andere beispielsweise in Gefahr bringen, weil sie ein Problem unterschätzen, während Menschen, die einen sehr hohen Wert für Gewissenhaftigkeit haben, inflexibel sein können. Forschungserkenntnisse scheinen zu belegen, dass es einen evolutionären Vorteil gibt, unterschiedliche Persönlichkeitszüge in verschiedenen Situationen zu zeigen – Ängstlichkeit kann in einigen Situationen das eigene Überleben sichern, Konservativismus oder Introversion in anderen etc.
Im Normalfall bemühten sich die Wissenschaftler darum, eine begrenzte Anzahl von spezifischen Persönlichkeitsmerkmalen zu identifizieren, durch die sich äußerst resiliente Menschen auszeichnen. Demgegenüber steht ein umfassendes Persönlichkeitsmodell wie das FFM, das die unterschiedlichen Weisen untersucht, wie jedes einzelne Charakteristikum oder die Kombinationen von ihnen in verschiedenen Situationen zur Resilienz beitragen. Der Ansatz der „resilienten Persönlichkeit“ lässt sich mit dem Modell der psychologischen Widerstandsfähigkeit beschreiben, das eines der wenigen Modelle ist, die speziell für den beruflichen Kontext entwickelt worden sind.
Abbildung 1.2: Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit in der Übersicht
Psychologische Widerstandsfähigkeit
Einige der in Tabelle 1.1 genannten Wissenschaftler bezogen persönliche Charaktereigenschaften als ein Element in ihre Untersuchung von Resilienz mit ein. Andere konzentrierten sich darauf, gerade diese individuellen Unterschiede zu identifizieren. Beispielsweise dokumentierte Suzanne Kobasa35 1979 ihre Ergebnisse über die Schutzfunktion einer Reihe von Persönlichkeitsmerkmalen, die sie als „Widerstandsfähigkeit“ (hardiness) bezeichnete. In ihrer Untersuchung verglich sie eine Gruppe von Managern und Führungspersonen, die stressbedingt unter gesundheitlichen Problemen litten, mit einer zweiten Gruppe, die unter ähnlichen Belastungen gesund blieben. Bei denjenigen, die auch unter hohem Druck gesund waren, stellte sie bei drei Merkmalen ein höheres Niveau fest: die Dispositionen Engagement, Kontrolle und Herausforderung („3Cs“: commitment, control, challenge). Engagement bezieht sich auf das Einbringen in die Umwelt und das Bewusstsein, einen Zweck oder Sinn zu haben. Kontrolle beschreibt das Gefühl, in der Lage zu sein, Ereignisse beeinflussen zu können (manchmal auch als internen Ort der Kontrolle bezeichnet). Herausforderung verweist auf eine Haltung, Veränderungen als normal zu empfinden und zu begrüßen, sie also eher als Chance denn als Bedrohung zu sehen.
Diese Arbeit gehört zu einer langen und beständigen Forschungstradition, an der eine Reihe von einflussreichen Psychologen wie Salvatore Maddi mitarbeiteten, der schließlich das Hardiness Institute in Kalifornien gründete, und Mihaly Csikszentmihalyi, eine zentrale Figur der Positiven-Psychologie-Bewegung. Weitere Forschungsarbeiten konzentrierten sich besonders auf das Konzept der Widerstandsfähigkeit. Darunter war eine groß angelegte Studie, die über zwölf Jahre (1975–1986) Vorgesetzte und Manager der Firma Illinois Bell Telephone während umfassender Veränderungen der Organisation untersuchte. Ihre Ergebnisse und Konsequenzen für die Praxis fassten Salvatore Maddi und Deborah Khoshaba in ihrem Buch Resilience at Work: How to Succeed No Matter What Life Throws at You36 zusammen. Interessanterweise werden in dieser späteren Beschreibung von Widerstandsfähigkeit die drei Charaktermerkmale Engagement, Kontrolle und Herausforderung als „resiliente Haltungen“, nicht als Dispositionen dargestellt. Sie werden durch „zwei lebenswichtige Fähigkeiten“ ergänzt, nämlich der Bewältigung von sich verändernden Verhältnissen (die Umwandlung von potenziell belastenden Veränderungen zum eigenen Vorteil) sowie der Unterstützung vom sozialen Umfeld (Umgang mit anderen in konstruktiver Weise, sodass Beziehungen aufgebaut und erhalten werden). Dieser Wandel stimmt mit unserer Sicht von Resilienz als Prozess und Ergebnis überein, die von beständigeren Persönlichkeitsmerkmalen und anderen individuellen Charakteristika untermauert werden – im Gegensatz zur Annahme, Resilienz sei ein oder eine Reihe von Persönlichkeitsmerkmalen.
Mentale Stärke im Sport
Während viele Untersuchungen sich mit Widerstandsfähigkeit im Kontext von Supervision und Management in Organisationen beschäftigten, gewann das verwandte Konzept „mentale Stärke“ in der Welt des Sports an Bedeutung. Angesichts der Bedeutungsvielfalt der Bezeichnung ist es vielleicht nicht weiter überraschend, dass mentale Stärke in unterschiedlichen Zusammenhängen unterschiedliche Bedeutung hat. Diese Situation wird nicht gerade dadurch verbessert, dass offensichtlich ein Mangel an Klarheit und konsequenter Forschung auf diesem Gebiet herrscht.37 In einer der zuverlässigeren Untersuchungen bezogen sich Peter Clough und Keith Earle38 unmittelbar auf die Erforschung mentaler Stärke und ihre eigenen Ergebnisse aus der Befragung von Spielern in der Rugby-Liga. Sie warteten mit einem neuen Modell auf und entwickelten einen Fragebogen, den MTQ48, Mental Toughness Questionnaire 48. Zu den bisherigen drei Aspekten Engagement, Kontrolle und Herausforderung fügten sie einen vierten hinzu: Vertrauen im Sinne von Vertrauen in interpersonale Situationen und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Jüngere Untersuchungen beschäftigten sich mit dem Zusammenhang von mentaler Stärke und verschiedenen Eigenschaften, die für Resilienz von Belang sind. In einer dieser Studien wurde der Zusammenhang zwischen mentaler Stärke und Optimismus sowie die Fähigkeit, Belastungen zu bewältigen, insbesondere mit der Tendenz, Probleme direkt anzugehen, anstatt ihnen auszuweichen, belegt.39
1.4 Individuelle Persönlichkeitsmerkmale, die Resilienz stärken: häufige Themen
Es existieren zahlreiche weitere Theorien und Ansätze bezüglich der Untersuchung individueller Unterschiede in der Reaktion auf Belastungen. Einige davon werden wir in späteren Kapiteln berücksichtigen, wenn es um das Forschungsdesign und die Implementierung von Maßnahmen zur Stärkung von Resilienz am Arbeitsplatz geht. Jedoch treten einige klare Gemeinsamkeiten und Themen auf, die wir im Folgenden darstellen werden.
Intelligenz und Problemlösung
Der Zusammenhang zwischen Ängstlichkeit / Besorgnis, Stress und Leistungsvermögen am Arbeitsplatz ist komplex, wie man seit Langem weiß. Angst und Stress sind eindeutig miteinander verknüpft, und ein hohes Niveau an Stress beeinträchtigt die Arbeitsleistung. Jedoch scheint das Persönlichkeitsmerkmal Ängstlichkeit (im Sinne von typischerweise eine ängstliche / besorgte Person sein) weniger einen negativen Effekt auf die Performance zu haben als angenommen. Wie sich herausstellt, liegt das an anderen Faktoren, die dabei ins Spiel kommen und bestimmen, in welchem Ausmaß Ängstlichkeit einen hinderlichen Effekt hat. Einer dieser Faktoren ist Intelligenz bzw. logisches Denken oder kognitive Fähigkeit. Intellektuelle Kompetenz hilft einfach, eine Situation einzuschätzen, Lösungen zu erkennen, Optionen zu bewerten und einen Handlungsplan zu erstellen. Auch Menschen mit guten Problemlösefähigkeiten können ängstlich sein, aber sie haben eine höhere Chance, die Lösung eines Problems zu erkennen. Ihre intellektuellen Fähigkeiten wirken als Schutzfaktor gegen Stress und Leistungsabfall. Unter diesen Umständen kann ein gewisses Maß an Ängstlichkeit Resilienz sogar zuträglich sein, da durch sie sichergestellt wird, dass Probleme erkannt und angegangen werden.
Das wiederum heißt nicht, dass die resilientesten Menschen automatisch die intelligentesten sind. Es geht mehr um die Frage, ob jemand in der Lage ist, ein zutreffendes Verständnis der eigenen Situation zu bekommen und ihre mögliche zukünftige Entwicklung vorauszusehen sowie die eigenen Optionen richtig einzuschätzen. Jedoch gibt es in der Tat Hinweise darauf, dass Menschen mit einem höheren Intelligenzniveau empfänglicher für bestimmte Arten von Belastungen sind als andere.40