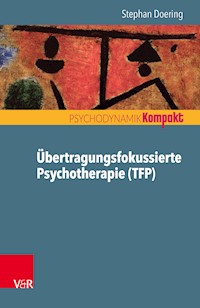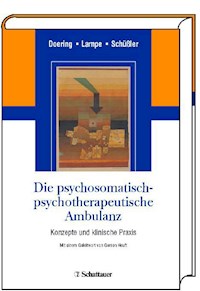37,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Vom magischen Moment in der Psychotherapie Wie kommt es zum wortlosen Verstehen in der therapeutischen Beziehung? Wie wird Resonanz erzeugt? Wie werden unbewusst Informationen ausgetauscht? Dieses Buch verbindet eindrücklich die empirischen Befunde zur impliziten Kommunikation mit den psychoanalytischen Konzepten und den klinischen Phänomenen in der Therapiestunde. Das magische Moment bleibt bestehen, doch werden einige Schleier gelüftet: Akustische, visuelle, motorische, taktile, propriozeptive und olfaktorische Botschaften rufen im Gegenüber in Millisekundenschnelle eine Reaktion hervor. Diese impliziten Interaktionen bestimmen die Chemie, die Wellenlänge zwischen Therapeut und Patient. Der Autor zeigt, wie PsychotherapeutInnen diesen Kanälen mehr Beachtung schenken können, so dass auch dort ein Verstehen gelingt, wo die Worte fehlen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Stephan Doering
Resonanz – Begegnung – Verstehen
Implizite Kommunikation in der therapeutischen Beziehung
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
© 2022 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte sowie die Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i.S.v. § 44b UrhG vorbehalten
Cover: Bettina Herrmann, Stuttgart,
unter Verwendung einer Abbildung von Harald Biebel/iStock by Getty Images
Gesetzt von Eberl & Koesel Studio, Kempten
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
Lektorat: Agnes Katzenbach
ISBN 978-3-608-98513-9
E-Book ISBN 978-3-608-11960-2
PDF-E-Book ISBN 978-3-608-20596-1
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorrede
Danksagung
Teil I
Psychoanalytische Konzepte der therapeutischen Beziehung
Kapitel 1
Epistemologische Vorbemerkung
Kapitel 2
Der Sensualismus
Kapitel 3
Telepathie
Kapitel 4
Theodor Reiks Beitrag
Kapitel 5
Die Übertragung
Kapitel 6
Die Gegenübertragung
6.1 Die frühe Zeit
6.2 Paradigmenwechsel
Kapitel 7
Die projektive Identifikation
7.1 Melanie Klein
7.2 Wilfred Bion
Kapitel 8
Donald W. Winnicott
Kapitel 9
Das interpersonale Feld
Kapitel 10
Resümee
Teil II
Empirische Befunde zur impliziten Interaktion
Kapitel 1
Die frühe Interaktion
1.1 Warum Säuglingsforschung?
1.2 Präsymbolische Repräsentation
1.3 Die frühen Kompetenzen
1.4 Synchronisierung
1.5 Rupture und Repair
1.6 Das Visual Cliff
1.7 Affektabstimmung
1.8 Die Markierungshypothese
1.9 Resümee
Kapitel 2
Embodied Communication
2.1 Freuds »körperliches Ich«
2.2 Die Facial-Feedback-Hypothese
2.3 Maurice Merleau-Ponty
2.4 Andrew Meltzoff und Alison Gopnik
2.5 Das Spiegelsystem
2.6 Emotionaler Gesichtsausdruck
Mimischer Affektausdruck in der Psychotherapie
2.7 Embodied Memories
2.8 Olfaktion
Geruch und soziale Präferenz
Die olfaktorische Übertragung
Empirische Befunde zu Olfaktion und Emotionen
2.9 Synchronisierung
Mimikry – die somatosensorische Synchronisierung
Interpersonale Physiologie
Das Interpersonal Synchrony (In-Sync) Model von Koole & Tschacher
2.10 Resümee
Teil III
Die implizite therapeutische Beziehung
Kapitel 1
Teletherapie
Kapitel 2
Der Dodo Bird
Kapitel 3
Die Boston Change Process Study Group
Kapitel 4
Das Modell von Rainer Krause
Kapitel 5
Der therapeutische Prozess
5.1 Sicherer Rahmen
5.2 Technische Neutralität
5.3 Containerfunktion
5.4 Beziehungserfahrung I: »Aushalten«
5.5 Durcharbeiten
Ein Zwischenruf von Donald W. Winnicott
5.6 Beziehungserfahrung II: »Verstehen«
5.7 Transfer
5.8 Ein klinisches Beispiel
5.9 Resümee
Zum Abschluss
Literatur
Bildquellen
Vorrede
Dieses Buch will Sie mitnehmen auf eine abenteuerliche Expedition zu einigen der aufregendsten Fragen des menschlichen Miteinanders. Im weitesten Sinne geht es um eine Annäherung an die Frage, wie Beziehung funktioniert. Und zwar nicht im Sinne dessen, was man denken, sagen oder tun muss, auch nicht im Sinne der Beschreibung mehr oder weniger pathologischer Muster oder gar ideologischer, soziologischer oder individueller Determinanten von unterschiedlichen Graden des Beziehungserfolgs – nicht das Was soll im Fokus stehen, sondern das Wie der Interaktion.
Nehmen wir an, ein großer Mozartfan trifft einen anderen Mozartfan und beide sprechen über Mozart – da sollte man doch annehmen, dass die beiden in einen Flow geraten, wunderbar zueinander passen, einander verstehen und mögen werden. Doch das ist alles andere als klar! Genauso wie mit jedem anderen Menschen besteht für die beiden eine gewisse Chance, dass dies geschieht, ebenso kann es aber ganz anders kommen: Es kann sein, dass sich kein Verstehen und keine Nähe einstellen – von Sympathie ganz zu schweigen. Woran liegt diese anscheinend kaum beeinflussbare Schicksalhaftigkeit des Gelingens der Kommunikation und der Begegnung?
Wir alle kennen die Redensarten – und die Gefühle dazu: »Es stimmt die Chemie zwischen uns«, »Wir sind auf einer Wellenlänge«. Auch wenn hier naturwissenschaftliche Begriffe verwendet werden (Chemie, Welle), so wird doch oft gemeint, dass da etwas Überirdisches, Magisches oder Spirituelles am Werk sei.
Natürlich treffen wir in der Psychotherapie auf das gleiche Phänomen. Die vielzitierte »Passung« zwischen Patient:in und Therapeut:in ist ebenso schwer vorherzusagen wie die Chemie der beiden Mozartfans. Und dennoch ist der eine Patient mit seiner Therapeutin von der ersten Minute an sehr zufrieden und fühlt sich verstanden, was am Ende zu einem Therapieerfolg führt. Im Gegensatz dazu fühlt sich der andere Patient unwohl und kommt nicht wieder – oder quält sich und die Therapeutin durch eine erfolglose Therapie. Natürlich geht es hier darum, wie frühe Beziehungserfahrungen wiederholt, Übertragungsbereitschaften bedient werden können – aber wie vermittelt sich diese Möglichkeit? Durch das richtige gesprochene Wort? Oder nicht doch vielmehr durch nonverbale Aspekte des Verhaltens, der Kommunikation?
Sigmund Freud und einige seiner frühen Wegbegleiter:innen hatten eine bemerkenswerte Schwäche für die Telepathie. Sie beobachteten unerklärliche Momente des Verstehens in den Psychoanalysen mit ihren Patient:innen. Das Unbewusste versteht das Unbewusste unter Umgehung des Bewussten, so erkannte Freud 1913 (S. 293). Ohne die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir heute haben (und denen dieses Buch nachgeht), konnte Freud kaum anders, als etwas Übersinnliches anzunehmen. Leider haben er und einige andere etwas zu viel über die magischen Momente der telepathischen Prozesse geschrieben, was möglicherweise dazu beigetragen hat, dass in manchen (schlechten) Buchhandlungen noch heute die Psychoanalyse näher an der Esoterik als an der Psychologie oder der Medizin steht.
Wie zu zeigen sein wird, hatte Theodor Reik bereits in den 1940er Jahren der Telepathie eine klare Absage erteilt und angenommen, dass es sich vielmehr um eine sehr subtile sinnliche Wahrnehmung handeln müsse, die das magisch Anmutende zwischen zwei Menschen ermögliche. Jedoch fehlten auch Reik noch die Befunde, die ihm sein Modell hätten bestätigen können.
Die von Freud halb gewollte, halb ihm aufgezwungene Verortung der Psychoanalyse außerhalb der Universität (Schröter 2017) hat dazu beigetragen, dass die naturwissenschaftliche Forschung und die psychoanalytische Theorieentwicklung in den letzten 100 Jahren weitestgehend in zwei Parallelwelten stattgefunden haben. So hat es in der Psychoanalyse enorm tiefgründige und heuristisch in höchstem Maße wertvolle Modellentwicklungen impliziter Beziehungsprozesse gegeben, während unabhängig davon in psychologischen und neurobiologischen Labors die aufregendsten Erkenntnisse zur nonverbalen Interaktion über alle Sinneskanäle und deren Verarbeitung im Gehirn entstanden.
Man fühlt sich an Platons Höhlengleichnis erinnert, wobei man meinen möchte, abwechselnd wären Psychoanalytiker:innen und Neurobiolog:innen vom Sonnenlicht der Erkenntnis abgeschnitten. Es sind voneinander getrennte Erkenntnissphären, in denen Wissen gewonnen wird, ohne dass ein nennenswerter Austausch oder gar eine wechselseitige Befruchtung stattfänden (Mark Solms und die von ihm begründete Neuropsychoanalyse seien beispielhaft als ermutigende Ausnahmen von dieser Regel genannt). Allerdings sollte man sich eine Integration der beiden Bereiche nicht als eine nur aus Versehen ausgelassene leichte Übung vorstellen – zu verschieden sind die Herangehensweisen und die zugrunde liegenden wissenschaftlichen Theorien und Praktiken. Während die Psychoanalyse mit der größtmöglichen Auflösung individuelle und oft unbewusste psychodynamische Prozesse zu erfassen und zu rekonstruieren sucht, bemüht sich die naturwissenschaftliche Forschung um verallgemeinerbares Wissen von beobachtbaren neurobiologischen und psychologischen Phänomenen. Man kann sich heute noch kaum vorstellen, dass eines Tages ein gemeinsames Theoriegebäude mit dem gleichen Repertoire an Epistemologie, experimenteller Methodik und Theoriebildung aus diesen beiden Ansätzen entstehen kann. Fragt man beispielsweise Rachel Blass (Blass & Carmeli 2008), so ist dies schlechterdings unmöglich – wenn nicht gar ein Sakrileg.
Das epistemologische Credo dieses Buches ist somit auch ein bescheideneres: Stellen wir die Erkenntnisse beider Welten nebeneinander ohne den Versuch, sie zur Deckung zu bringen – aber leisten wir uns, die Neugier zu erproben, was mit unserem je eigenen Modell geschieht, wenn wir uns auf das andere so weit als möglich einlassen. Im Idealfall – und das ist das Ziel dieses Buches – vollzieht sich eine Aneignung von Bestandteilen der Nachbardisziplinen, die uns auf dem eigenen Erkenntnisweg weiterkommen lässt.
Konkret bedeutet dies, dass der Versuch unternommen wird, psychoanalytische Modelle von Interaktion und Beziehung den korrespondierenden Experimenten aus Psychologie und Neurobiologie gegenüberzustellen, um sie so zu bestätigen, zu erweitern oder auch zu verwerfen. Gleichzeitig mag die eine oder andere Idee für eine empirische Überprüfung klinischer Beobachtung oder psychoanalytischer Theoriebildung entstehen.
Im I. Teil wird nach einer einleitenden epistemologischen Standortbestimmung die frühe Geschichte des Umgangs mit den »magischen Prozessen« innerhalb der Psychoanalyse dargestellt. Dann folgen die wichtigsten psychoanalytischen Theorien zur unbewussten Beziehung und Interaktion. Die stärker empirisch geprägten Kapitel des II. Teils fokussieren zunächst die Ergebnisse der Säuglingsforschung, die einen enormen Schatz an experimentellen Erkenntnissen und Theorien zu den naturgemäß sinnlich-körperlichen frühen Beziehungserfahrungen und Interaktionsmustern birgt, wie wir sie in Eltern-Kind-Dyaden finden. Das folgende Kapitel nimmt die Embodied Communication in den Blick, zu der es inzwischen eine Vielzahl faszinierender Befunde gibt, die jede denkbare sinnliche Erfahrung in den Blick nehmen. Auch hier geht es nicht um unsere Wortsprache, sondern vielmehr um Sehen, Hören, Riechen, Spüren und deren »Ablaufmuster« und »Aktivierungskonturen« (Stern 1992, S. 88) jenseits der Sprache. Der abschließende III. Abschnitt widmet sich ganz der Frage, wie alle bis dahin vorgestellten Theorien und Befunde in die psychotherapeutische Praxis Eingang finden können, beispielhaft dargestellt an einem mehrschrittigen Modell des psychoanalytischen Deutungsprozesses.
Begeben wir uns also auf die Reise in unsere innere vorsprachliche, sinnliche, körperlich-emotionale Welt und in die unbewussten Tiefen unserer zwischenmenschlichen Begegnungen.
Danksagung
Mein Dank gilt in erster Linie allen Forscher:innen und Autor:innen, deren Wissen ich begeistert rezipieren, zusammentragen und in einen – hoffentlich nicht nur für mich – sinnvollen Zusammenhang stellen durfte. Einem unter ihnen verdanke ich eine Art Initialzündung, nämlich Rainer Krause. In seinem Eröffnungsvortrag zur Langeooger Psychotherapiewoche 2013 sprach er zum »Austausch affektiver Zeichen« und berichtete von seiner Erfahrung in einem Geruchslabor, die ihn tief beeindruckt hatte, war es ihm doch gelungen, »affektive Geruchsproben« (siehe hierzu Kapitel II.2.8) ohne jegliche bewusste Wahrnehmung korrekt zuzuordnen. Schon damals hob Krause die Bedeutung emotional-olfaktorischer Interaktion hervor. Plötzlich wurde mir damals die Bedeutung impliziter Interaktionen jenseits des mimischen Affektaustauschs bewusst, was natürlich zum Verständnis interpersonaler Prozesse in der Psychoanalyse, die ja auf den Augenkontakt bewusst verzichtet, von zentraler Bedeutung ist: Was wir hier nicht sehen, riechen und hören wir! Fortan ließ mich die Faszination für die impliziten interpersonalen Prozesse nicht mehr los. Zum ersten Mal wagte ich mich 2016 beim New Yorker Kongress der International Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP) mit meinen Überlegungen vor die Ohren meiner (glücklicherweise) wohlwollenden Kolleg:innen.
2017 war es eine Einladung von Horst Kächele und Michael Buchholz zu ihrer Tagung »Psychoanalytic Process Research Strategies IV«, die zu einer faszinierenden Begegnung mit Stefan Pfänder und der Konversationsanalyse führte. Die gemeinsame Analyse eines videografierten Interviews von Otto Kernberg mit einer Borderline-Patientin ließ uns erkennen, wie die psychoanalytische und die konversationsanalytische Herangehensweise sehr ähnliche Ergebnisse hervorzubringen vermögen.
Schließlich gilt mein Dank auch Dorothea Huber, Cord Benecke und Peter Henningsen, die mir durch ihre Einladung zu den Lindauer Psychotherapiewochen 2020 die Chance gaben, meine Gedanken und Überlegungen zu strukturieren, und die – Corona sei Dank! – ein professionelles Filmteam zu mir nach Wien schickten, um die fünf Vorlesungen für das Online-Streaming und eine DVD aufzunehmen.
Der Klett-Cotta Verlag erwies sich als ein wunderbarer Partner, um aus den Vorlesungen ein Buch werden zu lassen. Mein größter Dank gilt hier Katharina Colagrossi, die mich sehr einfühlsam und unterstützend durch den gesamten Entstehungsprozess dieses Buches geführt und begleitet hat. Agnes Katzenbach als »meiner« Lektorin bin ich ganz besonders dankbar dafür, dass sie mich behutsam und taktvoll überall dort sprachlich, inhaltlich und formal auf Kurs gebracht hat, wo dies notwendig war.
Beeindruckt hat mich, wie eine ganze Reihe meiner Kolleg:innen, die ich mit der Bitte um Bildrechte angeschrieben habe, freigiebig und ohne zu zögern der Publikation ihrer Fotos bzw. Film-Stills zugestimmt haben. Ich danke Beatrice Beebe, Ed Tronick, Peter Fonagy und Rainer Krause für ihre Großzügigkeit.
Last but not least danke ich meiner Familie, die es tolerieren musste, dass über einen beträchtlichen Zeitraum hinweg meine Wochenenden in wesentlichen Teilen am Schreibtisch stattfanden.
Stephan Doering, Juli 2022
Teil I
Psychoanalytische Konzepte der therapeutischen Beziehung
Kapitel 1
Epistemologische Vorbemerkung
»Es ist bemerkenswert, daß das Ubw eines Menschen mit Umgehung des Bw auf das Ubw eines anderen reagieren kann. Die Tatsache verdient eingehendere Untersuchung, besonders nach der Richtung, ob sich vorbewußte Tätigkeit dabei ausschließen läßt, ist aber als Beschreibung unbestreitbar« (Freud 1913, S. 293).
Diese Bemerkung Freuds aus dem Jahr 1913 stellt so etwas wie das Leitmotiv dieses Buches dar. Mit anderen Worten: Wir nehmen an, dass es eine nonverbale, unbewusste, implizite Kommunikation gibt, die bisweilen magisch erscheint, aber auf sinnlicher Wahrnehmung beruht. Freuds Beobachtung nehmen wir als Ausgangspunkt unserer Hypothese an, für die wir Belege zusammentragen wollen, denn ein beträchtlicher Teil an »eingehenderer Untersuchung« hat inzwischen stattgefunden, sodass sich eine Bestandsaufnahme lohnt.
Bei einem Unterfangen wie diesem ist die Gefahr groß, der Versuchung einer Gleichsetzung von Erkenntnissen zu erliegen, die mittels verschiedener epistemologischer Zugangswege auf unterschiedlichen Erkenntnisebenen gewonnen wurden. Solche Kurzschlüsse stellen eine Trivialisierung dar, die den Schein von Verstehen vermittelt, wo allenfalls ein Staunen über die verschiedenen Erscheinungsformen und Bedeutungsebenen desselben Gegenstands zulässig wäre.
Hedy Lamarr galt als eine der schönsten Frauen ihrer Zeit – noch im Jahr 2020 widmete ihr das Jüdische Museum in Wien eine Ausstellung, die das eindrucksvoll belegte. Sieht man sich die Fotografien und Filme Lamarrs an, so ist man bewegt von ihrer Schönheit und – nicht zuletzt – von ihrer unfassbar makellosen Haut. Diese kann sicher als ein wichtiger Bestandteil ihrer Schönheit angesehen werden. Die Künstlerin wird die Magie der Beschaffenheit, die unvergleichliche Farbigkeit erkennen und wiederzugeben versuchen, der Ästhetiker das Ebenmaß, die Symmetrie des Gesichts hervorheben, der Filmkritiker die geistreiche Ausdruckskraft und Mimik der Schauspielerin loben. Die Dermatologin kann uns beschreiben, welches Zusammenspiel der Funktionen aller Hautgewebe- und Zellbestandteile nötig sind, um eine solche Glätte entstehen zu lassen. Fragen wir den Histologen, wird er uns auf die mikroskopisch sichtbaren Zellbestandteile hinweisen, während der Physiologe die Funktion dieser Organellen beschreibt – und so weiter.
Wir sehen an diesem Beispiel, dass es zum einen so etwas wie eine Körnung der Wahrnehmungsebene gibt: von der Makroebene zur Mikroebene mit immer größerer Auflösung. Gleichzeitig gibt es aber auch eine weitere Dimension, nämlich die Dimension subjektiv erlebte Bedeutung vs. »objektive« Phänomenologie. Die Ausdruckskraft der Lamarr als Schauspielerin lässt sich nur subjektiv erfahren, nicht aber objektivieren – der Versuch einer Vermessung mithilfe von Zeit und Raum führt zum Verlust der künstlerischen Erfahrung. Bis ins Absurde gesteigert wird dies deutlich, wenn wir versuchen wollten, Hedy Lamarrs Schönheit mithilfe der Funktion der Calcium-Kanäle ihrer epidermalen Basalzellen zu beschreiben.
Die dritte Dimension beschreibt das Ausmaß der Bewusstheit der Wahrnehmung. Die Erfahrung des Kinobesuchers, der eine Gänsehaut bekommt oder ein tiefes Sehnsuchtsgefühl erlebt, ist eine zunächst körperlich-emotionale, die sich ihres auslösenden Mechanismus – zumindest im Detail – nicht bewusst ist. Jeder ihrer sechs Ehemänner wird auf den Anblick und die Berührung ihrer Haut anders reagiert haben, sie als schön empfunden und sie wiederum körperlich-emotional erfahren haben. Aus psychoanalytischer Sicht können unbewusste Erfahrungen entweder symbolisiert bzw. »mentalisiert« sein (sekundäres Unbewusstes) oder aber (noch) nicht durch diese mentale Aufbereitung gegangen sein (primäres Unbewusstes).
Aus diesem Beispiel wird deutlich, dass es nur selten möglich ist, von einer Erkenntnisebene die Phänomene und Erfahrungen einer anderen erklären zu wollen. Gelegentlich ist dies teilweise möglich, nämlich dann, wenn der gleiche Grad der Objektivierbarkeit vorliegt: Die Atomphysik kann helfen, molekularbiologische Prozesse zu verstehen, aus der Histologie lässt sich einiges der Anatomie erklären. Wenn es allerdings darum geht zu erfassen, was der Kinobesucher erlebt, wenn Hedy Lamarr ihren Leinwandpartner küsst, sind die genannten Disziplinen völlig ungeeignet.
Bereits Aristoteles formulierte in seiner Metaphysik im 4. Jhdt. v. Chr.:
»Das, was aus Bestandteilen so zusammengesetzt ist, daß es ein einheitliches Ganzes bildet, nicht nach der Art eines Haufens, sondern wie eine Silbe, das ist offenbar mehr als bloß die Summe seiner Bestandteile. Eine Silbe ist nicht die Summe ihrer Laute, ba ist nicht dasselbe wie b plus a, und Fleisch ist nicht dasselbe wie Feuer plus Erde« (Aristoteles 2014, S. 114 f.).
Das Diktum »Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile« wird bis heute vielfach zitiert und beispielsweise als eine Grundannahme der Systemtheorie angesehen (siehe Engel 1980). In unserem Zusammenhang verweist es einmal mehr auf die Unzulässigkeit von Kurzschlüssen über Systemebenen hinweg: Die Erkenntnisse der Biologie sind nicht geeignet, das Funktionieren der Psyche zu erklären.
Kommen wir nun zur bereits zuvor erwähnten Rachel Blass. Sie ist Psychoanalytikerin mit kleinianischer Prägung, geboren in New York lebt und arbeitet sie in Israel. Sie ist eine der wortgewaltigsten und leidenschaftlichsten Verfechter:innen der Trennung der Erkenntnisebenen, genauer gesagt: Gegnerin einer neuropsychoanalytischen Forschung, die neurobiologische Erkenntnisse nutzt, um psychoanalytische Prozesse und Theorien zu entwickeln bzw. zu untermauern. In dem Artikel »Plädoyer gegen die Neuropsychoanalyse«, den sie gemeinsam mit Zvi Carmeli verfasst hat, warnt sie vor einer »Biologisierung der Psychoanalyse« (Blass & Carmeli 2008, S. 150). »Sinnliches, Physisches und Visuelles« würden »auf Kosten von psychischer Bedeutung, Wahrheit und Ideen« ins Feld geführt und dadurch der psychoanalytischen Erkenntnishaltung nicht nur entgegenstehen, sondern geradezu schaden. Die »Anwendung der Neurowissenschaften auf die Psychoanalyse [beruht] auf ungerechtfertigten Schlüssen« (S. 122). In sehr differenzierter Weise weisen Blass & Carmeli auf reduktionistische Schlüsse hin, wie zum Beispiel den, dass die Identifizierung von »im Gehirn befindlichen Motivationszentren« (S. 133) die psychoanalytische Triebtheorie erklären könnte. Zunächst, so die Autor:innen, konzipiere die psychoanalytische Triebtheorie wesentlich komplexer, als es in einer Gleichsetzung von Trieb und Motivation enthalten sei, darüber hinaus könne die Neurowissenschaft eben keine Aussage über die »psychologische Struktur« der Motivationen machen, lediglich über ihr »biologisches Substrat« (ebd.). Eine Gefahr entstehe unter anderem dort, wo aufgrund neurowissenschaftlicher Erkenntnis vorschnell und reduktionistisch der Schluss gezogen werde, dass »neuronale Abnormalitäten von solcher Art sind, dass eine psychologische Intervention, also auch Psychoanalyse, zwecklos« wäre (S. 124). In dramatischer Weise schließen Blass & Carmeli ihre Ausführungen mit der Warnung, dass »das besondere Interesse der Psychoanalyse an der psychischen Dimension der menschlichen Existenz«, dem »Höherwertigen« nach Freud, verloren gehen könnte (S. 150).
Blass & Carmeli spielen hier auf eine Passage aus Freuds Der Mann Moses und die monotheistische Religion an. Freud (1939) setzt sich mit den Folgen auseinander, die das (in der jüdischen Zählung) zweite Gebot gezeitigt hat. Im 2. Buch Mose (20, 4–5) lautet es:
»Du sollst Dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist: Bete sie nicht an, diene ihnen nicht!«
Das »Verbot, sich ein Bild von Gott zu machen, also der Zwang, einen Gott zu verehren, den man nicht sehen kann«, stellt für Freud die »Zurücksetzung der sinnlichen Wahrnehmung gegen eine abstrakt zu nennende Vorstellung, einen Triumph der Geistigkeit über die Sinnlichkeit, streng genommen einen Triebverzicht« dar. Mit einer gewissen Ironie fährt er fort:
»Die Harmonie in der Ausbildung geistiger und körperlicher Tätigkeit, wie das griechische Volk sie erreichte, blieb den Juden versagt. Im Zwiespalt trafen sie wenigstens die Entscheidung für das Höherwertige« (Freud 1939, S. 220).
Man darf bezweifeln, ob Freud es mit der Höherwertigkeit des Geistigen bzw. der »psychischen Dimension« ebenso ernst gemeint hat wie Blass & Carmeli – man sollte nicht vergessen, dass Freud selbst als Neurowissenschaftler begonnen und dass er zeit seines Lebens (auch) gehofft hat, mit der Psychoanalyse (wieder) Anschluss an die Medizin zu finden. In diesem Sinne verlangt er in »Zur Einführung des Narzißmus«: »[…] muss man sich daran erinnern, dass all unsere psychologischen Vorläufigkeiten einmal auf den Boden organischer Träger gestellt werden sollen« (Freud 1915a, S. 143 f.). Dieser Satz verdient eine genauere Betrachtung, spricht Freud doch nicht von organischer Erklärung oder gar einer Ersetzung des Psychologischen durch das Biologische – vielmehr geht es um einen »Träger«, den das Organische abgeben soll. Man könnte an eine Edelrose denken, die durch die Pfropfung auf die Wurzel einer wilden Rose sichereren Halt im Boden gewinnt. So gesehen wäre das Höherwertige wohl eher in einem räumlichen Sinn als in einem ökonomischen zu verstehen.
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen lassen wir uns auf das Wagnis ein, Ergebnisse der empirisch-psychologischen sowie der neurobiologischen Forschung als Träger für psychoanalytische und psychotherapeutische Konzepte, Theorien und klinisches Handeln einzusetzen. Neben der Gefahr eines Verlusts des Höherwertigen liegen dort nämlich auch Chancen. Zum einen kann psychoanalytisches Denken und Handeln eine Stärkung erfahren, wenn die Ergebnisse anderer Forschungsdisziplinen in dieselbe Richtung weisen, zum anderen kann auch eine Korrektur im positiven Sinne erfolgen, wenn beispielsweise – wie in diesem Buch zu zeigen sein wird – die Kraft des bloßen Wortes als therapeutisches Agens zugunsten nonverbaler impliziter Prozesse verschoben wird. Die Hoffnung liegt diesbezüglich darin, dass es gelingen könnte, einen Weg zwischen Biologisierung und Intellektualisierung zu gehen und Psychoanalytiker:innen zu ermutigen, auf die emotional-körperlichen Modi der therapeutischen Interaktion zu vertrauen, ohne dabei in eine esoterische Drift zu geraten.
Das zweite Argument für den Blick über die jeweiligen Tellerränder hat eine diplomatisch-strategische Qualität: Ohne Zweifel leben wir in einem Zeitalter der Dominanz eines reduktionistischen biomedizinischen Paradigmas der Gesundheitsdisziplinen (Engel 1977). In diesem Milieu haben die Psychoanalyse und die Psychotherapie insgesamt einen schweren Stand. Gelingt es, empirisch nachweisbare – oder gar organische – Surrogate psychotherapeutischer Effekte zu belegen, führt dies dazu, dass biomedizinische und positivistische Engstirnigkeit eine Öffnung hin zu größerer Pluralität epistemologischer Zugänge erfährt. Als ein Beispiel sei die Arbeit von Anna Buchheim et al. (2012) zu »Normalisierungen« bestimmter Hirnaktivitäten durch psychoanalytische Behandlung depressiver Patient:innen genannt, die es unter dem – zugegeben – reißerischen Titel »Freuds Erbe. Hirnforscher belegen die Wirksamkeit der Psychoanalyse« auf die Titelseite der etablierten Zeitschrift Gehirn und Geist (11/2012) geschafft hat.
Das Wissen um neurobiologische und empirisch-psychologische Erkenntnisse kann psychoanalytisches Denken und Arbeiten in keiner Weise ersetzen, kann es aber ergänzen und dadurch Beziehungserleben und -handeln absichern und erweitern. Abschließend sei am Ende dieses Kapitels noch einmal eindringlich vor reduktionistischer Gleichsetzung von Verstehensprozessen auf inkommensurablen Erkenntnisebenen gewarnt. Im Übrigen wäre auch allgemein gesprochen der Welt ein großer Dienst erwiesen, wenn jede Forscher:in und jede Therapeut:in vor der Tätigung einer Aussage sich und – wenn nötig – auch dem Gegenüber Rechenschaft über die gerade verwendete epistemologische Zugangsebene geben würde.
Kapitel 2
Der Sensualismus
Die bereits erwähnte Grundannahme dieses Buches, dass nämlich eine nonverbale, unbewusste, implizite Kommunikation existiert, die bisweilen magisch erscheint, aber auf sinnlicher Wahrnehmung beruht, ist nicht neu, vielmehr hat sie ihre Wurzeln in gut zweitausend Jahren philosophischen Denkens.
Das Leitmotiv der philosophischen Tradition des Sensualismus lautet: Nihil est in intellectu, quod non antea fuerit in sensu (Nichts ist im Geiste, was nicht vorher in den Sinnen war).
Abbildung 1: Aristoteles (384–322 v. Chr.)
Dieser Satz zieht sich wie ein roter Faden durch die Philosophiegeschichte und taucht in den unterschiedlichsten Köpfen immer wieder auf (siehe hierzu Cranefield 1970). Vermutlich war es Aristoteles (Abb. 1), der als Erster in diese Richtung dachte. In seinem Buch Über die Seele schreibt er:
»Da es aber, wie es scheint, kein Ding gibt, das abgetrennt neben den sinnlich wahrnehmbaren Größen existiert, so sind die denkbaren Formen in den wahrnehmbaren Formen enthalten, und zwar sowohl die in Abstraktion ausgesagten Dinge als auch alle Zustände und Eigenschaften der wahrnehmbaren Dinge« (Aristoteles 2011, S. 163).
Eine klare Absage an jegliche übersinnliche Wahrnehmung, aber auch Spiritualität, die später korrigiert oder zumindest ergänzt wurde.
Abbildung 2: Thomas von Aquin (1225–1274)
Bei Thomas von Aquin (Abb. 2) wird immerhin dem menschlichen ein göttlicher Verstand gegenübergestellt, der ohne sinnliche Wahrnehmung auskommt:
»Nichts ist im Geist/Intellekt, was nicht vorher in den Sinnen war. Aber bei Gott gibt es keine sensitive Erkenntnis, weil diese materiell ist. Daher kennt er keine erschaffenen Dinge, die vorher nicht in seinem Sinn waren« (Thomas von Aquin, De Veritate, zit. nach Wengraf 2016, S. 197).
Thomas von Aquin trennt klar zwischen menschlichem und göttlichem Verstand – der Schöpfergott kann nicht zuvor sinnlich wahrgenommen haben, was er erst erschafft. Der Mensch hingegen erschafft nicht, sondern erfährt zunächst, was von Gott geschaffen wurde, bevor er es geistig verarbeiten kann. Auch hier gibt es keinen Platz für übersinnliche Wahrnehmung – ausgenommen freilich den Glauben an Gott.
Abbildung 3: John Locke (1632–1704)
Wiederum sehr klar sensualistisch äußert sich John Locke (Abb. 3) in seinem Essay Concerning Human Understanding (Versuch über den menschlichen Verstand):
»Wenn man also fragen wird, wann ein Mensch irgendwelche Ideen zu haben beginnt, dann lautet die wahre Antwort meines Erachtens: wenn er erstmals irgendeine Wahrnehmung hat. Denn da es im Geist keine Ideen zu geben scheint, bevor die Sinne nicht irgendwelche übermittelt haben, denke ich, dass die Ideen im Verstand gleichzeitig mit der Sinnesempfindung bestehen, welche ein Eindruck oder eine Bewegung ist, die auf irgendeinen Teil des Körpers einwirkt, und zwar derart, dass sie im Verstand eine Wahrnehmung erzeugt. Es sind eben diese Eindrücke, die von äußeren Gegenständen auf unsere Sinne einwirken, mit denen der Geist sich anfangs im Rahmen solcher Tätigkeiten, die wir Wahrnehmung, Erinnerung, Betrachtung, Schließen usw. nennen, zu beschäftigen scheint« (Locke, zit. nach Lenz 2010, S. 268).
Abbildung 4: Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716)
Gottfried Wilhelm Leibniz (Abb. 4) schließlich nimmt in seinen Nouveaux Essais sur l’entendement humain (Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand) eine entscheidende Ergänzung vor: »Nichts ist im Geiste, was nicht vorher in den Sinnen war, ausgenommen der Geist selber« (Leibniz 1990, S. 111; Übers. S. D.). Damit trägt er der Annahme Rechnung, dass der Geist sich nicht ausschließlich aus sinnlicher Erfahrung entwickelt, sondern zumindest als basales Funktionsprinzip angeboren ist, sich aber erst durch die sinnliche Wahrnehmung mit Inhalten füllt.
Diese sensualistischen Positionen wurden vielfach in Frage gestellt – die zwei zentralen Kritikpunkte fassen Kirchner & Michaëlis (1907) zusammen. Zum einen sei
»der theoretische Sensualismus eine Einseitigkeit, die das Wesen der inneren Erfahrung und der apperzeptiven Vorgänge verkennt«, zum anderen gründe sich der »praktische Sensualismus […] auf die metaphysische Behauptung, alles, was die Grenzen der sinnlichen Wahrnehmung überschreite, sei Täuschung.« Dadurch würden »alle höheren spekulativen, ethischen, ästhetischen und religiösen Interessen gefährdet und der Weltansicht des Materialismus die Tore geöffnet« (S. 569 f.).
Der kleine Ausflug in die Philosophie soll keinesfalls dem Materialismus das Wort reden – wären wir doch damit wieder knapp vor der Biologismus-Falle –, sondern vielmehr die Frage aufwerfen, wie viele unserer metapsychologischen Konzepte inzwischen durch empirische Forschungsergebnisse auf sensualistischem Weg unterfüttert werden können.
Kapitel 3
Telepathie
Folgen wir der sensualistischen Auffassung, so dürfte klar sein, dass jede Form der Interaktion zwischen zwei Menschen auf dem Wege sinnlicher Wahrnehmung stattfindet. Ist dies die Antwort auf Freuds eingangs zitierten Satz:
»Es ist bemerkenswert, daß das Ubw eines Menschen mit Umgehung des Bw auf das Ubw eines anderen reagieren kann. Die Tatsache verdient eingehendere Untersuchung, besonders nach der Richtung, ob sich vorbewußte Tätigkeit dabei ausschließen läßt, ist aber als Beschreibung unbestreitbar« (Freud 1913, S. 293)?
Abbildung 5: Sigmund Freud (1856–1939)
Wenn wir uns für einen Moment vorstellen, was für Erfahrungen die frühen Analytiker:innen mit ihren Patient:innen gemacht haben müssen, lässt sich nachvollziehen, welche – aus heutiger Sicht – kuriosen Interpretationsversuche sie für die Prozesse in der Analysestunde heranzogen. Die analytische Situation funktioniert wie ein Treibhaus für Übertragungen, Gegenübertragungen, Gefühle und körperliche Zustände, die sich vielfach einem kognitiven Verstehen entziehen. Das plötzliche Auftreten intensiver Gegenübertragungen, das unvermittelte intuitive Verstehen, die sich in der Sitzung einstellen können, konnten die Pionier:innen durchaus an Magie glauben lassen. Freud selbst hat sich immer wieder mit Okkultismus und Telepathie auseinandergesetzt und zeitlebens ein ambivalentes Verhältnis dazu gehabt. Aus wissenschaftlicher Redlichkeit, aber auch um die Psychoanalyse nicht in Verruf zu bringen, hat er wiederholt betont, dass er nichts Gesichertes über diese »Phänomene« aussagen könne, so zum Beispiel am Ende seines Textes »Traum und Telepathie«:
»Habe ich bei Ihnen den Eindruck erweckt, daß ich für die Realität der Telepathie im okkulten Sinne versteckt Partei nehmen will? Ich würde es sehr bedauern, daß es so schwer ist, solchen Eindruck zu vermeiden. Denn ich wollte wirklich voll unparteiisch sein. Ich habe auch allen Grund dazu, denn ich habe kein Urteil, ich weiß nichts darüber« (Freud 1922, S. 191).
Auch hat er, wie aus seinem Brief an Hereward Carrington vom 24. Juli 1921 hervorgeht, diesem eine Absage erteilt, als der ihn offenbar als Mitstreiter oder Unterstützer für die Gründung seines American Psychical Institute1 gewinnen wollte:
»Ich gehöre nicht zu denen, die ein Studium der sogenannten okkulten psychischen Phänomene als unwissenschaftlich, als unwürdig oder gar als gefährlich von vorneherein ablehnen. […] Trotzdem bitte ich Sie, bei Ihrem Unternehmen auf meinen Namen zu verzichten, […] weil ich gewisse skeptisch-materialistische Vorurteile nicht loswerden kann, und diese in die Erforschung des Okkulten mitbringen würde« (Freud 1968, S. 351).
Wie man sieht, war Freud also dem Okkulten nicht abgeneigt. Insbesondere mit der Telepathie hat er sich immer wieder sehr ernsthaft beschäftigt. Er hat sie definiert als »die Aufnahme eines seelischen Vorgangs in einer Person durch eine andere auf anderem Wege als dem der Sinneswahrnehmung« (Freud 1925a, S. 570) und hat sie zuerst – aber nicht nur – im Traum gesucht, wie seinen Arbeiten »Traum und Telepathie« (1922), »Die okkulte Bedeutung des Traumes« aus den »Nachträgen zum Ganzen der Traumdeutung« (1925a), sowie der 30. Vorlesung (»Traum und Okkultismus«) der Neuen Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (1933) zu entnehmen ist. Freud stellte die Vermutung an, »daß dies [die Telepathie] der ursprüngliche, archaische Weg der Verständigung unter den Einzelwesen ist, der im Lauf der phylogenetischen Entwicklung durch die bessere Methode der Mitteilung mit Hilfe von Zeichen zurückgedrängt wird«, ein Kommunikationsweg, der »im Hintergrund erhalten bleiben und sich unter gewissen Bedingungen noch durchsetzen« könnte (1933, S. 60). Dann wiederum betont er sein Unwissen und wünscht sich, »mit Hilfe der Psychoanalyse mehr und besser Gesichertes über die Telepathie zu erfahren« (1925a, S. 573). Er beruhigt sich und seine Leser:innen:
»Wenn das telepathische Phänomen aber nur eine Leistung des Unbewußten ist, dann liegt ja kein neues Problem vor. Die Anwendung der Gesetze des unbewußten Seelenlebens verstünde sich dann für die Telepathie von selbst« (1922, S. 191).
Und er kehrt gelegentlich auch zu materialistischeren Annahmen zurück:
»Was zwischen beiden seelischen Akten liegt, kann leicht ein physikalischer Vorgang sein, in den sich das Psychische an einem Ende umsetzt und er sich am anderen Ende wieder in das gleiche Psychische umsetzt« (1933, S. 59).
Damit kehrt Freud zu seiner Telefonmetapher aus dem Jahr 1912 zurück (1912a, S. 381), die uns im Weiteren noch beschäftigen wird, wenn es um die Übertragungsphänomene geht (Kapitel I.5). Hier hatte Freud die Interaktion zwischen Analytiker und Analysand mit einem Telefongespräch verglichen, in dem eine zweimalige Umwandlung stattfindet, wobei dem Analytiker die Aufgabe zukomme, durch die Zuwendung seines empfangenden Organs und Umwandlung der eintreffenden Wellen ein Verstehen zu entwickeln.
Genau an dieser Stelle setzt Helene Deutsch mit ihrer besonders interessanten Arbeit Okkulte Vorgänge während der Psychoanalyse (1926) an. Sie weist zunächst auf den besonders innigen »psychischen Kontakt zwischen dem Analytiker und dem Analysierten während der Psychoanalyse« hin (S. 419), bevor sie feststellt:
»Unter Voraussetzungen, die uns nicht klargeworden sind, die aber aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem Prozeß der Übertragung – im psychoanalytischen Sinne – zusammenhängen, setzt sich sichtlich der reaktive Vorgang bei der Übertragungsperson ins Bewußtsein durch und wird zum Wahrnehmungsinhalte. Da die Sinneswahrnehmung, die sonst diesem Vorgang vorangeht, gefehlt hat, bekommt sie einen ›okkulten‹ Charakter« (S. 420).
Zwar betont Deutsch wie hier mehrfach die mystische Qualität des Unbewussten und der psychoanalytischen Situation, jedoch bleibt bei ihr das Okkulte einfach das Verborgene, also Unbewusste, Implizite, dem die Analytikerin ihre »unbewußte Bereitschaft zur Aufnahme« (ebd.) entgegenbringen müsse. Bei ihren Überlegungen hält sie konsequent Distanz zu parapsychologischen Spekulationen.
Während Freud und auch Helene Deutsch also offenbar fasziniert waren von dem Unerklärlichen, das (nicht nur) in der Psychoanalyse zwischen zwei Menschen geschieht, bewahrten sie sich eine gewisse Skepsis. Im Gegensatz dazu waren andere Analytiker:innen ihrer Zeit geradezu mit fliegenden Fahnen zu einer ungebremsteren Begeisterung für telepathische Prozesse aufgelaufen. Allen voran Sándor Ferenczi, der am 22. November 1910 euphorisch in einem Brief an Freud schrieb:
»Eine interessante Neuigkeit in der Übertragungsgeschichte. Denken Sie sich, ich bin ein großer Wahrsager resp. Gedankenleser! Ich lese (in meinen freien Assoziationen) die Gedanken meiner Patienten. Die zukünftige Methodik der ΨA muß daraus Nutzen ziehen. […] Komme ich nach Wien, so will ich mich Ihnen als ›Hofastrologe der Psycho-Analytiker‹ vorstellen« (Freud & Ferenczi 1993, S. 329).
Natürlich kann man auch hier eine gewisse Selbstironie nicht übersehen, allerdings hat Ferenczi noch mehr als 20 Jahre später, nämlich am 12. April 1932, als er seine frühere Idee vom »Dialoge der Unbewußten« (1915, S. 28) reflektierte, in sein Klinisches Tagebuch notiert:
»Schon vor mir haben manche auf die Auffälligkeit hingewiesen, wie oft sogenannte Gedankenübertragungsphänomene zwischen Arzt und Patient sich abspielen, oft in einer Art, die die Wahrscheinlichkeit des Zufalls weit übersteigt. Sollten sich einmal diese Dinge bewahrheiten, so wäre es uns Analytikern plausibel, daß das Übertragungsverhältnis das Zustandekommen verfeinerter Empfänglichkeitsäußerungen ungemein fördern könnte« (Ferenczi 2013, S. 133).
Dabei war er in seiner Arbeit von 1915 ohne jeglichen Rückgriff auf die Telepathie ausgekommen:
»Es handelt sich hier meiner Ansicht nach um einen der so häufigen Fälle, die ich als ›Dialoge der Unbewußten‹ zu nennen pflege, wo nämlich die Unbewußten zweier Personen sich vollkommen verstehen und sich gegenseitig zu verstehen geben, ohne daß das Bewußtsein beider auch nur eine Ahnung davon hätte« (1915, S. 28).
István Hollós berichtete 32 Fälle von Telepathie und argumentierte ohne jede Skepsis für das Vorkommen von telepathischen Phänomenen, »die ohne Zuhilfenahme unserer sensiblen und motorischen Mechanismen« stattfinden (Hollós 1933, S. 529). Er entwickelte eine Art Induktionsmodell, bei dem er sich auf Ferenczi bezog, der ihm gegenüber einmal von einer »Induktion des Unbewußten zweier Personen« im Zusammenhang mit der Telepathie gesprochen habe. Hollós führte diesen Gedanken fort: