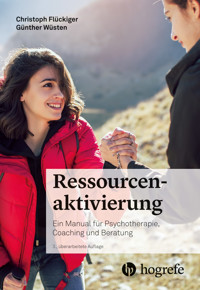
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Hilfe suchende Personen befinden sich zu Beginn einer Therapie oder Beratung oftmals in einem Zustand totaler Hoffnungslosigkeit. Sie haben es aufgegeben, an ihre eigenen Bewältigungsstrategien zu glauben. Die Aufgabe der Therapeutin?/?des Therapeuten ist es, ihr Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit zu reaktivieren. Sie?/?er muss versuchen, die vorhandenen Stärken und Fähigkeiten der Hilfe suchenden Person aufzugreifen und zu nutzen, was im Fachjargon "Kapitalisierung" genannt wird. Das Manual "Ressourcenaktivierung" zeigt konkrete Möglichkeiten auf, wie die Ressourcen einer Person in Therapie und Beratung mitberücksichtigt und in bestehende Therapiekonzepte integriert werden können. Die vorgestellten Interventionen, Fallbeispiele und Arbeitsblätter sind gut verständlich verfasst und für die Praxis einfach umsetzbar dargestellt. Für die dritte Auflage wurde der Inhalt aktualisiert und mit den Kapiteln •Ressourcenorientierte Psychodiagnostik •Wertschätzung der eigenen Charakterstärken •Ressourcenorientierter Umgang mit Beziehungsbrüchen •Förderung sozialer Unterstützung ergänzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Christoph Flückiger
Günther Wüsten
Ressourcenaktivierung
Ein Manual für Psychotherapie, Coaching und Beratung
Mit einem Geleitwort von Bruce E. Wampold
3., überarbeitete Auflage
Ressourcenaktivierung
Christoph Flückiger, Günther Wüsten
Wissenschaftlicher Beirat Programmbereich Psychologie
Prof. Dr. Guy Bodenmann, Zürich; Prof. Dr. Lutz Jäncke, Zürich; Prof. Dr. Astrid Schütz, Bamberg; Prof. Dr. Markus Wirtz, Freiburg i. Br., Prof. Dr. Martina Zemp, Wien
Prof. Dr. Christoph Flückiger
Universität Zürich
Psychologisches Institut
Binzmühlestrasse 14
8050 Zürich
Schweiz
E-Mail: [email protected]
Prof. Dr. Günther Wüsten
Hochschule für Soziale Arbeit
Institut für Soziale Arbeit und Gesundheit
Riggenbachstrasse 16
4600 Olten
Schweiz
E-Mail: [email protected]
Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Anregungen und Zuschriften bitte an:
Hogrefe AG
Lektorat Gesundheit
Länggass-Strasse 76
3012 Bern
Schweiz
Tel. +41 31 300 45 00
www.hogrefe.ch
Lektorat: Dr. Susanne Lauri
Herstellung: Daniel Berger
Umschlagabbildung: Jovanmandic, Getty Images
Umschlag: Claude Borer, Riehen
Satz: punktgenau GmbH, Bühl
Format: EPUB
3., überarbeitete Auflage 2021
© 2008/2015 Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern
© 2021 Hogrefe Verlag, Bern
(E-Book-ISBN_PDF 978-3-456-96063-0)
(E-Book-ISBN_EPUB 978-3-456-76063-6)
ISBN 978-3-456-86063-3
http://doi.org/10.1024/86063-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort
Einleitung
1 Systematische Ressourcenanalyse
1.1 Ressourcenpriming
1.2 Ressourcenorientierte Psychodiagnostik
1.3 Ressourcenorientierung als psychologisch-therapeutisches Prinzip im Therapieprozess
2 Ressourcenorientierte Gesprächsführung
2.1 Wahrnehmen und verstärken unmittelbar dargebotener Ressourcen und aktives Heranführen an brachliegende Ressourcen
2.2 Verbalisieren von Ressourcen und unmittelbares Erlebbarmachen von Ressourcen
2.3 Bewältigungsressourcen nutzen und motivationale Ressourcen integrieren
2.4 Persönliche Ressourcen verstärken und Ressourcen des sozialen Umfelds fördern
2.5 Auf problemunabhängige Ressourcen fokussieren und problemrelevante Ressourcen nutzen
2.6 Verbrauchbare Ressourcen optimieren und trainierbare Ressourcen fördern und aufrechterhalten
2.7 Perspektiven als Heuristiken zur Aufmerksamkeitslenkung
2.8 Ressourcenorientierung – das Pferd beim Schwanz aufzäumen
2.9 Unterschiede in der Selbst- und Fremdwahrnehmung
2.10 Problemsituation und therapeutische Strategien
2.11 Ressourcenaktivierung und Therapiephasen
2.12 Risiken und Nebenwirkungen ressourcenorientierter Vorgehensweisen
3 Ressourcenaktivierende Strukturinterventionen
3.1 Lebenspanorama
3.2 Geno- und Ecogramm unter Ressourcenperspektive
3.3 Ressourcen in sozialen Netzwerken vertiefen
3.4 Erste Veränderungen herausarbeiten
3.5 Nutzung und Aufrechterhaltung positiver Erwartungen an die Therapie
3.6 Wunderfragen und Zielvisionen
3.7 Personen als Ressourcenmodell
3.8 Bewältigungsressourcen aktivieren durch Rollentausch
3.9 Genuss planen
3.10 Ressourcenaktivierung mit imaginativen Verfahren
3.11 Ressourcentagebuch
3.12 Differenzieren positiver Gefühle und Stimmungen
3.13 Reframing- und Normalisierungssammlung
3.14 Wertschätzung der eigenen Charakterstärken
3.15 Ressourcenorientierter Umgang mit Beziehungsbrüchen
3.16 Förderung sozialer Unterstützung
4 Wirksamkeitshinweise des Wirkfaktors Ressourcenaktivierung
Anhang
Arbeitsblatt 1: Ressourcenpriming
Arbeitsblatt 2: Ressourcenorientierte Gesprächsführung – mögliche Fragen
Arbeitsblatt 3: Differenzieren positiver Gefühle und Stimmungen
Arbeitsblatt 4: Liste von 24 Charakterstärken
Die Autoren
|7|Geleitwort
Psychotherapie und Beratung stellt sich in den Dienst der gesellschaftlichen Aufgabe, Personen mit einem subjektiven Leidensdruck darin zu unterstützen, dass sie ihr Leiden reduzieren und das Wohlbefinden und psychosoziales Funktionieren verbessern können. Die Therapeuten und Berater helfen, jene Symptome zu lindern, die die Patienten bewogen haben, Hilfe aufzusuchen. Ein Schwerpunkt der therapeutischen Arbeit liegt deshalb in der Leidensbekämpfung. Aus medizinischer Perspektive liegt das primäre Ziel einer Behandlung oftmals in der Symptomreduktion. In gut ausgebildeten Gesundheitssystemen kann dieser Fokus zur Entwicklung und Verbreitung spezifischer Behandlungsrichtlinien für spezifische Störungen beitragen.
Es ist verlockend, Psychotherapie und Beratung in ein medizinisches Schema zu pressen. In weiten Teilen des Gesundheitssystems läuft die selektive Indikation über die Diagnosestellung (Welche Störung wird behandelt? Wie kann die Behandlung die Symptome reduzieren?). Wissenschaftliche Artikel konzentrieren sich oft auf die Behandlung bestimmter (psychischer) Störungen; Forschungsarbeiten, die sich nicht diesem Primat unterstellen, haben teilweise geringere Chancen, in renommierten Zeitschriften veröffentlicht zu werden. Weiter besteht ein – verständlicher – gesellschaftspolitischer Druck, Symptome möglichst schnell zu behandeln, da die meisten Finanzierungssysteme unter einem starken Kostendruck stehen – seien es Krankenkassen, Kliniken, Therapie- und Pflegeeinrichtungen, Universitäten oder auch Privatpersonen. Es ist deshalb verständlich, dass viele Behandler den Schwerpunkt ihrer Behandlungsplanung auf die Problemreduktion legen. Beispielsweise: Wo genau kann ich als Therapeutin oder Beraterin ansetzen, um die destruktiven Muster des Patienten zu durchbrechen?
Es wird viel Aufwand betrieben, sich ein detailliertes Bild über das Leiden der Patienten zu verschaffen. Diese Fokussierung kann dazu führen, dass wir die im|8|mense Zahl an Stärken, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die Patienten gleichzeitig in die Therapie mitbringen, allzu rasch vernachlässigen. Die Klienten haben möglicherweise Schwierigkeiten in einem bestimmten Lebensbereich (beispielsweise in der Partnerschaft); andere Bereiche müssen dabei nicht in Mitleidenschaft gezogen sein (berufliche Karriere usw.). Sogar den besonders stark belasteten Patienten gelingt es zumeist – oft trotz enormer Herausforderungen und furchtbarer Schicksalsschläge – ihr Leben zu organisieren. Meine Patienten beeindrucken mich immer wieder aufs Neue damit, mit welchem Mut und Durchhaltevermögen sie schwierige Zeiten überstehen.
Wir Therapeuten sind zwar oftmals dafür ausgebildet, auf die Ressourcen, Stärken und positiven Potenziale unserer Klienten zu achten. Es kommt mir jedoch manchmal vor, als ob sich die Mühlen des Gesundheitswesens schon fast etwas verschworen hätten, die vorhandenen Ressourcen unserer Klienten unter den Scheffel zu stellen. Die vermeintliche Dichotomie zwischen individuellen Problemen und Ressourcen ist ein Trugschluss. Sich in der Therapie auf die Stärken der Patienten zu besinnen, schließt die Probleme direkt zu benennen ebenso wenig aus wie umgekehrt. Ressourcenaktivierung und Problemaktualisierung schließen einander somit nicht aus. Im Gegenteil, sie ergänzen sich oftmals und werfen den Motor einer Veränderung erst richtig an.
Ressourcenaktivierung liefert pragmatische Strategien, die man in der Therapie einsetzen kann – oder vielleicht sogar muss –, damit die Patientinnen ihre Stärken erkennen und für die Problembearbeitung nutzen können. Einige therapeutische Gesprächsstrategien bestehen darin, Sätze so zu formulieren, dass sie gleichzeitig die vorhandenen Probleme wie auch die aktivierten Ressourcen mitberücksichtigen. Andere Strategien umfassen längere Übungen, um den Klienten darin zu unterstützen, seine bestehenden Bewältigungsressourcen besser zu erkennen und wertzuschätzen. Manche Fragen, Strategien und Übungen in diesem Band erscheinen einfach; oft aber erzielen gerade scheinbar „simple“ Veränderungen die beste Wirkung. Eine Rückbesinnung ist notwendig – weg von einer einseitigen Fokussierung auf Symptome und Leiden, hin zu einer sorgfältigen Wertschätzung von Stärken und Schwächen unserer Klientinnen.
Bruce E. Wampold, PhD, ABPP
University of Wisconsin – Madison
|9|Einleitung
Herr M. leidet seit Jahren unter starker Schüchternheit. Er bezeichnet seinen momentanen Zustand als hoffnungslos, und er hat es aufgegeben, an die eigenen Bewältigungsversuche zu glauben. Seine Schüchternheit und sein sozialer Rückzug haben dazu geführt, dass er fast seinen ganzen Freundeskreis verloren hat. Seit Jahren wünscht er sich eine Partnerin. Aber jedes Mal, wenn er eine interessante Frau sieht, erstarrt er und kann sich nicht überwinden, sie anzusprechen. In solchen Momenten wird er von seinen negativen Überzeugungen, der „langweiligste“ Mann zu sein, geradezu überrannt. Bis er die Gedanken wieder los ist, ist die Situation für eine Begegnung längst vergangen. Die Probleme haben im Leben von Herrn M. einen solchen Vorrang erlangt, dass er es vernachlässigt, an andere Dinge zu denken und etwas zu machen, das ihm Freude bereiten würde. In der letzten Zeit hat er sich durchringen können, professionelle Hilfe aufzusuchen.
Herr M. bemerkt, dass ihn der Therapeut nicht nur auf seine Probleme hin untersucht, sondern ihn auch in seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten verstehen will. So zeigte sich der Therapeut sehr interessiert, dass Herr M. Lehrer und bei seinen Schülerinnen und Schülern sehr beliebt ist. Herr M. war sich gar nicht mehr bewusst, wie vielseitig interessiert er ist. Herr M. gewinnt das Vertrauen, kompetente Hilfe zu bekommen, und die Hoffnung, dass seine Probleme lösbar sind. Mithilfe des Therapeuten versucht er, seine vorhandenen und brachliegenden Fertigkeiten und Fähigkeiten zu stärken und anknüpfend an seine Stärken und Wünsche neue Verhaltensweisen aufzubauen. Mit den ersten Fortschritten, die er mit seinem Therapeuten genau herausarbeitet, gewinnt er die Gewissheit, dass sein Zustand veränderbar ist, was ihn motiviert, sich noch mehr auf die Therapie einzulassen und an sich und seinen Problemen zu arbeiten.
|10|Alles das ist einfacher gesagt als getan! Das vorliegende Manual wendet sich primär an Psychotherapeuten, ist jedoch auch an weitere klinisch tätige Personen in Psychologie, Psychiatrie, Sozialer Arbeit und klinischer Supervision und Beratung gerichtet. Das Manual zeigt praktische Ansatzpunkte für Bereiche auf, in denen die individuellen Ressourcen einer Person unmittelbar diagnostiziert und in der Therapie eingesetzt werden. Es ist in Alltagssprache verfasst, sodass einzelne Teile direkt in die Therapie integriert werden können.
Klinisch tätige Personen finden sich zumeist in komplexen Situationen, in denen sie für das weitere Vorgehen unmittelbar Entscheide treffen müssen, und das oft ohne vollständiges Wissen über alle zur Verfügung stehenden Lösungswege. Um sich in diesem Möglichkeitsraum zurechtzufinden, werden wirkungsvolle Meta-Strategien oder Such- und Finde-Heuristiken verlangt, die es der beratenden Person ermöglichen, handlungsfähig zu bleiben. Eine zentrale Rolle spielt dabei unter anderem der Umgang mit den individuellen Stärken, den Ressourcen oder der Resilienz der Hilfe suchenden Person. Bei der Lösung von Problemen besteht die Gefahr, dass die Ressourcen einer Person durch die Fokussierung auf problematische Aspekte vorschnell aus dem Blickwinkel der Aufmerksamkeit verschwinden, und so die negative Sicht der hilfesuchenden Person übernommen wird und die Patienten im Netzwerk ihrer negativen Gedanken verharren (Grawe, 1998, 2004). Hilfe suchende Personen befinden sich zu Beginn einer Therapie oder Beratung oftmals in einem Zustand der Hoffnungslosigkeit und haben es aufgegeben, an ihre eigenen Problemlöse-Möglichkeiten zu glauben. Die Aufgabe des Hilfegebers ist es deshalb, die Selbstwirksamkeitserfahrungen der Person zu reaktivieren. Der Hilfegeber versucht, die vorhandenen Stärken und Fähigkeiten der Hilfe suchenden Person aufzugreifen und zu nutzen, was im Fachjargon „Kapitalisierung“ genannt wird.
Das vorliegende Manual zeigt konkrete Möglichkeiten auf, wie „Ressourcen“ einer Person in Therapie und Beratung verstärkt mitberücksichtigt und in bestehende Interventionskonzepte integriert werden können. Problematische Aspekte einer Person sollen dabei nicht ausgeblendet werden. Durch die verstärkte Ressourcenorientierung sollen im Gegenteil günstige Voraussetzungen geschaffen und Wege gefunden werden, die die unmittelbare Bearbeitung der Probleme erleichtern.
Im ersten Teil werden verschiedene Perspektiven aufgezeigt, die zur Aufmerksamkeitslenkung in Diagnostik und Gesprächsführung eingesetzt werden können und die individuellen Ressourcen einer Person aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Diese therapeutischen Perspektiven können im Rahmen bestehender |11|Manuale und Richtlinien eingesetzt werden und zielen auf das „Wie-Machen“ ab. Im zweiten Teil werden Verfahren vorgestellt, die einen geeigneten Rahmen bieten, die verschiedenen Perspektiven verstärkt anzuwenden. Die vorgestellten Interventionen haben keinen Vollständigkeitsanspruch. Sie sind so angelegt, dass sie einfach und unkompliziert angewandt werden können.
Mit zwei randomisiert kontrollierten Psychotherapie-Vergleichsstudien (Flückiger et al., 2016, 2018, 2020) sowie einer naturalistischen Vergleichsstudie (Flückiger & Grosse Holtforth, 2008) ist Ressourcenpriming sowohl ein äußerst pragmatisches als auch empirisch solide untersuchtes Vorbereitungstool für eine differenzierte stärkenorientierte Psychotherapie.
Literatur
Flückiger, C., Forrer, L., Schnider, B., Bättig, I., Bodenmann, G. & Zinbarg, R. E. (2016). A single-blinded, randomized clinical trial of how to implement an evidence-based cognitive-behavioural therapy for generalised anxiety disorder [IMPLEMENT] – Effects of three different strategies of implementation. EBioMedicine, 3, 163–171. Crossref
Flückiger, C. & Grosse Holtforth, M. (2008). Focusing the therapist‘s attention on the patient‘s strengths – A preliminary study to foster a mechanism of change in outpatient psychotherapy. Journal of Clinical Psychology, 64, 876–890. Crossref
Flückiger, C., Vîslă, A., Wolfer, C., Hilpert, P., Zinbarg, R. E., Lutz, W., grosse Holtforth, M. & Allemand, M. (2020). Exploring change in cognitive-behavioral therapy for generalized anxiety disorder – A two-arms, patient blinded, ABAB crossed-therapist randomized clinical implementation trial (IMPLEMENT 2.0). Manuscript submitted for publication.
Flückiger, C., Wolfer, C., Held, J., Allemand, M., Rubel, J., Hilpert, P., Zinbarg, R. E. & Vîslă, A. (2018). How to customize a bona fide psychotherapy for generalized anxiety disorder. A two-arms, patient blinded, ABAB crossed-therapist randomized clinical implementation trial design [IMPLEMENT]. BMC-Psychiatry. Crossref
Grawe, K. (1998). Psychologische Psychotherapie. Göttingen: Hogrefe.
Grawe, K. (2004). Neuropsychotherapie. Göttingen: Hogrefe.
Anmerkung: Im Text achten wir auf eine geschlechtsneutrale Sprache, indem wir entweder eine neutrale Ausdrucksweise oder nach Zufall die männliche und weibliche Form verwenden.
|13|1 Systematische Ressourcenanalyse
Die systematische Ressourcenanalyse dient der Ergänzung bestehender Fallkonzeptionen, wie sie in Therapie und Beratung eingesetzt werden (z. B. Situationsanalysen, Plananalysen und Beziehungsanalysen). Die hier beschriebene Ressourcenanalyse (Abb. 1-1) kann zu Schulungszwecken oder zum Selbststudium verwendet werden.
Abbildung 1-1: Ressourcenanalyse: Problembereiche und Ressourcenhotspots
|14|Seriöse Fallkonzeptionen basieren auf einer ebenso seriösen Eingangsdiagnostik, die strukturierte klinische Interviews, eine breite Abklärung und psychometrische Psychodiagnostik miteinschließen. Zentral erscheint dabei, dass die verwendeten Fragebogenbatterien der Klientel und dem Einsatzgebiet angepasst werden, ohne dabei die Breite der Abklärung zu vernachlässigen (für eine Übersicht deutschsprachiger, gut validierter Fragebogen für die klinische Praxis siehe z. B. Geue, Strauß & Brähler, 2016). Bei der Anwendung von Wohlbefindens- und Ressourcen-Fragebögen sei darauf hingewiesen, dass entsprechend der realen Lebenssituation auch in diesen Fragebögen die Defizite bzw. nicht vorhandene Ressourcen abgebildet werden, wie beispielsweise eine stark eingeschränkte Lebenszufriedenheit, mangelnde soziale Unterstützung oder verminderter Selbstwert. Grundsätzlich lässt sich ressourcenorientierte Diagnostik nicht auf spezifische Fragebögen beschränken. Im Gegenteil, eine ressourcenorientierte Perspektive kann in der gesamten Messbatterie eingenommen werden. Zentral für die Psychotherapie erscheint, dass Ressourcen unmittelbar prozessual während der Therapie angesprochen werden und so für den Patienten wie den Therapeuten explizit gemacht werden können. Therapeutinnen und Supervisorinnen können durch Verhaltensbeobachtung darin geschult werden, ressourcenorientierte Verhaltensweisen von Therapeuten und Patienten während der Therapiesitzungen u. a. mittels Videoaufzeichnungen systematisch zu erkennen.
Im professionellen wie im privaten Umfeld bilden wir fortlaufend Hypothesen über unser Gegenüber, wie es sich verhält, was es denkt, was ihm wichtig ist, was ihm unangenehm ist und wie es mit uns in Kontakt tritt. Unser Bild über die andere Person kann uns mehr oder weniger bewusst sein und wird durch unsere subjektive Einfärbung stärker oder schwächer beeinflusst. Dieses Bild kann problemzentriert sein, und die Ressourcen einer Person können vernachlässigt werden (Seligman, 2019). Parallel zur Diagnostik von „Problemen“ kann in den unterschiedlichsten Lebensbereichen auch nach „Ressourcen“ gesucht werden. Oftmals haben Personen Probleme in einzelnen Lebensbereichen und versuchen verzweifelt, diese zu lösen. Dabei vergessen sie jedoch häufig, in welchen Lebensbereichen sie Fähigkeiten und Fertigkeiten mitbringen, die sie als Mittel zum Erreichen ihrer Ziele einsetzen können. Abbildung 1-1 gibt einen Überblick über verschiedene Bereiche des psychischen Funktionierens, in denen Fähigkeiten und Fertigkeiten, aber auch Probleme und Schwierigkeiten vorhanden sein können. Bereiche mit besonders hilfreichen Fähigkeiten und Fertigkeiten werden „Ressourcenhotspots“ genannt. Die einzelnen Bereiche können direkt erfragt oder mittels professioneller Psychodiagnostik systematisch erhoben werden. Auf eine Empfehlung einer Fragebogenbatterie wird hier verzichtet, da unseres Erachtens |15|zumeist auch in den bewährten Fragebögen nach relevanten Ressourcen gesucht und eine sinnvolle Zusammenstellung je nach institutionellem Hintergrund unterschieden werden kann. Das Einholen einer Fremdeinschätzung durch eine nahe Vertrauensperson erweist sich als äußerst lohnenswert, da sich die Patientin ihrer eigenen Ressourcen oftmals wenig bewusst ist.





























