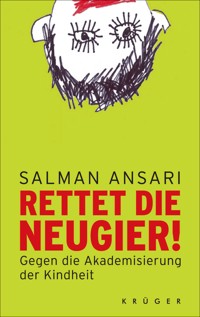
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Salman Ansari streitet für kindliche Freiräume und gegen die Bildungshysterie Physikkästen für Zweijährige? Chinesisch im Kindergarten? Salman Ansari, promovierter Naturwissenschaftler und Lernpädagoge, fordert: Weg mit dem Bildungsballast! Dieses Wissen ist nicht nur unnütz und teure Zeitverschwendung , sondern auch extrem gefährlich für Kinder. Sie scheitern an den viel zu komplexen Aufgaben, werden frustriert oder erwerben naive Vorstellungen, die später nur schwer zu korrigieren sind. Für die Kinder ist nicht die Anhäufung von Wissen wichtig, sondern die Fähigkeit, eigenständig und kreativ zu denken! Ansari begibt sich auf Augenhöhe mit den Kindern, geht konsequent von ihrem Denken aus und zeigt, wie sie Schritt für Schritt in ihrem Erkenntnisprozess begleitet werden können. Damit aus klugen Kindern interessierte und aufgeweckte Schüler werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Salman Ansari
Rettet die Neugier!
Gegen die Akademisierung der Kindheit
Impressum
Covergestaltung: buxdesign, München
Illustration: Carla Nagel
Erschienen bei FISCHER_Ebooks
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2013
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402543-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Dieses Buch widme ich [...]
Das Denken der Kinder
Erstes Kapitel Der Wunsch zu lernen ist der Wunsch nach Bewältigung der Wirklichkeit
Kinder sind die wahren Welterforscher
An das Wissen der Kinder anknüpfen
Was ist entdeckendes Lernen?
Zweites Kapitel Verhinderung und Unterstützung von Erfahrungsmöglichkeiten
Drittes Kapitel Wie können Kinder zur Kreativität ermuntert werden?
Der kreative Prozess
Viertes Kapitel Homo ludens oder die Bedeutung des Spiels
Fünftes Kapitel Naturerfahrung als Welterfahrung oder Wie viel Natur braucht ein Kind?
Sechstes Kapitel Zusammenarbeit mit Kindern – Die Forscherdialoge
Erster Forscherdialog: »Alle Vögel sind schon da« Frühling
Zweiter Forscherdialog: Wasserschöpfen
Dritter Forscherdialog: Sandschöpfen
Vierter Forscherdialog: Kinder als Entdecker und Gestalter
Fünfter Forscherdialog: Kinder, seid stark wie ein Baum! Sommer
Sechster Forscherdialog: Warum ist im Sandkasten Sand und keine Gartenerde?
Siebter Forscherdialog: »Liebe Sonne scheine wieder!«
Achter Forscherdialog: Bald wird es Blätter regnen Herbst
Neunter Forscherdialog: Kann Schnee warm werden? Winter
Siebtes Kapitel Wechsel von naiven Vorstellungen zu neuen Erkenntnissen
Erwerb übertragbarer Kompetenzen
Bildung von eigenständigen Konzepten
Selbständige Vernetzung von erworbenem Wissen
Achtes Kapitel Lernen ohne Anweisungen
Wie durch Erkennen von Fehlern neue Erkenntnisse gewonnen werden können
Neuntes Kapitel Naturerfahrung ist nicht Naturwissenschaft
Zehntes Kapitel Was heißt Frühförderung und naturwissenschaftliche Bildung?
Dank
Bildnachweis
Literaturempfehlungen
Dieses Buch widme ich allen Kindern und Erzieherinnen, die mich bei der Realisierung meiner unterschiedlichen Projekte begeistert unterstützt und mir tatkräftig geholfen haben.
Das Denken der Kinder
Nie zuvor hat man sich über die Frühförderung von Vorschulkindern so viele Gedanken gemacht wie heute: Chemiekästen für Kleinkinder, Chinesisch in Kitas, Kinder-Unis für Grundschüler, um nur einige Beispiele zu nennen. Kaum ein Elternpaar (zumindest nicht im bürgerlichen Milieu), das seinen Nachwuchs nicht an irgendeinem Zeitpunkt in den frühen Jahren für hochbegabt und daher besonders förderungsbedürftig hielte. Eine Generation von innovativen Nachwuchsforschern wächst da heran; die Zukunft und der Wohlstand unserer Gesellschaft müssten gesichert sein.
Doch schon in der Schule scheint die Begeisterung für die unterschiedlichsten Naturphänomene zu erlöschen. Aus wissensbegierigen, aufgeschlossenen Kindern werden desinteressierte, passive Schüler. An manchen Gymnasien kommen keine Leistungskurse in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) mehr zustande. An den Universitäten stagniert das Interesse an diesen Fächern. Mittlerweile fehlen deutschen Unternehmen um die 200000 Mathematiker, Naturwissenschaftler und Techniker. Der steigende Fachkräftemangel bedroht das gesamtwirtschaftliche Wachstum wie nie zuvor. Irgendetwas scheint schiefzulaufen. Die Kinder werden anscheinend nicht mitgenommen bei den ehrgeizigen Frühförderungsprogrammen und Lehrplänen.
Einblick in dieses Phänomen können uns die modernen kognitiven Wissenschaften und die Hirnforschung geben, die sich seit Jahren damit auseinandersetzen, wie die innere Welt von Kindern aussieht, wie es ist, ein Baby oder ein Kleinkind zu sein. Man weiß heute, dass in keiner Phase des Lebens die Fähigkeit zur ungeteilten, nicht zielgerichteten, entdeckenden Aufmerksamkeit so ausgeprägt ist wie in den frühen Jahren, in denen das Kleinkind seine Umwelt schrittweise zu erkunden beginnt. Das erklärt auch, warum man ein Vorschulkind für praktisch alles begeistern kann. Es geht ihm allein um das Verstehen und Begreifen seiner Wirklichkeit, die es sich ja erst erobern muss. Kleinkinder können nicht auswählen, welche Lernarten und Erfahrungsmöglichkeiten ihnen am ehesten dabei helfen, sich wertvolle Kompetenzen anzueignen. Ihre Entwicklung ist abhängig von den Einstellungen, Überzeugungen und Entscheidungen der Erwachsenen, die für sie verantwortlich sind. Damit sich die ungeteilte kindliche Lernbereitschaft und das Vorstellungsvermögen ungehemmt fortentwickeln können, ist es ausschlaggebend, welche alltäglichen Lernumgebungen und Welterfahrungen den Kindern zugänglich sind, und welches Maß an Zuwendung und Verständnis der Erwachsenen ihnen dabei zuteil wird.
Es ist also von großer Bedeutung zu lernen, wie Kinder denken, bevor man – sozusagen als Wissenschaftler – mit den Kindern über einen Sachverhalt spricht und Zusammenhänge erklärt. Aus einer Erwachsenenperspektive konzipierte Projekte schränken die geistige Beweglichkeit unserer Kinder ein und sind deshalb oft nicht nur teure Zeitverschwendung, sondern auch höchst fragwürdig: Es werden dabei sinnstiftende Alltagserfahrungen zugunsten von akademischen Kategorien verdrängt. Also von Lernstrategien, die nur die als wissenschaftlich korrekt geltende Interpretation der Natur gelten lassen, anstatt Lernkonzepte zu entwickeln und anzuwenden, die Kindern und Jugendlichen zugänglich sind und ihnen dabei helfen, selber den Weg zu den Naturgesetzlichkeiten zu beschreiten. Denn Erklärungen erweisen sich stets als Wissen aus zweiter Hand, zumal die Kinder keine Möglichkeit haben, reflektierend über sie nachzudenken, weil ihnen ein Rückgriff auf die Widersprüche ihres Weltverständnisses nicht möglich ist.
Wenn man Kinder ernst nehmen und verstehen will, ist es also unabdingbar und beglückend, die kindlichen Denkmuster nachempfinden zu lernen. Erst dann entdeckt man ihre Logik und ihr Weltbild. Eine solche Wissensvermittlung bedarf des Dialogs auf Augenhöhe, in dem alle Beteiligten wissen möchten, wie die Anderen über ein bestimmtes Phänomen denken. Erst im Dialog kommen unterschiedliche Vorstellungen, Überzeugungen und Bilder zum Ausdruck. Die Abwesenheit von solchen Dialogen bei Lehrprozessen in Kitas und Schulen könnte ein Grund dafür sein, weshalb viele Kinder und Jugendliche in diversen Bildungseinrichtungen scheitern. Anders ausgedrückt: Wenn die Lehrenden versuchen, ihre eigenen Vorstellungen und Schemata auf die Kinder zu übertragen, dann kann eigenständiges Lernen nicht stattfinden. Daher ist es so wichtig, erst die kindlichen Vorstellungen über einen Sachverhalt zu erkunden. Etwas in ein vorhandenes Schema hineinzupressen, scheitert, weil die Passung nicht da ist. Der Entwicklungspsychologe Jean Piaget formuliert diesen Zusammenhang wie folgt:
Das Lernen muss zum Ziel haben, kreatives Denken herauszufordern. Ein Denken also, das darauf gerichtet ist, selber Antworten zu finden und kritisch gegenüber Antworten zu sein, die von Anderen angeboten werden.
Im Rahmen dieses Buches soll über Aspekte einer falsch verstandenen Frühförderung nachgedacht und vor dem Hintergrund neuerer wissenschaftlicher Erkenntnisse beleuchtet werden, warum derartige Programme für die geistige Entwicklung von Kindern sogar hinderlich sein könnten. Mit Hilfe zahlreicher Beispiele wird gezeigt, dass es Alternativen gibt, die den Kindern dabei helfen können, sich selber und ihre Welt zu entdecken und besser zu verstehen. Alle Beispiele sind für Eltern und für Erwachsene, die mit Kindern zusammen arbeiten, auch ohne naturwissenschaftliche Bildung leicht umsetzbar und hoffentlich geeignet, sich gemeinsam mit den Kindern die Welt neu anzueignen.
Kinder sind die wahren Welterforscher
Kinder haben einen geradezu unbändigen Drang selbständig zu lernen. Sie sind in gewisser Weise Forscher und Erfinder. Denn ähnlich wie diese sind sie in der Lage, mit ungebrochener Unbefangenheit, Begeisterung und Ausdauer Dinge zu lernen und zu erforschen. Sehr junge Kinder besitzen bereits die Fähigkeit kausal zu denken. Sie agieren wie Erfinder, bilden Hypothesen und Theorien. Fähigkeiten, die bei vielen Schülern später oft vermisst werden. Während der Schulzeit scheinen diese bereits vorhandenen Kompetenzen verschüttet zu werden. Wie dies verhindert werden kann und wie die bereits vorhandenen Handlungs- und Orientierungsmöglichkeiten der Kinder entfaltet werden können, das sind die drängenden Fragen, die sich uns stellen. Da Kinder nicht selber entscheiden können, welche Aspekte der Welterfahrung ihre geistigen Fähigkeiten potentiell fördern, müssen Eltern und andere Bezugspersonen eine Lernatmosphäre schaffen, die Kinder dazu ermutigt, ihre Umwelt ungestört zu erforschen. Andererseits muss die Gesellschaft eine Antwort darauf finden, weshalb die meisten Kinder hochmotiviert, mit einem unbändigen Lerneifer in die Schule kommen, aber bereits am Ende der Grundschule, manchmal sogar früher, ihr ursprüngliches Bedürfnis, sich neue Kompetenzen anzueignen, erlahmt und stattdessen ein Gefühl von Enttäuschung und Versagen das Empfinden der Kinder bestimmt. Ein solches Empfinden können Kinder nicht vortäuschen und sich einbilden, sondern es hat tiefer reichende Gründe. Weil Kinder nicht selber die Gründe benennen können, müssen die verantwortlichen Erwachsenen genauer nach den Ursachen forschen. Die Kognitionswissenschaften, die Entwicklungspsychologie und die Hirnforschung haben bedeutende Erkenntnisse über die Prozesse des Lehrens und Lernens gewonnen. Diese Erkenntnisse sind hilfreich, um die Schwachpunkte im Bildungssystem zu erkennen. Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse möchte ich auf folgende Zusammenhänge hinweisen:
An das Wissen der Kinder anknüpfen
Bereits das Kindergartenkind hat seine ganz eigene Art und Weise mit Problemen umzugehen und besitzt eigenständige Vorstellungen und Konzepte, um die Wirklichkeit zu verstehen. So können schon zwei- bis dreijährige Kinder kleine Geschichten erzählen und die Handlung einer Erzählung mit verfolgen. Sie können sich besinnen, Fragen stellen, Urteile bilden, argumentieren, streiten, eine Vielzahl von Objekten klassifizieren und schlussfolgern. Sie besitzen somit alle Fähigkeiten, die nötig sind, um weiteres Wissen zu erwerben.
Was ein Kind zu irgendeiner Sache meint und welche Vorstellungen es bereits darüber besitzt, werden wir jedoch nur dann erkennen können, wenn wir uns bewusst und gezielt darum bemühen, seine Meinung zu befragen und seine sprachlichen Äußerungen zu verstehen. Wir müssen versuchen, uns dem Blickwinkel der Kinder anzunähern.
Ein möglicher Weg, das Weltwissen der Kinder auszuloten, und ein zutreffendes Bild von ihrem Weltverständnis zu bekommen, besteht darin, Schritt für Schritt zu lernen, die Fragen, Beschreibungen und Bemerkungen der Kinder in einem Zusammenhang zu begreifen, der auf den Erfahrungsmöglichkeiten der Kinder beruht. Ein Beispiel: Beim Betrachten von Bildern, die Schneckenarten darstellen, ruft ein Kind aus: »Schau diese Schnecke hat ein Haus, diese nicht!« Die Unterschiedlichkeit beschäftigt das Kind. Hier können wir durch Fragen weiterhelfen, wie z.B. »Vielleicht braucht diese das Haus und die andere nicht?« »Vielleicht muss sich manchmal die eine in ihr Haus verkriechen und sich verstecken. Aber warum hat die andere diese Möglichkeit nicht?« »Gibt es noch andere Tiere, die ein Haus mit sich herumtragen?«
Es geht immer darum, Formen der Kommunikation und des praktischen Handelns zu entwickeln, die hilfreich sein könnten, Kindern ihre Welt besser verständlich zu machen.
Dies setzt jedoch voraus, dass die Erwachsenen Klarheit über ihre Vorgehensweisen besitzen; d.h., das Lernziel und die Auswahl der Mittel bzw. Strategien müssen zum Erreichen des Ziels genau überlegt sein.
Von Bedeutung dabei ist, dass Erwachsene ihre eigenen Erfahrungen in die Zusammenarbeit mit den Kindern einbringen, statt eines Fachwissens, das sie möglicherweise selber nicht ganz verstanden haben. Ausgangspunkt kann eine Beobachtung wie die der Schnecke sein, eine Geschichte oder eine Frage, die die Kinder ermuntert, eigene Fragen zu stellen und Antworten zu finden, wobei sie aber immer das Gefühl haben müssen, selbständig und nach ihrem eigenen individuellen Tempo handeln zu können. Zeit geben heißt, Kindern dabei helfen, sich neue Kompetenzen anzueignen.
Auch im Schulunterricht wird versucht, die eigene Erfahrung der Kinder in Zusammenhang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu bringen. Allerdings ist ein solcher Ansatz wenig erfolgreich, wenn ihm eine Voraussetzung fehlt: nämlich die Kenntnis darüber, welche Vorstellungen die Kinder bereits über den jeweiligen Sachverhalt besitzen, der gelernt werden soll.
Ein wirkliches Verstehen der Naturerscheinungen kann nur durch eine Ablösung von falschen und naiven Vorstellungen zugunsten von wissenschaftlich gesicherten Erkenntnissen erreicht werden. Nur durch das Herstellen von Lernsituationen, in denen das eigene Wissen selbständig korrigiert werden kann, wird das Verstehen von Zusammenhängen und die Veränderung des Wirklichkeitsbildes erreicht. Gelingt das nicht, bleiben naive Vorstellungen bis ins Erwachsenenalter haften. Im siebten Kapitel behandle ich diesen Aspekt ausführlich.
Was ist entdeckendes Lernen?
Das Wort »entdecken« könnte folgende Bedeutungen enthalten: herausfinden, aufspüren, ermitteln, herausbekommen usw. Wir können allerdings nur dann etwas herausfinden oder aufspüren, wenn es uns gelingt, auf der Grundlage unseres vorhandenen Wissens und unserer Erfahrung eine Sache gezielt zu erforschen. Dazu werden wir nur dann bereit sein, wenn sie uns bedrängt oder wenn ein Ereignis, das in einem von uns nachvollziehbaren Kontext steht, uns rätselhaft erscheint und zu Fragen anregt. Jedenfalls werden wir nicht als Forschende agieren können, wenn uns die Fragestellung künstlich aufgedrängt oder uns in einer Art und Weise präsentiert wird, die sich unseren Erfahrungsmöglichkeiten, unseren Interpretationsmöglichkeiten entzieht.
Auch im Kindergarten bleiben naturwissenschaftlich orientierte Tätigkeiten oft losgelöst im Raum stehen, ohne dass Zusammenhänge mit Alltagsbeobachtungen der Kinder hergestellt werden. Die Kinder erwerben somit ein Wissen, das sie nicht auf die erlebte Wirklichkeit übertragen können.
Ein Beispiel:
Um zu beweisen, dass Luft Masse hat, wird folgendes Experiment für Kindergartenkinder vorgeschlagen:
Ein leeres Glas, in dem sich ein Stück Papier befindet, wird umgekehrt in eine Wasserwanne getaucht. Das Wasser steigt nicht hoch und das Papier bleibt trocken.
Selbst Grundschulkinder interpretieren diesen Versuch so: »Die Luft im Glas ist so stark, dass sie das Wasser nicht hochsteigen lässt.«
Tatsächlich herrscht jedoch im Glas der gleiche Druck wie außerhalb des Glases, also der jeweilige Luftdruck. Diesen Sachverhalt können Grundschulkinder aber noch nicht verstehen, weil sie noch kein Konzept für den atmosphärischen Druck haben. Dabei soll dieser Versuch den Kindern verdeutlichen, dass Luft tatsächlich eine Substanz bzw. Masse besitzt. Dies wissen die Kinder allerdings implizit ohnehin und werden durch diesen Versuch nur verunsichert bzw. zur Bildung von Fehlvorstellungen animiert.





























