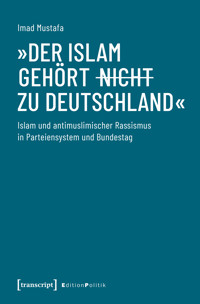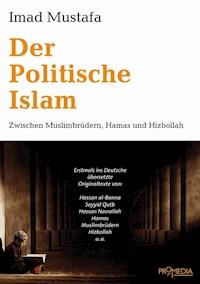0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: transcript Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Soziale Bewegung und Protest
- Sprache: Deutsch
»Das Volk will den Sturz des Regimes!« Unvergessen bleibt der Ruf der Menschen in Ägypten nach Freiheit und Selbstbestimmung, der im Jahr 2011 durch die Straßen Kairos hallte. Auf theoretisch innovative und interdisziplinäre Weise kombiniert Imad Mustafa strukturelle, netzwerktheoretische, konstruktivistische und kommunikative Aspekte des Transitionsprozesses zur umfassenden Untersuchung der revolutionären Mobilisierung säkularer Netzwerke sowie der konfliktiven Auseinandersetzungen mit dem Regime und der Muslimbruderschaft. So zeigt er auf, dass Demokratisierung ein widersprüchlicher und schwieriger Prozess ist, an dessen Ende die Re-Autoritarisierung der Politik stehen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 616
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Die freie Verfügbarkeit der E-Book-Ausgabe dieser Publikation wurde ermöglicht durch den Fachinformationsdienst Politikwissenschaft POLLUX
und einem Netzwerk wissenschaftlicher Bibliotheken zur Förderung von Open Access in den Sozialund Geisteswissenschaften (transcript, Politikwissenschaft 2021)
Die Publikation beachtet die Qualitätsstandards für die Open-Access-Publikation von Büchern (Nationaler Open-Access-Kontaktpunkt et al. 2018), Phase 1 https://oa2020-de.org/blog/2018/07/31/empfehlungen_qualitätsstandards_oabücher/
Hauptsponsor: Staats- und Universitätsbibliothek Bremen (POLLUX – Informationsdienst Politikwissenschaft)Vollsponsoren: Universitätsbibliothek Bayreuth | Universitätsbibliothek der Humboldt- Universität zu Berlin | Freie Universität Berlin - Universitätsbibliothek | Staatsbibliothek zu Berlin | Universitätsbibliothek Bielefeld | Universitätsbibliothek der Ruhr-Universität Bochum (RUB) | Universitäts- und Landesbibliothek Bonn | Vorarlberger Landesbibliothek | Universitätsbibliothek der Technischen Universität Chemnitz | Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt | Sächsische Landesbibliothek Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) | Universitätsbibliothek Duisburg-Essen | Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf | Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg | Universitätsbibliothek Frankfurt/M. | Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen | Universitätsbibliothek Greifswald | Universitätsbibliothek der FernUniversität in Hagen | Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky, Hamburg | TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek | Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - Niedersächsische Landesbibliothek | Universitätsbibliothek Heidelberg | Universitätsbibliothek Kassel | Universitätsbibliothek Kiel (CAU) | Universitätsbibliothek Koblenz · Landau | Universitäts- und Stadtbibliothek Köln | Universitätsbibliothek Leipzig | Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern | Universitätsbibliothek Otto-von-Guericke- Universität Magdeburg | Universitätsbibliothek Marburg | Max Planck Digital Library (MPDL) | Universitäts- und Landesbibliothek Münster | Universitätsbibliothek der Carl von Ossietzky-Universität, Oldenburg | Universitätsbibliothek Osnabrück | Universitätsbibliothek Passau | Universitätsbibliothek St. Gallen | Universitätsbibliothek Vechta | Universitätsbibliothek Wien | Universitätsbibliothek Wuppertal | Zentralbibliothek ZürichSponsoring Light: Bundesministerium der Verteidigung | Landesbibliothek OldenburgMikrosponsoring: Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) - Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit | Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, Mainz
Imad Mustafa arbeitet am Seminar für Medien- und Kommunikationswissenschaft der Universität Erfurt. Er promovierte dort am Lehrstuhl für Vergleichende Analyse von Mediensystemen und Kommunikationskulturen. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Demokratisierungs- und Bewegungsforschung, Nahostforschung, Rechtspopulismus, Islam in Deutschland und antimuslimischem Rassismus.
Imad Mustafa
Revolution und defekte Transformation in Ägypten
Säkulare Parteien und soziale Bewegungen im »Arabischen Frühling«
2020 an der Philosophischen Fakultät der Universität Erfurt angenommene Dissertation
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz (BY). Diese Lizenz erlaubt unter Voraussetzung der Namensnennung des Urhebers die Bearbeitung, Vervielfältigung und Verbreitung des Materials in jedem Format oder Medium für beliebige Zwecke, auch kommerziell. (Lizenztext: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de)
Die Bedingungen der Creative-Commons-Lizenz gelten nur für Originalmaterial. Die Wiederverwendung von Material aus anderen Quellen (gekennzeichnet mit Quellenangabe) wie z.B. Schaubilder, Abbildungen, Fotos und Textauszüge erfordert ggf. weitere Nutzungsgenehmigungen durch den jeweiligen Rechteinhaber.
Erschienen 2021 im transcript Verlag, Bielefeld © Imad Mustafa
Covergestaltung: Maria Arndt, Bielefeld
Lektorat: Safyah Hassan-Yavuz, Tuǧba Önder
Print-ISBN 978-3-8376-5754-8
PDF-ISBN 978-3-8394-5754-2
EPUB-ISBN 978-3-7328-5754-8
https://doi.org/10.14361/9783839457542
Buchreihen-ISSN: 2701-0473
Buchreihen-eISSN: 2703-1667
Besuchen Sie uns im Internet: https://www.transcript-verlag.de
Unsere aktuelle Vorschau finden Sie unter www.transcript-verlag.de/vorschau-download
Inhalt
Editorische Notiz
Vorwort und Danksagung
1.Einleitung
1.1Erkenntnisinteresse und wissenschaftliche Problematisierung
1.2Wissenschaftstheoretische Einbettung der Arbeit und Methodologie
1.3Aufbau der Arbeit
1.4Forschungsstand
I. Transition I: Regimewandel und Contention
2.Neopatrimonialer Autoritarismus und Regimewandel
2.1Strukturmerkmale des Neopatrimonialismus
2.2Das Militär im neopatrimonialen System: Ruling but not Governing
2.3Transition autoritärer Regime
3.Politische Herrschaft und soziale Organisation – Resultat distributiver Gruppenkonflikte oder regulativ hergestellte Systemstabilität?
3.1Strategische und konfliktfähige Gruppen
3.2Politische Konflikte als dynamische soziale Prozesse
II. Transition II: Von der Struktur zur Handlung. Kollektive Identitäten, Netzwerke, Parteien?
4.Deutungsrahmen und kollektive Identitäten
4.1Die Mobilisierung von Konsens, kollektive Identitäten und die Überwindung der Angst
4.2Verstärkung und Ausbreitung von Deutungsrahmen
5.Mobilisierung und Organisation von Netzwerken
5.1Netzwerkstrukturen: Sozio-kulturelle Manifestation sozialer Beziehungen
5.2Soziale Transaktionen und soziales Umfeld: Nukleus von Netzwerken
5.3Die Konstruktion von Identitäten in Netzwerken
5.4Positionen und soziale Beziehungen in Netzwerken
6.Netzwerkorganisationen als Metastruktur heterarchischer positionaler Ordnungssysteme
6.1Umwelterwartungen, schwache Konsolidierung und Interaktion
6.2Parteien und Parteiensystem in Ägyptens Transitionsprozess
7.Zusammenfassung und Synthese der Theorie
7.1Zusammenfassung
7.2Synthese: System, Akteur und Beziehungsdynamik – Relationale Transition
III. Datenerhebung und Datenauswertung
8.Datenerhebung: Interviews, schriftliche Quellen, Medienerzeugnisse
8.1Expert*inneninterviews
8.2Entwicklung und Funktion des semi-strukturierten Leitfadens
8.3Durchführung der Interviews
9.Datenauswertung: Strukturierung, dichte Beschreibung und freie Interpretation
9.1Strukturierung und Kontextualisierung
9.2Regelgeleitetheit, Kategorien und Vorgehen bei der Analyse
IV. Umkämpfte Transition – Mobilisierung, Organisierung, Konflikt
10.Mobilisierung und Konstituierung ägyptischer Parteien
10.1Die Mobilisierung zivilgesellschaftlicher Akteur*innen
10.2Framing und politische Legitimität
10.3Gesellschaftlich-politische Bruchlinien?
10.4Kollektive politische Identitäten und ideologische Kohärenz
10.5Zwischenfazit
11.Ägyptens neue Parteien: Konsolidierte Organisationen oder fluide Hierarchien?
11.1Die Vernetzung in Bewegungen
11.2Das Problem multipler Gruppenzugehörigkeiten: Konsens, Loyalität und Verbindlichkeit
11.3Äußere Merkmale einer Konsolidierung von Parteien
11.4Intraorganisationale Demokratie
11.5Konflikte und Brüche
11.6Organisieren, Organisiertheit und Organisat säkularer Parteien
11.7Zwischenfazit
12.Parteikonstellationen und Beziehungsdynamiken: Strategische Pakte oder radikale Polarisierung?
12.1Die Bündnisfähigkeit säkularer Parteien
12.2Zwischenfazit
13.Regime und Opposition: Konflikt, Kompromiss, Reform?
13.1Säkulare Parteien und die Muslimbruderschaft: »Immer gegen den Staat, mit den Islamisten manchmal«?
13.2Das Ringen zwischen SCAF und Muslimbruderschaft: Die kontextuelle Systemumwelt säkularer Parteien
13.3Politischer Wandel und das Ringen um Reformen
13.4Konterrevolution und das Ende des Transitionsprozesses I: Die nationale Rettungsfront
13.5Konterrevolution und das Ende des Transitionsprozesses II: Tamarrud
13.6Zwischenfazit
14.Schluss
14.1Fazit
14.2Ausblick
Quellen- und Literaturverzeichnis
Primärquellen
Wissenschaftliche Aufsätze, Monographien, Sammelbände
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Editorische Notiz
Die vorliegende Arbeit bedient sich bei der Transliteration arabischer Eigennamen und Worte eines stark vereinfachten Systems. Grundsätzlich wurde darauf verzichtet, Transliterationszeichen einzufügen. Maßgeblich für diese Entscheidung war die Absicht, eine höhere Lesbarkeit zu erreichen. Bekannte Namen oder Namen prominenter Politiker*innen, für die es übliche Schreibweisen im Deutschen gibt, wie Mubarak und Mursi, wurden übernommen. Der determinierte arabische Artikel wird in der Regel mit al- wiedergegeben. Abweichungen von diesem Vorgehen (el)kommen dann vor, wenn ein Zitat aus einer englischsprachigen Publikation vorliegt, wo el- die übliche Schreibweise ist oder die Person sich in latinisierter Schreibweise selbst so schreibt.
Mancher arabische Begriff, wie Tamarrud oder Dustur-Partei, der auch in der Forschung oder den Medien nicht übersetzt wird und deshalb bekannt ist, wurde auch hier nicht übersetzt. Im Übrigen folgt die Studie den Regeln zur wissenschaftlichen Umschrift, die vom Seminar für Orientalistik der Universität Kiel ausgearbeitet wurden (Seminar für Orientalistik – Christian-Albrechts-Universität zu Kiel o.J.).
Vorwort und Danksagung
»Das ist nicht Politik, hier geht es um unsere Leben, die Leben unserer Kinder! Es geht um unsere Zukunft!« Dieser wütende Ausruf stammt von einem Kairoer Taxifahrer im Sommer 2016, der es vehement ablehnte, die politischen Ereignisse der letzten Jahre in seinem Land als abstraktes Phänomen, als bloße Politik zu betrachten, die nur Eliten, aber nicht ihn angeht. Ganz im Gegenteil war er sehr involviert und politisiert, kommentierte die Nachrichten im Radio und die Plakate, die das Regime anlässlich des dritten Jahrestages der Machtübernahme von Abdel Fattah as-Sisi aufgehängt hatte. Die Stadt war geradezu gepflastert mit der Propaganda des Regimes, um Unterstützung für seinen vorgeblichen war on terror gegen innere Staatsfeinde zu generieren. Der Slogan Tahya Masr, also es lebe Ägypten, der überall zu lesen war und mit dem das Regime die Menschen hinter sich sammelte, konnte nur notdürftig die ideelle Nähe des neuen Regimes zum populistischen und menschenfeindlichen America First eines Donald Trump verschleiern. Bis heute hat sich daran wenig geändert. Doch ob diese Strategie der nationalen Sammlung angesichts der immensen innenpolitischen und ökonomischen Probleme langfristig aufgehen wird, ist mit Fug und Recht zu bezweifeln. Die durch den revolutionären Prozess angestoßene Subjektivierung der Menschen nach Jahrzehnten des gandenlosen Autoritarismus ist aus den Körpern der Menschen nicht mehr auszuradieren. Denn obwohl der Autoritarismus wieder fest im Sattel sitzt, so möchte ich doch betonen: Es ist noch nicht vorbei!
Dieses Buch will die Geschichte, die zum Putsch und der Rücknahme der während der Revolution durchgesetzten Freiheiten führte, aus einer alternativen Perspektive nachzeichnen und analysieren. Nicht Islam und Muslimbruderschaft stehen im Zentrum, sondern soziale Bewegungen und säkulare Parteien, die Zusammenschlüsse der Menschen, die im Januar 2011 ihre Angst überwanden und sich auf die Straßen Ägyptens trauten, um ihre Ablehnung eines sklerotischen und korrupten Regimes kollektiv kundzutun. Die vorliegende Studie stellt den Versuch dar, den genuin politischen Moment der Revolution einzufangen und seine Entwicklung bis hin zur Konterrevolution im Sommer 2013 zu rekonstruieren. Es bleibt die Hoffnung, dass der vorliegende Beitrag zu diesem Forschungsfeld breite Leser*innenschaft findet und weitere Studien inspiriert.
Doch ohne die Unterstützung und Anteilnahme vieler Menschen und Institutionen wäre dieses Forschungsprojekt nicht möglich gewesen. Hier muss als erstes Tunay Önder genannt werden, meine langjährige Kollegin und intellektuelle Wegbegleiterin, die erst den Anstoß dazu gab, dieses große Unterfangen anzugehen. Worte können kaum zum Ausdruck bringen, wie viel ich ihr schulde und danke.
Prof. Dr. Kai Hafez von der Universität Erfurt hat sich von Beginn an als fördernder Mentor meiner Arbeit erwiesen. Sein ideeller und fachlicher Beitrag, seine kritische Begleitung und seine stete Ermunterung insbesondere in schwierigen Phasen gehen sicherlich über das sonst übliche Maß hinaus. Ihm sei an dieser Stelle sehr herzlich gedankt.
Auch Prof.*in Dr. Carola Richter von der Freien Universität zu Berlin will ich herzlich für die Übernahme des Zweitgutachtens dieser Arbeit danken. Obwohl sie die Arbeit nur in der Endphase betreut hat, verdanke ich auch ihr wertvolle Hinweise, die der Arbeit den letzten Schliff gegeben haben.
Die Doktorand*innenkolloquien in Erfurt waren von einem respektvollen Umgang und einer stets sehr solidarischen und freundschaftlichen Atmosphäre geprägt, in der man ohne Scheu seine Ideen zur Diskussion stellen konnte. Hier möchte ich insbesondere Sabrina Schmidt, Anne Grüne, Nadia Leihs, Patricia Carolina Saucedo Añez, Regina Cazzamatta, Rouba el-Helou-Sensenig, Lino Marius Klevesath, Salih Günay, Bilal Rana und Subekti Priyadharma hervorheben. Euch allen sei herzlich gedankt!
Eine Dissertation zu verfassen, die sich auf eine komplizierte, zum Teil gefährliche Felderschließung wie im vorliegenden Fall stützt, wäre ohne die Hilfe zahlreicher Menschen vor Ort nicht möglich gewesen. Den vielen Menschen, die mir in Kairo auf vielfältige Weise geholfen haben, und die aus Sicherheitsgründen ungenannt bleiben müssen, sei herzlich gedankt.
Ohne die finanzielle Unterstützung des Avicenna-Studienwerks hätte ich die Promotion nicht durchführen können. Doch auch über mein persönliches Anliegen hinaus, möchte ich betonen, wie wichtig die Existenz eines muslimischen Studienwerks und damit die weitere Normalisierung muslimischen Lebens in der postmigrantischen Gesellschaft Deutschlands ist. Es erfüllt mich mit großer Freude, Teil des zweiten Jahrgangs zu sein. Neben dem Geschäftsführer des Avicenna-Studienwerks Hakan Tosuner, möchte ich Frau Ülkü Yildirim-Can für die Begleitung meines Projekts danken.
Meinen Freund*innen und Kolleg*innen, die mir im Laufe der Jahre fachlichen Beistand geleistet, Teile der Arbeit kritisch gelesen und kommentiert haben sowie immer ein offenes Ohr für meine Nöte hatten, will ich ebenso herzlich danken: Ebtisam Ramadan, Safyah Hassan-Yavuz, Linda Brahimi, Nora Ali, Maisalon Dallashi, Misbah Arshad, Vanessa Rabus, Janika, Cihan Büyükbaş, Christian Ratzke, Ömer Alkin, Ramy El-Sari, Burak Hasan Yalcin, Patrick Adel, Abdellatif Aghsain, Mustafa El-Hady, René Baluch und immer wieder Norbert Mattes.
Sebastian und Inci danke ich sehr, dass ich während des ersten Lockdowns ihre Küche besetzen durfte, um das Manuskript der Dissertation fertigzustellen. Ihr habt mich gerettet!
Safyah Hassan-Yavuz und Tuğba Önder danke ich herzlich für die Übernahme des mühsamen Korrektorats. Es war sicher nicht einfach mit mir. Prof.*in Iman Attia von der Alice-Salomon-Hochschule, Prof. Sabah Alnasseri von der York University (Kanada) sowie Prof. Ulaş Aktaş möchte ich herzlich für die wohlwollende und freundschaftliche Begleitung meines Projekts danken.
Last but not least gilt mein Dank meiner großen Familie, ohne die es schlicht nicht gegangen wäre: Amani, Clara, Samu, Henrik, Rita, Nora, Junis, Linda, Martina, Mohammed, Rische und alle anderen, die hier ungenannt bleiben.
Meiner Mutter, die als Immigrantin instinktiv wusste, wie wichtig Schule und Bildung für ihre Kinder ist und uns immer motiviert hat, obgleich sie nie eine formale Bildung genießen konnte, kann ich gar nicht genug danken.
Meinem Vetter Dr. Munir Mustafa, gebührt besondere Erwähnung. Er hat mich bereits als Student immer gefördert und auf meinem Weg bestätigt. Shukran Jazilan! Gleiches gilt für meinen Bruder Shawkat Mustafa, der mir in vielerlei Hinsicht ein Vorbild ist.
Als ich die Arbeiten an diesem Projekt begann, waren meine Frau Asma und ich noch allein. Heute sind wir eine kleine Gemeinschaft von vier Menschen. Ohne sie und die zwei kleinen Menschen, Samīr und Iyād, denen das zweifelhafte Privileg zuteilwird, als Akademiker*innenkinder heranzuwachsen, hätte ich diese Mammutaufgabe nicht geschafft. Eure Geduld war nicht vergebens!
Meinen Drei sei dieses Buch von Herzen gewidmet.
Imad Mustafa, Frankfurt im März 2021
1.Einleitung
1.1Erkenntnisinteresse und wissenschaftliche Problematisierung
Das Jahr 2011 hat in vielen Ländern der NAWA-Region1 tiefe Spuren hinterlassen. Nach Jahrzehnten autoritärer Staatsführung und Illiberalität, schien für einen kurzen historischen Moment eine politische Öffnung dieser Gesellschaften möglich. Während die Wucht und Unmittelbarkeit der Ereignisse viele externe Beobachter*innen überraschte, offenbart ein analytischer Blick auf die Mobilisierungen und Begründungen der Proteste, dass die Zeit für die Erhebungen in verschiedenen Ländern – bei allen strukturellen, historischen und politischen Unterschieden – wie Tunesien, Ägypten, Libyen, Syrien, Jemen, mehr als reif war.
Massive soziostrukturelle Ungleichheiten, intransparente, ineffiziente Staatsapparate, hohe Arbeitslosigkeitsraten, insbesondere unter jungen Menschen, korrupte Herrschereliten in Verbindung mit illiberalen staatlichen Verfasstheiten, die politische Teilhabe und Engagement auf zivilgesellschaftlicher Ebene weitgehend ausschließen, liefern als summierte Merkmalsausprägungen mit wechselseitigen Beziehungsverflechtungen plausible Erklärungsansätze für den politischen Protest von Millionen Menschen.
Der autoritäre Status Quo, dessen Aufrechterhaltung allzu oft im Interesse westlicher2Mächte lag, schien auf lange Zeit unüberwindbar. Unabhängige politische Partizipation in Form von Parteien oder anderen Interessenorganisationen war praktisch unmöglich. In Ägypten, dem Untersuchungsland dieser Studie, gab es unter Präsident Husni Mubarak, der ab 1981 das Land regierte, zwar Parteien, die neben der von ihm geführten Nationaldemokratischen Partei (NDP) existieren durften; jedoch waren diese Parteien ausnahmslos kooptierte Akteur*innen, die keinen reellen Einfluss auf politische Entscheidungen der Regierung hatten. Sie galten vielmehr als Papp-Parteien (ahzab cartoniya), die lediglich helfen sollten, eine demokratische Fassade aufrechtzuerhalten. Damit nahmen sie eine systemstabilisierende Funktion ein, indem sie die Illusion von Meinungsfreiheit und Pluralismus aufrechterhielten. Wahlen und die Partizipation dieser Parteien an ihnen hatten eine zusätzliche legitimatorische Funktion für das Regime (Hamid 2014: 133).
Nach dem Rücktritt Mubaraks blieben autoritäre Strukturen in vielen Teilbereichen der Gesellschaft und Politik bestehen. Die Parallelität von liberalen Elementen und autoritärem Erbe ist in Prozessen sozialen Wandels nichts Ungewöhnliches. Vielmehr ist der Umgang mit und die Interpretation dieser hybriden Situation durch die Beteiligten von Interesse, weil sich daraus Handlungsoptionen für sie ergeben, die wiederum Rückwirkungen auf den Transitionsprozess haben. Die durch den Rücktritt Mubaraks sich verändernden politischen Möglichkeitsstrukturen (political opportunity structures, POS) eröffneten der ägyptischen Opposition nach Jahrzehnten des politischen Ausschlusses neue Wege. Inwieweit diese jedoch konstruktiv wahrgenommen und genutzt wurden, bleibt eine zu klärende Frage.
Der Arbeit liegt folglich die Ausgangsprämisse zugrunde, der zufolge Liberalisierungen des autoritären politischen Systems sowie eine Demokratisierung der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse nicht ohne die Überwindung des Widerstands der herrschenden Kräfte möglich ist. Dies impliziert politische Auseinandersetzungen (contention) organisierter Interessenaggregationen, um die kollektive Interpretation der Ereignisse, die Repräsentation gesellschaftlicher Lagen sowie die Verfügungsgewalt über Ressourcen. Diese Auseinandersetzungen, so eine weitere These, münden nur dann in einen konstruktiven politischen Prozess, wenn sie von einer Anerkennung der asymmetrischen Machtverhältnisse zwischen den Akteur*innen ausgehend, in eine agonale politische Form der dauerhaften Aushandlung, des institutionalisierten Kompromisses überführt werden (Mouffe 2007, 2016).
Zugleich zeigt das Beispiel Ägyptens, dass die Einführung formaldemokratischer Verfahren und liberaler Rechte – Wahlen, Zulassung politischer Parteien, Versammlungs- und Pressefreiheit usw. – zwar als Erfüllung einer Minimaldefinition von Demokratie und eines von Konsens geprägten Kompromisses angesehen werden kann; doch darüber hinaus wurde deutlich, dass die multiplen, sich überlagernden und ungelösten innergesellschaftlichen Konfliktlinien erhebliche Einschränkungen für die Realisierung dieser Freiheiten bedeuteten. Die erstmals mögliche, uneingeschränkte Artikulation zum Teil antagonistischer gesellschaftlicher Interessen, die immer auch soziale Lagen abbilden, führte zu heftigen Anwürfen, umkämpften Interpretationen eines künftigen, noch zu schreibenden Sozialvertrags und steigerte sich zu einer radikalen Polarisierung oppositioneller Akteur*innen aus dem säkularen und islamischen Lager. Eine solche Polarisierung ist gekennzeichnet durch einen ideologisch-weltanschaulichen Gegensatz, dessen zentrales Merkmal die Feindwahrnehmung des politischen Gegners ist und seinen Repräsentationsanspruch gesellschaftlicher Schichten als illegitim ablehnt. Dauerhafte Allianzen, Bündnisse und Pakte auf Seiten der Opposition, die auch die islamischen Akteur*innen einschließen, wurden auf diese Weise erschwert und unterlagen stets dem Vorbehalt zeitlich sehr begrenzter, brüchiger Wahlallianzen.
Vor diesem Hintergrund ist nach Jahrzehnten von zuerst kolonialer und dann einheimischer autoritärer Herrschaft – oftmals in republikanisch-säkularem oder monarchisch-säkularem Gewand – nach den Bedingungen politischer Teilhabe und Partizipation in Ägypten zu fragen, die allen politischen Akteur*innen die Integration in das sich demokratisierende politische System ermöglicht.
In entwickelten Demokratien mit institutionalisierten Konflikten, welche auf Klasse, Weltanschauung, Ethnie oder Geschlecht beruhen, gilt die Macht von sozialen Gruppen und die Existenz schwerer Konflikte, etwa um die weltanschauliche Ausrichtung des Staates, als überwunden bzw. institutionell eingehegt – auch wenn aktuelle Kämpfe um die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie zunehmender Rassismus in Form eines alt-neuen ethno-Nationalismus in vielen Ländern der EU daran erinnern, dass institutionalisierte kollektive Beziehungen immer dem Vorbehalt des Temporären unterliegen.
In sich entwickelnden Demokratien bestimmen Konflikte um Weltanschauung und politische sowie soziale Teilhabe oftmals die tagespolitische Agenda. Nicht Institutionen gelten hier als Konfliktmanager, sondern unterschiedlich machtvolle Gruppen, sogenannte (herrschende) strategische und konfliktfähige oppositionelle Gruppen (SKOG), die sich mit unterschiedlichen Interessenlagen gegenüber stehen.
Folglich lautet die zentrale Frage dieser Studie, wie sich der Regimewandel eines neopatrimonialen politischen System gestaltet, welche strukturellen Determinanten des politischen Systems den Transitionsprozess hemmen oder fördern, und wie sich Akteur*innendynamiken zwischen Opposition und Regime in diesem Prozess gestalten.
Neopatrimonialismus bezieht sich auf die über Klientel- und Patronagestrukturen vermittelte politische Herrschaft. Als Renten werden materielle wie immaterielle Kapitalarten bezeichnet, die als Revenuen an anderer Stelle erwirtschaftet werden. Entsprechend zeichnen sich solche politischen Systeme durch eine enge Verzahnung von ökonomischer und politischer Macht aus.3
Diese Eliten ringen in Demokratisierungsprozessen mit oppositionellen Akteur*innen um Einflusschancen im politischen System, notwendige institutionelle Veränderungen sind oft umkämpft. Eine Veränderung des politischen Systems hängt maßgeblich von der Organisations- und Konfliktfähigkeit der Opposition ab. D.h. auf welche mobilisatorischen und ideologischen Ressourcen kann sie für die Aushandlung einer neuen Ordnung zurückgreifen, um als strukturierte Akteur*in systemrelevante Leistungen kollektiv zu verweigern oder damit zu drohen (Schubert et al. 1994).
An dieser Stelle soll ein vorläufiger Hinweis auf die noch genauer zu untersuchenden Probleme einer stark fragmentierten, säkularen Oppositionsbewegung ausreichen, deren mangelhaft ausgebildete Organisationsfähigkeit sie im Kampf mit den gut organisierten, konsolidierten strategischen Gruppen und der Muslimbruderschaft um die Ausgestaltung einer neuen politischen Ordnung strukturell benachteiligt. Allerdings zeichnet sich der SKOG-Ansatz durch ein strukturalistisches Übergewicht aus. Zwar benennt er die ideologische Komponente solcher Machtkonflikte, versäumt es aber, die Entstehung und Bedeutung ideologischer Parteifamilien (cleavages) sowie politischer Identitäten in den Auseinandersetzungen zu analysieren.
Aus diesem Grund soll Lipsets/Rokkans Ansatz der ideologischen Parteienfamilien (Cleavage-Ansatz) den SKOG-Ansatz ergänzen (1967). Zusätzlich soll Chantal Mouffes (2007, 2016) Konzept des Politischen bzw. polarisierter politischer Identitäten in seiner anerkennungstheoretischen Dimension adaptiert werden (Bedorf 2010; Fraser/Honneth 2003; Honneth 1992); d.h. der Gegensatz zwischen institutionalisierter Politik und dem Politischen soll auf Transitionsprozesse übertragen werden, und das Politische als konflikthafte Unterbrechung institutionalisierter Politik theoretisiert werden.
Denn nur durch die Anerkennung politischer Gegner, so lautet eine These, kann ein anderes, wichtiges Kriterium für systemveränderndes Potential von Akteur*innen erfüllt werden: Ihre Bündnisfähigkeit und -bereitschaft. Die Erfüllung dieser Kriterien gilt in der politikwissenschaftlichen Transformationsforschung als wichtige Voraussetzung für das Gelingen von Transformationen (vgl. klassisch O’Donnell/Schmitter 1989). Auf der ideologischen Ebene interessieren deshalb vor allem Dynamiken weltanschaulicher Anerkennung oder Ablehnung zwischen oppositionellen Akteur*innen. Inwieweit wurden im Gegensatz dazu auf Sachfragen orientierte Konfliktlinien wahrgenommen und betont?
Die vorliegende Arbeit folgt deshalb grundsätzlich dem Schema, politischen Wandel als Folge von konfliktiven politischen Auseinandersetzungen (political contention) und daraus resultierenden Verschiebungen des Kräfteverhältnisses zwischen strategischen herrschenden sowie konfliktfähigen oppositionellen Gruppen zu analysieren.
Oft verlaufen diese Prozesse nicht linear, sondern sind geprägt von einer »situativen Dynamik«, in der sich Akteur*innenkonstellationen, Mobilisierungsstrategien und politische Opportunitätsstrukturen über die Zeit verändern und relational bedingen (Harders 2013: 26; McAdam et al. 2001: 268). Die diesen Dynamiken zugrundeliegenden Verhältnisse werden einerseits durch die institutionellen Strukturen bestimmt, in denen sich die Akteur*innen bewegen (Umweltbedingungen), und zum anderen durch das in diesen Strukturen sich vollziehende Handeln kollektiver Akteur*innen, das sich wiederum auf ihre Handlungsoptionen und die Struktur auswirkt (Tilly/Tarrow 2015: 67).
Da es sich bei den zu untersuchenden strategischen und oppositionellen Akteur*innen um im Verlauf der Transition neu entstandene Organisationen handelt, soll versucht werden, diese Akteur*innen in ihrer Genese sowohl mittels Netzwerktheorien als auch Analysen von Netzwerkorganisationen (Stegbauer 2010b, 2010b, 2016; Stegbauer/Häußling 2010a; Sydow 1995, 2010; Sydow/Ortmann 2001, 2001) sowie akteur*innenzentrierter neo-institutionalistischerAnsätze der Organisations- und Parteienlehre theoretisch zu fassen (DiMaggio/Powell 1983; Matys 2014: Kap. 2&3; Mayntz/Scharpf 1995a; Meyer/Rowan 1977). Auf diese Weise wird ihrem fluiden Charakter, der zwischen heterarchischer Netzwerkstruktur und fester konsolidierter Organisation changiert, Rechnung getragen werden.
Doch kollektive Handlung benötigt mehr als Bündnisfähigkeit, organisationale Konfliktfähigkeit und die Verfügungsgewalt über Ressourcen, wie es der SKOG-Ansatz oder der Contentious-Politics-Ansatz fordern. Kommunikative Prozesse kollektiver politischer Identitätsbildung in Netzwerken, Protestgruppen und sozialen Bewegungen, die Angleichung kollektiver Erwartungen und die Erkenntnis, dass kollektive Handlung auch Veränderung bewirken kann, gehen der Handlung voraus und sind maßgeblich von Interpretationen der sozialen Wirklichkeit beeinflusst.
Deshalb interessieren darüber hinaus kollektive Deutungsrahmen (frames), die sich in Netzwerken und Protestbewegungen kommunikativ bilden und insbesondere bei der Mobilisierung eine große Rolle spielen, da sie den Akteur*innen helfen, ihre kollektiven Problemlagen zu definieren, zu Handlung motivieren und zu kollektiver Handlung anleiten. Allerdings wird keine detaillierte Frameanalyse durchgeführt, sondern der Zusammenhang von Framing, Mobilisierung und politischer Legitimität der säkularen Opposition untersucht, um Rückschlüsse darauf ziehen zu können, warum der Transitionsprozess in Ägypten diesen spezifischen Verlauf annahm.
Da auf der Akteur*innenseite säkulare Parteien im Mittelpunkt des Interesses stehen, soll danach gefragt werden, wie sich im innersäkularen oppositionellen Lager reale Versuche der kollektiven Aushandlung gestalteten? Welche systemischen oder akteur*innenspezifischen Einflussfaktoren (Ideologie, Machtpolitik, Institutionelle Hemmnisse und Gelegenheitsstrukturen) lassen sich identifizieren? Welche Mechanismen und Prozesse führten zu Allianzen oder Bündnissen oder haben diese verhindert? Welchen Einfluss hatte die Konstituierung der Akteur*innen auf die Allianzbildung?
Ist darüber hinaus – im Verhältnis zu islamischen Akteur*innen – Kooperationsbereitschaft bei den säkularen Parteiorganisationen vorhanden, die es erlaubt, im Transformationsprozess einen »neuen Gesellschaftsvertrag« auszuhandeln, dem alle maßgeblichen gesellschaftlichen Gruppen und Akteur*innen zustimmen können, insbesondere ihre islamischen4 Gegner*innen (Zorob 2013)?
Diese Fragen sollen zum einen Aufschluss über die Anerkennungsverhältnisse innerhalb der säkularen Opposition geben und wie sich diese auf die Transition ausgewirkt haben. Zum anderen soll analysiert werden, wie der weltanschauliche Gegensatz zwischen der Muslimbruderschaft und säkularen Parteiorganisationen sich auf Aushandlungsprozesse, die Bündnisbildung und damit auf die Gelegenheitsstrukturen im Transitionsprozess, ausgewirkt hat.
Denn für die Analyse Ägyptens bleibt die Frage nach dem Verhältnis von säkularen und islamischen Akteur*innen5 sowie der Rolle des Islams in Staat und Gesellschaft zentral. Nicht erst die kurze Regierungszeit der Muslimbruderschaft zwischen 2011 und 2013 hat die radikale Polarisierung zwischen beiden – wiewohl heterogenen – Blöcken sichtbar gemacht; thesenhaft formuliert, haben sich bereits bei der zivilgesellschaftlichen Mobilisierung westlich orientierte, junge, wohlhabende und urbane Mittelschichtsangehörige und deren politische Ziele von eher traditionell eingestellten, armen und kleinbürgerlich-konservativen Schichten abgehoben. Im Protest, wo es galt, das Regime als gemeinsamen Gegner zu bekämpfen, traten diese Divisionen in den Hintergrund, um mit Wucht nach der Mobilisierungsphase auf die tagespolitische Agenda zurückzukehren.
Die Frage, die es in diesem Zusammenhang zu beantworten gilt, lautet folglich nicht, ob es diese Polarisierung gab, sondern es stellt sich die Frage nach ihrer spezifischen Einbettung im politischen Prozess – und wie sich dies auf die Chancen einer erfolgreichen Transition ausgewirkt hat.
1.2Wissenschaftstheoretische Einbettung der Arbeit und Methodologie
Mit diesen Überlegungen wird klar, dass der Fokus der vorliegenden Arbeit einerseits auf – strukturell gelagerten – politischen und sozialen Transformationsprozessen in Ägypten liegen soll und andererseits auf den beteiligten innerstaatlichen Parteien, die sich während und nach den Mobilisierungen im Frühjahr 2011 gebildet haben. Die zu untersuchenden Parteien werden auf zwei Ebenen analysiert: Einmal in ihrer strukturellen sowie machtpolitischen Verortung im politischen System Ägyptens (Makroebene) und andererseits werden Mobilisierungs, Organisierungs- sowie Konsolidierungsprozesse dieser Parteien und sie umgebender Protestnetzwerke untersucht (Mikro- und Mesoebene). Daneben sollen diejenigen Faktoren und Strukturelemente des sich verändernden politischen Systems immer wieder in die Analyse miteinbezogen werden, die sich auf die Konstituierung und Handlungen der entstehenden kollektiven Akteure auswirken.6
Hinsichtlich der begrifflich-theoretischen Eiordnung des zu untersuchenden Phänomens, bedient sich die Arbeit zweier Begriffe: Einmal wird von Transition gesprochen, wenn konkrete politische Prozesse analysiert werden, die den Regimewandel betreffen (ohne zunächst darüber eine Aussage zu fällen, welche Qualität der Wandel hat). Zum anderen greift sie auf den Begriff der Revolution zurück, um die Ganzheit der Ereignisse zu fassen, die ab 2011 stattfanden.
Die Differenz zwischen beiden Perspektiven einerseits und die Stringenz andererseits, mit der die Menschen in Ägypten die Ereignisse, um den Rücktritt von Mubarak und die folgenden politischen Prozesse bis zum Putsch von Feldmarschall Abdel Fattah as-Sisi im Sommer 2013, in ihrer Selbstwahrnehmung und Rekonstruktion der Ereignisse als Revolution bezeichnen, tragen weitreichende methodologische und theoretische Implikationen in sich. Der Blick, die Interpretation des Forschenden auf die zu untersuchenden Fragen sollte – und dies ist auch eine normative Entscheidung – den formulierten politisch-sozialen Anspruch der beteiligten Akteur*innen immer reflektierend berücksichtigen und sie daran messen. Zu oft unterliegt politikwissenschaftliche Transformationsforschung einem – auch normativ geformten – Democracy Bias, der die eigene Perspektive auf die Regierungsform der westlich-liberalen Demokratie als Muss setzt und auf andere projiziert (Albrecht/Frankenberger 2010a; Albrecht/Schlumberger 2004; vgl. auch Kollmorgen et al. 2015: 24). Den Modus des Regimewandels als Revolution zu fassen, sagt noch nichts über die Organisation politischer und sozialer Teilhabe nach Abschluss des Transitionsprozesses aus.7 Im Gegenteil ist über den allseits bekannten Ruf nach dem Sturz des Regimes zu prüfen, welche politischen Visionen die neuen politischen Parteien angestrebt haben.
Damit reiht sich die vorliegende Arbeit wissenschaftstheoretisch in das politikwissenschaftliche Feld der Demokratisierungsforschung ein, mit der Besonderheit anhand einer engen Verzahnung von Theorie und Empirie sowie von Struktur und Handlungsebene den Verlauf des politischen Prozesses zwischen Januar 2011 und Juli 2013 analysierend nachzuzeichnen. Sie trägt den Komplexitäten politischen Wandels Rechnung, indem sie die engen Korrelationen, Rückkopplungen sowie Relationalitäten zwischen Struktur und Handlung analysiert. Außerdem weicht sie von politikwissenschaftlicher Transformationsforschung ab, die theoretisch oftmals einen reinen Ansatz verfolgt. Die Arbeit nimmt Anleihen bei der Sozialpsychologie, der Sozialen Bewegungsforschung, dem Konstruktivismus als erkenntnistheoretischer Folie und der Kommunikationswissenschaft. Diese disziplinär offene Herangehensweise will den Komplexitäten eines politischen Transitionsprozesses Rechnung tragen.
Dabei wird allerdings kein chronologisches Ablaufmodell des gesamten Untersuchungszeitraums verfolgt, das alle relevanten Ereignisse nachzeichnet; das wäre auch kaum zu bewältigen. Vielmehr sollen zentrale politische Aushandlungsprozesse fallweise zur Operationalisierung der Theorie herangezogen werden.8
Zugleich sollen im Laufe der theoretischen Erörterungen Anschlussmöglichkeiten zwischen den verschiedenen theoretischen Ansätzen aufgezeigt und zusammengeführt werden (vgl. für ein solches Vorgehen Merkel 1996: 325f.). Damit ist ein weiteres Ziel benannt: Neben der analytischen Beschreibung ausgewählter Merkmale der Revolution in Ägypten zielt die Arbeit auch auf eine Weiterentwicklung theoretischer Erkenntnisse hinsichtlich Transitionsprozessen.
Die konkrete Analyse der ägyptischen Revolution verläuft dann entlang der theoretisch gewonnenen Erkenntnisse und Modellierungen. Sie bedient sich empirischer Daten, die in Interviews erhoben wurden sowie Parteiprogrammen, Sekundärliteratur und Medienartikeln. Die Interviews wurden in explorativer Weise erhoben, um Leerstellen im Forschungsfeld zu füllen, die auch nicht durch die Analyse von Sekundärliteratur erklärt werden konnten.
Manche Kapitel der Analyse beruhen in erster Linie auf diesen Interviews, weil die Untersuchung an diesen Stellen Pioniercharakter hat und es praktisch keine andere Forschung in diesem Feld gibt. Eine dichte Beschreibung und Interpretation des Verlaufs des Transitionsprozesses soll dort vorläufige Erkenntnisse im Sinne einer Felderschließung liefern, um die Gesamtanalyse zu stützen.
Es soll explizit keine Typenbildung ägyptischer politischer Parteien durchgeführt werden, auch wenn in der Analyse existierende Unterschiede und Ähnlichkeiten in Programmen, Strukturen, Legitimitätsbasis der Akteur*innen sowie deren politischen Positionierungen analysiert werden. Dies soll lediglich dem besseren Verständnis der jeweiligen Position und der zwischen den Akteur*innen stattgefundenen Aushandlungen dienen. Folglich lässt sich die vorliegende Arbeit zwischen zwei großen wissenschaftlichen Traditionen verorten: Derjenigen der eher geisteswissenschaftlich geprägten Regionalforschung (NAWA), die mittels dichter Beschreibungen und Interpretationen politischer, historischer und sozialer Art den Untersuchungsgegenstand analysiert und derjenigen der empirischen Sozialwissenschaft, die mittels eigener Daten die Analyse vorantreibt.
Die methodologische und theoretische Verortung der Arbeit macht deutlich, dass es sich einerseits um eine einordnende Innenperspektivierung beteiligter Akteur*innen handelt und andererseits, dass ausschließlich innerstaatliche Dynamiken für diese Arbeit von Relevanz sind.
Die Fokussierung auf die Akteur*innen des Wandels und da insbesondere auf säkulare Parteiorganisationen ist auch der Situation des Forschungsfeldes geschuldet: Die Rolle säkularer, neu entstandener Parteiorganisationen während der ägyptischen Revolution bleibt unterbeleuchtet (Kap. 1.5). Zugleich muss die Bedeutung von Parteiorganisationen für politische Transformationsprozesse in der Politikwissenschaft betont werden: Nach wie vor gelten sie als unabdingbar für die Konsolidierung demokratischer Institutionen. Deshalb sind säkulare Parteiorganisationen diejenigen Akteur*innen, auf die sich die Untersuchung bezieht.
1.3Aufbau der Arbeit
Die Arbeit ist in vier Teile gegliedert. Teil I behandelt die systemischen Aspekte der Transition: Kapitel I-2 theoretisiert das herrschende politische System in Ägypten, das sich als neopatrimonialer Rentenstaat bezeichnen lässt. Kapitel I-3.1 führt das konflikttheoretische Konzept der SKOG ein. Im Anschluss daran wird das Konzept der umkämpften Politik (contentious politics) vorgestellt (I-3.2), welches das SKOG-Konzept um einige heuristische Elemente erweitern soll.
Teil II führt die Überlegungen aus Teil I fort und erweitert sie um eine kommunikationswissenschaftliche und konstruktivistische Perspektive. Kapitel II-4 führt das Konzept der Deutungsrahmen und politischen Identitäten und ihre Bedeutung für die Mobilisierung von Netzwerken ein. Kapitel II-5 behandelt Theorien von Netzwerken und deren Bedeutung für die Genese von festen formalisierten Organisationen, die in Kapitel II-6 als Netzwerkorganisationen theoretisiert werden. Kapitel II-7 bildet den Übergang zum methodischen Vorgehen in Teil III als auch zur empirischen Analyse in Teil IV. Mittels einer theoretischen Verdichtung und Synthese sollen gewonnene Erkenntnisse aus Teil I und II in Analysedimensionen umgewandelt und operationalisiert werden. Teil III beschreibt die Methoden der Datenerhebung und der Datenanalyse.
Die Analyse der Transition in Teil IV lehnt sich eng an die theoretisch gewonnenen Erkenntnisse aus Teil I und II an und verknüpft diese mit einer dichten Beschreibung der Ereignisse (Geertz 1997). Kapitel IV-10 beschreibt die Mikroprozesse der Mobilisierung zivilgesellschaftlicher Akteur*innen, des Framings sowie der Herausbildung kollektiver politischer Identitäten. In Kapitel IV-11 werden die Untersuchungsobjekte als fluide Organisationen charakterisiert, die zwischen konsolidierten Apparaten und offenen Netzwerken situiert sind. Kapitel IV-12 und IV-13 schließen die Arbeit ab und stellen die Interaktionen der verschiedenen Akteur*innen ins Zentrum der Untersuchung.
Kapitel 12 behandelt dabei die Auseinandersetzungen und Aushandlungsprozesse der säkularen Parteien. Kapitel 13 hingegen analysiert das Ringen zwischen Militärrat (Supreme Council of the Armed Forces, SCAF), der Muslimbruderschaft und den einzelnen Parteien im säkularen Lager.
1.4Forschungsstand
Die Literatur zum Demokratisierungsprozess in Ägypten spiegelt nicht zuletzt wegen der hohen Aktualität des Themas und seiner weltpolitischen Relevanz einen Work in Progress wider: Mit dem Frühjahr 2011 setzt zunächst die Produktion einer großen Menge Literatur zum Thema Arabischer Frühling ein, die oftmals vergleichend vorging und versuchte, ähnliche Strukturmerkmale in allen betroffenen Ländern der Region auszumachen (vgl. exemplarisch Achcar 2013; Davis 2013; GIGA German Institute of Global and Area Studies 2013; Haas/Lesch 2016; Javaher-Haghighi et al. 2013; Jünemann/Zorob 2013; Kelly 2016; Lynch 2014; Ouaissa 2014).
Doch schon bald wurde durch die zunehmend unterschiedlichen Transitionspfade, die die Länder der Region einschlugen, offenbar, dass ein solches Vorgehen nicht mehr zielführend ist, will man die Dynamiken und Prozesse in den einzelnen Ländern analysieren, ohne in die Falle homogenisierender Betrachtungen zu tappen, die von einer Gleichheit sozialer, politischer und historischer Strukturen ausgehen.
Aus dieser Erkenntnis resultierte eine große Zahl landesspezifischer Studien, die aus einer Makroperspektive die Strukturen und sozio-ökonomischen Verhältnisse analysieren, die zum Ausbruch der Proteste in den einzelnen Ländern geführt haben: Ägypten und Tunesien etwa (Albrecht/Demmelhuber 2013; Masri 2017) oder auch Libyen und Syrien (Edlinger 2015; Edlinger/Kraitt 2015; Hinnebusch/Imady 2018).9
Im Laufe der Zeit, als sich ein (vorläufiges) Scheitern der meisten Transitionsprozesse in verschiedener Form zunehmend abzeichnete (autokratischer Regress, Krieg, Bürgerkrieg), änderte sich auch der Tonfall der Publikationen: Waren die meisten frühen Veröffentlichungen der Jahre 2012 bis 2014 noch von Optimismus und der Hoffnung auf eine demokratischere Zukunft der gesamten Region geprägt, so ging es zunehmend um eine Analyse des (vorläufigen) Scheiterns der Revolutionen in verschiedenen arabischen Ländern (Bayat 2017; Hinnebusch 2018; Krieger/Seewald 2017; Masoud 2015; Zambakari/Kang 2016).
Zwar hat seit der brutalen Zurückdrängung der ägyptischen Muslimbruderschaft im Juli und August 2013 durch das neue Militärregime und verstärkt seit der Konsolidierung und Wahl des neuen Machthabers Abdel Fattah as-Sisi im Sommer 2015 eine Produktion von Forschungsliteratur darüber eingesetzt, wieso der Arabische Frühling in Ägypten gescheitert ist (Hatab 2018; Ketchley 2017; Khalifa 2015; Sowers/Rutherford 2016). Umfassende sozialwissenschaftliche Studien über die Rolle säkularer Parteien in Ägypten fehlen jedoch noch immer praktisch ganz.
Stattdessen lassen sich Studien und Analysen, welche die Binnenverhältnisse Ägyptens nicht nur aus einer strukturellen Perspektive betrachten, sondern auf beteiligte Akteur*innen abzielen und deren Rolle bei den Revolutionen, in mehrere Kategorien untergliedern: Studien, die islamische Akteur*innen und deren Interessen sowie Auseinandersetzungen mit anderen staatlichen, wie nicht-staatlichen Akteur*innen ins Zentrum der Analyse stellen (vgl. zu diesem Forschungsstrang exemplarisch al-Anani 2015; El Ashwal 2013; El-Nawawy/Elmasry 2018; Lacroix/Shalata 2016; Lübben 2011, 2013a, 2013b; Mariz 2012; Masoud 2014; Ranko 2014; Ranko/Nedza 2016; Trager 2016). Sowie Studien, die auf Akteur*innengruppen und Interessenaggregationen zielen, die sich nicht islamisch legitimeren: Frauen (Badran 2016; Moghadam 2016; Sholkamy 2012), Jugend (Abdalla 2013, 2016b; Abdallah 2012; Ouaissa/Gertel 2014; Shehata 2012), Arbeiter*innen (Albrecht 2013; Beinin 2012, 2015; Bishara 2012, 2018; Weipert-Fenner 2013), Militär (Alnasseri 2016b; Grawert/Abul-Magd 2016; Marshall/Stacher 2012).
Neben diesen single-issue- bzw. single-player-Studien, sind für das Verständnis des Transitionsprozesses in Ägypten und für die vorliegende Arbeit Studien von großer Relevanz, die das Zusammenspiel verschiedener gesellschaftlicher säkularer Akteur*innen beleuchten sowie die (Konflikt)Dynamiken, Interaktionen sowie die strukturellen Hemmnisse (constraints) und Möglichkeiten (opportunities) auf diese Dynamiken analysieren. Die wissenschaftliche Hinwendung zur sozialen Urheberschaft der Revolutionen lenkt den etablierten Blick der Politikwissenschaft weg von rein strukturellen Analysen, wie sie weiter oben angesprochen wurden, oder auch elitenzentrierten Betrachtungen, die Stabilität oder Wandel nur anhand des Handelns staatlicher Akteur*innen erklären (»Regimezentrismus«) (Grimm 2015: 113).
Einen ersten Schritt in diese Richtung liefert Cilja Harders in einem Aufsatz, in dem sie auf Akteur*innenkonstellationen während und nach der ägyptischen Revolution eingeht. Theoretisch deutet sie eine Synthese des SKOG-Ansatzes, transformationstheoretischen Elementen sowie Asef Bayats Ansatz des quiet encroachment an, also der informalen Wiederaneignung öffentlichen Raums durch städtische Arme (Bayat 2010; Harders 2013: 29).
Der genannte Sammelband von Albrecht/Demmelhuber geht in seinen verschiedenen Teilen zwar auf eine Reihe von relevanten Akteur*innen ein; doch stehen diese unverbunden nebeneinander – eine Synopse unter dem Schirm einer einheitlichen theoretischen Herangehensweise fehlt noch (2013). Zudem bleiben beide Arbeiten im Theoretischen, eine empirische Untersuchung zu Akteur*innenkonstellationen und -dynamiken bieten sie jeweils nicht an.
Nina Guerins Ansatz, Almonds und Verbas Konzept der politischen Kultur für Ägypten und Marokko anzuwenden, stellt einen interessanten Versuch dar, der allerdings nur die Ursachen für den Umbruch beleuchtet. Zwar führt sie eine empirische Studie durch, die die »demokratischen Einstellungen« der Befragten untersucht, ohne jedoch eine bestimmte Akteur*innengruppe besonders hervorzuheben (Guerin 2014: 313).
Arbeiten, die das Verhältnis von Demokratie, Staat und Säkularismus in Ägypten aus historischer, ideengeschichtlicher oder soziologischer Perspektive analysieren sind in der Literatur häufiger zu finden, als Analysen, die explizit säkulare Parteiorganisationen analysieren, die nach Februar 2011 entstanden sind (Agrama 2012; Esposito et al. 2016; Hasso 2015; Hefny 2014; Lust et al. 2013; Sika 2012a).
Wesentliche Arbeiten in diesem Bereich, die die post-Mubarak Entwicklung analysieren, sind die von Dunne/Hamzawy (2017), der Aufsatz von Lust/Waldner (2016) sowie die beiden Sammelwerke des Arab Forum for Alternatives in Kairo (o.J., 2015), einem Think Tank und Policy Forschungsinstitut, das Handlungsempfehlungen für die säkularen Parteien formuliert. Daneben gibt es schematische Darstellungen des neuen Parteiensystems in Ägypten, die an dieser Stelle aber keiner näheren Betrachtung unterzogen werden sollen: Carbonari (2011), Gemeinder et al. (2011), Dunne/Hamzawy (2017), Grimm/Roll (2016) sowie Hasan (2012).
Dunne/Hamzawys Studie untersucht säkulare Parteien in einem Zeitraum von 2011 bis 2017, bezieht allerdings historische Betrachtungen über die Entwicklung des ägyptischen Parteiensystems mit ein. Erkenntnistheoretisch steht das Verhältnis des Regimes bzw. vergangener Regime zu den säkularen Parteien im Fokus. Bei der Rezeption muss auch berücksichtigt werden, dass Amr Hamzawy Teil des politischen Prozesses in Ägypten war: Zunächst wurde er als möglicher Co-Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Ägyptens gehandelt, gründete nach einem Zerwürfnis mit anderen Parteiführer*innen innerhalb der Partei jedoch seine eigene Partei, Das Freie Ägypten (misr al-hurriya), (Ahram Online 2011a; Carnegie Endowment for International Peace 2011b).
Die Autor*innen situieren säkulare Parteien nicht auf einem herkömmlichen links-rechts-Spektrum, sondern ordnen sie nach dem Kriterium Staatsnähe bzw. Opposition, wobei sie dies nicht an der Ideologie, sondern am politischen Handeln der Parteien und dem Grad der Kooptation bzw. Einbindung durch den Staat determinieren (Dunne/Hamzawy 2017: 4f.). Dieses Vorgehen steht im Einklang mit der SKOG-Theorie, welche Akteur*innen nach ihren Aneignungschancen und dem Zugriff auf Ressourcen (Stellung im Herrschaftssystem) klassifiziert (Kap. I-3.1). Auch angesichts des beginnenden Transitionsprozesses ist es plausibler, die Akteur*innen nach ihrer Staatsnähe und dem damit verbundenen Ressourcenzugriff zu klassifizieren, als nach einer gewiss noch schwach ausgeprägten ideologischen Fundierung.
Im weiteren Verlauf der Studie analysieren die Autor*innen, welche Taktiken das Regime in der politischen Auseinandersetzung mit den säkularen Parteien eingesetzt hat, um diese zu schwächen.
Den größten Teil der Studie nimmt jedoch die Analyse des Versagens der säkularen Parteien im Ringen mit dem Regime ein. Beide Teilanalysen bedienen sich aber keines explizierten theoretischen Frameworks, sondern beschreiben anhand von Sekundärquellen den politischen Prozess in Ägypten.
Die Studie von Lust/Waldner zu Parteien in Transitionsprozessen stellt die vier Länder Ägypten, Tunesien, Libyen und Irak in den Mittelpunkt. Damit reiht sie sich einerseits in die Regionalforschung ein, andererseits in das Feld der Transitionsforschung. Allerdings verbleiben die Forscher*innen auf einer rein strukturellen Ebene, die lediglich Akteur*innenkonstellationen in den Blick nimmt, ohne dies jedoch auf den Transitionsprozess zu beziehen. Eine eigene empirische Erhebung führen sie nicht durch. Die Autor*innen erstellen eine Matrix, die autoritäre Herrschaftspraktiken und deren Erbe (authoritarian legacies) in ein Verhältnis zu politischen Parteien und sozialen Bewegungen setzen und daraus Konsequenzen für die Struktur des jeweiligen Parteiensystems, sowohl unter autoritären Herrschaftsbedingungen als auch im Transitionsprozess ableiten (Lust/Waldner 2016: 162). Damit weichen sie von herkömmlichen Studiendesigns der Autoritarismusforschung ab, die Handlungsstrategien autoritärer Regime im Zusammenhang mit ihrem möglichen Überleben untersuchen (Kap. I-2.3).
Ägypten bezeichnen sie als inklusives autoritäres Regime, welches neben der herrschenden Partei loyale Oppositionsparteien sowie einige soziale Bewegungen zulässt (ebd.: 163). Das daraus resultierende, post-autoritäre Parteiensystem sei deshalb als »heterogen und asymmetrisch« zu bezeichnen, drei Parteitypen würden in der Regel dominieren: Altparteien (relic parties), neue Parteien (novice parties) sowie Bewegungsparteien (movement parties) (ebd.: 176) (Kap. II-6.1).
Aus dem dargestellten Stand der Forschung lässt sich ein Forschungsdesiderat ableiten, das
1.säkulare politische Parteien in Ägypten ins Zentrum des Forschungsinteresses stellt;
2.sowohl die Entstehung als auch die Konsolidierung der Parteien sowie die Dynamiken mit der instabilen Systemumwelt bei diesen Prozessen in den Analysefokus nimmt;
3.die Interaktionen und Akteur*innendynamiken zwischen diesen Parteien, dem Regime und islamischen Parteien untersucht;
4.handlungstheoretische und strukturelle Elemente bei der Analyse verbindet.
1NAWA-Region steht für Nordafrika und Westasien und soll ethnozentrische und essentialisierende Benennungen der geographischen Region wie Islamische Welt, Arabische Welt, Orient oder auch MENA vermeiden.
2Dem Autor ist bewusst, dass der Begriff der westlichen Welt ähnlich homogenisierend und verkürzend ist, wie derjenige der Islamischen Welt. Aus diesem Grund werden im Folgenden solche Begriffe und uneigentliche Ausdrucksweisen kursiviert. So sollen umständliche Formulierungen, wie z.B. »so genannte Westliche Welt« etc. vermieden werden.
3Der Ansatz bleibt in seiner deskriptiven Funktion des politischen Systems Ägyptens, insbesondere was das Ineinandergreifen der Teilsystemlogiken betrifft, erste theoretische Wahl. Die darin enthaltenen impliziten und expliziten, bisweilen essentialisierenden Annahmen über einen arabischen Exzeptionalismus hinsichtlich demokratischer Strukturen werden in dieser Arbeit nicht problematisiert werden. Es soll an dieser Stelle die kritische Frage ausreichen, warum eine enge Verzahnung politischer und ökonomischer Macht nur Kennzeichen eines sogenannten neopatrimonialen Staates sein soll und nicht etwa auch charakteristisch für eine konsolidierte kapitalistische Demokratie wie den USA oder auch der BRD?
4Bei dieser Frage lege ich die Annahme zugrunde, dass nur durch eine praktische und ideologische Einbindung der islamischen Parteien und Organisationen ein erfolgreicher Übergang zu mehr Demokratie vollzogen werden kann, selbst wenn diese aus Sicht der Demokratisierungs- und Transformationsforschung einen nur mangelhaft ausgebildeten Demokratiebegriff besitzen sollten, vgl. Salamé (1994). Schließlich repräsentieren islamische Organisationen große Teile der ägyptischen Bevölkerung, so dass ein politischer Ausschluss dieser Bevölkerungsschichten nur unter Bedingungen des Autoritarismus vollzogen werden kann.
5Diese historisch gewachsenen Konfliktlinien sind im Wesentlichen Ergebnis zweier gegensätzlicher Modernisierungstendenzen Ägyptens: Zum einen der säkulare Nationalismus, der in der Unabhängigkeitsbewegung zwischen 1919 und 1922 seinen ersten pointierten Ausdruck im 20. Jahrhundert fand und in der vollständigen Dekolonisierung Ägyptens und der damit einhergehenden Abschaffung der Monarchie im Jahr 1952 durch die Freien Offiziere gipfelte. Und zum anderen die intellektuellen Entwicklungen, die durch Muhammad Abduh (gest. 1905), Hasan al-Banna (gest. 1949) und Sayyid Qutb (gest. 1966) in Form eines politisierten, antikolonial-nationalistischen Islams angestoßen wurden und zur Gründung der Muslimbruderschaft im Jahr 1928 als erster islamischer moderner Massenbewegung führten. Beide Tendenzen konkurrieren seit den 1920er Jahren um die intellektuelle und politische Vorherrschaft in Ägypten.
6Die zugrundeliegende Annahme hier lautet, dass im Untersuchungszeitraum zwischen 2011-2013 keiner der zu untersuchenden kollektiven Akteure wirklich seine Entwicklung abgeschlossen hatte, sondern sich in einem andauernden Konstituierungsprozess befand.
7Diese etwas apodiktische Formulierung soll die Leser*innen nicht in die Irre führen: Ein Abschluss sozialer Prozesse ist meist vorläufiger Natur, wie das Beispiel Ägypten selbst sehr gut illustriert.
8Die Entscheidung, welche politischen Prozesse als relevant oder zentral zu gelten haben, bleibt eine subjektive Entscheidung. Als Auswahlkriterien wurden aus der Theorie wichtige Schritte eines Transformationsprozesses extrahiert, wie Verfassungsgebung, Wahlen, Liberalisierungen vormals autoritär kontrollierter politisch-sozialer Sphären, Bündnis- und Allianzbildung, Machtkämpfe um die Gestaltung des politischen Prozesses, vgl. Merkel (2010: Kap. 6).
9An dieser Stelle sollen diese Beispiele ausreichen; die Liste ließe sich im Hinblick auf andere Länder wie Bahrain, Marokko, Jordanien, Jemen fast beliebig verlängern.
I.Transition I: Regimewandel und Contention
2.Neopatrimonialer Autoritarismus und Regimewandel
Das herrschende Regime in Ägypten ist in der Literatur als neo-patrimoniales autoritäres politisches System bezeichnet worden, das sich spätestens seit der Machtübernahme Gamal Abdel Nassers 1954 durch seinen personalisierten Herrschaftsstil einerseits und durch seine legal-rational vermittelte bürokratische Herrschaft andererseits auszeichnet (Eisenstadt 1973; Erdmann 2002; Erdmann/Engel 2006; Pawelka 1985). Im Folgenden sollen die kennzeichnenden Charakteristika dieses Herrschaftstyps, seine Institutionenkonfiguration, die maßgeblichen Akteur*innen sowie deren Funktion beschrieben werden.
2.1Strukturmerkmale des Neopatrimonialismus
Die auf Weber zurückgehende Klassifikation patrimonialer Herrschaft zeichnet sich dadurch aus, dass alle Machtbeziehungen zwischen Herrscher und Beherrschten persönlicher Natur sind. Auch die Beziehungen zwischen Herrscher und Mandatsträgern, die die »entscheidenden Strukturen politischer Herrschaft in Ägypten« darstellen, zeichnen sich durch einen stark ausgeprägten patriarchal-personalen Charakter aus (Pawelka 1985: 23; vgl. auch Snyder 1992: 379). Persönliche und öffentliche Sphäre gehen in der Person des Herrschers auf, eine Trennung existiert nicht. Im Neopatrimonialismus gibt es zumindest formal eine Differenzierung zwischen öffentlichen Institutionen und privater Sphäre oder anders ausgedrückt: einen legal-bürokratischen Aspekt der Herrschaft und einen personalen. Allerdings sind Erstere vornehmlich dem Herrscher und seinen Interessen untergeordnet (Erdmann/Engel 2006: 18). Das patrimoniale (informale) Element überlagert das legal-rationale (formale) System und nimmt Einfluss auf seine Funktionen und Wirkmechanismen. Erdmann/Engel haben dies auf die kurze Formel gebracht, wonach »informale Politik in formale Institutionen eindringen würde« (2006: 18). Bratton/Van de Walle definieren neopatrimoniale politische Systeme als
»Hybrid systems in which the customs and patterns of patrimonialism co-exist with, and suffuse, rational-legal institutions. […] The chief executive and his inner circle undermine the effectiveness of the nominally modern state administration by using it for systematic patronage and clientelist practices in order to maintain political order. Moreover, parallel and unofficial structures may well hold more power and authority than the formal administration (1997: 62).«
Welcher Anteil nun bei der Entscheidungsfindung überwiegt, das patrimoniale oder aber das legal-bürokratische Element, ist praktisch kaum vorherzusagen oder auszumachen. Außerdem werden Institutionen und Ämter bis zu einem gewissen Grad personalisiert. Ein Strukturmerkmal neopatrimonialer Systeme ist deshalb die große Unsicherheit, was das Handeln staatlicher Akteur*innen angeht (Erdmann/Engel 2006: 19).
Pawelka unterscheidet ferner fünf weitere Strukturmerkmale neopatrimonialer Herrschaft: Erstens steht der Herrscher im Mittelpunkt des Herrschaftssystems. Entscheidend ist der Top-Bottom-Ansatz, d.h. Entscheidungsfindung und politische Willensbildung vollziehen sich von oben nach unten. Der Herrscher und der ihm unterstellte Staatsapparat übernehmen die Funktion der Interessenartikulation und -aggregation, die in liberal-demokratischen Systemen von den Parteien erfüllt werden (1985: 24ff.).
Um ihn herum existiert ein Netz von kooptierten, klientelisierten Eliten und Patronagenetzwerken, Politikern und Beamten, die je nach ihrer Stellung im Entscheidungsfindungsprozess näher oder weiter entfernt von ihm sind und durch ein »Netz personaler Beziehungen« das Lenkungsinstrumentarium des Staatsapparates dominieren (Erdmann/Engel 2006: 20ff.; Pawelka 1985: 29).
Zugleich sind Patronagenetzwerke ein wichtiges Werkzeug für den Herrscher, politische Kohäsion herzustellen und zu erhalten. Sie repräsentieren kooptierte (Staats)Klassen und versorgen sie mit politischen und materiellen Renten (Erdmann/Engel 2006: 21). In Ägypten gezielt privilegierte und verrentete strategische Gruppen wie das Militär, Geheimdienste, Unternehmer und die höhere Staatsbürokratie tragen zur Stabilität des Systems bei, indem sie ein großes Interesse am Erhalt der Regierung entwickeln, was aber nicht heißt, dass diese Gruppen als homogen anzusehen sind (Hinnebusch 2015a; Kreitmeyr/Schlumberger 2010: 17). Neben materiellen Zuwendungen zählen dazu auch die Ämtervergabe und die Sicherung von exklusiven Marktzugängen in der Privatwirtschaft (Heydeman 2004). Damit wird die Steuerungs- und Allokationsfähigkeit von Ressourcen zu einem essentiellen Faktor für die Überlebensfähigkeit des Staates, die ihm seine derart erkaufte Legitimität sichert (Luciani 1987).
Weiterhin beruht die Legitimation der Herrschaft auf traditionaler Loyalität, in deren Mittelpunkt der Staat, verkörpert in der Person des (charismatischen) Herrschers, mit seiner Verantwortung für die soziale Ordnung steht (Pawelka 1985: 25). Deutlich tritt hier das patriarchale Element zutage, das den Staat als wohlwollenden Versorger, als ideellen Vater, konzipiert. Die Distribution von Renten unterliegt dem Erfordernis der Systemerhaltung und der Konservierung der Sozialordnung und soll drittens durch eine starke Machtkonzentration einerseits innerhalb des Machtzentrums, also zwischen Herrscher und Eliten, und andererseits zwischen Herrschaftszentrum und Gesellschaft, eine rigorose Unterbindung gesellschaftlicher Partizipation in Form autonomer gesellschaftlicher Interessenorganisationen und -artikulationen kompensieren (Kreitmeyr/Schlumberger 2010; Pawelka 1985: 25).
Bereits hier lässt sich thesenhaft andeuten, dass nicht zuletzt die Überwindung dieser Struktur für einen erfolgreichen Transitionsprozess in Ägypten von zentraler Bedeutung ist und ein Regimewandel sich auch an der Frage entscheidet, ob die neuen oppositionellen Akteur*innen in diesem Prozess in der Lage sind, das herrschende Machtmonopol aufzubrechen sowie die daran geknüpfte soziale Ordnung zur Disposition zu stellen. Substantielle Demokratisierung beschränkt sich nicht nur auf die politischen Strukturen, sondern schließt eine Transformation des (in)formellen Gesellschaftsvertrags, der zwischen herrschenden Gruppen und benachteiligten gesellschaftlichen Schichten besteht, ein, damit ein neuer und stabiler legitimer Herrschaftsmodus gefunden werden kann.
Inwieweit die in der Literatur verbreitete These aber zutrifft, wonach die Aufstände von 2011 nur in den arabischen Republiken ausgebrochen seien, weil diese Staaten an ihrem eigenen, normativen Legitimationsanspruch gescheitert seien, demokratische und soziale Ordnungen zu verkörpern und somit einen informellen Gesellschaftsvertrag gebrochen hätten, bleibt allerdings sehr fraglich (Schumann 2013: 29). Empirisch lässt sich diese Behauptung nicht halten, gab es doch Aufstände in den Monarchien Marokko, Jordanien und Bahrain, die in ihrer Intensität jedoch weit hinter den Aufständen in Tunesien, Ägypten oder Syrien zurückblieben.
Darüber hinaus kennzeichnen ein neopatrimoniales System ein kontinuierlicher intraelitärer Konkurrenzkampf und ein Verhandeln von Machtpositionen. Dieses Ringen werde vom Herrscher geschürt, um die eigene Position zu stärken und potentielle Oppositionskräfte zu zersplittern (Hinnebusch 2003: 109f.). Zugleich erhöht ständige Personalrotation die Problemlösungskapazitäten des Staates und optimiert so die Entscheidungsprozesse der Zentralgewalt (Pawelka 1985: 25). Andererseits werden die Strukturmerkmale der Unsicherheit, Informalität und Personalismus auf diese Weise weiter verstärkt, weil staatliche Akteur*innen ihre prekäre Position durch informale, persönliche Netzwerke und Einflussnahmen zu konsolidieren versuchen und so die systemimmanente Unsicherheit reproduzieren (Erdmann/Engel 2006: 19).
Daraus resultiert fünftens eine auf die Durchsetzung eigener kurzfristiger Interessen gerichtete Orientierung politischer Eliten und dysfunktionale ineffiziente Tendenzen, die zur Selbstzerstörung des Herrschaftsapparats führen können (Pawelka 1985: 26). Vieles hängt vom Geschick und der Moderationsfähigkeit des Herrschers ab, die konfligierenden Interessen zu integrieren und einen ständigen Ausgleich zu schaffen. Der politische Prozess ist auf diese Weise von personalen Beziehungen und Positionskämpfen geprägt, bei denen die partikularistischen Interessen dominieren und Netzwerke, die dem Präsidenten nahe stehen, versuchen ihre Nähe zu ihm auszunutzen (Hinnebusch 2003: 110ff.). Staatliche Institutionen können damit nur auf eingeschränkte Weise ihren Zweck der »gemeinschaftlichen Wohlfahrt« erfüllen (Erdmann 2002: 334). Zugleich bedeuten diese intraelitären Positionskämpfe eine Abschottung der politischen Sphäre gegenüber dem größten Teil der Gesellschaft, weil die patrimonialen Strukturen nur dem oberen Teil der Gesellschaft Zugang zu Eliten gewähren (Pawelka 1985: 26). Dieses Strukturmerkmal wird dann zum Legitimationsproblem für den neopatrimonialen Staat, wenn sich Ressourcenmangel, eine sogenannte Rentenlücke und unbefriedigte Bedürfnisse auf breiter Basis zu Protestbereitschaft bündeln. (vgl. grundlegend zu diesem Konzept am Beispiel Ägyptens Ibrahim 1997).
Nicht nur dieses letzte Merkmal des neopatrimonialen Systems gilt als Schwachpunkt des Modells: Die Perspektive, wonach die Funktion der herrschenden Machtgruppen sich in der Reproduktion des vorgegebenen Verteilungsmusters von Macht erschöpfe, ist zirkulär und vermag gesellschaftlichen Wandel und revolutionäre Prozesse nicht zu erklären (Offe 2003b: 13; Schumann 2013: 23). Der statische Charakter des Modells, wonach sowohl Stabilität als auch Zusammenbruch eines neopatrimonialen Systems vom Geschick oder dem Unvermögen der Zentralgewalt abhängen, ignoriert die Rolle externer Faktoren und diejenige von sozialem Protest gleichermaßen. In seiner Konzentration auf die Funktionseliten des politischen Systems ignoriert Pawelka die Rolle der Zivilgesellschaft und von Akteur*innen, die von unten kommen gänzlich (vgl. kritisch Stacher 2012: 33). Auch kritische Elitenansätze, wie der von Mills (1957), Mills/Horowitz (1979) oder auch Crewe (1974) und Latham (1965 [1952]), die sich mit dem Verhältnis von Eliten und Bewegungen auseinandersetzen, werden nicht berücksichtigt. Die Rolle von Institutionen bleibt stark unterbeleuchtet.
Trotz seiner Mängel sollen die Strukturmerkmale des neopatrimonialen Modells als Analyserahmen herangezogen werden, weil es den institutionellen Ist-Zustand Ägyptens vor dem Aufstand und somit die Strukturbedingungen für die gesellschaftlichen Akteur*innen gut abbildet. Die theoretischen Grundannahmen des Modells sollen allerdings mittels des SKOG-Ansatzes erweitert werden (Kap. I-3.1).
2.2Das Militär im neopatrimonialen System: Ruling but not Governing1
Seit der Etablierung der ägyptischen Republik 1952 und ihrer Konsolidierung 1954 spielt das ägyptische Militär eine Mal größere, Mal kleinere Rolle in der ägyptischen Politik und Gesellschaft. Spätestens jedoch seit dem Oktoberkrieg 1973 genießt der Militärsektor im neopatrimonialen System Ägyptens eine privilegierte Stellung in Staat und Wirtschaft (Pawelka 1985: 39). Dem Militär kommen »reservierte Bereiche« (reserved domains) sowie »uneingeschränkte Befugnisse« (discretionary powers) in autoritären Systemen zu (Croissant/Kühn 2011: 9). Erster Begriff bezieht sich auf die Fähigkeit von Militärapparaten, bestimmte Politikfelder dem Handlungsfeld ziviler Autoritäten zu entziehen und letzterer zielt auf die Fähigkeit von Militärs ab, »sich selbst in den politischen Entscheidungsprozess einzuschalten« (ebd.). Cook hingegen spricht von »militärischen Enklaven« (military enclaves), die vom Rest der Gesellschaft abgetrennt seien (2007: 14). Unabhängig von der Benennung liegt das übergeordnete Interesse des Militärs darin, die vorherrschende politische Ordnung zu konservieren, von der es in nicht unerheblichem Ausmaß profitiert (Cook 2007: 15; Pawelka 1985: 39).
Die beschriebenen Mechanismen und Strukturmerkmale des neopatrimonialen Systems Kooptation, Klientelismus und Patronage sind auch in den Beziehungen zwischen staatlich-politischen Eliten und den hohen Rängen im Militär dominant (Springborg 1987: 6). Die Kerninteressen des Militärs als strategischer Akteur im politischen System Ägyptens erstrecken sich auf vier Domänen: Wirtschaft, Sicherheit und Außenpolitik, Staatsapparat sowie die Aufrechterhaltung eines nationalistischen Narrativs, das seine Herrschaft legitimieren soll.
Weite Teile der ägyptischen Ökonomie fallen unter die Kontrolle des Militärs (Alnasseri 2016b: 128ff.; Amar 2011). Fünf Bereiche seiner Wirtschaftsdomäne werden in der Literatur unterschieden: Das jährliche Verteidigungsbudget, US-amerikanische Finanzhilfen, Waffengeschäfte, Industriekonglomerate und Fabriken, die von der Arab Organization for Industrialization (AOI)2 betrieben werden sowie der National Service Projects Organization (NSPO), die direkt dem Verteidigungsministerium untersteht (Chams el-Dine 2016: 188; Cook 2007: 19). Die NSPO, ein Konglomerat von Firmen, welches vor allem Nahrungsmittel produziert sowie als öffentlicher Auftraggeber auftritt, ist ein gutes Beispiel für die personellen Überschneidungen und Interessenkonvergenzen hochrangiger Angehöriger der Eliten: Unter Mubaraks langjährigem Verteidigungsminister Abd al-Halim Abu Ghazala (1981-1989), der zugleich Feldmarschall war, wuchs die NSPO zu einem der größten Wirtschaftsunternehmen Ägyptens an (Abul-Magd 2014: 3; Springborg 1987: 6ff.). Auch in den 1990er und 2000er Jahren wuchsen die Tätigkeitsbereiche von AOI und NSPO weiter an (Abul-Magd 2014: 3ff.). Im Gegenzug sind vom Staat kontrollierte Wirtschaftssektoren wie die Häfen am Roten Meer oder die Suez-Kanal Verwaltung von hohen (ehemaligen) Militärs besetzt. Die Wirtschaftsunternehmungen des Militärs sollten im Anschluss an den ruinösen Juni-Krieg von 1967 und dem folgenden jahrelangen Abnutzungskrieg gegen Israel dieses befähigen, autark seine Ausrüstung unterhalten zu können. Der Staatshaushalt sollte entlastet werden. Doch mit der Zeit entwickelte sich das Militär zu einer wirtschaftspolitischen Last für das gesamte Land, da die korrupten Strukturen nur Militärangehörige und von ihnen alimentierte Klassen am oberen Ende der Sozialstruktur privilegieren (Cook 2007: 19).
Hinsichtlich der Sicherheits- und Außenpolitik behält sich das Militär vor, Entscheidungen in diesem Bereich selbst zu treffen (ebd.: 22). Das Primat des Militärs über die Politik war 1991 bei der sogenannten Golfkrise deutlich zu sehen, als Ägypten – trotz erheblicher innenpolitischer Widerstände – über 30000 Soldaten nach Saudi-Arabien entsandte sowie in den Jahren nach as-Sisis Putsch 2013, als er etwa auf Seiten verschiedener Golfländer in Libyen intervenierte. Auch der Friedensvertrag mit Israel von 1979 wurde vom Militär gegen erhebliche innenpolitische Widerstände durchgesetzt, nicht zuletzt aufgrund der erwähnten Finanzhilfen der USA in Milliardenhöhe, die direkt an das Militär fließen.
Strukturell existieren Verflechtungen nicht nur im Bereich Wirtschaft und Militär, sondern auch auf der politischen Ebene: Neben dem Präsidenten sind spätestens seit Mubaraks Machtübernahme 1981 eine Mehrheit der Provinzgouverneure ehemalige Militärangehörige (ebd.: 26). Offiziell befinden sie sich zumeist im Ruhestand, jedoch sind die interpersonalen Verbindungen in den Militärapparat so gefestigt, dass von Unabhängigkeit keine Rede sein kann. Auch 2011, kurz vor Ausbruch der Revolution, waren 18 der 27 Provinzgouverneure in Ägypten ehemalige Militärgeneräle oder -offiziere (Abul-Magd 2014: 4). Und selbst Mohammed Mursi, Kurzzeitpräsident der Muslimbruderschaft, durchbrach diese Logik nicht, sondern berief mehrere ehemalige Militäroffiziere zu Provinzgouverneuren und auf andere hohe Posten in der ägyptischen Verwaltung (ebd.: 6). Ihre Loyalität zum Militärapparat setzten sie dazu ein, politische Entwicklungen zu kontrollieren, die Entstehung einer Opposition zu verhindern sowie Protest zu unterdrücken. In diesem Sinne ist eine Überwindung des autoritären Status Quo nur möglich, wenn die existierenden Institutionen von personalen Elementen des alten Regimes – insbesondere Angehörigen des Militärsektors – befreit werden.
Aber auch auf der ideologischen Ebene benötigen neopatrimoniale Systeme eine Legitimationsbasis. Neben der charismatischen Herrschaft des legendären Nassers, schuf sich das Militär – insbesondere nach dem Suezkrieg 1956 und dem Oktoberkrieg von 19733 – ein Narrativ, in dessen Mittelpunkt seine Rolle bei der Verteidigung des Landes gegen imperialistische Aggression, israelische Landnahmeversuche sowie als Hüter der republikanischen Ordnung steht. Auch auf der regionalen Ebene hat sich das ägyptische Militär als Hüter von Stabilität inszeniert (Cook 2007: 27f.).
Wie in der Analyse des Transitionsprozesses zu zeigen sein wird, war und ist das Militär seit 2011 bemüht, dieses nationalistische Narrativ gegen konkurrierende säkular-zivile wie islamische Narrative aufrechtzuerhalten und seine Rolle im institutionellen Gefüge des Landes zu bewahren. Insbesondere die seit 1928 existierende Muslimbruderschaft, kann sich auf ihren antikolonialen Beitrag in der Bekämpfung der britischen Besatzungsmacht sowie auf ein kohärentes nationalistisches, jedoch islamisch eingefärbtes Narrativ berufen. Im Kampf um die Deutungshoheit der Ereignisse nach dem Rücktritt Mubaraks, haben die Auseinandersetzungen um ein (neues) nationalistisches Narrativ im Hintergrund eine große Rolle bei der Mobilisierung und Konstituierung neuer politischer Interessenartikulationen gespielt.
2.3Transition autoritärer Regime
Die Autoritarismusforschung hat bis zum Beginn der politischen Umwälzungen des Jahres 2011 in der NAWA-Region versucht zu erklären, warum dort eine Demokratisierung nach Art der Dritten Welle bisher ausblieb (Huntington 1991; Kreitmeyr/Schlumberger 2010; Merkel 2010; vgl. kritisch: Schaffar 2018). Der Optimismus, der in den 1990er Jahren in der politikwissenschaftlichen Transformationsforschung vorherrschte, wonach eine Demokratisierung immer möglich sei, wich ab den 2000er Jahren zunehmend einem Pessimismus, der in der Formel der Persistenz autokratischer Regime in der NAWA-Region seinen Ausdruck fand. Diese Persistenz schien so nachhaltig zu sein, dass es oft nur noch um das warum einer Nicht-Demokratisierung ging (Albrecht/Frankenberger 2010b; Albrecht et al. 2011; Bellin 2004; Hinnebusch 2006; Volpi/Cavatorta 2006).4
Demzufolge lassen sich in der Literatur sechs Erklärungsansätze für die (scheinbare?) autokratische Persistenz und das Ausbleiben einer Demokratisierung in der NAWA-Region ausmachen (Schlumberger 2008): Neben der These, die zuweilen stark essentialisierende und kulturalisierende Formen annehmen kann, dass derIslam Schuld an einer ausbleibenden Demokratisierung sei (islamic democracy gap) (Huntington 1996; Karatnycky 2002; Koopmans 2020; vgl. kritisch Pawelka 2002; vgl. kritisch Tessler 2002a, 2002b), wird auf die arabische Kultur verwiesen (Arab democracy gap) (vgl. kritisch Carothers/Ottaway 2004; Kedourie 1992; Stepan/Robertson 2003). Angeblich unveränderliche Charakteristika von Muslim*innen oder Araber*innen wie Irrationalität, übersteigertes Ehrgefühl und ein Hang zu Gewalt seien für die Unmöglichkeit einer Demokratisierung verantwortlich (vgl. kritisch Diamond et al. 2003; Ghadbian 1997: 8ff.).
Ein klassisches Argument der Modernisierungstheorie besagt, dass ein hohes Pro-Kopf-Einkommen und ein gleichsam hoher Bildungsstand mit demokratischen Regierungsformen stark korrelieren (Dahl 1975; Lipset 1959). Je mehr sich Gesellschaften modernisieren, desto mehr würden sich die Einstellungen der Staatsbürger in Richtung demokratischer Werte verschieben. In der Tradition dieses Arguments stehen Autoren, die darauf hinweisen, dass die ökonomischen Strukturen und die daraus resultierende mangelhafte Entwicklung in der NAWA-Region für das Scheitern von Demokratisierungsversuchen verantwortlich seien (Beblawi/Luciani 1987; Przeworski et al. 2000). Mit Blick auf die Golfstaaten, lässt sich diese These empirisch jedoch kaum halten: Trotz reicher Ölvorkommen und einer mittlerweile fortgeschrittenen sozioökonomischen Entwicklung, ist Demokratie in diesen Ländern nicht in Sicht. Ross kommt sogar zu dem Ergebnis, dass reiche Ölvorkommen eine nachhaltige Demokratisierung verhindern, da die Einnahmen (Renten) von den herrschenden Eliten eingesetzt werden, um potentielle Parteigänger*innen der Demokratie zu klientelisieren, so dass sie kaum Anreize haben, gegen die herrschenden Eliten zu opponieren (vgl. auch Hinnebusch 2015a: 12; 2001).
Immanente politische und gesellschaftliche Strukturen sehen wiederum andere Autor*innen als Ursachen für ausbleibende Demokratisierung (Bratton/van de Walle 1994; Brownlee 2002; Pawelka 2002; Snyder 1992). Insbesondere das neopatrimoniale Herrschaftssystem, das auch in Ägypten seit Jahrzehnten Bestand hat, gilt als Haupthindernis auf dem Weg zu einer, wenn auch vorsichtigen, Demokratisierung.
Als letzter Bedingungsfaktor für die (ausbleibende) Demokratisierung gelten die internationalen Rahmenbedingungen. Aufgrund der geostrategischen Lage der NAWA-Region und ihrer reichen Erdöl- und Gasressourcen, haben westliche Akteur*innen zumeist kaum Anreize, den herrschenden Status Quo zu verändern und Demokratiebewegungen in der Region zu unterstützen5 (Schlumberger 2008: 125ff.). Mehr noch: Mit Waffenlieferungen haben insbesondere die USA autoritäre Herrscher über Jahrzehnte unterstützt – so auch Mubarak in Ägypten. Die kriegerischen Unternehmungen im Irak 1991 und 2003 sowie in Libyen ab 2011 und Jemen 2015 zeigen, dass die USA willens sind, ihre Interessen militärisch durchzusetzen, auch wenn sie diese unter dem Label Regime-Change und Demokratisierung verschleiern (Lust-Okar 2011: 168ff.).
Während monokausale Erklärungen für komplexe sozio-politische Prozesse und Entwicklungen kaum je fruchtbare Erkenntnisse zeitigen, helfen uns diese Ansätze in Summe doch, wenn nicht die Ursachen, so doch den Verlauf der Transition in unserem Untersuchungszeitraum besser zu verstehen. Abgesehen von den kulturalisierend-depolitisierenden Erklärungsmustern, spielen strukturelle Elemente wie sozioökonomische Entwicklung, die bisherige Regimekonfiguration, die Einbettung eines Landes ins »Weltsystem« sowie gesellschaftliche und politische Tendenzen eine große Rolle bei einem Regimewandel (Wallerstein 2012).
Von innergesellschaftlichen Entwicklungen abzusehen, wie es die frühe Transformationsforschung tat, und Regimewandel ausschließlich als Funktion von Brüchen innerhalb der herrschenden Eliten zu deuten, der einer starren Teleologie folgt, an dessen Ende eine zwangsläufige Demokratisierung gesellschaftlicher und politischer Prozesse steht, hieße die Rolle sozialer Akteur*innen und der Wechselfälle zwischen ihnen und den herrschenden Regimen zu vernachlässigen (Carothers 2002: 7f.; Schlumberger 2008: 83).
Damit ist im konkreten Fall die Frage verbunden, wie die Übergangsphase zwischen 2011 und 2013 konzeptionell und theoretisch einzuordnen ist: Handelte es sich bei diesem Prozess um den Ausgangspunkt einer Liberalisierung, an deren Ende eine konsolidierte Demokratie stehen würde oder waren die vom Regime eingeleiteten Liberalisierungsmaßnahmen nur eine vorübergehende strategische Anpassung, um der zunächst temporären Legitimationskrise des Systems Herr zu werden (vgl. kritisch Harders 2013: 27)?
Die Autoritarismusforschung hat versucht, die verschiedenen Spielarten dieser Übergänge zu konzeptualisieren und die alte Dichotomie zwischen Demokratie und Autoritarismus zu überwinden, indem sie verschiedene Begrifflichkeiten für »unfertige Demokratien« bzw. »liberale Autokratien« in Transitionsprozessen einführte (Hinnebusch 2010; Stacher 2012: 32): »Demokratie mit Adjektiv« (Collier/Levitsky 1997), »Pseudodemokratie« (Diamond 2002; Volpi 2004), »liberalisiertes autoritäres Regime« (Brumberg 2002a), »kompetitiver Autoritarismus« (Levitsky/Way 2013) sowie »hybrides Regime«, das in einer Grauzone zwischen Demokratie und Autoritarismus angesiedelt sei (Bendel et al. 2002; Diamond 2002; Rüb 2002).
Merkel (2010: 25; 37-48) präzisiert diese Begrifflichkeiten, indem er eine Typologie defekter Demokratien und autoritärer Regime einführt. Diese unterscheidet er nochmals nach Subtypen »real existierender Regime«. Ausgangspunkt für die Typologie defekter Demokratien und autoritärer Regime ist die Definition von fünf Teilregimen einer konsolidierten, »eingebetteten Demokratie«, wie er es nennt: Demokratisches Wahlregime, politische Partizipationsrechte, bürgerliche Freiheitsrechte, institutionelle Sicherung der Gewaltenkontrolle (horizontale Verantwortlichkeit) sowie die Sicherung der effektiven Regierungsgewalt (de jure und de facto) (ebd.: 30).
Die vier Formen defekter Demokratien exklusive Demokratie, Enklavendemokratie, illiberale Demokratie und delegative Demokratie zeichnen sich folglich durch das teilweise Fehlen bzw. die Dysfunktionalität eines oder mehrerer Teilregime der eingebetteten Demokratie aus. Beim häufigsten Typ einer defekten Demokratie, der illiberalen Demokratie, ist die Kontrolle von Legislative und Exekutive durch die Judikative stark eingeschränkt. Die Rechtsstaatsdimension, also individuelle Freiheits- und Schutzrechte, sind entweder gar nicht oder nur teilweise gewährleistet (ebd.: 37f.).