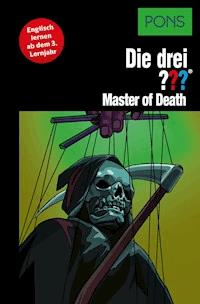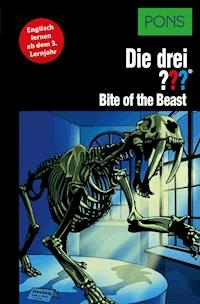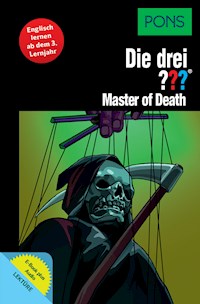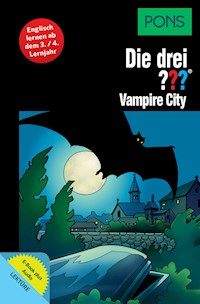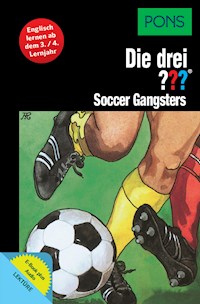13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Fachkommunikation, Sprache, Note: 1,7, SRH Hochschule Riedlingen, Sprache: Deutsch, Abstract: Seit Korax und Teisias sind Jahrhunderte vergangen, dennoch gelten viele der Lehren aus der altgriechischen Rhetorik noch heute. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung der Rhetorik von der Zeit der großen griechischen Rhetoriker bis heute. Zunächst wird sich mit der griechischen Rhetorik im geschichtlichen Verlauf von Korax bis Aristoteles beschäftigt. Die Arbeit schneidet dabei auch das Thema der "Sophisten" und die Unterscheidung zwischen Überredung und Überzeugung an. Im zweiten Teil geht die Hausarbeit auf die aktuelle Nutzung der Rhetorik in Politik und Medien, sowie beispielhaft auf andere Möglichkeiten der (Meinungs-)Beeinflussung ein. Hier wird unter anderem Bildmanipulation (am Beispiel von "Varoufake" und einem Bild aus einem Kriegsgebiet), aber auch Beeinflussung/Lenkung der öffentlichen Aufmerksamkeit durch Selektion der Tagesnachrichten thematisiert. Im letzten Abschnitt befasst sich die Arbeit mit der Entwicklung der Alltagskommunikation im 21. Jahrhundert und den Auswirkungen von Kurznachrichten und Social Media Netzwerken auf das sprachliche Niveau von Kindern und Jugendlichen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Ursprünge der Rhetorik
1.1 Rhetorik bei Aristoteles
1.2 Die Sophisten
1.3 Nutzung der Rhetorik
2. Meinungsbildung im 21. Jhd
2.1 Heutige Rolle der Rhetorik
3. Entwicklung der Kommunikation
3.1 Einfluss neuer Medien auf die Kommunikationsqualität
Literaturverzeichnis
1. Ursprünge der Rhetorik
Korax und sein Schüler Teisias gelten als die Begründer der Rhetorik in der Antike. Aber auch schon deutlich vor dem ersten bekannten Redelehrer Korax im 5. Jhd. v. Chr. gab es erfolgreiche Redner, die sich (bewusst oder unbewusst) der Redekunst bedienten. Folglich hat Korax nicht die Rhetorik als solche begründet, sondern sie lediglich aus der vorhandenen Praxis abgeleitet und beschrieben.[1]Schopenhauer als vergleichsweise moderner Blickwinkel geht sogar von einer naturgegebenen Dialektik aus:„Die Hilfsmittel hiezu gibt einem jeden seine eigne Schlauheit und Schlechtigkeit einigermaßen an die Hand: dies lehrt die tägliche Erfahrung beim Disputieren; es hat also jeder seine natürliche Dialektik, so wie er seine natürliche Logik hat.“[2] Woher die Rhetorik im Ursprung stammt, lässt sich nicht mehr zurückverfolgen. Allerdings lässt sich der Verlauf nach Korax nachvollziehen. Es ist überliefert, dass der Redelehrer Gorgias von Leontinioi, der 427 v. Chr. nach Griechenland kam, einen großen Teil zur Entwicklung und Verbreitung der Rhetorik beitrug. Er selbst erlangte seine Redekunst in Gerichtsverhandlungen in Sizilien.[3] Etwa zur gleichen Zeit entwickelte der Philosoph Sokrates eine rhetorische Dialogform, die er Mäeutik nannte. Hierbei geht es im Kern darum, Wissen zu vermitteln indem man den Dialogpartner durch gezielte Fragen zur Erkenntnis bringt. Dadurch, dass dieser selbst zur Einsicht gelangt ist, es also sein eigener Gedanke war, nimmt er das Gelernte besser für sich an.[4] Lysias, der sich von Teisias in der Rhetorik hatte Unterrichten lassen, verdiente seinen Unterhalt mit dem Schreiben von Reden. Er schrieb vor allem Reden für Gerichtsverhandlungen, bei denen er sein rhetorisches Geschick einsetzte um seinen Kunden zum Recht zu verhelfen. Isokrates hatte die Rhetorik bei Gorgias von Leontinioi studiert und verfasste zunächst wie Lysias auch Gerichtsreden. Diese Tätigkeit gab er allerdings nach Eröffnung einer eigenen Rhetorikschule auf. Karl-Heinz Göttert fasst den Grundgedanken Isokrates’ wie folgt zusammen: „Was Isokrates im Auge hatte, war die kulturstiftende Rolle der Sprache, ihre integrierende, ja pazifizierende Wirkung im menschlichen Zusammenleben“[5]. Tatsächlich geht es Isokrates primär um die Rhetorik als sprachliches/stilistisches Mittel. Zugunsten der Rhetorik stellt er die Philosophie hinten an[6] und sieht sich damit im Konflikt mit dem Philosophen Platon. Dieser hatte bei Sokrates gelernt und die erste Philosophenschule Griechenlands gegründet, die „Platonische Akademie“. Hier lehrte er im Gegensatz zu Isokrates vor allem die Philosophie, der die Rhetorik seiner Meinung nach bestenfalls untergeordnet sein sollte. Seine Schule wird z.T. sogar als „rhetorikfeindlich“[7] bezeichnet. Aristoteles, einer der bekanntesten griechischen Philosophen der Geschichte, hatte bei Platon gelernt, nimmt jedoch nicht die gleiche Position ein wie sein Lehrvater, sondern bringt Rhetorik und Philosophie zusammen. Seine Werke behandeln unter anderem die Themen Physik, Astronomie, Meteorologie, Biologie, Philosophie und Politik.
1.1 Rhetorik bei Aristoteles
Natürlich nimmt auch die Rhetorik einen großen Stellenwert bei Aristoteles ein, eines seiner Werke befasste sich ausschließlich mit der Redekunst. Er nimmt beispielsweise eine Einteilung in drei „Arten der Beredsamkeit“[8] ,auch genera orationis (Redegattungen) genannt, vor: genus iudicale – Gerichtsrede, genus deliberativum – Beratungsrede und genus demonstrativum – Lobrede. Diese ordnet er auch temporal ein: Die Gerichtsrede für Vergangenes, denn die Taten über die gesprochen wird sind bereits vergangen; die Lobrede für die Gegenwart; und die Beratungsrede für Entscheidungen, die die Zukunft betroffen oder in der Zukunft gefällt werden.[9] Den einzelnen Redegattungen weist er bestimmte Merkmale, ein bestimmtes Publikum und die daraus hervorgehenden Verhaltensweisen zu.[10] Er schafft damit eine erste verschriftlichte Grundlage für das zielgruppenorientierte schreiben von Texten. Außerdem erstellt er eine Einordnung in status orationes – vier Frageweisen für die Rechtspraxis. Er unterteilt die Fragen in status coniecturae – Vermutungsfragen, status finitionis – Definitionsfragen, status qualitatis – Rechtsfragen und status translationis – Verfahrensfragen.[11] Wenn auch vorrangig für genus iudicale geschrieben, lässt sich die Statuslehre auch auf die beiden anderen aristotelischen Genera anwenden.[12] Status und Genus nach Aristoteles geben wichtige Hinweise zur Redevorbereitung. Wie die Rede allerdings stilistisch ausgestaltet werden soll, kann erst entschieden werden wenn die Intention des Redners geklärt ist. Hierzu hat Aristoteles die officia oratoris – die Aufgaben des Redners in drei Bereiche unterteilt: Logos, der Redner versucht die Zuhörer intellektuell zu Einsicht zu bewegen, hierzu muss der Redner muss die Zuhörer belehren (docere) oder ihnen mittels Argumenten etwas beweisen (probare); Ethos, hierbei versucht der Redner die Zuhörer zu besänftigen, sie emotional für seine Sache zu gewinnen (conciliare) oder zu erfreuen (delectare); und Pathos, der Redner versucht die Zuhörer zu bewegen (movere) oder gegen jemanden oder etwas wie z.B. den Gegenredner aufzustacheln (concitare). Aristoteles strebte nach einem Ausgleich zwischen den drei Aufgaben des Redners, einer emotionalen Beeinflussung sollten in der Regel auch logische Argumente vorausgegangen oder gefolgt sein.[13]
1.2 Die Sophisten
Mit voranschreitender Entwicklung der Rhetorik, kamen auch Zweifel über Zweck und Stellenwert der Redekunst auf. Durch geschickte rhetorische Manöver, konnte derjenige der eigentlich im Unrecht war, das Recht zugesprochen bekommen. Platon vergleicht die Rhetorik mit Schmeichelei und gibt zu bedenken, dass die Gefahr bestünde, die Frage nach dem wirklichen Recht hierdurch aus dem Fokus zu verlieren.[14] Schopenhauer schreibt darüber: „...wer als Sieger aus einem Streit geht, verdankt es sehr oft, nicht sowohl der Richtigkeit seiner Urteilskraft bei Aufstellung seines Satzes, als vielmehr der Schlauheit und Gewandtheit, mit der er ihn verteidigte.“[15] Genau dies warfen Platon, Aristoteles und wahrscheinlich auch Sokrates (so steht es in Platons Schriften) den sogenannten Sophisten (griech. „Weisheitslehrer“) vor. Die Sophisten waren eine Bewegung, die bestehende Moralvorstellungen und Werte wie auch das mythische Weltbild um den griechischen Pantheon in Frage stellten, und so maßgeblich zur Aufklärung beitrugen. Sie wichen allerdings nicht nur von Werten und Normen ab, sondern auch von etablierten Sichtweisen auf die verschiedenen möglichen Sichtweisen der Individuen. Hierdurch ergab sich eine Verschiebung der Wahrheitswahrnehmung, eine objektive Wahrnehmung ist in dieser Betrachtungsweise kaum möglich. Durch die subjektivistisch-relativistische Tendenz der Sophisten, kannten sie nur positionsabhängige Standpunkte.[16] Die Sophisten lebten als wandernde Lehrer, die gegen Bezahlung die Rhetorik lehrten und ihren Schülern die Mittel an die Hand gaben, einen Disput mit rhetorischen Mitteln zu gewinnen.[17] In den Diskussionen gab es für die Sophisten selten Recht oder Unrecht, der Sophist Protagoras (481-411 v.Chr.) stellte hierzu einen noch immer bekannten Satz auf: “Der Mensch ist das Maß aller Dinge, der Seienden, wie sie sind, der nicht seienden, wie sie nicht sind“[18]. Von den zuvor bereits genannten Rhetorikern gelten Gorgias[19], Lysias[20] und Isokrates[21] als Sophisten. Ersterer wurde von Platon wegen seiner sophistischen Ansichten der Wortverdreherei bezichtigt.[22] Aristoteles sieht die Rhetorik als wichtiges Instrument an, sie solle allerdings zur Überzeugung genutzt werden, nicht zur Überredung. Die Überredung war für Aristoteles ein sophistisch geprägter Begriff, Überredung bedeutet für ihn das Gegenüber um jeden Preis von seiner Sache zu überzeugen, auch mit Scheinwahrheiten und Trugschlüssen. Überzeugen hingegen kann man jemanden nur von einer Sache, die auch für den Gesprächspartner Sinn ergibt, von der er am Ende eben selbst Überzeugt sein kann – und nicht etwa überredet worden ist.[23]
1.3 Nutzung der Rhetorik
Schon immer war die Rhetorik Bestandteil der Literatur. Jeder der Texte verfasste, bediente sich bewusst oder unbewusst stilistischer Mittel und griff somit in die rhetorische Trickkiste. Da sich schon früh der Begriff Redekunst prägte, lässt sich auch dieser Aspekt der Rhetorik nicht absprechen. Hier lässt sich die Rhetorik gewissermaßen als Werkzeug für den künstlerischen Umgang mit der Sprache begreifen – und dies muss nicht zwangsläufig in Literatur münden.
Die frühen Rhetoriker wie Gorgias von Leontinioi nutzten die Redekunst vor allem zum Formulieren von Anklage- und Verteidigungsreden von Gericht. Hier galt es den Sachverhalt möglichst drastisch oder harmlos erscheinen zu lassen, sowie den Angeklagten in ein gutes oder schlechtes Licht zu rücken, um dadurch das gewünschte Resultat, wie z.B. eine Verschiebung des Strafmaßes, zu erreichen. Im Zuge der Entwicklung erster demokratischer Tendenzen, wurde es für Politiker und andere Menschen die in der Öffentlichkeit standen immer wichtiger, möglichst viele Bürger von ihrer Meinung zu überzeugen – so fand die Rhetorik auch Anwendung in der Politik und Rhetorikschulen erhielten mehr und mehr Zulauf. So wurde die Rhetorik mit der Zeit zu einem Kulturgut, für angesehene Bürger und solche die es werden wollten, war es wichtig sich gewählt und rhetorisch geschickt ausdrücken zu können.
2. Meinungsbildung im 21. Jhd
Von der Zeit der frühen griechischen Rhetoriker bis heute, hat sich vieles verändert. Zentrum öffentlicher Diskussionen ist nicht mehr die Agora sondern das Internet, Reden finden nicht mehr nur ein Publikum von einigen Duzend Menschen, die gerade vor Ort sind, sondern erreichen über die Massenmedien theoretisch fast jeden Bürger und das geschriebene Wort ist nicht mehr die einzige Möglichkeit, Reden und Wissen aufzubewahren und in die Welt hinaus zu tragen. Insgesamt ist die Kommunikation schneller, aber auch schnelllebiger geworden. Und durch das scheinbare zusammenrücken der Welt durch bessere Kommunikationsinfrastruktur erreicht uns täglich eine Flut von Informationen, die kein Mensch verarbeiten könnte. Berichte werden gekürzt, Themen werden selektiert und nach Aktualität und öffentlichem Interesse priorisiert. Die Möglichkeiten der Beeinflussung sind stark angestiegen, allein zuvor genannte Priorisierung, die Entscheidung darüber welche Nachrichten gesendet, gedruckt und thematisiert werden, steuert den Fokus eines Großteils der öffentlichen Bevölkerung. Einseitig laufende Massenmedien wie Fernsehen, Radio, Zeitungen und Magazine ermöglichen es einigen wenigen, die Meinung von vielen zu beeinflussen. Man könnte von einem Oligopol auf die öffentliche Meinungsbildung sprechen. Aber nicht nur die Frage ob eine Nachricht oder wie im folgenden Beispiel ein Bild veröffentlich wird, ist entscheidend für die bei den Adressaten entstehende Meinung:
Abbildung 1: Ein irakischer Soldat umgeben von amerikanischen Soldaten. Teil der Ausstellung "Bilder, die Lügen" der Stiftung Haus der Geschichte der BRD.
http://www.spiegel.de/fotostrecke/manipulierte-bilder-fotostrecke-107186-3.html
Durch die Position der Soldaten und den Blickwinkel der Kamera, hängt es stark vom Bildausschnitt ab, welcher Eindruck erweckt wird. Nimmt man nur den linken Bildausschnitt, so wirkt es fast wie eine Hinrichtung, es hinterlässt in der breiten Masse sicherlich einen negativen Eindruck. Wenn man hingegen nur den rechten Bildausschnitt wählt, so sieht das Bild nach Unterstützung aus, fast schon wie eine humanitäre Mission. Die Reaktionen der Rezipienten auf das Bild werden wahrscheinlich eher positiv ausfallen. Die Art der Darstellung lässt hier also ebenfalls Raum für Überzeugung oder Überredung der Rezipienten. In diesem Fall handelte es sich lediglich um ein einzelnes Foto. Die Möglichkeiten, die Bewegtbild- und Audioaufzeichnungen eröffnen sind noch um einiges Größer. Dies reicht von geschickter Montage durch einfache Schnitte bis hin zu aufwändig bearbeiteten/manipulierten Bildsequenzen, die uns eine Scheinwirklichkeit zeigen können, die es nie gab. Ein gutes Beispiel hierfür ist ein Video aus der ZDF Sendung „Neo Magazin Royale“, das im Internet unter dem Namen „Varofake“ verbreitet wurde. Hier geht es um einen Video-Einspieler, der bei Günther Jauchs ARD Talkshow lief, in dem Yanis Varoufakis zu den Worten „and stick the finger to Germany“ den ausgestreckten Mittelfinger zeigt. Varoufakis selbst leugnet diese Geste bei der Rede gemacht zu haben[24], dies nimmt Satiriker Jan Böhmermann später in seiner Show „Neo Magazin Royale“ zum Anlass, zu behaupten das Video habe die seine Redaktion gefälscht. Es folgt ein Video, das den Fälschungsvorgang beschreibt und es werden zwei Videos gezeigt, eins mit gestrecktem Mittelfinger und eins ohne. Später wird auch noch eine Variante mit dem Zeigefinger präsentiert.[25]Das heute Journal stellt am Folgetag klar: die Fälschung sei gefälscht. Böhmermann und seine Redaktion habe nicht das Mittelfinger-Video gefälscht, sondern die anderen Varianten.[26]Im Internet herrscht allgemeine Verwirrung, was wohl auch Ziel der Aktion war.[27],[28]Hier wird deutlich wie schnell mein einer Täuschung, oder wie hier einer getürkten Täuschung zum Opfer fallen kann. Es existieren also im Vergleich zur Zeit der griechischen Philosophen deutlich mehr Möglichkeiten, die Meinungsbildung zu beeinflussen.
2.1 Heutige Rolle der Rhetorik
Trotz der neuen Medien und der daraus resultierenden Möglichkeiten, ist die Rhetorik ist immer noch ein funktionierendes Mittel, wenn es darum geht zu überzeugen. Unabhängig davon, ob es um Massen oder um Einzelpersonen bzw. kleine Gruppen von Menschen geht. In der deutschen Politik jedoch nimmt der Stellenwert der Rhetorik immer weiter ab. Gregor Gysi sieht hier als Grund wird hier vor allem der Einfluss der audiovisuellen Medien. Viele Inhalte ließen sich eben nicht so verkürzen, dass sie in die Zeitspannen, die z.B. für die Berichterstattung aus dem Bundestag zur Verfügung stehen, hineinpassen. Folglich wird der Raum für rhetorische Manöver hier sehr knapp.[29]Auch Rhetorik Professor Joachim Knape sieht das Problem neben den kürzeren Redezeiten in der Geschäftsordnung des Bundestags bei den vom Fernsehen geforderten Kurzstatements.[30]Die Sendezeiten für Bundestagsreden und Politikerstatements werden aber wahrscheinlich auch in Zukunft nicht länger ausfallen, wenn sie nicht rhetorisch und sprachlich ansprechend gestaltet sind. Auch die Fixierung auf den optischen Auftritt, statt auf Inhalte oder sprachlich-rhetorisches Niveau lastet Gysi den Medien als weiteren Kritikpunkt an. Er bemängelt außerdem, dass in Deutschland nur noch eine Hochschule existiert, an der Rhetorik als Studienfach gelehrt wird. Dies läge vor allem in der Zeit des Nationalsozialismus begründet, in einer Diktatur sei schließlich keine Gegenrede erwünscht und danach sei lediglich der eine Lehrstuhl wieder eingerichtet worden.[31]In anderen Ländern herrschen hier zum Teil andere Verhältnisse. Das britische Parlament beispielsweise sei hier deutlich diskussionsfreudiger und habe sogar „Unterhaltungswert“, so Knape. Dies läge vor allem in kulturellen Unterschieden begründet. Traditionell seien Sprache und Rhetorik in Großbritannien für die Politiker von hoher Wichtigkeit.[32]
Eine Branche in der die Rhetorik auch in Deutschland noch eine bedeutende Rolle spielt, ist die Werbeindustrie. Die Werberhetorik befasst sich mit Mitteln zur Überzeugung und Überredung, die innerhalb eines Mediums oder mehrerer Medien (z.B. im Rahmen einer Kampagne) genutzt werden sollen, um die Rezipienten zu einem bestimmten Verhalten zu veranlassen, meist jedoch um Rezipienten zu Kunden zu machen.[33]Im Kern gleicht eine Werbebotschaft einer Rede, es finden sich hier folglich gängige Redeelemente, wie z.B. der Ohröffner wieder. Werbebotschaften müssen aber um einiges kürzer und pointierter sein als durchschnittliche Reden. In einer Printanzeige beispielsweise muss ein Bild, ggf. ergänzt durch Text, überzeugen. In Fernsehen und Radio ist die Länge der Spots durch die Kosten für Werbezeit stark begrenzt, außerdem rechnen Werbeagenturen nicht damit, dass der Zuschauer oder Zuhörer in der Werbepause aufmerksam die Werbespots schaut.[34],[35]Kurze, prägnante Botschaften sind hier essenziell. Man könnte hier außerdem sagen, der Werbung liegen sophistische Tendenzen nahe, da es im Rahmen eines Werbespots kaum möglich ist, den Zuschauer wirklich von seiner Sache zu überzeugen (hierzu fehlt das Zwiegespräch und die nötige Zeit). Folglich ist die Werberhetorik eher auf Überredung aus, dem Zuschauer wird – unabhängig ob es für den Konsumenten wirklich zutrifft oder nicht – eingebläut, dass das beworbene Produkt für ihn auf jeden Fall die beste Wahl ist und dass er es braucht. In Werbespots wird versucht, alle rhetorischen Mittel zur Überredung des Rezipienten zu nutzen, neben der Ursprungsform der Rhetorik als Sprachkunst, sei hier am Rande auch die sogenannte Bildrhetorik erwähnt: Wenn gleich es die Übersetzung von Rhetorik als „Lehre von der Redekunst“ ad absurdum führt, da das Wort „Bildredekunst“ wohl kaum sinnhaft ist, so ist der Aspekt der sich dahinter verbirgt insbesondere in der heutigen, multimedialen Zeit ein wichtiger. Botschaften werden nicht nur mittels Worten, sondern natürlich auch mittels Bildern übermittelt, Kommunikation kann auf vielerlei Ebenen stattfinden, visuelle Kommunikation ist in der Kommunikationstheorie inzwischen ein breites Themenfeld.[36]Allein farbliche und geometrische Gestaltung von Elementen, kann sich auf die bewusste und unbewusste Wahrnehmung der Werbung stark auswirken.[37]Die Abgrenzung zur Werbepsychologie ist hier nicht ganz einfach, aber es zeigt auf, dass neben den Medien auch die Rhetorik eine immer größere Vielfalt an Möglichkeiten hervorbringt.
3. Entwicklung der Kommunikation
Neben den zuvor genannten Massenmedien, existieren auch eine Reihe weiterer neuer Medien, die z.T. eine Direktkommunikation zwischen zwei Personen ermöglichen, zum Teil aber auch schnell und einfach Nachrichten mit Personengruppen oder der allgemeinen Öffentlichkeit (mit unterschiedlicher Reichweite) zulassen. Im Folgenden sollen diese Kommunikationsmedien kurz in Gruppen zusammengefasst erklärt werden (aus Gründen der Relevanz werden nur Text-Nachrichtendienste behandelt):
Direktnachrichtendienste(E-Mail, WhatsApp, Threema, ChatOn, etc.): ermöglichen eine Kommunikation zwischen zwei Personen oder in kleinen Gruppen. Ein Benutzer kann Nachrichten an einen anderen Schicken und auf dem gleichen Weg Antworten bekommen. In jedem Fall kennt der Benutzer seine Adressaten. Die Nachrichtenlänge ist nicht beschränkt, das Teilen von Fotos, Audio und Video ist möglich. Smileys können in den Fließtext eingebettet werden. Als zeichenbeschränkte[38]Variante existiert hier noch die SMS-Nachricht.
Veröffentlichungsdienste(Facebook, Twitter, Blogs, Google+, etc.): ermöglichen dem Benutzer Texte für Gruppen oder die Öffentlichkeit sichtbar zu verbreiten. Bieten auch eine Feedback Funktion (in der Regel öffentlich sichtbare Kommentare) an. Twitter ist hierbei ein Sonderfall, alle Beiträge sind auf 140 Zeichen beschränkt, die Nutzer müssen sich also kurz fassen.
Da die Direktnachrichtendienste ihren Anfang bei der SMS hatten, bei der jeder Satz von 160 Zeichen Geld kostet, wurde hier versucht mittels Abkürzungen und Elliptischem Satzbau möglichst viele Zeichen einzusparen. Aus „bis gleich“ wurde so z.B. kurzerhand „bg“, aus „hab dich lieb“ die Abkürzung „hdl“ und so weiter. Inzwischen ist die Zahl von Akronymen im Direktnachrichtenversand riesig groß geworden. Bei den am Meisten genutzten Nachrichtendiensten existieren zwar keine Zeichenbeschränkungen mehr und es wird auch nicht nach Zeichenanzahl abgerechnet, aber die Kurzschreibweise hat sich inzwischen etabliert, es ist normaler Schreibstil in Kurznachrichten und es spart Zeit. Twitter Meldungen sind immer noch ein Sonderfall, durch die Beschränkung auf 140 Zeichen pro Nachricht, wird hier auf elliptischen Satzbau und Abkürzungen zurückgegriffen wo es nur geht. Ein weiterer Punkt sind die sogenannten „Hashtags“. Hiermit kann man Artikel bestimmten Themen zuordnen, in denen sie dann gefunden werden können. Ein Großteil der Navigation und Sortierung bei Twitter basiert auf Hashtags. Häufig werden inzwischen auch Smileys als Ergänzung oder Ersatz für den Text benutzt, wie in folgendem Beispiel dargestellt:
Abbildung 2: Ein gestellter WhatsApp Dialog
Insgesamt wird bei Benutzung der beschriebenen Kommunikationsmedien eher die Umgangssprache genutzt. Nicht selten wird in Direktnachrichtendiensten auch auf Interpunktion und die Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung verzichtet. Insgesamt spielt die korrekte Rechtschreibung hier häufig eine untergeordnete Rolle.
3.1 Einfluss neuer Medien auf die Kommunikationsqualität
Im Umgang mit den beschriebenen Kommunikationsmitteln wird also eine von der Norm abweichende Schreibweise genutzt. Im Folgenden Soll untersucht werden, ob sich dies negativ auf die Qualität der Sprache per se auswirkt. Natürlich unterscheidet sich der Stil einer E-Mail in der Regel von dem Stil eines Briefes, vorausgesetzt es handelt sich hierbei nicht um ein offizielles oder geschäftliches Schreiben. In privaten Mails wird nicht selten umgangssprachlicher und stumpfer geschrieben, als es eventuell in einem Brief der Fall wäre. Allerdings wurden z.B. im Jahr 2014 auch mehr als 40-mal so viele E-Mails versendet wie Briefe (11.9 Mrd. Briefe stehen hier 506,2 Mrd. E-Mails, Spam ausgenommen, gegenüber).[39],[40]Es wird also immerhin mehr geschrieben als zuvor. Hinzu kommen zuvor beschriebene Kurzmitteilungen und Online-Posts. Die Anzahl der geschriebenen Texte stieg also deutlich an. Quantität sagt nun noch nichts über den Verlauf der Qualität aus, doch auch hier geben Sprachwissenschaftler bereits Entwarnung. In einem Interview des WDR beantwortete Peter Schlobinski beantwortete die Frage ob die Sprache von WhatsApp und Facebook die Standardsprache beeinflussen könne wie folgt: „Der Einfluss ist äußerst gering. Wir haben es bei diesen Kommunikationsformen vom Duktus her mit einer Art Umgangssprache zu tun. Das würde erst dann ein Problem werden, wenn Kinder und Jugendliche künftig nicht mehr in der Lage wären, anders zu schreiben. Also wenn sie zum Beispiel in der Schule ihren Aufsatz über Goethe ähnlich verkürzt schreiben würden. Studien zeigen aber, dass genau das nicht passiert. Schüler sind durchaus in der Lage unterschiedliche Stile zu schreiben.“[41]Dies stützt auch eine Studie der Coventry University, stark abgekürztes Schreiben z.B. beim Verfassen von SMS hat laut den Wissenschaftlern keine negativen Auswirkungen auf den Sprachlernprozess. Die Schweizer Sprachwissenschaftlerin Christa Dürscheid kam zu einem ähnlichen Schluss, laut ihr unterscheiden Jugendliche zwischen in der Freizeit und in der Schule genutztem Sprach- und Schreibstil.[42]Schlobinski hebt hervor, dass sich der Sprachstil und die Ausführlichkeit des Textes nach den genutzten Medien richten: „Man schreibt über die Tastatur auch anders, als mit der Hand. Und man passt sich ja auch der Bildschirmgröße eines Smartphones an. Es werden also immer die vorhandenen Ressourcen genutzt…“[43]Auch die steigende Nutzung von Anglizismen in der Kommunikation ist laut Johannes Ebert, Generalsekretär des Goethe Instituts keine Gefahr für die Sprachkompetenz, die Unterscheidung zwischen englischer und deutscher Sprache sei hier den Menschen, die Anglizismen nutzen in der Regel noch immer gut möglich.[44]
Zusammenfassend kann man also sagen: es findet zwar eine Verlagerung der Kommunikation auf neue Medien statt, bei der Worte durch Piktogramme und Akronyme ersetzt, elliptische Sätze gebaut und reihenweise Anglizismen verwendet werden, doch eine Gefahr für die Sprachkompetenz von Kindern und Jugendlichen ist dies nicht. Sofern die Kinder über ihre Sozialisation, also aus Elternhaus, Bekannten- und Freundeskreis und der Schule, die Standardsprache als Grundlage erlernen, etabliert sich die durch die neuen Medien geprägte Sprache allenfalls als Slang.
Literaturverzeichnis