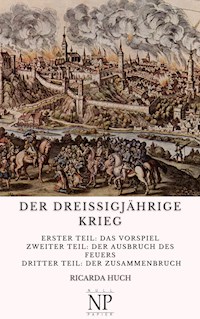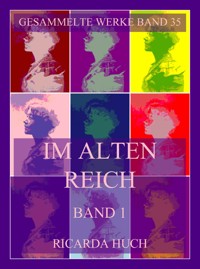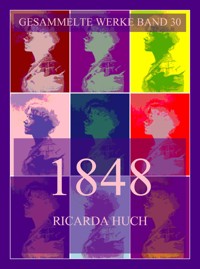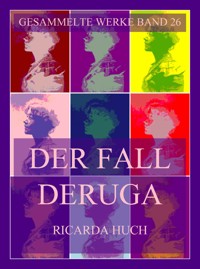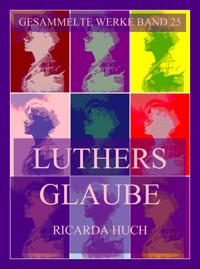Ricarda Huch: Deutsche Geschichte – Mittelalter – I. Römisches Reich Deutscher Nation – E-Book
Ricarda Huch
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: gelbe Buchreihe
- Sprache: Deutsch
Ricarda Huch beschreibt das Römische Reich Deutscher Nation im Mittelalter. Ihre Themen: Bonifatius – Die ersten Karolinger und die Päpste – Die Deutschen und das Christentum – Kloster – Der Adel – Die Ottomanen – Bischöfe – Frauen – Der Norden – Imperatoren – Heinrich IV. und Gregor VII. – Heinrich IV. und die Stände – Welfen und Staufer – Kaiser und Papst – Die Kreuzzüge – Die Kolonisation – Die letzten Hohenstaufer – Kaufleute – Städte – Die Juden – Die Juden und der Wucher – Ketzer – Die heilige Elisabeth und der Deutsche Orden – Geistiges Leben – Albert Magnus – Der Rheinische Bund – Stedinger, Friesen, Dithmarscher, Schlachten, Die Eidgenossenschaft, Der falsche Friedrich, Ludwig der Bayer – Sprache und Nationalität – Die Mystiker – Karl IV. – Territorialfürsten – Österreich – Zunft-Kämpfe – Städtebünde – Das Konzil zu Konstanz – Die Hanse – Siegmund und das Reich im Osten – Die Reformation des Kaisers Siegmund – Gutenberg – Untergang des Deutschen Ordens – Die Auflösung – Rezession: Ich bin immer wieder begeistert von der "Gelben Buchreihe". Die Bände reißen einen einfach mit. Inzwischen habe ich ca. 20 Bände erworben und freue mich immer wieder, wenn ein neues Buch erscheint. oder: Sämtliche von Jürgen Ruszkowski aus Hamburg herausgegebene Bücher sind absolute Highlights. Dieser Band macht da keine Ausnahme. Sehr interessante und abwechslungsreiche Themen aus verschiedenen Zeit-Epochen, die mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt haben! Man kann nur staunen, was der Mann in seinem Ruhestand schon veröffentlicht hat. Alle Achtung!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 716
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ricarda Huch
Ricarda Huch: Deutsche Geschichte – Mittelalter – I. Römisches Reich Deutscher Nation –
Band 178 in der gelben Reihe – bei Jürgen Ruszkowski
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort des Herausgebers
Die Autorin Ricarda Huch
Deutsche Geschichte – Band I. – Römisches Reich Deutscher Nation
Bonifatius
Die ersten Karolinger und die Päpste
Karl der Große
Die Deutschen und das Christentum
Das Kloster
Der Adel
Die Ottomanen
Bischöfe
Frauen
Der Norden
Imperatoren
Heinrich IV. und Gregor VII.
Heinrich IV. und die Stände
Welfen und Staufer
Kaiser und Papst
Ausgang
Die Kreuzzüge
Die Kolonisation
Die letzten Hohenstaufer
Kaufleute
Städte
Die Juden
Die Juden und der Wucher
Ketzer
Die heilige Elisabeth und der Deutsche Orden
Geistiges Leben
Albert Magnus
Der Rheinische Bund
Stedinger, Friesen, Ditmarscher
Schlachten
Die Eidgenossenschaft
Der falsche Friedrich
Sprache und Nationalität
Die Mystiker
Karl IV.
Territorialfürsten
Österreich
Zunftkämpfe
Städtebünde
Das Konzil zu Konstanz
Die Hanse
Siegmund im Reich und im Osten
Die Reformation des Kaisers Siegmund
Gutenberg
Untergang des Deutschen Ordens
Die Auflösung
Die maritime gelbe Buchreihe
Weitere Informationen
Impressum neobooks
Vorwort des Herausgebers
Vorwort des Herausgebers
Von 1970 bis 1997 leitete ich das größte Seemannsheim in Deutschland am Krayenkamp am Fuße der Hamburger Michaeliskirche.
Dabei lernte ich Tausende Seeleute aus aller Welt kennen.
Im Februar 1992 entschloss ich mich, meine Erlebnisse mit den Seeleuten und deren Berichte aus ihrem Leben in einem Buch zusammenzutragen. Es stieß auf großes Interesse. Mehrfach wurde in Leser-Reaktionen der Wunsch laut, es mögen noch mehr solcher Bände erscheinen. Deshalb folgten dem ersten Band der „Seemannsschicksale“ weitere.
Hamburg, 2021 Jürgen Ruszkowski
Ruhestands-Arbeitsplatz
Hier entstehen die Bücher und Webseiten des Herausgebers
* * *
Die Autorin Ricarda Huch
Die Autorin Ricarda Huch
https://www.projekt-gutenberg.org/autoren/namen/huchric.html
Ricarda Octavia Huch wurde am 18. Juli 1864 in Braunschweig geboren und starb am 17. November 1947 in Schönberg im Taunus. Sie war eine deutsche Schriftstellerin, Dichterin, Philosophin und Historikerin, die als eine der ersten Frauen im deutschsprachigen Raum im Fach Geschichte promoviert wurde. Sie schrieb Romane und historische Werke, die durch einen konservativen und gleichzeitig unkonventionellen Stil geprägt sind.
* * *
Deutsche Geschichte – Band I. – Römisches Reich Deutscher Nation
Deutsche Geschichte – Band I. – Römisches Reich Deutscher Nation
https://www.projekt-gutenberg.org/huchric/dtgesch1/chap001.html
Zuerst 1934 im Atlantis-Verlag Berlin erschienen
* * *
Das Römische Weltreich liegt in Trümmern, aber es ist nicht tot. Es lebt ein gesteigertes Leben, seit es nicht mehr Wirklichkeit ist; denn es ist Idee geworden. Einem Lied gleicht es, das in das Ohr eines Schlafenden dringt und ihm wunderbare Träume erzeugt. Nichts, das man am Tag hört, tönt so laut, so hinreißend; erinnert man sich wachend seiner auch nicht deutlich, so bleibt man doch seiner unvergleichlichen Schönheit bewusst, die ewige Sehnsucht erregt. Es hob das Herz wie ein Schlachtgesang, strahlend von Majestät und Triumph, es durchbohrte das Herz mit feierlicher Trauer wie ein Choral. Weltherrschaft und Christentum waren darin verschmolzen, Imperium sine fine dedi (Ich habe dir endlose Befehle gegeben) – Endlos daure das Reich, das ich gab. Die Verkündigung Jupiters, des Vaters der Götter und Menschen, durch die Virgil dem Römerreich unendliche Dauer verheißt, schlug in einen gewaltigen Akkord zusammen mit den Worten des Herrn, auf welche die Kirche ihren Anspruch auf Unvergänglichkeit gründet: Tu es Petrus – Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Götterworte übten bindenden Zauber, beugten die siegreichen Söhne Germaniens unter Rom in Trümmern.
Manche von den Germanen hatten Rom gedient, manche hatten sich ihm unterworfen, andere es bekämpft, es besiegt, alle glaubten an das Römische Reich. Es war eine von Gott errichtete Ordnung, von Gott dadurch beglaubigt, dass er innerhalb dieses Reiches Fleisch geworden war, außerhalb dessen das Chaos der Heidenwelt brandete, und Rom war sein Haupt. Roma sancta, Roma aeterna (Heiliges Rom, ewiges Rom). Es war der Sitz der Cäsaren gewesen, es war jetzt der Sitz der Päpste, es konnte verfallen und veröden, es blieb der magische Punkt, durch den die Erde mit den Göttern verbunden war. Die Germanen waren reich an Gegenwart und Zukunft, aber Rom, wenn es auch darniederlag, besaß einen Schatz über alle Schätze, es besaß geformte Vergangenheit. Alte Kultur ist Schwerkraft, die den Menschen unwiderstehlich anzieht; je näher er der Natur steht, desto williger beugt er sich ihrem vergilbten Glanze. Verschiedene germanische Völker gründeten Reiche, die überraschend aufblühten, einige vergingen so rasch, wie sie entstanden waren, alle glaubten ohne Wurzel im Zufälligen der eigenen Kraft zu schweben, bis sie unvergänglich göttlichen Rechtsgrund im Römischen Weltreich fanden.
* * *
Bonifatius
Bonifatius
Selten ist es den Menschen vergönnt, aus eigenem Geiste eine Tat von dauernder Bedeutung zu tun; ein dazu Auserwählter war Winfried Bonifatius, der die Kirche des Frankenreiches dem Papst unterwarf. Wieviel Umwälzendes die Jahrhunderte den britischen Inseln gebracht haben, der Angelsachse des 8. Jahrhunderts war dem Engländer der neuen Zeit ähnlich: tatkräftig, sachlich, streng kirchlich, ohne fromm zu sein, großartig in seinen Entwürfen, im Organisieren, so dass man den jungen Mönch des Klosters Nutscelle gern zu diplomatischen Geschäften verwendete. Es würde ihm an Ehren und Einfluss in der Heimat nicht gefehlt haben; aber ihn bewegten größere Gedanken. Er ging aus von dem Wunsche, die Friesen zu bekehren, nichts Fernliegendes für ihn, denn von den Iren und Angelsachsen war größtenteils die Mission unter den germanischen Stämmen des Festlandes ausgeführt worden. Die keltischen Iroschotten, die Ureinwohner der Inseln, gehörten der alten britischen Mönchskirche an, die den Verfall des Römischen Reiches überdauert hatte, die Angelsachsen der von Papst Gregor I. gepflanzten bischöflichen Kirche. In der britischen Mönchskirche bestanden allerlei von der Papstkirche abweichende Gebräuche, wie dass die Ehelosigkeit der Geistlichen bei ihnen kein Gebot war, hauptsächlich aber waren sie, wenn sie auch mit dem römischen Papst in Beziehung standen, doch unabhängig von ihm, indem der Begriff der Fortpflanzung der göttlichen Priesterweihe durch den römischen Bischof bei ihnen nicht galt. Die Geringschätzung, mit welcher die Angelsachsen auf die Mönchskirche herabsahen, hatte vermutlich ihren Grund mehr darin, dass sie überhaupt die unterworfene Rasse verachteten, als in den Eigenheiten ihrer Verfassung. Mangel an Bildung konnte man den Iroschotten kaum vorwerfen, die sogar Griechisch verstanden und lehrten; es war wohl mehr etwas Regelloses, Schweifendes, Phantastisches in ihrem Wesen, was die Angelsachsen abstieß. Der sächsische Stolz war bei den Angelsachsen noch gesteigert; Winfried war von vornehmer Abkunft, dazu persönlich durch das Machtgefühl eines überragenden Geistes und unbeugsamen Charakters gehoben. Die Bekehrung der Friesen war eine Aufgabe der Zeit, zuerst vom Erzbischof von York versucht, der bei einer Romreise an die friesische Küste verschlagen war, während der Frankenherrscher Pipin von Heristall (635 – 714) und dessen Sohn Karl sie mit dem Schwert zu unterwerfen trachteten. Der kriegerische Angriff verdoppelte die Widerspenstigkeit der Friesen gegen die Glaubensboten; denn der neue Gott stellte sich offensichtlich dar als der Gott von Feinden, die ihrer Freiheit nachstellten. Ein Sieg Pipins hatte zunächst Erfolg: der Friesenhäuptling musste einen Teil seines Landes abtreten und eine Tochter einem Sohn Pipins, Grimsald, zur Frau geben.
Willibrord
Der angelsächsische Missionar Willibrord war Pipin als Gehilfe willkommen, er gründete das Kloster Echternach, stellte sich dem römischen Papst vor und wurde von diesem zum Erzbischof von Utrecht geweiht, demselben Ort, wo Radbod, der Friesenhäuptling, seinen Sitz hatte.
Klosterkirche Echternach – Foto: © Raimond Spekking
Dieser rasche Erfolg war nicht von Dauer: Grimsald wurde auf der Reise zu seinem erkrankten Vater in der Kirche von Lüttich von einem Friesen ermordet, der, wie man glaubte, ein Beauftragter Radbods war. Als bald darauf Pipin starb, fiel das eroberte Gebiet ab. So war die Lage, als Winfried, etwa fünfunddreißig Jahre alt, sich dem verschütteten Werk zu weihen beschloss. Er fuhr nach Friesland hinüber und hatte eine Unterredung mit Radbod; dabei muss er den Eindruck unüberwindlichen Widerstandes empfangen haben, denn er kehrte bald in sein Kloster zurück, nicht um seinen Plan aufzugeben, sondern um ihn anders anzupacken. Winfried war nicht ein Glaubensbote, wie Columban, Gallus, Pirmin gewesen waren, die das Feuer ihres Glaubens auf die Heiden zu übertragen wussten, die Mensch und Tier durch die fremde Rede bezauberten, auch mit der Faust dreinschlugen, wenn das Wort nicht verfing; Winfried war ein Aristokrat, dem es mehr auf Kultur als Religion ankam, den das Ungeordnete mehr beleidigte als das Unchristliche. Als ein rechter Engländer sah er die Religion als Teil der staatlichen Ordnung an und beschloss, sein Bekehrungswerk nicht als ein Abenteurer gleichsam von unten aus im Herzen des Volkes, sondern von oben und außen her, als Organisation an die Hand zu nehmen, ausgehend von der Spitze der Kirche, dem römischen Papst. Nachdem er die eben erhaltene Abts-Würde niedergelegt hatte, ging er nach Rom, um sich vom Papst die Vollmacht zur Missionspredigt zu holen. Auch die Romreise war etwas Zeitgemäßes, sie wurde von den britischen Inseln aus mit Vorliebe unternommen. Geistliche und weltliche Personen, männliche und weibliche folgten dem Zug nach der Hauptstadt der Welt, nach dem heiligen Sonnenland. Dort war, wie in unseren Tagen, eine Kolonie von Fremden, dort machte man interessante Bekanntschaften, dort trank man, gelöst vom Alltag, aus einem Lebensstrom, der über fabelhaften Ruinen voller als anderswo rauschte. Die vier Päpste, die Bonifatius erlebte, Gregor II., Gregor III., Zacharias und Stephan III., waren ihm gegenüber die Lässigeren, wenn sie auch auf seinen Plan, die fränkische Kirchenhierarchie aufzubauen, willig eingingen. Als Haupt der Christenheit sich fühlend, mochten sie denken, die Barbarenreiche würden ihnen ohnehin einmal als zeitige Frucht in den Schoß fallen, zum Teil waren sie mittelmäßige Leute, die nicht den immertätigen Geist des großen Angelsachsen hatten. Die Eigenschaften und Zustände des Nordens waren ihnen wenig bekannt, die Schärfe der Abneigung Winfrieds gegen die irischen Mönche und ihre Mission, gegen die verweltlichten fränkischen Bischöfe fühlten sie nicht mit. Andererseits waren sie gewöhnt, von den germanischen Christen als Schiedsrichter und Wissende in unzähligen Fragen des Staates, der Kirche, der Sitte angerufen zu werden. Sie waren die Inhaber der Tradition, von ihnen glaubte man erfahren zu können, was gültig war.
Papst Gregor II. – Foto: 3268zauber
Nachdem Winfried dem Papst Gregor II. förmlich gehuldigt und von ihm einen Kodex des kanonischen Rechtes empfangen hatte, unterwarf sich der stolze Sachse dem Urteil des römischen Bischofs mit erstaunlicher Selbstüberwindung. In den meisten Fällen waren die Entscheidungen der Päpste so verständig, dass sie ohne weiteres einleuchteten; aber in dem kanonischen Gesetz zum Beispiel, wonach geistliche Verwandtschaft, nämlich die Patenschaft bei demselben Kind, ein Ehehindernis bildet, konnte er, obwohl er sich Mühe gab, begreiflicherweise keinen Sinn finden. Wie sollte er denen, die unter dieser Bestimmung zu leiden hatten, den Grund ihres Leidens begreiflich machen? Da der Papst darauf bestand, schluckte er den Bissen ohne Sinn hinunter. Wenn es seinen Begriff von Religion anging, wenn er sah, wie in Rom heidnischer Aberglaube ungerügt sein Wesen trieb, konnte er aber auch die Unterwürfigkeit abwerfen und den Papst wegen seiner unzeitigen Duldsamkeit abkanzeln, wie wenn er der Herr wäre. Ausgestattet mit der Vollmacht des Papstes hat der Apostel in Thüringen und Hessen das heidnische Volk bekehrt, Klöster gegründet und mächtig die heiligen Eichen vor den entsetzten Augen ihrer Verehrer gefällt; aber die Organisation und die Belehrung der Gebildeten lagen ihm mehr. Für diese hatte seine Erscheinung etwas Blendendes, namentlich für die gebildete oder nach Bildung strebende Jugend. Als er auf seinen Reisen im Nonnenkloster Pfalzel bei Trier einkehrte, dessen Äbtissin eine Enkelin des Merowingerkönigs Dagobert II. war, bestand ihr fünfzehnjähriger Enkel Gregor darauf, dem Fremden zu folgen; ebenso schloss sich ihm der junge Bayer Sturm an. Die Jugend wusste sich nichts Schöneres, als diesem Mann, der unentwegt ein hohes Ziel verfolgte, der alles Niedrige verabscheute, und der durch Niedriges unberührbar zu sein schien, zu dienen. Am liebsten waren ihm als Mitarbeiter seine Landsleute, die auf seinen Wink begeistert aus den angelsächsischen Klöstern herbeiströmten. Unter ihnen war eine Verwandte, Lioba, deren Mutter, während sie schwanger war, geträumt hatte, sie trage eine Glocke unter dem Herzen, die zu läuten beginne. Da sie klug und begabt war, sich lieber mit Lesen, Schreiben und Dichten als mit Handarbeit beschäftigte, übergab man sie einem Kloster; Bonifatius machte sie zur Äbtissin des Klosters Tauberbischofsheim. Man liebte sie wegen ihrer zarten Lieblichkeit; doch ging sie festen Schrittes ihren einsamen Weg. Seinen Jüngern gegenüber war Winfried ein gütiger, wenn auch viel fordernder Herr, gegen die, welche sich ihm nicht unterwarfen oder die er als schädlich ansah, war er ein unnachgiebiger Verfolger. Er hasste die hohen Geistlichen, die, wie das bei den Franken nicht selten war, ein weltliches Leben führten, und diejenigen, die den römischen Kanon verwarfen oder irgendwie von ihm abwichen. Was für Kämpfe und Ränke stattfanden, ist uns nicht im Einzelnen überliefert; aber gewiss ist, dass seine Bestrebungen auf mancherlei Widerstand stießen. Es war leichter, in den noch heidnischen Gegenden Klöster zu gründen, dort geeignete Vorsteher einzusetzen, Kirchen zu bauen, als da, wo sich schon eigenartiges Leben in Kirchen und Klöstern entfaltet hatte, dies in eine einheitliche Ordnung einzubinden. Gewald, Erzbischof von Mainz, hatte Karlmann, den Bruder Pipins, der mit diesem gemeinschaftlich regierte, in den Sachsenkrieg begleitet und war gefallen. Dessen Sohn Gewilieb, beim Tode des Vaters Laie, empfing rasch die Weihen, um sein Nachfolger werden zu können; sein Leben änderte er deswegen nicht. Der neu ausbrechende Krieg gab ihm Gelegenheit, seinen Vater zu rächen: er forderte den Sachsen, der Gewald getötet hatte, zu einer Unterredung auf, und als der Gerufene erschien, brachte er ihn um. Winfried fand, dass Krieg und Mord kein Geschäft für christliche Bischöfe sei; aber die fränkischen Bischöfe waren gewohnt, ihre Würde als ein königliches Amt zu betrachten, dessen kirchliche Seite nur die zufällig Frommen pflegten. Schließlich setzte Winfrieds Eifer durch, dass Gewilieb auf einer Synode abgesetzt wurde; bestraft wurde er nicht, sondern setzte sein weltlich prächtiges Leben auf seinen Gütern fort. Auch die Gegner der Lehre und der Organisation warf Bonifatius nach langen Kämpfen mit Härte nieder, nur mäßig unterstützt vom Papst und von den fränkischen Herrschern.
Karl Martell (Foto: J. Patrick Fischer) (* zwischen 688 und 691; † 15. Oktober oder 22. Oktober 741 in der Königspfalz Quierzy) war ein fränkischer Hausmeier. Er stieg als Sohn Pippins des Mittleren in dieses Amt auf, dessen Besetzung durch Nachfolgekämpfe geprägt war, auf die der merowingische König keinen Einfluss mehr hatte.
Karl Martells Großtat, die Zurückwerfung der Sarazenen nach Spanien, machte ihn zum Helden des germanisch-romanischen Abendlandes, die Kirche betrachtete ihn, der gewalttätig mit dem Kirchengut geschaltet hatte, um seine Gefolgsleute belohnen zu können, mit scheuer Abneigung. Winfried ließ sich einen Schutzbrief von ihm ausstellen, da er einsah, dass sich ein solcher in strahlenden Taten ausgeprägter Ruhm nicht übersehen ließ und dass es klüger sei, ihn zur Befestigung der eigenen Stellung zu benützen; aber die beiden Großen waren zu anders geartet und hatten zu verschiedene Wege vorgeschaut, als dass sie sich freundschaftlich hätten berühren können. Wenn Winfried den Hof mied, tat er es sicher nicht, um den Verführungen auszuweichen, die für ihn keine waren, sondern um als ein Herr nicht dem Herrscher begegnen zu müssen, der sich als den Höheren betrachtet hätte, und der sicher der Mächtigere war. Als lange nach Winfrieds Tod seine Freundin Lioba einer dringenden Einladung der Kaiserin Hildegard folgte, bat die Äbtissin ihre freundliche Gastgeberin, indem sie sie unter Tränen umarmte, sie sofort wieder zu entlassen; so sehr wirkte Winfrieds Verhältnis zu den fränkischen Herrschern im Herzen der ihm Ergebenen nach. Ausschalten ließ sich die Mitwirkung der Herrscher bei den kirchlichen Dingen nicht, sie beriefen die ersten großen Synoden, die auf Anregung des Bonifatius stattfanden. Als auf einer Synode des Jahres 747 die anwesenden Bischöfe und Geistlichen die Metropolitanverfassung annahmen, eine Urkunde über den orthodoxen Glauben ausstellten und sie dem Papst übersandten, konnte er sein Ziel als erreicht betrachten. Die Einheit der Kirche im Aufbau und im Glauben unter dem Papst war hergestellt.
Trotzdem war der stolze Mann nicht befriedigt. Tiefe Traurigkeit lastete oft auf ihm wie ein körperlicher Schatten. Er fühlte sich im Bezirk seiner Wirksamkeit in der Fremde, angefeindet, nicht richtig gewertet. Sein Wunsch, das Erzbistum Köln zu erlangen, wo er den Friesen nahe gewesen wäre, wurde ihm nicht erfüllt, weil die dortige hohe Geistlichkeit ihn ablehnte, anstatt dessen bekam er Mainz, das er nicht gewollt hatte. Mehr hing sein Herz an dem Kloster Fulda, das er selbst gegründet und dem Papst unmittelbar unterstellt hatte, womit jede Möglichkeit königlicher Eingriffe ausgeschaltet war. In dieser Anstalt sollte die strenge Regel des heiligen Benedikt herrschen, nach welcher das Kloster einen selbständigen Wirtschaftsbezirk zu bilden hatte, wo alle erforderliche Arbeit von den Klosterbrüdern selbst, ohne Hilfe dienender Laien geleistet würde. Der Ort, wo später das Kloster Hersfeld entstand, den Winfrieds Schüler Sturm zuerst ausgewählt hatte, erschien ungeeignet, weil zu nah am heidnischen Gebiet gelegen; so wanderte der Abgesandte weiter durch sommerliche Buchenwälder, bis ihn eines Tages ein Tal von besonderer Lieblichkeit fesselte. Da war der Boden wie eine Wiege gestaltet, die den Menschen hegend umfassen will, und Hügel und sanfte Bergkuppen zogen einen schützenden Ring darum; da führte ein geselliger Fluss das klare Wasser herbei, das fast wie die Luft zur Erhaltung des Lebens notwendig ist, da gab es außer dem Holz der Wälder Basalt und Sandstein als Material zum Bau des Gotteshauses. Nachdem Karlmann, damals noch Regent in Oberhessen, das gewünschte Gebiet geschenkt hatte, wurde die Errichtung des Klosters in Angriff genommen.
Kloster Fulda
Von einem Hügel herab sah Winfried, alternd und zuweilen der unbequemen Reisen, der bitteren Kämpfe und der eigenen Leidenschaften müde geworden, den emsigen Männern zu und dem Erwachsen des kleinen Reiches, wo er für eine Zeitlang wenigstens Zuflucht und Heimat und bald vielleicht die ewige Ruhe finden würde. Von der alten Kirche und dem alten Kloster, die seine Augen sahen, ist nichts übriggeblieben, das festliche Barock des heutigen Doms ist unendlich fern von dem ernsten, glühenden, weltüberwindenden Geist der Stifter des ersten. Einzig die karolingische Rotunde der Michaeliskirche, einsamer Fremdling, der in unverständlicher Zunge redet, hat eine Spur davon erhalten.
Als Winfried etwa siebzig Jahre alt war, körperlich sehr hinfällig, mit schneeweißem Haar, so schildert ihn einer, der ihn damals sah, ergriff ihn wieder der Wunsch seiner Jugend, den Friesen das Wort Gottes zu predigen. Er hatte damals den Plan zugunsten eines anderen aufgegeben, aber es scheint, dass er ihn nie aus den Augen verloren hatte. Vielleicht betrachtete er die Friesen als einen besonders nahverwandten Stamm und ihr Land als seinem Volk besonders zugehörig; denn von dort sollen die Angelsachsen ausgezogen sein, um Britannien zu erobern, worauf die Friesen in das verlassene Gebiet eindrangen. Damals hatte er eben das Mannesalter erreicht, und sein Werk lag vor ihm, er wollte das Leben erhalten, das seinem Werke geweiht war; jetzt war es anders. Sein Werk war getan und sollte gekrönt werden durch den Märtyrertod. Die, welche die Nachfolge des Herrn gelobt hatten, sehnten sich danach, zu sterben wie er, gleichsam mit ihm, wie Gefolgsleute mit ihrem Herzog. Trotzdem zog er nicht aus wie ein einfacher Glaubensbote, der mit keinem anderen Schild als seinem Glauben sich in den Rachen der Hölle wagt; sondern er reiste als der Kirchenfürst, der Legat des Papstes, umgeben von einem zahlreichen bewaffneten Gefolge, mit allerlei Reisegepäck, auch Büchern, als der höchste Geistliche Germaniens, der sich einer entfernten, noch unsicheren Gemeinde zeigen will. Zugleich aber, entsprechend der zwiefachen Richtung seines Geistes, schickte er sich an wie zum gewissen Tode, als wisse er, dass der Tod seit dem Anfang seines Lebens dort an der friesischen Küste stände und ihn erwartete. Bevor er abreiste, nahm er in Mainz Abschied von seinen Getreuen und ließ auch Lioba kommen, um sie noch einmal zu sehen und seinen Freunden zu empfehlen. Er traf die Bestimmung, dass er in Fulda bestattet sein wolle, und dass, wenn Lioba einst gestorben sein würde, ihr Leichnam zu dem seinigen in seinen Sarg gelegt werde. Die er im Leben sich ferngehalten hatte, getreu dem strengen Gebot, dem er sich unterstellt hatte, riss er im Tode an sich, in seinem herrischen Sinn sicher, dass sie so oder so die Seine war, ihm folgend in der Entsagung, ihm folgend im besten Eins werden der Liebe. Dies Hervorflammen einer ein Leben lang zurückgehaltenen Leidenschaft mochte für die Jünger des alten Mannes etwas Erschreckendes haben; sie schwiegen, aber sie getrauten sich nicht, als Lioba gestorben war, seinen Befehl auszuführen. Jedoch hielten sie die zarte Freundin des Heiligen so hoch, dass ihr als der einzigen Frau gestattet wurde, im Kloster Fulda als Gast empfangen zu werden. Sie wurde auf dem Petersberg beigesetzt; während Winfrieds Leiche, wie ungern auch Mainz auf die Überreste seines großen Erzbischofs verzichtete, seinem Willen entsprechend nach Fulda überführt und in der Kirche des Klosters bestattet wurde. Die Bibliothek bewahrt das aus dem Domschatz übernommene Buch auf, mit dem Bonifatius in unwillkürlicher Bewegung wie mit einem Schild den Streich des Mörders abzuwehren suchte, und das die Spuren des ihm geltenden Schwerthiebes trägt.
Denn der Erzbischof fand mit 52 Begleitern den ersehnten Tod; es war, als wenn der Himmel, der dem ordnenden Herrscher beigestanden hatte, auch seinen Opfermut bestätigen wollte.
Die Sonne eines heiteren Sommermorgens war eben aufgegangen, und Bonifatius erwartete bei seinen Zelten friesische Christen zur Firmung, als eine Schar friesischer Männer die Fremden überfiel, wahrscheinlich mehr von Raublust als von Glaubenshass angetrieben. Eine Frau berichtete später, dass sie gesehen habe, wie der Erzbischof, den Arm mit dem Buch erhoben, den Todesstreich empfing.
* * *
Die ersten Karolinger und die Päpste
Die ersten Karolinger und die Päpste
Bei der Bekämpfung der Araber hatte Karl Martell die Langobarden zu Bundesgenossen. Die guten Beziehungen zu diesem germanischen Volk zu pflegen war natürlich, und Karl hielt an der langobardenfreundlichen Politik auch dann fest, als sich ihm Gelegenheit bot, eine entgegengesetzte zu verfolgen.
Es geschah nämlich, dass der Langobardenkönig Aistulf den großen Gedanken fasste, seine Herrschaft über ganz Italien auszubreiten, von dem außer Rom nur ein Zipfel im Süden und Venedig im Nordosten mehr dem Namen nach als tatsächlich noch zum Oströmischen Reich gehörten.
Das Langobardenreich in Italien
Er eroberte Ravenna und machte sich dadurch den römischen Papst zum Feind, der sich als Herr Roms und als solcher, wenn er es auch nicht aussprach, als Herr Italiens fühlte. Nachdem die letzten Kaiser Rom aufgegeben hatten, übernahmen die Bischöfe von Rom den Schutz der Ewigen Stadt, und ihre kirchliche Stellung, ihr sittliches Übergewicht wuchsen unmerklich mit der Seele der Weltherrscherin zusammen. Nicht alle Päpste waren sich dessen bewusst, und nicht alle konnten den Anspruch, den das Bewusstsein verlieh, vertreten; aber es war eine Tatsache, die sich immer geltend machte: weil sie Rom innehatten, mussten sie Nachfolger der römischen Cäsaren sein, weil sie das Haupt der Kirche waren, die die Welt umfassen sollte, mussten sie das Reich bis zu den Grenzen der bewohnten Erde auszudehnen suchen; aus einem zwiefachen Grund mussten sie sich zu Herren der Welt bestimmt glauben. Ein ungeheures Herrscherbewusstsein war die Schicksalsgabe von Männern, die als Kirchenhäupter nicht nur keine weltliche Macht besaßen, sondern weltliche Macht geringschätzten, mit dem Wort allein Führer der Seelen sein sollten. Wenn der König der Langobarden König von Italien wurde, musste er Rom zu seiner Hauptstadt machen; musste das Haupt der Welt zum Haupt Italiens, der Papst in die Stellung eines dem König untergeordneten Bischofs herabgedrückt werden. Wie sollte er sich der herandrängenden Gefahr erwehren? Zwei christliche Mächte kamen in Betracht: der Kaiser in Byzanz, der als Nachfolger der römischen Kaiser Ansprüche auf Italien hatte, und der König des fränkischen Reiches.
Papst Gregor der Große
Zu der Zeit, als Gregor der Große zwischen den Schwertern der Langobarden lebte, wie er selbst sagte, wurde die Oberherrschaft des Kaisers von Byzanz noch anerkannt, eine Lockerung trat durch einen Zwiespalt in der Lehre ein, indem in Byzanz der Bilderdienst verboten wurde, während zwar Gregor die Anbetung der Bilder verwarf, sie aber zur Belehrung des Volkes behalten wollte. Nicht nur dieser Gegensatz jedoch, sondern gerade der zu Recht bestehende Herrschaftsanspruch der oströmischen Kaiser bewog die Päpste, den Schutz der Franken vorzuziehen: sie schienen eher in der Lage, Rom zu helfen, aber weniger in der Lage, Rom zu beherrschen. Nicht zwar an die ohnmächtigen Merowinger, die die Königskrone trugen, wandte sich Gregor III., sondern an den mächtigen Hausmeier Karl Martell mit der Bitte, ihm Schutz gegen die Langobarden zu gewähren, wogegen er ihm versprach, ihn zum römischen Konsul zu machen, eine Würde, mit der die Schutzherrschaft über Rom verbunden war. Trotz der wiederholten inständigen Bitten Gregors zog Karl, wie es scheint ohne Besinnen, das Bündnis mit den Langobarden der Freundschaft mit dem Papst vor, durchaus ein Mann der Tat, der die naheliegenden Aufgaben kühn und großartig vollbrachte, den keine innere Beziehung mit der Kirche verband. Anders waren seine Söhne Pipin und Karlmann; sie waren von Kirchenmännern erzogen, und ihr Interesse umspannte weitere Gebiete. Beide waren liebenswürdige und hervorragende Persönlichkeiten, Karlmann leichter vom Gefühl hingerissen, Pipin besonnener, tatkräftig, großmütig, ein sympathischer Mensch und schöpferischer Staatsmann. Vor dieselbe Frage gestellt wie sein Vater, entschied er im entgegengesetzten Sinn. Der erste Schritt zu einer engeren Beziehung zum Papst ging von ihm aus, indem er zwei Gesandte, den Bischof Bernhard von Würzburg und den Abt Fulrad von St. Denys (* um 710 in Andaldovillare (heute Saint-Hippolyte) im Elsass; † 16. Juli 784 in Saint-Denis), nach Rom schickte, damit ihn Papst Zacharias, ein kluger Grieche, zur Führung des Königstitels berechtigt erkläre.
Papst Zacharias
Man könnte meinen, die förmliche Richtigstellung eines Verhältnisses, das große Taten begründet hatten, hätte keines päpstlichen Gutachtens bedurft; allein abgesehen davon, dass Pipin die Eifersucht, den Neid und die Treulosigkeit seiner Großen kannte, liegt es im Menschen, dass er das Bedürfnis hat, sich und sein Dasein nicht nur auf die eigene Kraft und Gewalt, sondern auf einen Rechtsgrund zu stützen und mit der Vergangenheit zu verbinden. Der Gläubige wie der Ungläubige, sie wollen nicht nur besitzen, sondern mit Recht besitzen, der Unterliegende fühlt sich noch als Sieger, wenn er sich als Vertreter des Rechtes, einer höheren Entscheidung in einer anderen Region betrachten kann. Einen weltlichen Herrn konnte Pipin als Schiedsrichter nicht gelten lassen; aber das Urteil des römischen Bischofs, des Hauptes der christlichen Kirche würde allgemein als Gottesurteil aufgefasst werden. Doch wurde die Antwort des Zacharias, es sei billig, dass derjenige, der die Macht habe, auch den Königstitel führe, und Pipin sei deshalb als König zu krönen, nur als ein für Pipins Gewissen wichtiges Gutachten angesehen und als eine Weisung an die fränkische Geistlichkeit, die als Großgrundbesitzer von ausschlaggebender Bedeutung war; die Königswahl fand nach alter germanischer Sitte durch das Heer statt. Danach wurde Pipin in Soissons von den Bischöfen gesalbt; man nimmt an, dass Bonifatius dabei tätig war.
Papst Zacharias stand in guten Beziehungen zu den Langobarden; nach seinem Tod griff Aistulf den Plan der Eroberung Italiens wieder auf und nahm Ravenna ein. Papst Stephan II. wandte sich zuerst brieflich an Pipin und trat dann die Reise über die Alpen an, um als Schutzflehender vor dem König zu erscheinen, eine Reise, die doppelt schwierig war, weil sie durch das feindliche langobardische Gebiet ging. Pipin war entschlossen, den ihm vom Papst gewiesenen Weg einzuschlagen; aber er stand damit ziemlich allein. Unvergessen war seines Vaters langobardenfreundliche Politik, daran wollten nicht nur viele fränkische Große, sondern auch Pipins Frau, die Königin Bertrada, und sein Bruder Karlmann festhalten. Karlmann hatte die Regierung schon seit mehreren Jahren niedergelegt, war nach Rom gegangen und Mönch geworden; man nimmt an, dass er im Kloster durch ein Mitglied der königlichen Familie für die Langobarden gewonnen war. Die Sache war ihm so wichtig, dass er über die Alpen ging, um Pipin persönlich zu beeinflussen. Trotz so vieler und gewichtiger Gegenwirkungen beharrte Pipin auf seinem Willen: er empfing Stephan ehrenvoll, ließ sich, seine Frau und seine Söhne von ihm salben und versprach ihm Schutz nicht nur in seiner augenblicklichen Notlage, sondern auch für künftige Zeiten. Stephan verlieh ihm den Titel eines Patricius Romanorum, den der König seitdem führte. Auf seinem Weg nach Italien nahm Pipin seine Frau und seinen Bruder mit sich bis Vienne, wo er sie zurückließ, und wo Karlmann im folgenden Jahr starb. Pipin belagerte Aistulf in seiner Hauptstadt Pavia und zwang ihn, auf Ravenna und die sogenannte Pentapolis, fünf Städte von Rimini bis Ancona, zu verzichten; als Aistulf bald darauf seinen Angriff auf das päpstliche Gebiet erneuerte, wiederholte er seinen Kriegszug mit Erfolg. Die Schlüssel der zurückeroberten Städte, die den päpstlichen Dukat ausmachten, ließ Pipin am Grab des heiligen Petrus niederlegen zugleich mit einer Urkunde, in welcher er seinem Versprechen gemäß die Schenkung dieses Gebietes an den Heiligen Stuhl aussprach.
Pipinsche Schenkung in Quierzy
Dies bedeutungsvolle Ereignis fand zu der Zeit statt, als Bonifatius starb. Pipin nahm den Faden auf, den der Angelsachse angesponnen hatte, so dass nun staatlich und kirchlich das fränkische Reich in eine enge Verbindung mit Rom eingetreten war. Man kann nicht umhin, sich vorzustellen, dass es auch anders hätte kommen können, da ja die Entwicklung, die tatsächlich sich vollzog, durchaus nicht allgemein gefordert wurde, sondern, soweit sie persönlich bedingt war, hauptsächlich nur von zwei hervorragenden Männern getragen wurde. Wenn die Langobarden Italien zu einem Reich zusammengefasst hätten, wie anders wäre das Schicksal Deutschlands, das Schicksal Italiens, das Schicksal Europas geworden. Man könnte sich denken, dass schon damals ein Gleichgewicht nationaler Staaten sich hätte herausbilden können; man könnte geneigt sein, die Niederlage der Langobarden, eines so reichbegabten edlen germanischen Stammes zu beklagen. Das Lied vom Römischen Weltreich ertönte lauter als die Stimmen der einzelnen Völker, es erfüllte das Abendland. Und lässt man die Ereignisse und Gestalten des Mittelalters an sich vorüberziehen, so zweifelt man nicht, dass die tatsächliche Entwicklung diejenige war, die der Menschheit gerade durch das tragische Verhältnis zwischen Papst und Kaiser, durch den übermenschlichen Umriss ihrer Ziele den reichsten Gehalt an großen Ideen und vorbildlichen Gestalten geben konnte.
* * *
Karl der Große
Karl der Große
Karl der Große, * 2.4.747, † 28.1.814 in Aachen stammte aus dem Geschlecht der Arnulfinger, das später nach ihm Karolinger genannt wurde. Karl übernahm 768 die Regentschaft im Frankenreich. Er führte Kriege gegen die Langobarden und Sachsen und vergrößerte so das Territorium des Frankenreiches. Seine Bündnis- und Grenzsicherungspolitik befriedete das Land in Richtung Osten. Am 25.12.800 krönte ihn Papst Leo III. in Rom zum Kaiser. Diesem Vorbild der Kaiserkrönung folgten später die deutschen Könige. Karl gilt als eine der größten europäischen Herrscherpersönlichkeiten.
Nach Pipins Tod, der wie sein Vater jung starb, siegte noch einmal der politische Gedanke des Karl Martell, nämlich der Anschluss an die Langobarden. Bertrada reiste selbst nach Italien; und wenn sie auch Rom nicht mied, wo sie an den heiligen Stätten betete, so war doch ihr hauptsächlicher Zweck, die Vermählung ihres ältesten Sohnes mit einer Tochter des Langobardenkönigs Desiderius zu betreiben, die auch wirklich vollzogen wurde. Das festigte zugleich die Verbindung mit Bayern, da Thassilo, der Herzog von Bayern, mit einer Schwester der jungen Frau verheiratet war. Papst Stephan äußerte seinen Zorn über diese Wendung in einem Schreiben, das bald zähnefletschend grimmig, bald ölig milde den bombastischen Stil trägt, der in der Kanzlei der Kurie üblich wurde. Er bezeichnete die Verbindung Karls mit einer Langobardin als aus einer Einflüsterung des Teufels entstanden, von der Niedertracht selbst ausgeheckt, die Langobarden als ein stinkendes, aussätziges, treuloses Volk, ja überhaupt nicht einmal Volk. Wahnsinn sei es, wenn der edle König des ruhmvollen Frankenlandes sich durch eine solche Verbindung beflecke. Zum Schluss drohte er, wenn die Heirat trotz seiner Abmahnung zustande käme, dem Schuldigen mit dem Bannfluch, durch den er mitsamt den übrigen Gottlosen dem Teufel und dem ewigen Feuer zum Verbrennen überantwortet werden würde. Vielleicht war Karl von Anfang an gegen die eigene Überzeugung dem Willen der Mutter gefolgt, vielleicht besorgte er, was auch wirklich geschah, dass sich Papst und Langobarden nunmehr zu seinem Schaden miteinander verständigen würden: nach einjähriger Ehe schickte er dem Desiderius seine Tochter zurück, die vermutlich keine wärmere Neigung in ihm erweckt hatte. Aus dieser schroffen Tat hätten bedenkliche Verwicklungen innerhalb der Familie entstehen können, wenn nicht Karlmann, der wie einst sein gleichnamiger Oheim zu Bertrada hielt, plötzlich gestorben wäre, etwa zu gleicher Zeit auch Stephan. Seinem Nachfolger Hadrian I. wurde das widernatürliche Bündnis mit den Langobarden, das Stephan aus Not und Trotz eingegangen war, sehr bald drückend, und er wandte sich hilfesuchend an Karl. Nun war der Augenblick gekommen, wo Karl das Problem mit dem Schwert lösen konnte; er führte ein Heer über die Alpen, besiegte und entthronte Desiderius und zwang ihn, in ein Kloster zu gehen. Karl trat als König in die durch die Absetzung des Desiderius frei gewordene Stelle ein, ohne übrigens in der Lage des Langobardenvolkes etwas Nennenswertes zu verändern, außer dass er allmählich die Langobarden, die ihm unzuverlässig erschienen, auf verantwortungsvollen Posten durch fränkische Grafen oder Herzoge ersetzte. Er war Nachbar des Papstes in Italien geworden, nicht mehr nur der entfernte Schutzherr, der zu Hilfe kam, wenn er gerufen wurde, und nach getaner Arbeit sich wieder zurückzog.
Zunächst erwuchsen daraus keine Schwierigkeiten. Der römische Stadtadel war eine Gegnerschaft des Papstes, die ihn immer noch des fränkischen Schutzes bedürftig machte. Leo III., Hadrians Nachfolger, wurde von seinen römischen Feinden so verfolgt, dass er sich und sein Schicksal Karl völlig überantwortete. Er suchte ihn in Paderborn auf, wo der König Hof hielt. Karl liebte diesen Ort am Fuße des Teutoburger Waldes, der ihm zu einer Stätte des Ruhms wie kaum ein anderer werden sollte; denn hier empfing nach dreißigjährigen erbitterten Kämpfen sein gefährlichster, sein größter Gegner, der Sachse Widukind, die Taufe.
Widukind
Er mochte Augenblicke haben, wo das Rauschen des Eichwaldes ihm wie ein Gotteswort des Friedens klang, das das vergossene Blut sühnte. An Stelle der Salvatorkirche, die im Sachsenkrieg zerstört war, hatte er nahe dem Quell der Pader einen Dom aus Stein errichtet, der den Zeitgenossen prächtig erschien; er wurde 200 Jahre später durch eine Feuersbrunst vernichtet. Er war noch nicht vollendet, als Papst Leo zum Gedächtnis seiner Anwesenheit einen Altar darin weihte. Was sich sonst an Häusern in Paderborn vorfand, war vermutlich aus Holz und ziemlich dürftig; wenn aber der Ort dem Italiener nicht sonderlich imponierte, so tat es doch die Menge gerüsteter Krieger, die ihn empfing, und vor allem der König selbst im meergrünen Mantel mit dem edelsteingeschmückten Schwert und dem Diadem, wie er sich an Festtagen trug. Trotz der Anklage, die auf dem Papst lastete, wobei es sich hauptsächlich um Meineid und Ehebruch handelte, empfing ihn Karl mit allen Ehren, umarmte und küsste ihn, von vornherein entschlossen, ihn für unschuldig zu halten. Man nimmt an, dass bei dieser Begegnung die Krönung des Königs zum römischen Kaiser beredet wurde; sie war die Gegengabe des Papstes für den Schutz, den Karl ihm gewährte. Dennoch scheint es, dass der König, als ihm Leo am Weihnachtstag des Jahres 800 in der Basilika des heiligen Petrus die Krone aufsetzte, überrascht war; er hat später gesagt, dass er nicht in die Kirche gegangen sein würde, wenn ihm das Vorhaben des Heiligen Vaters bekannt gewesen wäre. Die Gründe dafür kennen wir nicht; es ist möglich, dass er fürchtete, sich durch diesen Akt die Feindschaft des oströmischen Kaisers zuzuziehen, möglich auch, dass er vorgezogen hätte, sich selbst zu krönen, wie er denn vor seinem Tod seinem Sohn Ludwig befahl, sich die Krone aufs Haupt zu setzen und sich Kaiser und Augustus nennen zu lassen. Diesen Titel führte er selbst seit der Krönung in Rom.
Die Übertragung der Cäsarenwürde auf den Frankenkönig war ein Ereignis von ungeheurer, einschneidender Bedeutung; aber da sie nicht ein neues Verhältnis schuf, sondern einer allmählich vollendeten Entwicklung Ausdruck gab, empfand sie Karl wohl als etwas Selbstverständliches. Das Weltreich bestand, es war die Form, in der seit Jahrhunderten die Menschen lebten. Durch die Entstehung des großen fränkischen Reiches war Byzanz an den Rand gedrängt, der mächtige Germanenfürst als tragende Säule in die Mitte des Weltreiches gerückt. Von ihm strahlte schaffende Kraft nach allen Seiten aus; der Titel verlieh ihm nichts, besiegelte nur das, was war. Die Möglichkeit künftiger Verwicklungen und Gefahren, die aus der Beziehung zum römischen Papst entstehen konnten, wird ihn nicht ernstlich beunruhigt haben; dazu lebte er zu sehr in der Fülle der Zeit.
Karl der Große war einer der Berufenen, die das Zusammengehörige, aber Vereinzelte zu einem lebendigen Ganzen ordnen, und die von den dankbaren Völkern, deren Geschichte sie begründet haben, wie Halbgötter verehrt wurden. Seine Vorfahren hatten das große Werk vorbereitet, Thüringen, Schwaben, Bayern fand er bereits mit den Franken vereinigt, auch die Sachsen und Friesen hatte Pipin schon zu unterwerfen versucht. Was ihn vor jenen auszeichnete, war, dass er dem neugeschaffenen Körper eine gemeinsame Ordnung, einen gemeinsamen Sinn und Geist gab.
Zu den Büchern, die Karl mit Vorliebe las, gehörte der Gottesstaat des heiligen Augustinus. Der edle Schwung, der es erfüllt, die unerschütterliche Überzeugung eines durch Anlage und Bildung überlegenen Geistes machen die Wirkung, die es jahrhundertelang ausgeübt hat, verständlich, mehr noch vielleicht die Einfachheit und doch auch Vieldeutigkeit der Gedankengänge. Schon in dem ersten Brüderpaar der Menschheit, in Kain und Abel, so sieht Augustinus den Sinn der Geschichte, spaltete sie sich in zwei Reiche, in ein solches, das Gott angehört, und in ein solches, das den Menschen folgt, menschlichen Begierden, menschlicher Einsicht, menschlichen Zwecken. Das Reich Gottes steht innerhalb der Menschheit gegenüber der Welt oder dem Reich der Menschen, das durchaus nicht etwa des Verstandes, der Bildung, der Tugend ermangelt, aber auf menschliche und irdische Zwecke beschränkt ist und zweifelhafte irdische Genüsse durch ewiges Verderben erkauft. Das Reich Gottes ruht auf dem Glauben und gewinnt das ewige Leben, es beginnt hienieden in Hoffnung und entfaltet sich drüben im Schauen.
Augustinus von Hippo, meist ohne Zusatz „Augustinus“ oder „Augustin“, gelegentlich auch „Augustinus von Thagaste“ oder (wohl nicht authentisch) „Aurelius Augustinus“ (* 13. November 354 in Tagaste, heute Souk Ahras, Algerien; † 28)
Augustinus wusste, dass nicht alle, die sich Christen nannten, Christen waren, aber die Kirche, die das Wissen von Gott und den göttlichen Dingen lehrte, der zu seiner Zeit alle Christen angehörten, ohne die die Nachfolge Christi als nur von einzelnen verwirklicht ohne Halt und ohne Dauer gewesen wäre, fiel ihm zusammen mit dem Gottesstaat, während der heidnische Staat diejenigen umfasste, die sich der Gnade Gottes entzogen. Der Gedanke lag nahe, Kirche und Staat überhaupt als Gottesstaat und Menschenstaat oder Welt einander entgegenzusetzen; man konnte aber auch den Schluss ziehen, dass zwischen Kirche und dem inzwischen christlich gewordenen Staat kein Unterschied mehr bestehe und nur die gesamte Heidenschaft als gnadenloses, der Verdammnis geweihtes Reich aufzufassen sei. So sah es Karl der Große an; sein Reich sollte ein Gottesreich sein, das als solches die Kirche ehrte und schützte und ihre Lehre verbreitete. Vergleicht man ihn mit Bonifatius, so tritt die Freiheit und das Schöpferische seines Geistes bewunderungswürdig hervor. Er ließ sich gern belehren, verzichtete aber nie auf eigenes Urteil. In Bezug auf manche kirchlichen Fragen, zum Beispiel auf den Bilderdienst, hatte er andere Ansichten als der Papst. Zuweilen war er derjenige, der die Richtung gab. Er hatte eine durch Erleben und Nachdenken gewonnene Überzeugung. Wenn er sich auch als Schirmherr der Kirche und des christlichen Glaubens fühlte, so verfolgte er doch Andersdenkende nicht. Allerdings zwang er mit Härte den Sachsen das Christentum auf; das war ein Mittel zur Einigung der Stämme, und die strengsten Strafen konnten sofort gemildert werden, wenn der Schuldige seine Zuflucht zur christlichen Kirche oder zu einem christlichen Priester nahm. Während Bonifatius Bedenken trug, mit einem Christen, den er nicht für ganz rechtgläubig hielt, der im geringsten vom römischen Kanon abwich, zu sprechen und zu essen, trat Karl der Große in freundschaftliche Beziehung zu Harun al Raschid, sammelte er die alten Volkslieder, in denen die Germanen die Taten ihrer Helden verherrlicht hatten.
Harun ar-Raschid (geboren um 763 möglicherweise in Rey; gestorben 809 in Tūs in Persien, begraben in Maschhad) stammte aus dem Geschlecht der Abbasiden.
Der Charakter des Gottesreiches sollte sich nicht nur durch den Schutz der Kirche, sondern durch die vom König ausfließende Gerechtigkeit erweisen. Die Sage erzählt, dass in Zürich, in einem dem Münster gegenüberliegenden Haus, wo der Kaiser zu wohnen pflegte, eine Glocke angebracht war, damit jeder Rechtsuchende sich bei Karl melden könne. Eines Tages läutete dort eine Schlange, um gegen eine Kröte zu klagen, die sich auf ihre Eier gesetzt habe. Sie beschenkte den Kaiser, der ihr zu ihrem Recht verhalf, aus Dankbarkeit mit einem wunderkräftigen Stein, dessen er sich oft bediente. So verdeutlichte sich das Volk die Gerechtigkeitsliebe seines großen Königs, der auch den Geringsten in seinem Recht schützte. Im Umfassenden seines Geistes zeigte sich sein Genie. Kein Gebiet war ihm fremd, keins vernachlässigte er; er förderte die Baukunst, die Dichtkunst, die Musik, die Schule, die Landwirtschaft, er war groß als Gesetzgeber, als Verwalter, als Richter, als Gutsherr, im Krieg. Nichts war ihm zu klein, nichts zu fernab. Als die nie fehlende Unterlage großer Genialität besaß er eine unerschöpfliche Tätigkeit. Er war immer erfüllt von großen Gedanken, immer mit ihrer Ausführung beschäftigt, immer voll Teilnahme an nahen und fernen, großen und kleinen Ereignissen. „Lasst uns heute etwas Denkwürdiges unternehmen“, so lässt ihn die Überlieferung täglich sprechen, „damit man uns nicht tadele, weil wir den Tag müßig verbracht haben.“
Seine zeitgenössischen Verehrer haben uns Karls Äußeres geschildert: die kräftige, hochgewachsene Gestalt, den festen Gang, die männliche Haltung, die großen, leuchtenden Augen. Seine Stimme war hell und nicht stark, er sprach gern und viel und war immer fröhlich, wie er denn auch Frohsinn um sich her liebte. Immer durch die Interessen seines riesigen Reiches bewegt, lebte er doch voll ungeteilter Hingabe mit seiner Familie und seinen Freunden. Jeder Frau, die er liebte, jedem seiner Kinder, jedem seiner Freunde gehörte sein Herz ganz. Jahrelang lebte er in glücklicher Ehe mit der Schwäbin Hildegard, die allgemein verehrt wurde, und die ihm drei Söhne und drei Töchter gebar.
Seine Kinder liebte er so sehr, dass er sie immer, selbst auf Reisen, um sich haben wollte, und wie der maßlose König des deutschen Märchens ließ er seine Töchter nicht heiraten. Doch gönnte er den schönen und leidenschaftlichen Mädchen ein beglückendes Liebesleben und hielt ihre Kinder wie rechtmäßige Enkel. Nach dem Tode der Hildegard heiratete er Fastrada aus ostfränkischem Stamm, deren ungünstigem Einfluss es zugeschrieben wurde, dass er ein einziges Mal bei Gelegenheit einer Verschwörung zu übertriebener Härte sich hinreißen ließ. Für seinen übermäßigen, für die Regierung verhängnisvollen Schmerz bei ihrem Tod entdeckte man, so erzählt die Sage, eine magische Ursache in einem Ring, den sie am Finger trug. Der Erzbischof Turpin zog ihn der Toten ab, und die Neigung des Königs ging auf ihn über, bis der geistliche Herr den Talisman in einen Teich bei Aachen versenkte. Seitdem pflegte der Kaiser, in Trauer und Traum versunken, stundenlang an diesem Teich zu sitzen; das bezauberte Gewässer, zum Teil verschüttet, befindet sich am Rande der Stadt in der Nähe der Frankenburg, einem düsteren, efeuumrankten Gebäude, das die Stelle der alten Königsburg bezeichnen soll.
Keines anderen germanischen Helden Bild ist so farbenbunt, so vielseitig prächtig von der Sage aufgefangen. Immer erscheint er in ihr von Freunden und Gefährten umgeben, immer freundlich, furchtlos, überlegen, großmütig, aber auch zuweilen streng und vernichtend.
Notker der Stammler oder Notker der Dichter) genannt, (* um 840 in Elgg oder Jonschwil; † 6. April 912 in der Fürstabtei St. Gallen) war ein bedeutender Gelehrter und Dichter der karolingischen Zeit.
Notker der Stammler, der nach Karls Tode aus mündlicher Überlieferung von ihm erzählt, nennt ihn nicht nur den weisen, den milden, den siegreichen, sondern auch den schrecklichen, den furchtbaren Karl, aber das eine ebenso bewundernd wie das andere. Nicht ohne Ströme von Blut zu vergießen hat er sein Reich gegründet. Die Sachsen aber, die am meisten durch ihn gelitten hatten, trugen es ihm nicht nach; auch für sie war er der Urquell alles Guten und Großen im Reich, das Urbild eines germanischen Heldenkaisers.
* * *
Die Deutschen und das Christentum
Die Deutschen und das Christentum
Man möchte gern wissen, was von Staat und Kirche geschah, um die Sachsen zu bekehren, wie die Bekehrung wirkte, was für ein Christentum es war, das gelehrt und das aufgenommen wurde.
Rabanus Maurus (links), Alkuin (Mitte), St. Martin zu Tours (rechts)
Alkuin war ein bedeutender Vermittler der in England und Irland durch die Zeit der Völkerwanderung hindurch geretteten lateinischen Bildung ins Frankenreich, die er als Lehrer zahlreichen Schülern.
Ein schöner Brief des Angelsachsen Alkuin an Kaiser Karl gibt zu verstehen, dass die Bekehrer hauptsächlich fordernd auftraten, indem sie den Zehnten zur Erhaltung der Kirche auferlegten, der, wie es scheint, mit Härte eingetrieben wurde. Es sei besser, meinte Alkuin, den Zehnten als den Glauben zu verlieren, es sei auch nicht erwiesen, ob die Apostel gewollt hätten, dass der Zehnte gegeben werde. Wären die Neugetauften später reif im Glauben geworden, möge man ihnen ein so schweres Gebot zumuten, zunächst solle man sie die Heilswahrheiten lehren und ihnen mit Werken der Barmherzigkeit näherzukommen suchen. Ohne Zweifel hatte Alkuin gehört, wie die Sachsen sich beklagten, dass die Religion des Gottes der Liebe für sie nur Bedrückung bedeute; wusste er, dass für die Predigt nicht genügend gesorgt war. An den Erzbischof Arn von Salzburg schrieb er, der Kaiser habe den besten Willen, aber er habe nicht genug Leute, die von der Liebe zur Gerechtigkeit beseelt wären, es gäbe eben mehr Diebe als Prediger, und mehr Menschen suchten das Ihre als das Göttliche.
Überall und zu allen Zeiten sind von den Menschen, die ein Gesetz ausführen sollen, viele, ja die meisten voller Mängel und Schwächen, so dass der Wille des Gesetzgebers selten rein zur Geltung kommt. Dasselbe ungünstige Verhältnis von Guten, Minderguten und Schlechten besteht natürlich in allen Schichten des Volkes und bestand bei den zu Bekehrenden wie bei den Siegern. Der Art der Bekehrung entsprach die Gesinnung, mit welcher die Taufe empfangen wurde, wie die folgende Anekdote erzählt. Als einmal um Ostern fünfzig Heiden zugleich sich zur Taufe meldeten, waren am Hof des Kaisers nicht so viele leinene Gewänder vorrätig, mit denen man die Täuflinge zu beschenken pflegte, und die fehlenden wurden schnell aus grobem Stoff zusammengenäht. Entrüstet sagte der eine der Heiden, als man ihm einen solchen Kittel reichte: „Zwanzigmal schon habe ich mich hier gebadet und immer habe ich gutes neues Gewand bekommen; dieser Sack passt höchstens für einen Sauhirten, nicht für einen Krieger. Wenn ich mich nicht meiner Nacktheit schämte, könntet ihr das Kleid mitsamt dem Chrisam behalten.“
Seit ihren Anfängen hatte die Kirche eine wesentliche Veränderung erfahren: als der Glaube des herrschenden Volkes gehörte sie nicht mehr in erster Linie den Armen und Sklaven, sondern den Großen. Bei allen germanischen Stämmen wurden die Könige und Herzöge zuerst Christen, und ihnen schloss sich der Adel an; was sie zum Übertritt bewog, war die Hoffnung, dass der Christengott ihnen Sieg verleihen werde. In den ersten Jahrhunderten hatte man die Armen beschenkt, wenn man die Kirche beschenkte; was der Kirche gehörte, gehörte den Armen, die Tätigkeit der christlichen Kirchenvorsteher bestand hauptsächlich in der Armenpflege. Allmählich, wie der Aufgabenkreis der Kirche sich erweiterte, wurde es üblich, dass die Bischöfe ihr Vermögen in vier Teile teilten und davon einen Teil für sich, einen für die Kanoniker, einen für die Instandhaltung und Verschönerung ihrer Kirche und einen für die Armen verwendeten. Almosen wurden noch immer reichlich verteilt, und Almosengeben von der Kirche dringend empfohlen; aber die Armen wurden doch als untergeordnete Leute und gewiss oft mit Geringschätzung behandelt. Es wurde erzählt, Widukind habe als Gefangener Karls, während sie, ein jeder an einem besonderen Tisch, speisten, gegen Karl bemerkt: „Euer Christus sagt, in den Armen werde er selbst aufgenommen. Mit welcher Stirn redet denn ihr uns zu, dass wir unsere Nacken beugen sollen vor dem, welchen ihr so verächtlich behandelt und dem ihr nicht die geringste Ehrerbietung beweist?“ Der Kaiser, so heißt es weiter, erschrak und errötete; denn die Armen saßen demütig am Boden.
Das Missverhältnis zwischen Ideal und Wirklichkeit, das immer besteht, drängte sich sicher gerade den Heiden auf, die der neuen Lehre zweifelnd gegenüberstanden. Indessen die Armen und Sklaven waren nur ein Teil des Volkes, und die Beziehung zur Armut ist nur ein Teil des Christentums. Erschüttert durch das ungeheure Erlebnis des mehr als dreißigjährigen Kampfes beugten sich die Besiegten, wie Widukind getan hatte, dem fremden Gott, der seine Übermacht an ihnen bewiesen hatte. Von ihm erwarteten sie nun Sieg im Kampf, Gedeihen der Äcker, Glück und Gelingen in allen Angelegenheiten, bereit, ihm dafür mit grenzenloser Ergebenheit zu dienen. Der alte Götterglaube, ob er nun dem nordischen ähnlich war, wie er sich in der Edda darstellt, oder ob er bei den deutschen Stämmen sich anders entwickelt hatte, sicherlich hatte er nicht mehr die quellende Frische eines neuen oder erneuerten Glaubens.
Edda ist der Name zweier Werke des 13. Jahrhunderts aus Island. In diesen beiden Werken werden skandinavische Sagen über die nordische Mytholokie und der Asen erzählt. Dabei ist die Snorra-Edda in Prosa geschrieben, während in der Lieder-Edda alte Lieder niedergeschrieben wurden. Obwohl beide Werke denselben Namen tragen und ähnliche Geschichten liefern, hängen sie nicht direkt miteinander zusammen. Die Lieder-Edda ist eine Sammlung altisländischer Lieder, die sich im Laufe der Jahrhunderte im Volksmund gesammelt hatten. Die Snorra-Edda hingegen stellt einen Überblick des damaligen nordischen Glaubens dar, der wirklich erst im 13. Jahrhundert durch Snorri Sturluson entstanden ist. Snorri Sturluson bedient sich mehrerer, heute unbekannter Quellen und beinhaltet teilweise auch Lieder, die in der Lieder-Edda niedergeschrieben sind.
Man weiß aus den Klagen des Bonifatius, dass sich die Religiosität der heidnischen Deutschen hauptsächlich in abergläubischen Bräuchen und Beschwörungen äußerte, im Wählen glückbringender Tage, im Los werfen, im Zwingen des Wetters oder menschlichen Willens; in solchen Formeln war der einst sinnvolle, lebendige Glaube erstarrt. An dem christlich abgewandelten Aberglauben festzuhalten, genügte dem religiösen Bedürfnis vieler. Weise Päpste ordneten an, dass soviel wie möglich der christliche Kult an heidnische Feste, Gebräuche, Gewohnheiten angeknüpft werde; so traten denn Heilige an die Stelle der Götter, und die das Leben Christi und der Heiligen bezeichnenden Feste an die Stelle der heidnischen, die den Sonnenlauf, das Erwachen und Hinsterben der Natur begleiten. Unter den Sachsen und Friesen, den zuletzt bekehrten Stämmen, waren wohl viele Bauern, die, wenn sie sich auch an die neuen Namen gewöhnten, doch der Kirche und den Priestern im Herzen feindlich blieben auf eine verbissene, schweigsame, gefährliche Art. Aber auch bei diesen schwand die Erinnerung an den alten Glauben, selbst wenn sich die alten Zaubersprüche im Gedächtnis erhielten. Die, welche die Pfaffen hassten, fühlten sich trotzdem als gute Christen.
(Die meisten Menschen in deutschen Landen wurden nicht missionisiert, sondern nur christianisiert.)
Ein ganzes Volk kann sich nicht plötzlich wesentlich verändern. Für die große Menge änderten sich zunächst nur die Namen und die Formeln. Einzelne religiös Begabte erfuhren durch die Berührung mit dem Christentum ein erschütterndes Erlebnis und eine Wandlung, und von solchen ging allmählich umbildender Einfluss auf das Volk aus. Es war nicht so, dass das Christentum seine Bekenner sofort auf eine hohe moralische Stufe gehoben hätte; aber das unergründliche Bibelwort riss Schluchten in ihrer Seele auf, aus denen heraus sie glühender lebten. Altheilige Vorstellungen verschmolzen mit dem neuen Gottesbild. Jehova (Jahwe – יהוה) war dem alten nordischen Himmelsgott verwandt; wie dieser durchstürmte er die Nacht auf weißem Blitz, Dichterworte, Zauberworte auf den überschwenglichen Lippen. Sie begriffen ihn als den Herrn, die furchtbare Majestät, unnahbar in ewige Glut gehüllt, als den Urton, der die Welt durchsummt. Sein Weg war unerreichbar hoch, sein Wille unerforschlich, unwiderstehlich. Und dieser Allmächtige wurde des Menschen Freund, schloss einen Bund mit ihm, und aus eines menschlichen Mädchens Schoß zeugte er wunderbar sein Ebenbild, den Frühlings- und Liebesgott, dessen Tod Dunkel und unendliche Trauer über die Erde ausbreitet. Den Mittelpunkt des Kultes und des Glaubens bildete das Sakrament des Abendmahls. Man feierte darin ein heiliges Geheimnis, die Vermählung von Gott und Natur, die Entzündung des elementaren Stoffes durch die Flamme Gott. Das Zauberwort des Magiers am Altar presste die durch das Weltall ergossene in einen elektrischen Punkt zusammen und leitete sie zu Segen oder Fluch auf die Lippe des sterblichen Menschen. Die wenigsten hatten das Bedürfnis, das Wunder zu verstehen, da sie es erlebten. Die Hostie war neben den Reliquien der Mittelpunkt der Wundersucht, das schauerlichste Mittel der Zauberei. Die Verehrung der irdischen Überreste von Heiligen, ein edler Brauch, vermischte sich bald mit teils heidnischen, teils weltlichen Vorstellungen, die von wenigen Hochstehenden benutzt, von den meisten geteilt wurden. Jahrhunderte hindurch waren Reliquien ein Zaubermittel, das von den Besitzenden gesammelt, erjagt, wenn es nicht anders ging, gestohlen wurde.
Gerhard vom Berge (* im 14. Jahrhundert; † 15. November 1398) stammte aus dem Hause der Herren vom Berge, die bei Minden ihren Sitz hatten und bis 1397 die Vogteirechte des Bistums Minden wahrnahm, er war Domkantor, dann Domdechant im Minden später das Bischof von Verden und Bischof von Hildesheim.
Als im 14. Jahrhundert Bischof Gerhard von Hildesheim gegen mehrere mächtige Fürsten in die Schlacht ging, versprach er erst der Mutter Gottes ein goldenes Dach auf ihre Kirche für den Fall seines Sieges, während sie sonst mit einem Strohdach sich begnügen müsse, außerdem steckte er Reliquien in seinen Ärmel. „Leve Kerel, truret nich, hie hebbe ek dusend Mann in miner Mauen“, rief er seinen Leuten zu, um sie gegen die Überzahl beherzt zu machen, und errang einen gewaltigen Sieg. Wenn sich viel Abgeschmacktes und Rohheit in die Auffassung des Göttlichen mischte: was wäre eine Religion, die nicht auch Magie wäre? Teilhaben an der Gotteskraft, das ist es doch, was alle Gläubigen wollen, die einen um der rohesten, andere um der sublimsten Zwecke willen. Bei aller derben Sinnlichkeit versenkten sich die Deutschen mit Leidenschaft in das Übersinnliche. Die erhabene Gewaltsamkeit, mit der das Christentum den eigentlichen Schauplatz der Menschengeschichte von der Erde hinweg in ein jenseitiges Geisterreich verlegt, gerade diese Umwälzung, die der Epoche, die man Mittelalter nennt, die grandiose Spannung, die geheimnisvolle Tiefe verlieh, das Leben in ein Himmel und Erde überbrückendes Drama verwandelt, entsprach einer Geisteskraft, die dem Deutschen besonders eigen ist, der Phantasie. Der Sinn für das Unsichtbare, der vielleicht mit der Begabung des deutschen Menschen für Musik zusammenhängt, öffnet sein Ohr den Stimmen von drüben.
Unterdessen ging die Ausgestaltung des künftigen Bistums Münster weiter:
Liudger (* 742 in Zweesen, heute ein Stadtteil von Utrecht in den Niederlanden † 26. März 809 in Billerbeck) wurde am 30. März 805 vom Kölner Erzbischof Hildebold (787–818) zum ersten Bischof von Münster geweiht.
Liudger, der erste Bischof von Münster, der, weil er selbst Friese war, leichter Zugang zu seinem Volk fand als die früheren Missionare, bekam einen wertvollen Gehilfen in dem sangeskundigen Bernlaf. Ihn hatte die Schönheit der Psalmen für das Christentum gewonnen, und da er überall beliebt war, weil er von den Taten der Vorfahren singen und sagen konnte, wehrte man ihm auch nicht, als er für seinen Glauben warb. Diese Gesänge überzeugten unmittelbar, auf Zauberart. Nicht nur der friesische Sänger, nicht nur Mönche, sondern auch Könige wussten viele Psalmen auswendig und führten eine Psalmensammlung auf Reisen mit sich. Karl der Große liebte die Musik und pflegte in der Kirche mit gedämpfter Stimme die Psalmen mitzusingen. Keine Kunst ist so wie die Musik Verkünderin des Übersinnlichen, doppelt so, wenn sie sich mit der Wirkung der Architektur verbindet. Die Feierlichkeit des Gottesdienstes in den Chören der karolingischen und ottonischen Kirchen mögen mehr als die Predigt die Herzen dem dreieinigen Gott zugeführt haben.
Indessen, wenn auch die neue Religion hauptsächlich als Himmelszauber auf die Seele wirkte, so herrschte sie doch auch als sittliche Macht. „Du sollst heilig sein, denn ich bin heilig.“ Von allen Göttern, zu denen die Völker beten, hatte noch nie einer so zu seinem Volk gesprochen. Der Sinn des deutschen Menschen für Gerechtigkeit verband ihn mit dem Gott, der der Gerechte hieß, das Kämpferische seiner Gesinnung machte, dass er sich willig in die Geisterschlacht zwischen Gut und Böse hineinreißen ließ. Die Weltüberwindung durch Askese, die der Mönch im Kloster führte, war zugleich ein ritterlicher Gedanke und den Germanen nicht durchaus fremd. Allerdings waren sie im Allgemeinen zügellos im Trinken und in der Frauenliebe; sie bedurften des Rausches. Den erwählten Frauen gaben sie sich mit einer fast kindlichen Gewaltsamkeit hin, und es kam zu erbitterten Kämpfen mit der Kirche, wenn sie ein Liebesverhältnis wegen zu naher Verwandtschaft zu lösen unternahm. Andererseits wurde in der germanischen Mythologie Jungfräulichkeit als Quell übermenschlicher Kraft begriffen, und im Verhalten zum Tod, den zu fürchten für den Freigeborenen als Schande galt, lag Selbstüberwindung. Karl der Große verabscheute Trunkenheit. Dass bloßes Sichgehenlassen nichts Großes erzeugt, wusste auch der heidnische Deutsche, und gerade weil der Freie keinen Zwang duldet, musste er sich selbst zwingen. Ohne diesen Selbstzwang gibt es keine Ehre. Um an dem Kampf des schaffenden Gottes gegen den zerstörenden Teufel teilzunehmen, strömten Männer und Frauen den Klöstern zu.
Im Süden Deutschlands hatten schon vor Bonifatius Klostergründungen stattgefunden, sowohl in Franken wie in Schwaben und Bayern. In Schwaben gründeten iroschottische Mönche Reichenau und Sankt Gallen, im frommen Bayern beteiligten sich die Bischöfe, die einheimischen Herzöge und adligen Privatpersonen. So etwa wie die ersten europäischen Ansiedler in den wilden Westen Amerikas eindrangen, so zogen glaubensstarke, abenteuerlustige Leute in kleineren und größeren Gruppen dem Süden und Osten zu, drangen in die alten römischen Provinzen ein, wo längs der großen Straßen noch Romanen, abseits in den Flusstälern Slawen wohnten. Auch einzelne freie Bauern siedelten und rodeten, der Name manches kühnen Mannes ist in den Namen alter Ortschaften erhalten; aber die Klöster hatten größere Mittel zur Verfügung und erzielten dementsprechend größere Ergebnisse. Gewöhnlich wurde den Mönchen ein Stück Kulturland und ein Stück Ödland verliehen, damit sie von den Erträgnissen des einen lebten, während sie das andere urbar machten. Verlassene Ruinen aus der Römerzeit lieferten oft das Material für die klösterlichen Bauten; die Trümmer des alten Iuvavum ermöglichten, dass gleich das erste Salzburger Kloster aus Stein hergestellt werden konnte. Kam eine auswandernde Gesellschaft an der Stätte an, die zur Errichtung eines Klosters oder der Filiale eines Klosters geeignet schien, so wurde zum Zeichen der Besitznahme ein Kreuz aufgestellt und dann eine Zelle gebaut, wovon das häufige Vorkommen des Wortes Zell im Ortsnamen Kunde gibt. Sie wurde unter den Schutz der heiligen Margarete oder des heiligen Georg, des Drachenüberwinders, gestellt, wenn man in benachbarten Wäldern die wilden Tiere fürchtete; freundliche Auen weihte man der Jungfrau Maria. Die strenge Regel des Bonifatius, wonach die Mönche alle Arbeit selbst tun sollten, wurde in Bayern nie durchgeführt; die schwere Arbeit der Kolonisation wurde von hörigen Knechten geleistet.
Passau, St. Florian, Kremsmünster, Chiemsee, Staffelsee, Wessobrunn, Tegernsee, Benediktbeuren, die beiden letzteren von zwei adligen Brüderpaaren gestiftet, wurden in Bayern zu bedeutenden Kulturmittelpunkten, in Franken Lorsch und Prüm, im Elsass Weißenburg, in Sachsen Korvey und die berühmten Nonnenklöster Gandersheim, Quedlinburg und Nordhausen. Die Schenkungen, mit denen die Klöster überhäuft wurden, machten sie schnell außerordentlich reich.
In den Vorratshäusern und Ställen des Klosters Staffelsee befanden sich im Jahre 812: 1 Pferd, 26 Ochsen, 20 Kühe, 1 Stier, 51 Stück Kleinvieh, 5 Kälber, 87 Hammel, 14 Lämmer, 17 Böcke, 58 Ziegen, 12 Böckchen, 40 Schweine, 50 Frischlinge, 63 Gänse, 50 junge Hühner, 17 Bienenstöcke, 20 Speckschwarten, 40 Käse, 127 Fett- und Schmalztöpfe. Dazu kamen noch Honig, Butter, Salz und Malz. In den Mägdekammern spannen und webten 24 Mägde und verfertigten aus Wolle und Leinen Wäsche und Kleidungsstücke. Das Land wurde teils verpachtet, teils vom Kloster selbst durch Hörige bewirtschaftet, die teils mit dem Land zusammen geschenkt waren, teils sich mit oder ohne Land dem Kloster freiwillig ergaben. Trotz des damaligen Überflusses an Land und Leuten bedarf der Wetteifer des Schenkens, der im 9. und 10. Jahrhundert das deutsche Volk ergriff, der Erklärung, und er erklärt sich hauptsächlich durch die Gewalt des Glaubens. Mochte immerhin noch mancher sächsische Bauer in einsamen Höfen sich an seinen alten Runen und Sprüchen genügen lassen, der Adel und die begüterten Freien waren gläubige Christen, überzeugt, das Heil ihrer Seele nur durch die Vermittlung des Papstes in Rom empfangen zu können.
* * *
Das Kloster
Das Kloster