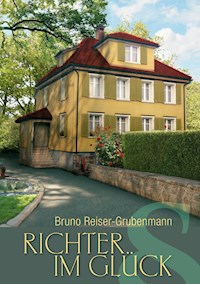
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Ein habgieriger Hausbesitzer hat eine von Fehlern strotzende Klage gegen seine Mieter eingereicht. Der herzlose Gerichtspräsident stellt die ganze Familie ohne Verhandlung widerrechtlich auf die Straße… Ein unbekannter Täter begeht schweren Hausfriedensbruch, wird später erkannt und bleibt dennoch straffrei… Eine vom Bundesgericht bestrafte Person versucht die Entschädigung an das Opfer an einer filmreifen amtlichen Versteigerung aus der Welt zu schaffen. Sein Arbeitgeber kann das Manöver in letzter Minute verhindern… Davon stand nichts in der Zeitung. Im stolzen Rechtsstaat werden solche für die betroffenen Menschen verheerenden Schicksale als unbequeme Einzelfälle abgetan. Eine idealistische Mitbürgerin hat eine kostenlose private Beratungsstelle für Menschen in existenziellen Notlagen gegründet. Beispielhaft erzählt sie zwei Fälle, die tief in die Niederungen des Schweizer Rechtssystems führen und von der Ohnmacht der Betroffenen, wenn Behörden und Rechtsprechung versagen, berichten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 161
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
M it zunehmendem Kopfschütteln lauschte ich den Schilderungen krasser Ungerechtigkeiten, von denen die Öffentlichkeit in unserem stolzen Rechtsstaat nichts erfuhr. Es handelte sich eben nur um unbequeme „Einzelfälle“. Im sonnengebräunten Holzhaus ihrer Großeltern im Eifischtal rund 1900 Meter über dem Meeresspiegel erzählte mir die Leiterin einer kostenlosen privaten Beratungsstelle für benachteiligte Mitmenschen einige beklemmende Beobachtungen aus ihrem Berufsalltag in einer entfernten Landesgegend. Mehr als einmal seien ihr bei ihrer Tätigkeit für Menschen, die in die Schuldenfalle geraten waren, Fälle unbegreiflicher Härte von Seiten der Behörden und Gerichte begegnet. Sie erinnerte sich durchaus auch an tröstliche Erfahrungen und Mitmenschlichkeit. So als eine vom Bundesgericht verurteilte Person versuchte, die dem Opfer zugesprochene Entschädigung in einer filmreifen amtlichen Versteigerung aus der Welt zu schaffen. Ein hilfsbereiter Arbeitgeber schritt dagegen ein und verhinderte das schändliche Manöver in letzter Minute. Häufiger ging es aber um Fälle von Willkür rechtspflegerischer Organe, so zum Beispiel bei einem schweren Hausfriedensbruch durch einen unverfrorenen Unbekannten, der dann anhand seines anonymen Schmähbriefs erkannt wurde und dennoch straffrei blieb. Oder in dem Prozess um einen geldgierigen Hauseigentümer, der gegen einen seit neun Jahren bei ihm wohnhaften Mieter eine vor Buchhaltungsfehlern strotzende Klage einreichte. Der kaltschnäuzige Bezirksgerichtspräsident ließ des ungeachtet die ganze Familie ohne Verhandlung am Freitagabend vor Pfingsten auf die Straße setzen.
Auf meine Anregung, über solche Vorkommnisse ein Buch zu schreiben, erklärte das Kind der Berge lächelnd, nach ihrem Kurzurlaub nur noch Zeit für die gegenwärtigen Sorgen von Menschen auf der Schattenseite des Lebens zu haben. Mit zurückliegenden Missetaten wolle sie sich nicht auch noch befassen. Deshalb notierte ich mir einige dokumentierte Angaben der Frau, die den gleichen Namen trägt wie der Erbauer der Gotthardbahn.
* * *
Die junge Ilse lernt den erträumten Mann kennen: Michael, großgewachsen, hübsch, schwarzhaarig, romantisch, intelligent – und reich. Sie begegnet ihm bei einem Hochzeitsfest, das nach althergebrachter Meinung ein neues Glück stiftet. Die beiden verlieben sich unsterblich. Was wie ein kitschiges Märchen begann, wird durch die Mutter des Auserwählten jedoch zunichtegemacht; denn sie hat andere Pläne mit ihm und verbietet ihm schließlich den Umgang mit dem Arbeiterkind. Nach einer schlechten Erfahrung mit einer anderen Frau lässt er Ilse wissen, dass er nicht mehr auf seine Mutter hören und sich nunmehr für sie entscheiden würde. Doch Ilse hat sich inzwischen von Walter, einem Mann aus dem einfachen Volk, zur Ehe überreden lassen. Sie verbündet sich mit der schwatzhaften Olga gegen den verachteten, nun im Weg stehenden Walter.
So beginnt die Erzählung der gemeinnützig tätigen Beraterin. Beispielhaft erzählt sie vor allem zwei Fälle, die tief in die Niederungen des Rechtssystems führen und von der Ohnmacht der Betroffenen, wenn Behörden und Rechtsprechung versagen, berichten. Die Idealistin seufzte und diktierte mir:
* * *
Olga Krieg starb im März 2003. Meine Geschwister sowie die Cousine und der Cousin baten mich, den Nachlass dieser Schwester unseres Großvaters zu ordnen. Am meisten fesselten mich nicht Wertpapiere, sondern drei Genugtuungserklärungen, welche von Olga im Laufe von zwölf Jahren vor den Gerichtspräsidenten verschiedener Städte unterzeichnet worden waren. Jedes Mal entschuldigte sich Olga bei demselben Ehepaar für immer ähnliche Verleumdungen, die sie über Jahre hinweg ausgestreut hatte. Auch die Opfer gehörten zu meiner weiteren Verwandtschaft.
Wie war es möglich, dass eine Einzelperson so gezielt und hartnäckig das Leben von Mitmenschen vergiften konnte? Warum glaubten so viele Leute deren Lügen? Weshalb zogen sich manche nur wortlos zurück, ohne den Verfemten eine Chance zur Klarstellung zu geben? Welche Kräfte wurden neben heimlicher Schadenfreude wirksam? Gerade weil ich selber Olga und die von ihr gebeutelte Familie aus den Erzählungen meiner Mutter nur von der besten Seite kannte, trug ich meine Erinnerungen und Beobachtungen zusammen, um für mich die Wahrheit herauszufinden. Merkwürdigerweise scheint niemand den langsam an den Tag gekommenen wahren Sachverhalt zur Kenntnis genommen zu haben. So verjubelten einige meiner Verwandten auf der Heimfahrt von einem der Gerichtsprozesse frohlockend das Zeugengeld in einem Gasthaus. Sie waren im Glauben, auf Kosten des angeschwärzten Ehepaars zu zechen. Dabei waren natürlich die Gerichtskosten in allen drei Verfahren der Verleumderin voll aufgebürdet worden.
Zu denken gab mir auch, dass vor allem eines der Opfer sozusagen als Stellvertreter für seinen längst verstorbenen Vater Arnold den Kopf hinhalten musste. Olga hielt sich als zwölfjährige Schülerin oft in der Wohnung meiner Großeltern in Oberhausen auf. Arnold Wolf stand vor der Heirat mit Rosa, einer Schwester meiner Großmutter Lina. Er hatte sie kennengelernt, als sie auf dem Bauernhof des wohlhabenden Herrn Gugolz eine Freundin besuchte. Der kecke Arnold stieg zum Spaß auf das Fahrrad von Rosa und kurvte auf dem Hofplatz herum. So begann eine lebenslange Beziehung. Zu jener Zeit verkehrte in Oberhausen auch Karl Fischer, der Bräutigam unserer Berta, einer anderen Schwester meiner Oma. Die beiden Jungmänner schienen nicht viel von dem vielleicht etwas vorlauten und eitlen Jungmädchen Olga zu halten und mokierten sich über sie. Diese belauschte die ahnungslosen Herren dabei in einem Nebenzimmer. Von diesem Tage im Jahre 1925 an waren die beiden Familiennamen Wolf und Fischer für sie mit Gefühlen einer starken Abneigung verbunden.
Der spätere Prügelknabe Walter Fischer kam 1930 in Schooren zur Welt. Ein inneres Bild aus früher Kindheit blieb ihm für immer im Gedächtnis haften: Er spielte gerade mit einem kleinen Mädchen, das aus dem Welschland zu Verwandten in die Ferien gekommen war, als dessen Vater hinzutrat. Er fragte Walter mit sanfter Stimme und französischem Akzent: „Bist du der Junge, der meine Yvonne fluchen gelehrt hat?“ Er lud Walter ein, ins Haus mitzukommen. Trotz der freundlichen Einladung blieb Walter trotzig auf dem Vorplatz stehen.
Die frühen Jugendjahre von Walter Fischer waren schnurgerade verlaufen. Von einem arbeitsamen und bescheidenen Elternpaar sorgfältig erzogen und von wohlgesinnten Lehrkräften ausgebildet, fehlte es ihm an nichts. Es wurde ihm auch bald einmal bewusst, dass seine Familie besser lebte als die Familie der Base Elsi und des Vetters Peter, wie man Cousine und Cousin auf dem Lande noch nannte. Gelegentlich besuchte die Mutter ihre unglückliche Schwester Rosa, wobei Walter bei gemeinsamen Fahrradausflügen darum bettelte, auf ihrem Gepäckträger mitfahren zu dürfen. Mit dem Rad gelangte man bis zu einer Fähre und setzte die Velotour nach der Seeüberquerung fort. Es konnte aber geschehen, dass die lieben Verwandten von ihrem Haustyrannen eingeschlossen worden waren, so dass man sich im besten Fall mit Hilfe von herausgereichten Stühlen und dergleichen durch ein Fenster Zutritt verschaffen konnte. Die Stimmung war dann nicht sehr gehoben und die Gastgeber schämten sich auch ihres Schicksals. Verlegen verglichen die beiden Vettern ihre Schulnoten und verrieten einander ihre heimlichen Wünsche. Bei späteren Besuchen mit dem Fahrrad erfanden sie ein Spiel, welches sie in die Rollen von Großwildjägern und Hochseekapitänen versetzte, welche nach dreißig Jahren wieder zusammentrafen und ihre Erlebnisse austauschten.
Sicher konnte Walters Mutter ihrer Schwester manchmal etwas unter die Arme greifen, doch eine umfassende Hilfe war nicht möglich. Zudem spielte auch Rosas Stolz mit, der in einer solchen Lage leicht verletzt werden kann. Anderseits wäre ja der Trinker in der Lage gewesen, mit einer gewissen Mäßigung mehr Mittel in die Haushaltskasse fließen zu lassen. Und zudem war Walters Familie nicht wohlhabend, denn der Kauf des Milchkreises, das heißt die Berechtigung zur Zustellung von Milchprodukten in die Häuser eines abgegrenzten Ortsgebietes, war nicht billig gewesen.
Unvergesslich blieb Walter ein Zwischenfall, als er mit seinem Vater, den er oft begleitete, Milch und Milchprodukte in die Häuser von Kunden in Bendlikon verteilte. Das Elektrofahrzeug war nicht leicht lenkbar und kroch nur mühsam die steilen Straßen hinan. Irgendwie kam der Sohn einem Hinterrad zu nahe, wobei ihm ein halber Schuh abgerissen wurde. Der schockierte Vater war heilfroh, dass es nicht zu einer Verletzung gekommen war, und betrat mit dem erschrockenen Sohn eine Konditorei, wo er ihn zur Ablenkung einige Leckerbissen auslesen ließ. Die wackere Bäckersfrau wunderte sich über die Großzügigkeit an einem gewöhnlichen Werktag und fragte: „Ist denn der Knabe so verwöhnt?“ Die Mutter staunte nicht weniger, als Walter plötzlich mit neuen Schuhen nach Hause zurückkehrte.
* * *
Sein Cousin Peter Wolf trug an diesem Tage eine Zweiliterflasche voll sauren Mostes vom stattlichen Bauernhof Zelg in Toggwil nach Hause in die enge Mietwohnung. Er war gut gelaunt, denn am Vormittag hatte ihn die Schulvikarin gelobt. Als Jüngster aus den oberen Klassen habe er den besten Aufsatz zum Thema Frühling abgeliefert. Die entgegenkommenden älteren Schüler schauten ihn etwas höhnisch an und einer rief halblaut: „Hast du schon wieder Durst?“ Sie wussten natürlich wie jedermann im Dorf, dass der Alkohol für den Vater Arnold Wolf bestimmt war, den man kaum je nüchtern sah. Den kleinen Lohn für seine Arbeit im Wald vertrank er zum Teil schon auf dem Heimweg im Gasthof Zum Adler. Die Mutter fragte während des Abendessens in der Küche immer: „In welchem Zustand kommt der Vater wohl heute nach Hause?“ Eigentlich kannte sie die Antwort bereits. Im Treppenhaus waren schwere Schritte zu hören. Mit grimmigem Gesicht trat „der Herr und Gebieter“, wie sich der Familienvater nannte, in die Stube und rief durch die offene Türe zur Küche, wo sich seine Frau und die Kinder nur noch mit gedämpfter Stimme zu verständigen wagten. Aber auch über dieses Flüstern ärgerte sich Arnold. Er rief durch die offene Küchentüre: „Bringt mir den Tabak!“ Er stopfte sich eine Pfeife und ließ sich auf das Sofa fallen. Eine halbe Stunde später saß er seiner Frau gegenüber, welche die Zeitung las. Vom sauren Most gut geölt, begann er jetzt auf die Frau einzureden, denn heute war er im Wirtshaus an einen Gast geraten, den er von einem Wahlplakat her als Parlamentarier erkannt hatte und dem er seine eigenen Ansichten erklären wollte. Er war nicht auf Gegenliebe gestoßen. Im Gegensatz zum gebildeten Volksvertreter zog es die Ehefrau zu Hause vor, den endlosen Prahlereien nickend zuzuhören. Die Kinder waren längst zu Bett gegangen, wo sie der dünnen Wände wegen jedes Wort mitbekamen, bis nur noch ein Lallen und dann gar nichts mehr zu vernehmen war.
Am Morgen trat Peter vor das Haus, wo zwei Kameraden auf dem Schulweg auf ihn warteten. Er folgte ihren leicht schadenfreudigen Blicken und bemerkte, dass sein hölzernes Dreirad vom Vater mit einem einzigen Tritt zerstört worden war. Erst vor einigen Tagen hatte ihm ein Arbeiter des Abfuhrwesens das von reichen Leuten ausgemusterte Kinderfahrzeug zum offenen Entsorgungswagen heraus überlassen.
Wie es in der Familie Wolf seit Jahren zuging, wusste meine Mutter sehr gut, denn Frau Wolf war ihre geliebte Tante Rosa. Schon einmal hatte sich mein Großvater für Rosa und deren erstes Kind Elsi eingesetzt. Meine Großeltern hatten den beiden Unterkunft und Schutz gewährt und waren dafür vom jähzornigen und ewig durstigen Arnold Wolf schwer bedroht worden. Seit Rosa entgegen allen Ratschlägen wieder mit ihrem Mädchen zu ihrem „Noldi“ zurückgekehrt war, gestalteten sich die verwandtschaftlichen Beziehungen eher frostig. Am großen Hochzeitsfest meiner Tante Ida musste Arnold das Mittagessen zusammen mit den Kutschern in der Hotelküche einnehmen, währenddem alle willkommenen Gäste an der festlichen Tafel im Saal speisten. Mein Großvater hatte diese Sonderbehandlung so angeordnet.
Vor Ostern 1939 trieb es Arnold Wolf besonders bunt: Er redete jede Nacht stundenlang auf seine Frau ein, wiederholte immer wieder die gleichen Berichte über seine Großtaten, obwohl die Kinder in den durch dünne Wände getrennten Kammern längst Ruhe gebraucht hätten. Da öffnete sich plötzlich die Türe zum Elternschlafzimmer und die Nachbarin Frau Mager schlug dem betrunkenen Schnorrer links und rechts ins Gesicht, worauf dieser sogleich verstummte.
Als Arnold Wolf am Ostersamstag aus einem Gasthaus nach Hause kam, fegte er mit einer einzigen Bewegung alles vom Tisch, was für das bescheidene Festmahl bereitlag. Rohe Eier, Mehl, Zucker, aber auch Farben und Schlüsselblumen lagen durcheinander auf dem Stubenboden. Großtante Rosa konnte sich nicht versagen, der gerade im Hausflur vorbeigehenden Nachbarin die Bescherung zu zeigen. Sie bereute es zwar sofort, doch hatte sich Frau Mager schon in Richtung Dorf in Bewegung gesetzt. Sie wusste, dass Arnold vor kurzem wegen seiner Trunksucht entmündigt worden war. Sie läutete bei Wolfs Vormund und verlangte, dass nun etwas geschehen müsse. Der Vormund bot noch ein Mitglied des Abstinentenvereins auf und erschien in der Wohnstube der Familie. Er forderte den Trinker zum Mitkommen auf. Nach langem Hin und Her erhob sich der Säufer und sagte zu seinen Kindern: „Euer Vater kommt nie mehr nach Hause!“ Er glaubte eine größere Wirkung zu erzielen, wenn er in der dritten Person sprach. Aber die Tränen der Kinder erweichten den Vormund nicht. Nach einer Nacht in der Ausnüchterungszelle wurde er zur Abklärung des Geisteszustandes in eine Nervenklinik gebracht und dann in die Trinkerheilanstalt Effingerhort eingewiesen, wo er ein Jahr bleiben musste. Die treue Ehefrau schrieb jede Woche einen langen Brief und die Kinder legten eigene Briefchen und Zeichnungen bei. Einmal besuchten ihn alle, eingeschlossen der Großvater aus dem Glarnerland, im streng geführten Heim ob Schinznach.
Als meine Großeltern die Patenschaft für den inzwischen zehn Jahre alt gewordenen Peter antraten, fand die kleine Zeremonie im Pfarrhaus statt, also nicht in der Kirche wie sonst üblich. Anschließend führten die Erwachsenen ein gutes Gespräch über die Weltreligionen. Meine Großmutter war damals sehr bewegt, als ihr der Knabe auf dem Heimweg anvertraute, wie froh er sei, jetzt nicht mehr als Heide zu gelten. Der Vater Arnold hatte wohl bei der Geburt seines Jüngsten den Vornamen Peter in die amtlichen Register eintragen lassen, weil er sich vornahm, seinen ehemaligen gutmütigen Arbeitgeber Peter Gugolz um die Übernahme der Patenschaft zu bitten. Dann hatte ihn der Mut verlassen, so dass von seiner Seite nichts mehr zu erwarten war.
Wohl das schönste Erlebnis ihrer Jugendzeit war für Walter und Peter und dessen ältere Schwester Elsi die Hochzeit ihrer Cousine Ida mit Daniel Weibel. Dieser war ein tüchtiger Handwerker und verbrachte seine Freizeit am liebsten in seinem Kanu auf dem nahen See. Als letztes Kind seiner begüterten Eltern wurde er immer stark umhegt. Am Familientisch wurde ihm wie in der Kindheit immer noch eine farbig bemalte Tasse hingestellt, währenddem die älteren Brüder längst ihren Kaffee aus riesigen weißen Trinkbecken schlürften. Die Hochzeitsgäste besichtigten zuerst die neue Wohnung der Brautleute mit den von meinen Großeltern gespendeten Möbeln. Es war ein alter Brauch, dass der Hausrat, die sogenannte Aussteuer, von Seiten der Braut kam. Die Hochzeitsgesellschaft wurde in sechs Kutschen verfrachtet. Auf den zwei hintersten Kaleschen durften Walter und Peter stolz neben den Fuhrleuten Platz nehmen. In der blumengeschmückten Kirche bereicherte eine Sängerin die feierliche Trauung. Dann ging die Fahrt durch benachbarte Dörfer bis in den Bezirkshauptort vor die Metzgereifiliale, in der Ida bisher gearbeitet hatte. Hier hatte Ida den Knaben Peter gelegentlich als Mitfahrer gerufen, wenn ein neuer Lieferwagenchauffeur aus der Zentrale noch nicht ortskundig war. Nun durfte Ida vom Vorgesetzten und von ihren Mitarbeiterinnen Geschenke entgegennehmen. Im Hotel Hirschen wurde ein umfangreiches Festmahl eingenommen. Vor Genuss der Nachspeise durften die Knaben die schönen Pferde streicheln und sich von ihnen Würfelzucker von der flachen Hand fressen lassen. Dann ging die Fahrt durch Peters Wohnquartier, wo sich die Mütter seiner Mitschüler in ihren Vorgärten beschäftigten und dem geschmeichelten Knaben auf seinem ungewohnten Ehrensitz wohlwollend zuwinkten. Beim Nachtessen saßen Walter und Peter neben dem Paten der Braut. Meine Mutter hatte diese Tischordnung so gestaltet, weil sie wusste, dass die Jungen nicht mit dem Fischbesteck umgehen konnten und ein Vorbild neben sich gut brauchen konnten. Der umtriebige Verwandte hatte auch den Männerchor aufgeboten, dem er selber angehörte, und gab als Tafelmajor eine lustige Geschichte nach der anderen zum Besten, zudem verlas er Glückwunschtelegramme und organisierte kleine Gesellschaftsspiele, in die er die glücklichen Kinder einbezog. Idas Base Elsi und ihre Vettern Walter und Peter glänzten mit Versen aus ihren Schulbüchern. Den ganz großen Auftritt hatte aber die Schwester meines Großvaters. Olga Krieg trug ein langes Gedicht vor, worin sie sich als „die Unschuld vom Lande“ vorstellte.
* * *
Wenn Arnold gar nichts mehr besaß, musste Peter versuchen, bei einem Landwirt auf Kredit sauren Most für seinen Vater zu holen. Die Antwort war meist: „Wir liefern ihm wieder Most, wenn er jenen vom Vorjahr bezahlt hat.“ Arnold meldete sich an den gewöhnlichen Wochentagen häufig krank. Wenn das Wochenende kam, schwang er sich auf das Fahrrad und klapperte die Wirtshäuser ab. Manchmal hatte er auch ein geschlachtetes Kaninchen bei sich, das er mit der knappen, seit Kriegsbeginn rationierten Milch aufgezogen hatte, welche eigentlich seinen Kindern zustand. Beim nächsten Wirt beglich er mit dem Kaninchen die Zeche, und im Gasthaus stand dann auf einer Wandtafel noch Hasenragout auf der Speisekarte. Wenn es hoch kam, durfte die Familie mit dem Vater zusammen die kleine Leber des Tieres verspeisen. Das musste geschehen, wenn er gerade nach Hause kam, meist mitten in der Nacht.
Ein einziges Mal entschloss sich Arnold, mit seiner Familie zu Fuß einen kleinen Ausflug in ein Gasthaus auf dem Berg zu unternehmen. Sie kamen zur Mittagszeit dort an. Der Vater bestellte je eine Mahlzeit für Frau und Kinder; für sich selber verlangte er nur sauren Most und blieb damit am Wirtshaustisch sitzen. Ein Trunkenbold rief herüber: „Musst du fasten?“ Die Wirtin bot ihm mit mitleidigem Blick auf seine Familie verständnisvoll ein halbes Menü an, was er verweigerte. Frau und Kinder schämten sich für diesen armseligen Auftritt vor den vielen fröhlich zechenden Wanderern.
Auf Weihnachten hin traf meistens ein Paket von den Verwandten im Klettgau ein. Am Heiligen Abend kramte der Vater die Geschenke hervor und verhielt sich so, als ob die Gaben von ihm gekauft worden wären.
Von seinem Lohn gab er weiterhin nichts ab. Einmal schickte er Peter zu einem Hafnermeister, um einen Lohnvorschuss zu erbitten. Dann setzte er den Knaben vor sich auf das Fahrrad und pedalte über den Berg. Im Dorfwirtshaus Zur Krone bestellte er nacheinander Most und Bier. Der Knabe bekam von der mitleidigen Wirtin endlich einen Sirup zu trinken. Am späteren Abend setzte sich ein Kind der Wirtsleute hinzu und lud ihn zum Hütchenspiel ein. Ein Bäckermeister, der Mehl eingekauft hatte und auf dem Heimweg kurz einkehrte, erbarmte sich schließlich des Schulknaben und ließ ihn auf seinem Pferdefuhrwerk bis ins Nachbardorf mitfahren. Den Rest des Weges nach Hause musste der Knabe im Dunkeln zu Fuß zurücklegen.
Einige Tage später lernte Arnold in der Spelunke einen Mann kennen, der ein Zimmer suchte. Da in Wolfs Wohnung noch eine Kammer frei war, brachte er den Unbekannten mit nach Hause und betrachtete ihn als eine willkommene Einnahmequelle. Kurz darauf wurde dieser Mann arbeitslos. Wenn Frau Rosa ihrem Arnold das warme Mittagessen zur Baustelle brachte, fragte er sie in Anwesenheit seiner Arbeitskameraden laut: „Hast du es schön daheim mit dem Zimmerherrn?“
Das Zureden des erfahrenen Anstaltsleiters Lüscher nützte nach der Entlassung aus der Entziehungskur nur eine kurze Zeit. Im Jahre 1942 telefonierte eine Händlerin dem Vormund, der Familienvater habe in kurzen Abständen mehrmals sauren Most holen lassen, und zwar zuletzt gegen kleinste Geldstücke. Der Vormund platzte dann in eine typische Szene hinein: Der Trunkenbold saß in schiefer Haltung am Stubentisch und spielte sich bei einer daneben stehenden neuen Nachbarin als großer Held auf. Am Boden standen und lagen leere Flaschen. Am Tage zuvor hatte Arnold seiner Tochter, die sich vor dem Antritt einer neuen Stelle von ihm verabschieden wollte, den Koffer zum Fenster hinaus nachgeworfen. Die Familienmutter war abwesend, weil sie für das Überleben der Familie auswärts waschen und putzen musste. Diese Aufopferung zog der Pflichtvergessene ins Lächerliche, indem er sich heuchlerisch über die zu häufige Abwesenheit der Gattin beklagte. Als er endlich seinen Vormund erkannte, erklärte er lallend, keine Zeit für den Besucher zu haben.





























