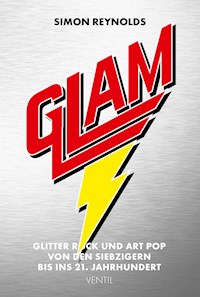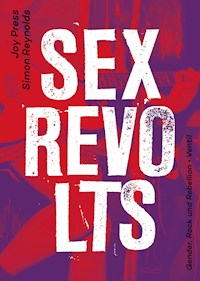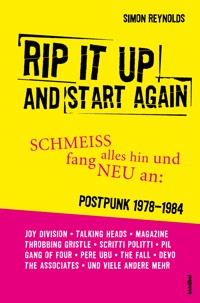
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hannibal Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Schmeiß alles hin und fang neu an Auf rund 600 Seiten stellt Simon Reynolds Bands und Musiker vor, die auf ganz unterschiedliche Weise das Rad der Musikkultur neu erfanden: Public Image Limited, The Buzzcocks, Devo, Pere Ubu, The Pop Group, The Slits, Scritti Politti, Gang Of Four, Joy Division, Wire, Talking Heads, The Fall, Robert Wayatt, The Specials, Cabaret Voltaire, Throbbing Gristle, The Human League, ABC, Art Of Noise und Frankie Goes To Hollywood, um nur einige zu nennen. Im Sommer 1976 explodierte Punk – und zwei Jahre später waren nur noch Rauchwolken und ein Häufchen Asche übrig. Johnny Rotten fragte beim letzten Konzert der Sex Pistols spöttisch ins Publikum: »Schon mal das Gefühl gehabt, verarscht worden zu sein?«. Damit brachte er die Enttäuschung und Verbitterung vieler Protagonisten und Fans der folgenreichsten Kulturrevolution der Siebzigerjahre auf den Punkt. Hier setzt Simon Reynolds an. In "Rip It Up And Start Again" nimmt er jene Musikgeneration unter die Lupe, für die das Ende von Punk ein Anfang war. Viele von ihnen hatten die Kunsthochschule besucht und kannten sich nicht nur in Musik, sondern auch in Literatur, Philosophie und Theater aus. Anders als die Punks vor ihnen fürchteten sie sich nicht vor tanzbaren Grooves, hatten keine Angst vor Synthesizern und scheuten einzig und allein die Konventionen des Rock. Sie wollten sich keiner Bewegung unterordnen, sondern bildeten ihre jeweils eigene. Während die Politik weltweit nach rechts rückte und das Orwell-Jahr 1984 bedrohlich nahe rückte, verweigerten sich die Vertreter des Postpunk der rockistischen Herz-Schmerz-Lyrik und beschrieben die Trostlosigkeit der ehemals blühenden Industriestädte. Sie wetterten gegen Rassismus oder besangen Jacques Derrida. Indem sie sich nicht nur auf die Musik beschränkten, gelang ihnen der Entwurf einer echten Gegenkultur: Sie organisierten sich selbst und setzten den Do-It-Yourself-Gedanken endlich in die Tat um. Bands und Fanzines schossen wie Pilze aus dem Boden; es entstand ein Netzwerk aus unabhängigen Studios, Labels und Vertrieben. Simon Reynolds behauptet daher: Das Versprechen von Punk wurde erst mit Postpunk eingelöst. Doch auch einem neuen Begriff von Pop wurde der Weg geebnet. Bands, die einst in der Absicht angetreten waren, das kommerzielle System von innen zu verändern, gingen im Mainstream auf, und der Erfolg ließ ihre Träume platzen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1162
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Simon Reynolds
Schmeiss alles
hin und Rip it up
fang neu an and
start again
Postpunk 1978–1984
aus dem Englischen von Conny Lösch
Mehr zu unseren Büchern und Autoren unter:www.hannibal-verlag.de
Titel der Originalausgabe:
Rip It Up and Start Again
First published 2005 by Faber and Faber Limited, London
Copyright 2005 © by Simon Reynolds
© 2025 der deutschen Ausgabe: Hannibal Verlag, ein Imprint der KOCH International GmbH,
Gewerbegebiet 2, A-6604 Höfen
www.hannibal-verlag.de
Lektorat: Hollow Skai, Manfred Gillig
Korrektur: Christian E. Fock
Cover: bürosüd°, München
Buchdesign und Produktion: bw works
ISBN 978-3-85445-786-2Auch als Buch erhältlich mit der ISBN 978-85445-785-5
Printed in Germany
CPI books GmbH
Birkstraße 10, D-25917 Leck
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne eine schriftliche Genehmigung nicht verwendet oder reproduziert werden. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Widmung
Meinem Bruder Tim, der mich mit Punk überhaupt erst auf den Geschmack gebracht hat,
meinem Sohn Kieran,
und in Erinnerung an Rebecca Press
und Burhan Tufail
Inhalt
Delirium und Klarsicht
Vorwort zur deutschen Ausgabe von Klaus Walter.
Vorbemerkung des AutorsEinleitungProlog: Die unvollendete Revolution
Teil 1: Postpunk
1. Public Image Belongs To Me: John Lydon und PiL
Public Image Ltd.
2. Outside of Everything: Howard Devoto und Vic Godard
Buzzcocks. Magazine. Subway Sect.
3. Fear and Loathing in Ohio: Die Postpunkdrehscheiben Cleveland und Akron
Pere Ubu. Devo.
4. Contort Yourself: No Wave New York
James Chance & The Contortions. Suicide. Lydia Lunch. DNA. Mars. Lounge Lizards.
5. Tribal Revival: The Pop Group und The Slits
The Pop Group. Alternative TV. The Slits. New Age Steppers. Rip Rig & Panic.
6. Autonomy in the UK: Independent-Labels und die DIY-Bewegung
New Hormones. Fast Product. Factory. Rough Trade. Cherry Red. Desperate Bicycles. Thomas Leer. The Normal. Mute. Swell Maps.
7. Militant Entertainment: Die Szene in Leeds
Gang Of Four. The Mekons. Delta 5. Au Pairs.
8. Art Attack: Talking Heads und Wire
Talking Heads. David Byrne und Brian Eno. Wire. Dome.
9. Living for the Future: Die Szene in Sheffield
Cabaret Voltaire. The Future/The Human League.
10. Just Step Sideways: Die Szene in Manchester
The Fall. Joy Division. Martin Hannett. The Passage. Factory Records. A Certain Ratio. Durutti Column.
11. Messthetics: Die Londoner Speerspitze
Scritti Politti. LMC. Flying Lizards. This Heat. Rough Trade. Section0001.xhtmlThe Raincoats. The Red Crayola. Young Marble Giants. John Peel.
12. Industrial Devolution: Musik aus der Todesfabrik
Throbbing Gristle. Whitehouse. Nurse With Wound. Clock DVA. 23 Skidoo.
13. Freak Scene: Cabaret Noir und das Theater der Grausamkeit im Postpunk-San-Francisco
The Residents. Tuxedomoon. Factrix. Chrome. The Sleepers. Flipper.
14. Careering: Aufstieg und Fall des Postpunk
Public Image Ltd.
teil 2: new pop und new rock
15. Ghost Dance: 2 Tone und die Wiederauferstehung des Ska
The Specials. Madness. The Beat. The Selecter. Dexys Midnight Runners.
16. Sex Gang Children: Malcolm McLaren, der Rattenfänger des Pantomimenpop
Bow Wow Wow. Adam & The Ants.
17. Electric Dreams: Synthiepop
The Human League. Gary Numan. Ultravox. John Foxx. Visage. Spandau Ballet. Martin Rushent. Soft Cell. Japan. DAF.
18. Fun ’n’ Frenzy: Das Postcard-Label und der Sound des jungen Schottland
Orange Juice. Josef K. The Fire Engines. The Associates.
19. Play to Win: Pioniere des New Pop
Scritti Politti. Heaven 17. Trevor Horn. ABC.
20. Mutant Disco und Punk-Funk: Crosstown Traffic im New York der frühen Achtziger (und darüber hinaus)
The B-52’s. Pylon. Club 57. Mudd Club. Jean-Michel Basquiat. ZE Records. Kid Creole & The Coconuts. Was (Not Was). Material. 99 Records. Bush Tetras. ESG. Liquid Liquid. A Certain Ratio. New Order.
21. New Gold Dreams 81 – 82 – 83 – 84: Höhepunkt und Fall des New Pop
The Associates. Altered Images. Simple Minds. Haircut 100. Orange Juice. Duran Duran. The Eurythmics. The Thompson Twins. Wham!. Culture Club. ABC. The Human League. Scritti Politti.
22. Dark Things: Gothic und die Rückkehr des Rock
Bauhaus. Batcave. Siouxsie And The Banshees. The Cure. The Birthday Party. Killing Joke. The Virgin Prunes. Theatre Of Hate. Sisters Of Mercy. Southern Death Cult.
23. Glory Boys: Liverpool, New Psychedelia und Big Music
Echo And The Bunnymen. Zoo. Wah! Heat. The Teardrop Explodes. The Blue Orchids. The Waterboys. Big Country. Simple Minds. U2.
24. The Blasting Concept: Progressive Punk von SST Records bis Mission Of Burma
Black Flag. The Minutemen. Hüsker Dü. Mission Of Burma. Meat Puppets.
25. Conform to Deform: Die Subversion der zweiten Industrial-Welle
Psychic TV. Some Bizzare. Cabaret Voltaire. Coil. Foetus. Einstürzende Neubauten. Test Dept. Swans. Depeche Mode.
26. Raiding the Twentieth Century: ZTT und Frankiemania
Malcolm McLaren. Trevor Horn. The Art Of Noise. Frankie Goes To Hollywood. Propaganda. Grace Jones.
NachtragMTV und die Zweite Britische InvasionPostpunk in Europa und darüber hinaus: Ein diskografischer ÜberblickChronik des PostpunkDanksagungBibliografie
Vorbemerkung des Autors
Nimmt man sich einen derart langen Zeitraum vor, sieben Jahre von 1978 bis 1984, die noch dazu derart vollgepackt sind mit unterschiedlichen Ereignissen und Entwicklungen wie Postpunk, sieht man sich mit einer Reihe von Problemen konfrontiert, wenn es darum geht, das Material zu sortieren. Da sich so vieles parallel ereignete, kam eine streng chronologische Darstellung nicht infrage. Ich habe dies so gelöst, dass ich die Zeit in viele kleine Erzählungen aufgesplittet habe, die sich oft geografisch ableiten: die verschiedenen Szenen in verschiedenen Städten (No Wave in New York), Regionen (Cleveland und Akron in Ohio) oder Ländern (Schottland). Andere Kapitel konzentrieren sich auf ein Genre oder eine Richtung: Industrial, Synthiepop, New Pop und so weiter. Wieder andere orientieren sich an bestimmten Gruppen von Künstlern: das Milieu um Rough Trade oder 2 Tone ebenso wie artverwandte Bands, die aber auf keinem der beiden Labels vertreten waren. In anderen Fällen werden Künstler zusammengeführt, weil direkte Verbindungen und/oder Gemeinsamkeiten bestehen: Zwischen The Pop Group und den Slits gab es personelle Überschneidungen, und eine Zeit lang veröffentlichten beide auf demselben Label. Zwischen Wire und den Talking Heads gab es keinerlei solcher Verbindungen, und doch gehören sie zusammen. Weil jede Mikroerzählung die Protagonisten von Anfang bis Ende (beziehungsweise dem Punkt, an dem es sinnvoll schien, aufzuhören) begleitet, bewegt sich Rip It Up And Start Again gewissermaßen jeweils drei Schritte vor und zwei zurück. In der Regel setzt jedes Kapitel an einem historisch späteren Punkt an als das vorangegangene, und zum Schluss befinden wir uns in den Jahren 1983 und 1984. Die Zeittafel am Ende des Buchs gewährt Einblick in die chronologischen Abläufe und macht noch einmal deutlich, wie viel im Postpunk tatsächlich gleichzeitig geschah.
Einleitung
Punk ging fast völlig an mir vorbei. Ich war dreizehn Jahre alt, wurde damals gerade vierzehn, wuchs in Hertfordshire in einer Satellitenstadt voller Pendler auf und habe nur verschwommene Erinnerungen an 1977 und das alles. Ich erinnere mich vage an Fotostrecken mit Bildern von stachelhaarigen Punks in einer farbigen Sonntagsbeilage, aber das war’s auch schon. Die Pistols, die im Fernsehen fluchen, mit „God Save The Queen“ gegen das silberne Thronjubiläum der Königin wettern und damit eine ganze Gesellschaft erschüttern – ich hab’s ganz einfach nicht mitgekriegt. Auf was ich stattdessen abgefahren bin – tja, auch das verschwimmt ein bisschen vor meinem geistigen Auge. War 1977 das Jahr, in dem ich Karikaturist werden wollte? Oder hatte ich gerade Science-Fiction entdeckt und mich in der Gemeindebibliothek systematisch durch die Werke von Ballard, Pohl und Dick gearbeitet? Ich weiß nur, dass Popmusik so gut wie gar nicht in mein Bewusstsein drang.
Mein jüngerer Bruder Tim fuhr als Erster auf Punk ab, aus seinem Zimmer dröhnte grauenhafter Lärm. Bei einer der vielen Gelegenheiten, bei denen ich rüberging, um mich zu beschweren, muss ich einen Moment innegehalten haben. Die Kraftausdrücke hatten’s mir zuallererst angetan (schließlich war ich erst vierzehn): Johnny Rotten mit seinem „Fuck this and fuck that / Fuck it all and fuck her fucking brat“ („Scheiß auf dies, und scheiß auf das / Scheiß auf alles und auf ihren Scheißbalg“). Mehr noch als die unanständigen Wörter aber waren es die Vehemenz und Virulenz, mit denen Rotten sie aussprach – jene rhythmischen „fucks“ und die dämonische Freude mit der er die r in „brrrrrrat“ rollte. Tausende von durchaus vernünftig begründeten Thesen wurden seither aufgestellt, um die soziokulturelle Bedeutung der Bewegung zu erklären, aber wer ehrlich ist, gibt zu, dass das ungeheuer Dreckige an Punk größtenteils auch seinen Reiz ausmachte. Zum Beispiel das Kranke an Devo – noch nie hatte ich etwas so Unheimliches und Widerliches gehört wie deren erste, bei Stiff erschienene Single, „Jocko Homo/Mongoloid“, die ein Freund von uns mitgebracht hatte, der bereits ein bisschen weiter war als wir.
Als ich Mitte 1978 allmählich anfing, mich für die Pistols und den Rest zu begeistern, hatte ich keine Ahnung, dass die Bewegung offiziell schon wieder „tot“ war. Die Pistols hatten sich längst aufgelöst, Rotten hatte bereits Public Image Ltd. gegründet. Weil ich anderweitig beschäftigt gewesen war und Geburt, Leben und Tod von Punk komplett verpasst hatte, übersprang ich auch die anschließende Trauerphase – das unsanfte Erwachen 1978, das niemandem erspart blieb, der während des unglaublichen, rauschhaften Jahres 1977 „dabei“ gewesen war. Meine verspätete Entdeckung fiel zeitlich mit einem Neubeginn zusammen, als etwas in Gang kam, das später als „Postpunk“ bekannt wurde und dem sich dieses Buch widmet. Ich hörte Germ-free Adolescentsvon X-Ray Spex, aber auch das erste Album von PiL, Fear Of Musicvon den Talking Heads und Cutvon den Slits. Das war wie eine einzige grelle, aufregende Explosion.
Die meisten Historiker bilden sich etwas darauf ein, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein: jene Momente miterlebt zu haben und an jenen Schauplätzen gewesen zu sein, von denen Revolutionen ihren Ausgang genommen haben. Uns, die wir in den provinziellen Vorstädten festsitzen, fällt das schwer. Dieses Buch ist für jene und handelt von ihnen, die nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren (bei Punk waren das London und New York ungefähr 1976), die aber auch nicht glauben mochten, dass alles vorbei war, alles gesagt und getan, bevor sie überhaupt die Chance hatten, mitzumachen.
Junge Menschen haben das biologische Recht, die Zeit, in der sie leben, spannend zu finden. Wenn man großes Glück hat, entspricht sie dem eigenen hormonellen Aufruhr, und das jugendliche Bedürfnis, etwas zu finden, worüber man staunen und woran man glauben kann, trifft auf eine objektiv ereignisreiche Phase. Die Glanzzeit des Postpunk, das halbe Jahrzehnt von 1978 bis 1982, war solch eine Zeit: ein Glücksfall. Einige Male war ich nah dran, aber ein derartiges Hochgefühl verspürte ich seither selten. Mit Sicherheit aber habe ich nie wieder so sehr in der Gegenwart gelebt.
Meiner heutigen Erinnerung nach kaufte ich nie alte Platten. Wofür hätte das gut sein sollen? Es gab so viele neue Platten, die man haben musste, dass es schlicht keinen vernünftigen Grund gab, sich mit Vergangenem zu beschäftigen. Bei Freunden nahm ich mir Cassetten mit dem Besten der Beatles und der Stones auf, und ich besaß die Anthologie Weird Scenes Inside The Goldminevon den Doors, aber das war’s auch schon. Zum Teil lag das daran, dass es die Wiederveröffentlichungskultur, die uns heute überschwemmt, damals noch nicht gab. Plattenfirmen zogen Veröffentlichungen bisweilen sogar aus dem Verkehr. Das hatte zur Folge, dass die jüngste Vergangenheit praktisch unzugänglich war. Hauptsächlich aber lag es daran, dass einem die Zeit fehlte, sehnsüchtig auf eine Vergangenheit zu blicken, die man nicht einmal erlebt hatte. Dafür war aktuell gerade viel zu viel los.
Damals sah ich das noch nicht so, aber rückblickend kommt der Zeitraum von 1978 bis 1982 als eigenständige popkulturelle Epoche an jene sagenumwobenen Jahre von 1963 bis 1967 heran, die allgemein als „die Sechziger“ bekannt sind. Jedenfalls insofern, als sehr viel sehr gute Musik entstand, die in vergleichbarer Weise von Abenteuerlust und Idealismus zeugte und untrennbar mit den politischen und sozialen Unruhen der Zeit zu tun hatte. Die Gefühle waren ähnlich gemischt, Freude und Furcht trafen aufeinander, Faszination für alles Neue und Futuristische paarte sich mit der Angst vor dem, was die Zukunft bringen mochte.
Nicht dass ich besonders patriotisch wäre, aber es fällt auf, dass Britannia sowohl in den Sechzigern als auch in den Postpunkjahren die musikalischen Weltmeere beherrschte. Deshalb konzentriert sich dieses Buch auf Großbritannien und auf die amerikanischen Städte, in denen Punk eine größere Rolle spielte: die beiden Hauptstädte der Boheme, New York und San Francisco, die postindustriellen Angstregionen Cleveland und Akron in Ohio sowie Collegestädte wie Boston in Massachusetts und Athens in Georgia (um nicht wahnsinnig zu werden und Platz zu sparen, habe ich darauf verzichtet, mich mit dem europäischen Postpunk oder dem faszinierenden Underground Australiens zu beschäftigen, abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen wie DAF, Einstürzende Neubauten und The Birthday Party, die beträchtlichen Einfluss auf die angloamerikanische Rockkultur hatten). In Amerika gehörten Punk und Postpunk sehr viel weniger dem Mainstream an als in Großbritannien, wo The Fall und Joy Division von staatlichen Radiosendern landesweit gesendet wurden und so extreme Bands wie PiL in die Top 20 kamen, die über Top of the Popszehn Millionen Haushalte erreichten.
Für mich gab es sowohl subjektive wie objektive Gründe, dieses Buch zu schreiben. Einer davon ist, dass Postpunk von Historikern weitgehend unbeachtet blieb. Es gibt Dutzende Bücher über Punkrock und die Ereignisse der Jahre 1976 und 1977, aber praktisch nichts darüber, was danach geschah. Die herkömmliche Geschichtsschreibung über Punk endet gewöhnlich mit seinem „Tod“ 1978, als sich die Sex Pistols auflösten. Skandalträchtige oder nachlässige Berichte – das gilt oft für Fernsehdokumentationen – lassen den Eindruck entstehen, als wäre zwischen Never Mind The Bollocks und Nevermind, zwischen Punk und Grunge, nichts von Bedeutung passiert. Selbst nach der Achtziger-Nostalgiewelle wird dieses Jahrzehnt noch immer als Einöde betrachtet, in der einzig Außenseiter wie Prince oder die Pet Shop Boys oder aber Musikmatadore wie R.E.M. und Springsteen für Lichtblicke sorgten. Besonders die frühen Achtziger werden als eine von affektierten Komikern dominierte Phase betrachtet – eine Zeit, die von peinlich prätentiösen Kunstvideos und eitlen Engländern mit Eyeliner, Synthesizer und bescheuerten Frisuren geprägt war. Bruchstücke der Postpunkgeschichte kamen hier und da zum Vorschein, meist in den Biografien bestimmter Bands, aber niemand hat sich an die Aufgabe gemacht, einmal das ganze Bild zu zeichnen und Postpunk als das darzustellen, was er war: eine Gegenkultur, die aus vielen Einzelteilen bestand, die aber der Glaube einte, dass Musik die Welt verändern konnte und auch sollte.
Trotz aller Versuche so unvoreingenommen wie möglich zu sein, erscheint mir das lange „Nachspiel“ des Punk bis 1984 musikalisch sehrviel interessanter als das, was 1976/77 passiert war, als Punk dem Rock ’n’ Roll in seiner Urform zu einem Revival verhalf. Selbst was den allgemeineren kulturellen Einfluss angeht, lässt sich behaupten, dass sich erst nach dem Ableben von Punk zeigte, welch provokante Folgen er haben würde. Dies ist ein Argument, das ich in diesem Buch vertrete: Revolutionäre Bewegungen in der Popkultur wirken sich eigentlich erst dann am stärksten aus, wenn der „Augenblick“ bereits verstrichen ist, wenn die Ideen von den städtischen Künstlereliten und Hipstercliquen, deren „Eigentum“ sie ursprünglich waren, bis in die Vorstädte und Provinzen vordringen. Zum Beispiel standen die Gegenkultur und die radikalen Ideen der Sechzigerjahre in der ersten Hälfte der Siebziger sehr viel höher im Kurs, als lange Haare und Drogenkonsum zum Allgemeingut wurden und Feminismus zur Populärkultur gehörte, in der „Unabhängige Frauen“-Filme und -Fernsehsendungen entstanden.
Ein weiterer objektiver Grund für dieses Buch ist, dass das Interesse an jener Ära wieder aufzuleben scheint. Compilations erscheinen, Postpunkmaterial aus den Archiven wird wiederveröffentlicht, und eine ganze Reihe neuer Bands orientiert sich an Subgenres wie No Wave, Punk-Funk, Mutant Disco und Industrial. Eine junge Generation, die sich an diese Zeit nicht erinnert – manche waren 1984, dem Jahr, mit dem dieses Buch schließt, noch nicht einmal geboren –, findet sie plötzlich ungeheuer faszinierend. Weil Postpunk so lange vergessen war, zählte er zu den wenigen ungenutzten Ressourcen der Retroindustrie und scheint jetzt einen wahren Goldrausch auszulösen.
Nummer eins unter den subjektiven Gründen ist meine Erinnerung an die Zeit als eine des Überflusses, als ein goldenes Zeitalter, in dem alles neu war und im Jetzt stattfand, als würde man sich mit Hochgeschwindigkeit auf die Zukunft zubewegen. Nummer zwei der subjektiven Gründe hat etwas mehr mit der Gegenwart zu tun. Als Rockkritiker fragt man sich ab einem gewissen Alter, ob es schlau war, so viel geistige und emotionale Energie in die Sache mit der Musik investiert zu haben. Dabei handelt es sich weniger um eine Krise der Zuversicht als eine leichte Verunsicherung. In meinem Fall führte dies dazu, dass ich mich fragte, wann genau ich mich eigentlich dafür entschieden hatte, Musik ernst zu nehmen. Weshalb war ich zu der Überzeugung gelangt, dass Musik derart wichtig sei? Der Grund war, dass ich in der Zeit von Postpunk aufgewachsen war. Der Doppelpack aus Never Mind The Bollocksvon den Sex Pistols und Metal Boxvon PiL hatte mich auf meinen Kurs gebracht. Aber ich wurde auch dadurch geprägt, dass ich zu jener Zeit für die britische Musikpresse schrieb und so jede spannende Woche erneut austesten konnte, wie ernst man Musik nehmen kann (eine Diskussion, die bis heute in unterschiedlicher Form und an unterschiedlichen Orten fortgesetzt wird).
Zum Teil ist dieses Buch auch eine Abrechnung mit meinem jüngeren Selbst. Und die Antwort, die ich gefunden habe, lautet …
Prolog: Die unvollendete Revolution
„Die Sex Pistols haben ‚No Future‘ gesungen, aber es gibt eine Zukunft, und wir wollen sie aufbauen.“
Allen Ravenstine, Pere Ubu, 1978
Im Sommer 1977 war Punk zur Parodie seiner selbst geworden. Viele der ursprünglich an der Bewegung Beteiligten hatten das Gefühl, etwas Offenes, das einst voller Möglichkeiten zu stecken schien, sei zur kommerziellen Formel verkommen. Schlimmer noch: Punk hatte sich als Jungbrunnen eben jener etablierten Plattenindustrie erwiesen, welche die Punks zu entmachten gehofft hatten. Was jetzt?
An dieser Stelle begann die fragile Einheit zwischen Kids aus der Arbeiterklasse und den künstlerisch ambitionierten Bohemiens der Mittelklasse zu bröckeln. Auf der einen Seite standen die populistischen „echten Punks“, die später das Oi! Movement bildeten und glaubten, Musik müsse zugänglich und unprätentiös bleiben, eine wütende Stimme der Straße. Auf der anderen Seite stand die Avantgarde, die als „Postpunk“ bekannt wurde und die 1977 nicht als Rückkehr zu einem ungeschliffenen Rock ’n’ Roll, sondern als Chance betrachtete, mit den Traditionen zu brechen. Sie hatten Punk als Aufruf zu ständiger Veränderung begriffen.
Oi! und dessen amerikanisches Pendant, Hardcore, haben eigene Bücher verdient (und auch schon bekommen: Cranked Up Really Highvon Stewart Home und verschiedene andere Geschichten des Hardcore sind bereits erschienen). Dieses Buch allerdings hält die Fahne des Postpunk hoch: Bands wie PiL, Joy Division, Talking Heads, Throbbing Gristle, Contortions und Scritti Politti, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, die unvollendete Revolution des Punk zu beenden und durch die Beschäftigung mit Electronic, Noise, Dub, Disco, Jazz und klassischer Avantgarde neue musikalische Möglichkeiten zu erfinden.
Einige Unverbesserliche warfen diesen Experimentalisten vor, in das zurückzufallen, was Punk ursprünglich zu zerstören angetreten war: elitären Art-Rock. Und es stimmt, dass viele Musiker des Postpunk die Kunsthochschule besucht haben. Die New Yorker No-Wave-Szene bestand praktisch ausschließlich aus Malern, Filmemachern, Dichtern und Performancekünstlern. Gang Of Four, Cabaret Voltaire, Devo, Wire, The Raincoats, DAF … dies sind nur eine Handvoll Bands, die von Designstudenten oder akademisch gebildeten Künstlern gegründet wurden. Besonders in Großbritannien fungier-ten Kunsthochschulen lange als staatlich subventionierte Zufluchtsorte der Boheme, an denen sich Jugendliche aus der Arbeiterklasse, die für ein geregeltes Arbeitsleben zu aufsässig waren, und verwahrloste Jungs und Mädchen aus der Mittelklasse, die sich für eine Karriere im mittleren Management als zu widerspenstig erwiesen, begegnen konnten. Nach ihrem Abschluss wandten sich viele der Popmusik zu, weil sie hofften, dadurch ihren „experimentellen Lebensstil“, den sie am College geführt hatten, fortsetzen und vielleicht außerdem ihren Lebensunterhalt verdienen zu können.
Natürlich hat nicht jeder im Postpunk die Kunsthochschule oder auch nur die Universität besucht. Viele der Schlüsselfiguren im britischen Postpunk kamen aus der sozial unbestimmten Grauzone, in der die obere Arbeiterklasse in die untere Mittelklasse übergeht. Autodidakten wie John Lydon und Mark E. Smith von The Fall sind typische Beispiele für antiintellektuelle Intellektuelle, die gierig Bücher in sich hineinfraßen, aber alles Akademische verachteten und der „Kunst“ in jeglicher institutionalisierter Form misstrauten. Aber was hätte künstlerisch ambitionierter sein können, als die Kunst zerstören zu wollen, indem man deren Grenzen zum Alltag aufhebt?
In jenen sieben Postpunkjahren von Anfang 1978 bis Ende 1984 wurden die moderne Kunst und Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts systematisch geplündert. Die gesamte Zeitspanne wirkt wie der Versuch, praktisch jedes bedeutende modernistische Thema und jede Technik mit dem Medium Popmusik noch einmal durchzuspielen. Cabaret Voltaire schauten sich ihren Namen bei den Dadaisten ab, der von Pere Ubu stammt von Alfred Jarry. Die Talking Heads verwandelten ein Lautgedicht von Hugo Ball in einen Disco-Dance-Track. Gang Of Four holten sich Anregungen bei Brecht und Godard und deren Verfremdungseffekten, und sie versuchten, Rock zu dekonstruieren, selbst dann, wenn sie am rockigsten klangen. Textautoren sogen die radikale Science-Fiction-Literatur von William S. Burroughs, J. G. Ballard und Philip K. Dick in sich auf und übertrugen die Verfahren der Collage und des Cut-up auf die Musik. Marcel Duchamp galt, vermittelt über die Fluxusbewegung der Sechzigerjahre, als Schutzheiliger des No Wave. Die Gestaltung der Plattencover entsprach den neomodernistischen Ansprüchen, die mit Worten und mit Musik formuliert wurden, wobei sich Grafikdesigner wie Malcolm Garrett und Peter Saville sowie Labels wie Factory und Fast Product auf Konstruktivismus, De Stijl, Bauhaus, John Heartfield und Die Neue Typographie bezogen. Dieser manische Beutezug durch die Archive der Moderne erreichte mit dem nonkonformistischen Poplabel ZTT – die Abkürzung steht für Zang Tuum Tumb, ein Auszug aus der Prosapoesie der italienischen Futuristen – und dessen Konzeptband The Art Of Noise, die sich zu Ehren von Luigi Russolo und dessen Manifest für eine futuristische Musik so nannte, seinen Höhepunkt.
Versteht man die Bands des Postpunk auf unspezifischere Weise als „Vertreter der Moderne“, so hatten sie sich zum Ziel gesetzt, moderne Musik zu machen. Sie waren absolut zuversichtlich, dass es mit dem Rock weitergehen könne und es eine Zukunft zu erfinden galt. In den Augen der Vorkämpfer des Postpunk war Punk gescheitert, weil er versucht hatte, den rockistischen Old Wave mit konventioneller Musik abzulösen (dem Rock ’n’ Roll der Fünfzigerjahre, Garagenpunk, Mod), die den Dinosaurier-Megabands wie Pink Floyd und Led Zeppelin vorausgegangen war. Vertreter des Postpunk handelten in dem Glauben, dass „radikaler Inhalt auch nach radikalen Formen verlangt“.
Kurioserweise führte die Überzeugung, dass der Rock ’n’ Roll seine Schuldigkeit getan habe, dazu, dass Chuck Berry mit ungeheurer Verachtung gestraft wurde. Obwohl er durch die Gitarristen Johnny Thunders und Steve Jones zu einem der Stützpfeiler des Punk wurde, stand er gleichzeitig für das, was unbedingt vermieden werden musste, und ständig fiel sein Name, wenn es um negative Kriterien ging. Der vielleicht erste Fall von Berry-Phobie ist bereits auf einem der für das Album The Great Rock ’n’ Roll Swindle ausgegrabenen Demobänder der Sex Pistols zu hören. Die Band jammt „Johnny B. Goode“, woraufhin Johnny Rotten – der heimliche Ästhet der Gruppe, der später die archetypische Postpunkband Public Image Ltd. gründete – die Melodie halbherzig mitsingt und dann stöhnt: „Ach Scheiße, das ist grauenhaft …Hört auf, ich kann’s nicht ab … AAARRRRGH.“ Lydons Widerwillen – er klingt, als würde er ersticken, als würde ihm der tote Sound die Luft zum Atmen nehmen – hallte bei Dutzenden von Postpunkbands nach: Cabaret Voltaire zum Beispiel klagten, „Rock ’n’ Roll ist nicht, wenn man andauernd Chuck-Berry-Riffs rauswürgt“.
Statt Rama-Lama-Riffs oder bluesiger Akkorde bevorzugten die innovativen Gitarrengötter des Postpunk Kantigkeit, eine saubere und knackige Schärfe. Größtenteils vermieden sie Soli, von kurzen, in das Rhythmusspiel eingebetteten Leadgitarreneinsätzen einmal abgesehen. Statt eines „fetten“ Sounds zogen Musiker wie David Byrne von den Talking Heads, Martin Bramah von The Fall und Viv Albertine von The Slits eine „dürre Rhythmusgitarre“ vor, die sich oft an Reggae oder dem Funk im Gefolge von James Brown orientierte. Dieser kompakte, ruppige Stil füllte nicht jeden Winkel der Klanglandschaft aus. Bands versuchten, auch bezüglich der Strukturen innovativ vorzugehen. Gruppen wie Devo, XTC und Wire unterbrachen, inspiriert von Brian Enos Soloalben und dem zerklüfteten, kubistischen R & B von Captain Beefheart, den musikalischen Fluss mit einem stotternden Anti-Groove – einem nervösen, zuckenden Stil, den der New Musical Express-Autor Miles als „geometrischen, ruckartigen Quickstepp“ bezeichnete.
Aber nicht nur die Gitarre wurde radikalisiert: Jedes Instrument veränderte sich angesichts der Herausforderung, die Rockmusik zu erneuern. Die Schlagzeuger Hugo Burnham von Gang Of Four, Steve Morris von Joy Division, Budgie von den Banshees und Palmolive von den Raincoats vermieden die Klischees des Heavy Rock und entwickelten neue Rhythmusfiguren, die spartanischer und „verdrehter“ wirkten. Tom-Toms wurden typischerweise eingesetzt, um einen polternden, urwüchsigen Antrieb zu erzeugen. Der Bass gab seine bislang unauffällige Unterstützerrolle auf und trat als führendes Instrument in den Vordergrund und erfüllte auch dann Melodiefunktionen, wenn er gleichzeitig den Groove vorantrieb. In dieser Hinsicht blieben die Bassisten des Postpunk den Innovationen von Sly Stone und James Brown dicht auf den Fersen und lernten vom damals aktuellen Roots Reggae und Dub. Punk, der es auf einen militanten und aggressiv monolithischen Sound anlegte, hatte dem Rock das „Schwarze“ fast vollständig ausgetrieben, die Verbindung zum R & B gekappt und Disco gleichzeitig als realitätsfremd und banal zurückgewiesen. Ab 1978 machte in Postpunkkreisen jedoch das Konzept einer gefährlichen Tanzmusik die Runde, was sich in Genrebezeichnungen wie „Perverted Disco“ und „Avant-Funk“ niederschlug.
Neben der Sinnlichkeit und dem Swing der Dance Music hatte Punk auch alle jene zusammengesetzen Genres abgelehnt (Jazzrock, Countryrock, Folkrock, Classical Rock et cetera), die sich zu Beginn der Siebzigerjahre durchgesetzt hatten. In den Augen der Punks stank diese Art von Musik nach virtuoser Angeberei, ausufernden Jamsessions, frommen Hippiesprüchen wie „It’s all music, man“. Punk, der sich gegen diesen kraftlosen Eklektizismus abgrenzen wollte, vertrat einen strikten Purismus. Während „Fusion“ nach wie vor diskreditiert blieb, leitete Postpunk eine neue Phase ein, in der auch über den eng begrenzten Tellerrand des Rock geschaut wurde – ins schwarze Amerika und nach Jamaika, aber auch nach Afrika und in andere Bereiche, die man später „Weltmusik“ nannte.
Postpunk baute Brücken in die Vergangenheit des Rock, die tabu gewesen waren, als Punk das Jahr 1976 zur Stunde null erklärte, was einen Mythos begründete, der in vielen Bereichen bis heute Gültigkeit hat: die Vorstellung, in den Siebzigerjahren hätte vor Punk ausschließlich Langeweile geherrscht. Tatsächlich handelte es sich um eine der vielfältigsten Phasen der Rockgeschichte. Die Postpunkbands entdeckten diese Vielfalt zunächst zögerlich (schließlich wollte sich niemand vorwerfen lassen, ein Kryptohippie oder Progressive Rocker zu sein) und ließen sich von den künstlerisch ambitionierteren Vertretern des Glam-Rock (Bowie und Roxy Music), Exzentrikern wie Beefheart oder teilweise auch den gewitzteren Vertretern des Prog (Soft Machine, King Crimson, ja sogar Zappa) inspirieren. In gewisser Hinsicht war Postpunk „Progressive Rock“, nur deutlich abgespeckt und neu belebt, besser frisiert und nüchterner (ohne virtuose Protzerei). Rückblickend wirkt Punk wie ein historischer Umweg – eine radikale Rückkehr zu den Anfängen des Rock ’n’ Roll, die sich lediglich als kurze Unterbrechung eines ansonsten ungebrochenen Art-Rock-Kontinuums entpuppte, das sich von Anfang bis Ende durch die Siebzigerjahre zog.
Genau genommen handelte es sich bei einem Großteil der ausgewiesenen Postpunkbands – Devo, Throbbing Gristle, Cabaret Voltaire, This Heat – um Prä-Punk-Formationen, die in der einen oder anderen Form bereits jahrelang existiert hatten, bevor 1976 das Debütalbum der Ramones erschien. Punk verwirrte die Verantwortlichen in der Plattenindustrie, sodass sich die Majors plötzlich für Vorschläge empfänglich zeigten, und brachte Bewegung in die ästhetischen Vorschriften, sodass Abnormes oder Extremes plötzlich Chancen hatte. Diese Störung des althergebrachten Betriebs ermöglichte es allerhand seltsamen Freaks, an die Oberfläche durchzustoßen, die Gelegenheit beim Schopf zu packen und ein breiteres Publikum für sich zu gewinnen.
Es handelte sich um eine besondere Sorte „Art-Rock“, mit dem sich Postpunk verbündete. Nicht um die Kombination aus elektrischen Gitarren und klassischen Instrumenten aus dem neunzehnten Jahrhundert in elend langen Kompositionen, sondern um die minimalistische Linie, die sich von Velvet Underground über Krautrock und die intellektuell anspruchsvolle Glam-Fraktion durchzieht. Die Musik, die einer bestimmten Sorte von Hipstern über die „öden“ Siebzigerjahre hinweghalf, wurde von einer Handvoll seelenverwandter Personen gemacht, Lou Reed, John Cale, Nico, Iggy Pop, David Bowie, Brian Eno, die entweder direkt von Velvet Underground kamen oder stark von ihnen beeinflusst waren und die in dieser Zeit in den unterschiedlichsten Kombinationen miteinander arbeiteten. Bowie zum Beispiel hatte mit fast allen zu tun, als Produzent oder sonst wie. Er war das Bindeglied, der größte Dilettant des Rock: immer auf der Jagd nach der nächsten Herausforderung, ständig in Bewegung. Mehr als sonst jemand stand er Pate für das Ethos des Postpunk, das permanenten Wandel forderte.
1977 mag das Jahr gewesen sein, in dem das Debütalbum der Clash und Never Mind The Bollocksvon den Sex Pistols erschien; für die Musik des Postpunk aber waren vier Alben, an denen Bowie beteiligt war und die im selben Jahr erschienen, sehr viel wichtiger: Lowund „Heroes“von ihm selbst und The Idiotund Lust For Life von Iggy Pop, die Bowie beide produziert hatte. Diese erstaunlichen Alben, die allesamt in Berlin aufgenommen worden waren, beeindruckten vor allem Hörer, die bereits den Verdacht hegten, dass sich Punkrock seinerseits als Wiederkehr des Immergleichen entpuppen würde. Die Alben von Bowie und Iggy schlugen eine Abkehr vom amerikanischen Rock ’n’ Roll und die Hinwendung zu Europa und zu einem coolen, kontrollierten Sound nach dem Vorbild der teutonischen „Motor“-Rhythmen von Kraftwerk und Neu! vor. Einen Sound, bei dem Synthesizer eine ebenso große Rolle spielen wie Gitarren. In Interviews sprach Bowie von seinem Umzug nach Berlin als von dem Versuch, sich Amerika sowohl musikalisch (in Bezug auf den Soul und Funk, der Young Americansgeprägt hatte) wie auch geistig (als Flucht vor der schnelllebigen Dekadenz des Rock ’n’ Roll von Los Angeles) zu entziehen. Lowwurde durch diese Art der Entwurzelung und Entfremdung seinem ursprünglichen Arbeitstitel New Music Night And Day gerecht – vor allem auf der zweiten Seite, einer Abfolge atmosphärischer Instrumentals und sehnsuchtsvoller, wortloser Klagelieder. Low, sagte Bowie, war eine Reaktion auf „den Ostblock, auf Ostberlin, das mittendrin steckt, das war etwas, das ich mit Worten nicht ausdrücken konnte. Dazu brauchte ich Strukturen.“ Für die Arbeit an Lowund „Heroes“ wandte er sich deshalb an Eno, den Strukturalisten par excellence, als Mentor und rechte Hand. Eno, der bereits wegen seiner Synthesizereinsätze bei Roxy Music und seinen Proto-New-Wave-Soloalben als Postpunkikone galt, wurde durch die Berliner Bowie-Alben zum damals wichtigsten Produzenten. Er dokumentierte die New Yorker No-Wave-Szene, arbeitete mit Devo, Talking Heads, Ultravox und, sehr viel später, U2. Bono witzelte: „Manche Bands sind auf die Kunsthochschule gegangen, wir gingen zu Brian Eno.“
Die neue Liebe zu Europa bei Bowie und Eno entstand aus dem für den Postpunk typischen Gefühl heraus, dass Amerika – oder zumindest das weiße Amerika – politisch und musikalisch der Feind war. In Bezug auf zeitgenössische Anregungen blickte Postpunk über das Kernland des Rock ’n’ Roll hinaus: ins urbane schwarze Amerika, nach Jamaika und Europa. Für viele Postpunkanhänger waren 1977 nicht „White Riot“ und „God Save The Queen“ die wichtigsten Singles, sondern „Trans Europe Express“, ein metronomisch-metallisches Klagelied auf das Industriezeitalter, sowie der von Giorgio Moroder produzierte Porno-Disco-Hit von Donna Summer „I Feel Love“, ein Track, der beinahe ausschließlich aus synthetischen Sounds bestand. Moroders Electronic Disco und Kraftwerks strenger Synthiepop ließen verlockende Visionen vom neuen Europa entstehen – modern, vorwärtsgewandt und durch und durch Postrock in dem Sinn, dass keinerlei Anleihen bei amerikanischer Musik mehr gemacht wurden. Die Vorstellung, dass Synthesizer, Sequenzer und Maschinenrhythmen eine authentisch unamerikanische musikalische Identität ermöglichten, erwies sich für damals noch sehr junge Bands wie The Human League und Soft Cell als ungeheuer verführerisch.
Schwarze Rhythmen, europäische Elektronik, jamaikanische Produktionstechniken bildeten das Koordinatensystem der formalen Radikalisierungen des Postpunk. Aber wie stand es mit dem radikalen Inhalt? Die politische Haltung von Punk – blanke Wut oder Agitpropprotest – schien den Vorreitern des Postpunk zu platt oder zu bevormundend, weshalb sie raffiniertere und weniger vorhersehbare Wege beschritten. Gang Of Four und Scritti Politti verzichteten darauf, zu erzählen, wie’s wirklich war, und schrieben stattdessen Songs, in denen die alltäglichen Machtmechanismen beschrieben und in Szene gesetzt wurden: die Konsumgesellschaft, sexuelle Beziehungen, Auffassungen des „gesunden Menschenverstands“, das, was als natürlich oder „selbstverständlich“ galt, auf welche Weise scheinbar spontane, innerste Gefühle von übergeordneten Kräften bestimmt werden. „Alles hinterfragen“ war die Losung des Tags, dicht gefolgt von „Das Private ist politisch“. Gleichzeitig beschrieben die scharfsinnigsten dieser Gruppen aber auch, weshalb „das Politische privat“ ist – weshalb aktuelle Ereignisse und Regierungsbeschlüsse Eingang ins Alltagsleben finden und sich in den privaten Tag- und Albträumen jedes Einzelnen niederschlagen.
Was Politik im herkömmlichen Sinn angeht – Demonstrationen, Basisarbeit, organisierte Kämpfe –, gab sich Postpunk ambivalenter. Kunststudenten und Autodidakten schätzten Individualität. Den nonkonformistischen Bohemiens wurde angesichts von Solidaritätsaufrufen oder dogmatischer Parteipolitik unwohl. Die Demagogie offen politischer Gruppen wie der Tom Robinson Band und Crass war ihnen viel zu ästhetisch unbewusst, und sie empfanden deren Kanzelpredigten als herablassend oder überflüssig, da ohnehin schon Überzeugten die wahre Lehre vorgekaut wurde. Während die meisten britischen Postpunkbands an den von Rock Against Racism organisierten Tourneen und Festivals teilnahmen, misstrauten sie sowohl RAR selbst wie auch deren Schwesterorganisation, der Anti-Nazi League, da sie diese für nur notdürftig verhüllte Fassaden der militanten linken Socialist Workers Party hielten (die Musik lediglich als Mittel zur Radikalisierung und Mobilisierung von Jugendlichen betrachtete). Gleichzeitig übernahm Postpunk vom Punk den Traum, mit Rockmusik etwas, wenn nicht gar die Welt, zumindest aber das Bewusstsein des einzelnen Zuhörers verändern zu können. Entscheidend war, dass sich diese Form von Radikalität in Text und Musik gleichermaßen ausdrückte und die Musik nicht nur als Plattform für Agitprop diente. Die Worte entsprachen mit ihrem subversiven Potenzial den formalen ästhetischen Eigenschaften (dem Grad ihrer Innovation) und beschränkten sich nicht darauf, eine „Botschaft“ oder Kritik zum Ausdruck zu bringen.
Postpunk war eine Zeit der Experimente in Bezug auf Text und Gesangstechniken. Mark E. Smith von The Fall erfand eine Art magischen, nordenglischen Realismus, indem er den industriellen Schmutz mit Überirdischem und Unheimlichem verband und das Ergebnis auf einzigartig monotone Art vortrug, was wie betrunkenes Faseln und wütendes Speedgequassel gleichzeitig klang. David Byrnes nervöses, neurotisches Gehabe passte perfekt zu seinen knochentrockenen und unrockistischen Themen wie Tiere, Bürokratie, „Gebäude und Nahrung“. Mark Stewart von The Pop Group jaulte wie eine Kreuzung aus Antonin Artaud und James Brown. Postpunk war auch eine Glanzzeit der idiosynkratisch weiblichen Ausdrucksformen, zum Beispiel der unvergleichlichen Perspektiven und dissonanten Töne, die The Slits, Lydia Lunch, Ludus und The Raincoats einnahmen und anschlugen. Andere Sänger/Texter – Ian Curtis von Joy Division, Howard Devoto von Magazine, Paul Haig von Josef K – tauchten in die Schattenwelten und lähmenden Ängste ein, wie sie Dostojewski, Kafka, Conrad und Beckett beschrieben hatten. Ihre Songs, dreiminütige Miniromane, beschäftigten sich mit klassischen existenzialistischen Fragen wie dem Kampf mit dem eigenen Ich, der Liebe im Gegensatz zu Einsamkeit, der Absurdität des Daseins, Perversion und Gemeinheit als menschlichen Eigenschaften, der ewigen Frage: „Selbstmord – warum eigentlich nicht?“
Es ist kein Zufall, dass Manchester und Sheffield, die beiden heruntergekommenen Industriestädte im Norden Englands, die trostlosen Hochburgen des britischen Postpunk bildeten. Bands mit ähnlich gelagerten Texten und einer vergleichbaren musikalischen Herangehensweise kamen aus Cleveland, Ohio (dem einst eindrucksvollen, inzwischen aber kränklichen Herzen des amerikanischen Rust Belt), sowie aus Düsseldorf. Parallel zueinander, aber auf jeweils unterschiedliche Art und Weise verwendeten Pere Ubu aus Cleveland, The Human League und Cabaret Voltaire aus Sheffield, Joy Division aus Manchester sowie DAF aus Düsseldorf Synthesizer. In unterschiedlichem Maß beschäftigten sie sich alle mit den Problemen und Möglichkeiten des menschlichen Daseins in einer zunehmend technisierten Welt. Diese Städte waren sowohl deutlich sichtbar wie auch atmosphärisch von dem brutalen Übergang ländlichen Lebens des achtzehnten Jahrhunderts zu den unnatürlichen Rhythmen des Industriezeitalters geprägt, was den Bands, deren Mitglieder dort aufgewachsen waren, einen besonderen Zugriff auf das Dilemma von Entfremdung und Anpassung im Maschinenzeitalter ermöglichte.
So ausgelaugt und verrottet diese inzwischen schon postindustriellen Städte auch waren, so konnte – und musste vielleicht sogar zwingend – das Panorama des Niedergangs ästhetisiert werden. Die Postpunkbands fanden in dieser Hinsicht vor allem zwei Autoren besonders anregend. A Clockwork Orange, der Roman von Anthony Burgess aus dem Jahr 1962, spielt im Großbritannien der nahen Zukunft und erzählt von Banden marodierender Jugendlicher, irgendwo zwischen Skinheads und Punks, im Grunde aber einfach gemeinen Dandys, deren Lebensinhalt in der Ausübung völlig sinnloser Gewalt besteht. Sowohl das Buch wie auch Stanley Kubricks Film aus dem Jahr 1970 beschreiben die trostlose Psychogeografie des neuen Großbritannien, wie es die „visionären“ Städteplaner und modernen Architekten der Sechzigerjahre entworfen hatten – Hochhäuser, finstere Unterführungen, Fußgängerbrücken und -wege aus Beton. Vor diesem traumatischen Hintergrund einer urbanen Landschaft spielt auch die zum Klassiker gewordene Trilogie von J. G. Ballard, Crash, Concrete Islandund High-Rise, aus den Siebzigerjahren. Ballard hatte angesichts von Zerstörung und Verfall in seinen früheren Kurzgeschichten und Katastrophenromanen eine unheimliche, unmenschliche Schönheit beschrieben – verlassene Flugfelder, stillgelegte Raketenbasen, erschöpfte Reservoirs, verlassene Städte. In Interviews schwärmte Ballard von der „Magie und Poesie, die man empfindet, wenn man einen Schrottplatz betrachtet, auf dem lauter alte Waschmaschinen, Autowracks liegen, oder wenn man ein altes Schiff sieht, das in einem stillgelegten Hafen liegt. Ein unglaubliches Geheimnis und eine Magie umgeben diese Dinge.“ Pere Ubu und Joy Division machten Musik, welche die ballardeske Schönheit ihrer Heimatstädte einfing. Diese vom Cleveland und Manchester der Siebzigerjahre geprägte Musik, die sich aber nicht vollkommen auf jene Zeit und jene Orte reduzieren ließ, entstand im Bereich zwischen dem historisch und geografisch genau Bestimmbaren und der Zeitlosigkeit universaler Ängste und Sehnsüchte.
Die Postpunkära trifft auf zwei unterschiedliche Phasen der britischen und der amerikanischen Politik: die Mitte-links-Regierungen des Labour-Premiers Jim Callaghan und des demokratischen Präsidenten Jimmy Carter, die beinahe gleichzeitig durch den Aufstieg von Margaret Thatcher und Ronald Reagan abgelöst wurden – ein Rechtsruck, der zwölf Jahre konservativer Politik in Amerika und achtzehn Jahre in Großbritannien einleitete. Postpunk beginnt mit einer Zeit der Lähmung und Stagnation linksliberaler Politik, die als kompromittiert und gescheitert gilt, und endet mit Monetarismus, beginnender Massenarbeitslosigkeit und wachsenden sozialen Unterschieden.
Besonders in der Anfangszeit, von 1978 bis 1980, ließen diese Veränderungen ein ungeheures Gefühl der Angst und Anspannung entstehen. Großbritannien erlebte ein Wiederaufkeimen rechtsextremer und neofaschistischer Parteien, was sich sowohl im Wahlverhalten wie auch in Form blutiger Gewalt auf den Straßen niederschlug. Der Kalte Krieg trat in eine neue Eiszeit ein. In der führenden Musikzeitschrift Großbritanniens, dem New Musical Express, erschien eine regelmäßige Kolumne über den Einsatz amerikanischer Marschflugkörper in Großbritannien unter dem Titel „Plutonium Blondes“. Singles wie „Breathing“ von Kate Bush und „The Earth Dies Screaming“ von UB40 brachten die atomare Bedrohung in die Top 20, und unzählige Bands, von This Heat mit ihrem Konzeptalbum Deceitbis zu den Young Marble Giants mit ihrem Klassiker „Final Day“, sangen über den Weltuntergang wie über eine unmittelbar bevorstehende, reale Gefahr.
Das Beeindruckende an der dissidenten Musik dieser Zeit ist auch, dass sie sich in diametralem Gegensatz zur Allgemeinkultur entwickelte, die immer weiter nach rechts driftete. Thatcher und Reagan standen stellvertretend für eine allumfassende Reaktion sowohl auf die Gegenkultur der Sechzigerjahre als auch auf die lockeren Siebziger. Postpunk, der gewissermaßen im internen kulturellen Exil festsaß, versuchte, mithilfe der eigenen, unabhängigen Infrastruktur aus Labels, Vertrieben und Plattenläden eine alternative Kultur aufzubauen. Das Bedürfnis nach „totaler Kontrolle“ (das The Clash in ihrem Song „Complete Control“ nur noch voller Bitterkeit thematisieren konnten, da sie die Kontrolle bereits an CBS abgegeben hatten) führte zur Gründung der Independent-Labels Rough Trade, Mute, Factory, SST, Cherry Red und Subterranean. Das Do-it-yourself-Prinzip verbreitete sich wie ein Virus und führte zu einer allgemeinen Samisdat-Kultur, in der Bands ihre Platten selbst veröffentlichten, Veranstalter vor Ort eigene Konzerte organisierten, Musikerkollektive Räume schufen, in denen Bands proben und auftreten, sowie kleine Zeitschriften und Fanzines die Aufgaben einer alternativen Presse übernehmen konnten. Independent-Labels bildeten eine Art Mikrokapitalismus, der weniger auf linker Ideologie als auf der Überzeugung aufbaute, dass Major-Labels zu schwerfällig, einfallslos und kommerziell orientiert waren, als dass sie die wirklich wichtige Musik der Zeit hätten angemessen fördern können.
Postpunk setzte sich ebenso mit den politischen Möglichkeiten von Musik auseinander wie mit allen anderen Phänomenen der „wahren Welt“. Ziel des Postpunk war es, die Traumfabrik des Rock zu umgehen oder zu sabotieren, jene Freizeitindustrie, welche die Energie und den Idealismus der Jugend in kulturelle Sackgassen führte, während Großunternehmen ungeheure Einnahmen erzielten. Der Begriff „Rockism“, den die Liverpooler Band Wah! Heat geprägt hatte, wurde schon bald zum Inbegriff für überholte Verfahrensweisen, welche die Kreativität beschnitten und jegliche Überraschungsmomente unterbanden, wozu auch konventionelle Produktionsverfahren (wie die Verwendung von Hall, um einen „Live“-Sound entstehen zu lassen) und vorhersehbare Rituale bei Tourneen und Auftritten zählten (einige Postpunkbands gaben grundsätzlich keine Zugaben, andere experimentierten mit Multimedia- und Performance-Art). Da es die Vertreter des Postpunk darauf anlegten, das Rockbusiness aus seinem althergebrachten Trott zu bringen und die gesamte Aufmerksamkeit der Hörer zu beanspruchen, steckten die Texte voller metamusikalischer Kritik und kurzer Manifeste: Songs wie „Part Time Punks“ von den Television Personalities und „A Different Story“ von Subway Sect sprachen vom Scheitern des Punk.
Die zum Teil große Zurückhaltung der Postpunkbands rührte von der radikal selbstkritischen Haltung her, die man in der Konzeptkunst der Siebzigerjahre vertreten hatte, wo die begleitenden Diskurse als ebenso wichtig galten wie die Kunstobjekte selbst. Der metamusikalische Ansatz vieler Postpunks mag vielleicht auch die außerordentliche Bedeutung erklären, die der Rockpresse in jener Zeit zukam, wobei einige Kritiker Richtung und Gestaltung entscheidend mitbestimmten.
Die Musikzeitungen hatten seit Punk diese neue Rolle übernommen. Weil Radio und Fernsehen die Bewegung meist ablehnten, die Printmedien des Mainstreams feindselig reagierten und es Punkbands eine Zeit lang schwer hatten, Konzerte zu geben, wurden die wöchentlich erscheinenden britischen Musikzeitungen plötzlich immer wichtiger. Von 1978 bis 1981 schwankte die Auflage des Marktführers New Musical Expresszwischen zweihundert- und zweihundertsiebzigtausend Exemplaren, während die Verkaufszahlen von Sounds, Melody Makerund Record Mirrorinsgesamt bei weiteren sechshunderttausend Exemplaren lagen. Rechnet man den ungewöhnlich hohen Anteil von „Zweit- und Drittlesern“ dazu – jedes Exemplar wurde in der Regel von mehren Personen gelesen –, so kam man insgesamt auf eine Leserschaft von schätzungsweise zwei Millionen.
Punk hatte ein riesiges Publikum mobilisiert, das nach einem Weg in die Zukunft Ausschau hielt und bereit war, sich führen zu lassen. Die Musikpresse war in dieser Funktion praktisch konkurrenzlos – Monatsmagazine wie Q oder Style-Zeitschriften wie The Faceexistierten damals noch nicht, und in den seriösen Tageszeitungen fiel die Popberichterstattung äußerst dürftig aus. Das Ergebnis war, dass die wöchentlich erscheinenden Musikzeitungen enormen Einfluss ausübten, und einzelne Autoren – die getriebenen, diejenigen mit messianischem Anspruch – genossen ein Prestige und eine Macht, wie man sie sich heute kaum noch vorstellen kann. Indem sie bestimmte Verbindungen zwischen Bands erkannten (oder übertrieben darstellten) und die ungeschriebenen Manifeste der daraus entstehenden Bewegungen oder stadtspezifischen Szenen formulierten, intensivierten und beschleunigten die Kritiker die Entwicklung des Postpunk. Seit Ende 1977 feierte Jon Savage „New Musick“, die Industrial- beziehungsweise dystopische Sci-Fi-Schiene des Postpunk. Beim NME arbeitete Paul Morley zunächst an der Mythenbildung in der und um die Szene von Manchester und Joy Division und heckte anschließend das Konzept des New Pop aus. Garry Bushell von Soundswar der Demagoge oder Ideologe von Oi! und Real Punk. Die Kombination aus „aktiven Kritikern“ und reflektierten Musikern, deren Arbeit eine Art „aktiver Form der Kritik“ darstellte, führte dazu, dass sich die Entwicklung allgemein beschleunigte: Jeder neue Trend bekam sofort Konkurrenz durch etwas noch Neueres, und jeder neuen Entwicklung folgte unmittelbar eine Gegenreaktion oder ein Richtungswechsel. All dies verstärkte noch das Gefühl, dass man sich schnellen Schritts auf die Zukunft zubewegte, während sich Punk zur gleichen Zeit in untereinander zerstrittene Fraktionen aufsplitterte.
Oft kam es zu Verbrüderungen zwischen Musikern und Journalisten, was mit einem allgemeinen Bedürfnis nach Solidarität zu tun haben mochte. Man fühlte sich wie Kampfgefährten im Kulturkrieg des Postpunk gegen den Old Wave, aber auch wie Genossen in den damals aktuellen politischen Kämpfen. Die Rollen änderten sich, Journalisten machten Platten, und Musiker – David Thomas von Pere Ubu (unter dem Pseudonym Crocus Behemoth), Steven Morris von Joy Division, Steve Walsh von Manicured Noise – schrieben Plattenkritiken und Artikel. Weil so viele Leute, die mit Postpunk zu tun hatten, ursprünglich keine Musiker waren oder aus anderen künstlerischen Bereichen kamen, war die Kluft zwischen jenen, die Musik machten, und jenen, die darüber schrieben, nicht annähernd so groß, wie sie es vor Punk gewesen war. Genesis P-Orridge von Throbbing Gristle beschrieb sich zum Beispiel in erster Linie als Autor und Denker und eigentlich gar nicht als Musiker. Auch benutzte er den Begriff „Journalismus“ als positive Beschreibung der dokumentarischen Art der Auseinandersetzung von Throbbing Gristle mit der kargen postindustriellen Wirklichkeit.
Veränderungen, die den Stil und die Methoden des Schreibens über Rock betrafen, verstärkten den Eindruck, dass man sich mit Hochgeschwindigkeit auf ein aufregendes, neues Zeitalter zubewegte. Musikjournalisten der frühen Siebziger verbanden typischerweise die traditionellen Kritikerwerte (Objektivität, solide Berichterstattung, zuverlässiges Wissen) mit einer vom New Journalism beeinflussten Rock’n’Roll-Lockerheit. Dieser abgehangene Plauderstil voller cooler Slangbegriffe und versteckter Anspielungen auf Drogen und Bräute passte nicht zum Postpunk. Der intellektuelle Unterbau dieser älteren Rockkritikergarde – die Vorstellung, schlechtes Benehmen von Männern hätte etwas mit