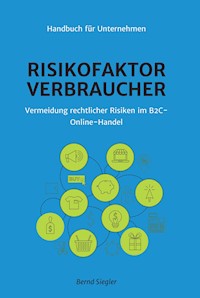
44,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Verbraucher genießen in der Geschäftswelt einen besonderen Schutz, der durch die Gesetzgebung gesichert wird. Diese Schutzmaßnahmen bedeuten jedoch für Online-Händler im Umkehrschluss, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen zu Einschränkungen in der Handlungsfreiheit führen. Letztendlich entstehen in der Folge Risiken für Unternehmen, falls die Rechte des Verbrauchers verletzt werden - ob wissentlich oder unwissentlich ist dabei unerheblich. Diese Risiken aufzuzeigen und im Vorfeld zu vermeiden, ist das Ziel dieses Buchs. Dabei ist ein Nachschlagewerk entstanden, das einen Mittelweg zwischen zwei Welten bietet: ein Praxis-Handbuch für juristische Laien, aber mit dem Anspruch, wissenschaftlich fundiertes Wissen an Entscheider zu vermitteln. Die Intention ist jedoch nicht, einem E-Commerce-Unternehmen detaillierte und vorgefertigte Prozessanleitungen mit auf den Weg zu geben, z.B. durch das Stellen von AGB-Templates, stattdessen soll ein rechtliches Grundverständnis beim Leser entstehen, damit es dem Unternehmer zukünftig möglich ist, auf rechtliche Fragestellungen weitgehend eigenständig zu reagieren und die entsprechenden Entscheidungen für sein Unternehmen zu treffen, sowohl strategisch als auch taktisch. Behandelte Rechtsgebiete sind z.B.: -AGB im Online-Handel, -Störungen von Kaufverträgen, -Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), -Produkt- und Produzentenhaftung -und vieles mehr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Handbuch für Unternehmer
RISIKOFAKTOR VERBRAUCHER
Vermeidung rechtlicher Risiken im B2C-Online-Handel
Bernd Siegler
© 2020 Bernd Siegler
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN Paperback: 978-3-7469-5656-5
ISBN e-Book: 978-3-7469-5658-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhaltsübersicht
I. Hinweis
II. Einleitung
III. Grundlagen
IV. Die AGB im Online-Handel
V. Gesetzliche Informationspflichten
VI. Preisangaben in Online-Shops
VII. Störung von Kaufverträgen
VIII. Grenzüberschreitender Handel
IX. Datenschutz-Grundverordnung
X. Zweite Zahlungsdiensterichtlinie
XI. Produkt- und Produzentenhaftung
XII. Ausblick
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Entscheidungsregister
Inhaltsverzeichnis
I. Hinweis
II. Einleitung
A. Geschichte des Verbraucherschutzes
B. Überblick
C. Motivation
D. Abgrenzung
III. Grundlagen
A. Entwicklung des deutschen Rechts
B. Einordnung der Rechtsquellen
C. Hierarchie der Rechtsquellen
D. Rechtsprechung
1. Bindungswirkung
2. BVerfG und EuGH
3. Widersprechende Urteile
E. Aufbau des BGB
F. Rechtssubjekt Verbraucher
1. Definition Verbraucher
2. Definition Unternehmer
3. Umfang des Verbraucherschutzes
4. Schutzbedürftigkeit des Verbrauchers
5. Kritik am Verbraucherschutz
6. Zusammenfassung
G. Vertragsschluss im Internet
1. Übereinstimmende Willenserklärungen
2. Wirksames Angebot
3. Wirksamkeit elektronischer Willenserklärungen
4. Zugang elektronischer Willenserklärungen
5. Wille zur rechtlichen Bindung im Internet
6. Schuldrechtliche Verpflichtungen
7. Trennungs- und Abstraktionsprinzip
8. Erfüllung des Vertrags
9. Vertragliche Neben- und Schutzpflicht
10. Zusammenfassung
IV. Die AGB im Online-Handel
A. Sind AGB obligatorisch?
B. Grundsätze der AGB
C. Das Einbeziehen der AGB
D. Rechtliche Grenzen der AGB
E. Folgen mangelhafter AGB
F. Zusammenfassung
V. Gesetzliche Informationspflichten
A. Definition Fernabsatz
B. Informationspflichten im Verkaufsprozess
1. Vor Vertragsschluss
2. Nach Vertragsabschluss
C. Folgen der Pflichtverletzung
D. Allgemeine Pflichten
E. Informationspflichten gem. TMG
F. Informationen zur Streitbeilegung
1. Anforderungen
2. Ausnahmen
3. Ahndung bei Verstoß
G. Zusammenfassung
VI. Preisangaben in Online-Shops
A. Angabe von Gesamtpreisen
B. Darstellung der Versandkosten
C. Die Grundpreisangabe
1. Mengeneinheiten
2. Produktkombinationen
3. Ausnahmen
4. Darstellung
D. Mindermengenzuschlag
E. Werbung für Kreditverträge
1. Anwendungsbereich
2. Maßgaben
3. Gestaltung
F. Sonderregelungen für Kleinunternehmer
G. Folgen bei Verstoß gegen die PAngV
H. Zusammenfassung
VII. Störung von Kaufverträgen
A. Beschwerde kann Rechtsausübung sein
B. Nichtigkeit
1. Geschäftsunfähigkeit
2. Formmangel
3. Fehlender rechtsgeschäftlicher Wille
4. Verbotener Inhalt
5. Zusammenfassung
C. Anfechtung
1. Inhalts- und Erklärungsirrtum
2. Eigenschaftsirrtum
3. Arglistige Täuschung
4. Durchführung der Anfechtung
5. Anfechtung elektronischer Willenserklärungen
6. Wirkung der Anfechtung
7. Schadensersatz
8. Verdrängung der Anfechtung
9. Zusammenfassung
D. Rücktritt
1. Berechtigung zum Rücktritt
2. Rücktrittserklärung
3. Rechtsfolgen
4. Wertersatz
5. Nutzungs- und Verwendungsersatz
6. Zusammenfassung
E. Unmöglichkeit
1. Subjektive und objektive Unmöglichkeit
2. Rechte des Verkäufers
3. Rechte des Käufers
4. Zusammenfassung
F. Garantie & Mängelhaftung
1. Garantie
2. Mängelhaftung
G. Widerruf
1. Voraussetzungen
2. Widerrufserklärung
3. Ausnahmen
4. Beginn der Widerrufsfrist
5. Regelmäßiges Ende der Frist
6. Verzögertes Ende der Frist
7. Folgen des Widerrufs
8. Ausblick
9. Zusammenfassung
H. Verzug
1. Schuldnerverzug
2. Gläubigerverzug
I. Aufrechnung
J. Zusammenfassung
VIII. Grenzüberschreitender Handel
A. Internationale Zuständigkeit
1. Gerichtsstandsverordnung EuGVVO
2. Schiedsgerichtsvereinbarungen
3. Schlichtungsstellen
4. Zusammenfassung
B. Anzuwendendes Recht
1. Allgemeine Regelungen
2. UN-Kaufrecht CISG
3. Rom-I-VO
4. Zusammenfassung
C. Rechtsverfolgung im EU-Ausland
1. Europäisches Mahnverfahren
2. Bagatell-Verfahren
3. Vollstreckung innerhalb der EU
D. Rechtsverfolgung in Drittländern
1. Verfahren
2. Gerichtsbarkeit
3. Zugelassene Anwälte
4. Vollstreckung
5. Außergerichtliche Einigung
6. Zusammenfassung
E. Ausschluss bestimmter Regionen
F. Zusammenfassung
IX. Datenschutz-Grundverordnung
A. Anwendungsbereich
1. Zeitlicher Anwendungsbereich
2. Sachlicher Anwendungsbereich
3. Räumlicher Anwendungsbereich
4. Verarbeitung personenbezogener Daten
5. Datenverarbeitung
6. Zusammenfassung
B. Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten
C. Grundsätze zur Datenverarbeitung
1. Rechtmäßigkeit, Treu und Glauben, Transparenz
2. Zweckbindung
3. Datenminimierung
4. Richtigkeit
5. Speicherbegrenzung
6. Integrität und Vertraulichkeit
7. Rechenschaftspflicht
8. Zusammenfassung
D. Einwilligung
E. Datenverarbeitung zur Vertragserfüllung
F. Informationspflichten
1. Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO
2. Informationspflichten nach Art. 14 DSGVO
3. Abgrenzung zwischen Direkt- und Dritterhebung
4. Form der Bereitstellung von Informationen
5. Zeitpunkt der Information des Betroffenen
6. Einschränkungen der Informationspflicht
7. Folgen bei Verstoß
8. Zusammenfassung
G. Rechte der betroffenen Personen
1. Informationspflichten
2. Auskunftsrecht der betroffenen Person
3. Recht auf Löschung
4. Recht auf Datenübertragbarkeit
5. Weitere Betroffenenrechte
6. Zusammenfassung
H. Verletzung des Schutzes
1. Definition
2. Meldung an die Aufsichtsbehörde
3. Benachrichtigung der betroffenen Person
4. Dienstliche Verwendung von Instant Messengern
5. Zusammenfassung
I. Cookies
1. Übergangszeit bis zur ePrivacy-Verordnung
2. Cookies unter Berücksichtigung der DSGVO
3. Zusammenfassung
J. Tracking-Tools
K. Kontaktformulare
L. E-Mail-Marketing
M. Zusammenfassung
X. Zweite Zahlungsdiensterichtlinie
A. Auswirkungen auf E-Commerce
B. Nutzung von E-Payment-Dienstleistern
C. Zahlung per Rechnung
D. Relationen zu § 270a BGB und anderen
E. Auswirkung auf Preisgestaltung
F. 2FA-Bestimmung
G. Zusammenfassung
XI. Produkt- und Produzentenhaftung
A. Produkthaftung
1. Voraussetzungen
2. Folgen
B. Produzentenhaftung
1. Voraussetzungen
2. Folgen
C. Auslagerung von Haftungsrisiken
1. Auslagerung Produkthaftungsrisiken
2. Auslagerung Produzentenhaftungsrisiken
D. Zusammenfassung
XII. Ausblick
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Entscheidungsregister
I. Hinweis
Bei aller Mühe, den rechtlichen Sachverhalt leicht verständlich und übersichtlich darzustellen, stellt dieses Buch keine Rechtsberatung dar und kann diese auch nicht ersetzen. Die erläuterten Sachverhalte zielen darauf ab, ein grundsätzliches Rechtsverständnis aufzubauen, losgelöst von Einzelfällen. Jeder reale Sachverhalt eines Unternehmens hat individuelle Besonderheiten, die es in einer juristischen Untersuchung zu beachten gilt und die mit dem vorliegenden Recht in Einklang gebracht werden müssen (sog. Subsumtion). Dies kann in den folgenden Ausführungen unmöglich geleistet werden. Daher ersetzen die bereitgestellten Informationen keine ausführliche Beratung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Sachverhalte im Geschäftsbetrieb des Lesers.
Das Werk inklusive aller Inhalte wurde mit größter Sorgfalt recherchiert und überprüft, dennoch erfolgen die Benutzung des Buchs und die Umsetzung der darin enthaltenen Informationen ohne Rechtsbeistand ausdrücklich auf eigenes Risiko. Fehlinterpretationen können nicht ausgeschlossen werden, u.a. schon deshalb, weil Gesetzgebung und Rechtsprechung einem permanenten Wandel unterliegen.
II. Einleitung
Als Unternehmer ist man zwangsläufig mit rechtlichen Fragen konfrontiert. Die Entscheidungen, die auf täglicher Basis getroffen werden, haben eine unmittelbare Auswirkung auf das Umfeld, in dessen Raum sich das Unternehmen bewegt. Überall, wo das Unternehmen Berührungspunkte mit außenstehenden juristischen oder natürlichen Personen hat, können diese Auswirkungen zu unterschiedlichen Auffassungen über richtig und falsch führen. Dabei ist es unerheblich, ob man Unternehmensgründer (in spe) ist, Einzelunternehmer, Geschäftsführer einer Gesellschaft oder im Management eines etablierten Konzerns – die Problematik bleibt dabei immer die gleiche: Die geschäftlichen Entscheidungen haben juristische Folgen im Umgang mit anderen Rechtssubjekten.
Dieses Buch soll Brücken bauen – zwischen dem schwer zugänglichen Thema der Rechtswissenschaften und den alltäglichen Problemen eines Unternehmens im E-Commerce. In herkömmlicher einschlägiger Literatur ist häufig zu sehen, dass rechtliche Ratschläge gegeben werden, diese aber nicht nachvollziehbar bzw. verifizierbar sind. Denn meist sind solche Empfehlungen ohne Begründungen und Quellen, wie Rechtsnormen oder Urteile, verfasst. Darüber hinaus fehlt es häufig auch an der Hinterfragung und kontroversen Diskussion. Als Kontrast dazu gibt es Fachliteratur, die für Juristen gedacht ist und somit im Alltag von Anwälten, Professoren und Studenten zur Anwendung kommt. Aus dieser Zielgruppe ergibt sich, dass ein breites Grundverständnis bei den Lesern dieser Fachliteratur vorausgesetzt wird und folglich die Texte für juristische Laien in der Praxis kaum brauchbar sind. Mit diesem Buch soll der Mittelweg dieser beiden Möglichkeiten gebildet werden: ein Praxis-Handbuch für juristische Laien, aber mit dem Anspruch, wissenschaftlich fundiertes Wissen an Entscheider zu vermitteln. Dabei geht es nicht darum, einem E-Commerce-Unternehmen detaillierte und vorgefertigte Prozessanleitungen mit auf den Weg zu geben, z.B. durch das Stellen von AGB-Templates, stattdessen soll ein rechtliches Grundverständnis beim Leser entstehen, damit es dem Unternehmer zukünftig möglich ist, auf rechtliche Fragestellungen weitgehend eigenständig zu reagieren und die entsprechenden Entscheidungen für sein Unternehmen zu treffen, sowohl strategisch als auch taktisch.
Vor dem Einstieg in die eigentliche Thematik noch ein Hinweis zur Verwendung von maskulinen Substantiven. In der deutschen Sprache sind viele Substantive von einem Verb abgeleitet, indem ein Suffix angehängt wird (sog. Nomina Agentis). Die häufigste Endung, vor allem bei Berufsbezeichnungen, ist „-er“. Diese Endung wird oft als männliche Endung interpretiert (sog. generisches Maskulin). Durch dieses generische Maskulin lässt sich allerdings kein Rückschluss auf das tatsächliche Geschlecht der Person ziehen. Der Grund dafür liegt in der Unterscheidung zwischen Sexus und Genus in der deutschen Sprache. Das grammatische Geschlecht (Genus) ist nicht mit dem natürlichen Geschlecht des Bezeichneten gleichzusetzen (Sexus). So ist z.B. der Hund nicht immer männlich und die Maus nicht zwangsläufig weiblich. Deutlicher wird das bei Nomen wie die Geisel, die Person oder die Wache; es ist einleuchtend, dass keine dieser Personen weiblich sein muss, vielmehr ist das tatsächliche Geschlecht (Sexus) bis zur weiteren Definition ungeklärt. Was mit dieser ausschweifenden Erklärung zum Ausdruck gebracht werden soll, ist, dass in diesem Buch sehr oft Berufsbezeichnungen wie z.B. Händler, Kunden oder Verbraucher thematisiert werden. Trotz dieser grammatisch männlichen Form der Substantive (Genus) sind damit keinesfalls ausschließlich männliche Personen (Sexus) gemeint. Der Einfachheit halber wurde auf weibliche Suffixe verzichtet, da diese aus grammatischer Sicht ohnehin eine fragwürdige Vermischung von Sexus und Genus darstellen. Kurzum, ist später z.B. vom Händler die Rede, sind alle Geschlechter gleichermaßen einbezogen bzw. angesprochen.
A. Geschichte des Verbraucherschutzes
Die Chronik des Verbraucherschutzes in Deutschland geht zurück bis in die Zeit nach dem 2. Weltkrieg. Bereits ein Jahr nach der Einführung der D-Mark (1948) und kurz nach Inkrafttreten des Grundgesetzes im Mai 1949 wurde der ständige Ausschuss für Selbsthilfe von Verbrauchern gegründet. Schon kurz darauf wurden die Arbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft (AgH) und die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände (AgV) gegründet. Letztere erarbeitete auf Basis der „Charta der Verbraucher und die Grundsätze zur Verbraucheraufklärung“ die Einrichtung von Verbraucherzentralen in allen Bundesländern und führte noch in den 50ern des letzten Jahrhunderts erste Preistests durch. Als Folge dieser Bewegung, die auch international auf europäischer und transatlantischer Ebene forciert wurde, wurde kurz darauf in den 60ern die Stiftung Warentest gegründet, das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb wurde maßgeblich geändert, der Verbraucherschutzverein VSV und der Verband der Postbenutzer wurden gegründet und die EG-Kommission richtete den Fachdienst für verbraucherrelevante Fragen in der Generaldirektion Wettbewerb ein. Somit wurden bereits sehr früh die Grundsteine für den Verbraucherschutz gelegt, wie wir ihn heute kennen. In den folgenden Jahren bzw. Jahrzehnten wurden diese Errungenschaften kontinuierlich ausgebaut und es entstanden vor allem rechtliche Reformen, die neue Rechtsnormen schufen bzw. dem ursprünglichen BGB (das zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs am 01.01.1900 in Kraft trat) einen verbraucherfreundlichen Schliff gaben. So wurden z.B. AGB-Gesetz, Fernunterrichtsschutzgesetz und Bundesdatenschutzgesetz reformiert, das Reisevertragsgesetz erschaffen und neue Preisangabenverordnungen erlassen. Die Bemühungen der Berliner und Brüsseler Legislative sorgten unaufhörlich für eine stringente Verbesserung der Position des Verbrauchers gegenüber Unternehmen. Dieser Prozess ist keineswegs abgeschlossen, sondern wirkt bis heute auf die Gesetzgebung ein. So gab es z.B. im Jahr 2002 eine Reform des BGB, die weiter zur Stärkung der Verbraucherrechte beitrug, indem z.B. eine ausgeweitete Garantiedauer sowie das Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz eingeführt wurden. Die letzte große Änderung, die sicherlich vielen Online-Händlern noch im Gedächtnis ist, war die Umsetzung der Europäischen Verbraucherrechterichtlinie 2011/83/EU (VRRL) in nationales Recht. Die Änderungen in BGB und EGBGB traten zum 13.06.2014 in Kraft und führten zu gravierenden Neuerungen für Händler in Bezug auf die Informationspflichten im Fernabsatz, einschließlich des Widerrufsrechts sowie der Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr.
Betrachtet man die Entstehung des Verbraucherschutzes auf der politischen Zeitachse des Landes, fällt unweigerlich ins Auge, dass simultan wesentlich größere Umbrüche im Gange waren. Ursprünglich kam Deutschland aus der Monarchie und anschließend über die Weimarer Republik und die dunkle Zeit des Dritten Reichs in seine jetzige Form: ein demokratischer föderaler Bundesstaat. So ging die Entstehung des Verbraucherschutzes einher mit der Verwandlung der deutschen Ökonomie in die sog. soziale Marktwirtschaft. Soziale Marktwirtschaft ist ein gesellschafts- und wirtschaftspolitisches Leitbild mit dem Ziel, das Prinzip der Freiheit auf dem Markt mit dem des sozialen Ausgleichs zu verbinden. Alfred Müller-Armack wählte diese Wortverbindung erstmals 1947. Er entwarf die Soziale Marktwirtschaft als Alternative neben der rein liberalen Marktwirtschaft und der staatlichen Wirtschaftslenkung. Die Soziale Marktwirtschaft setzte sich bald als Bezeichnung für die Wirtschaftsordnung der BRD durch.
Aber auch auf europäischer Ebene bemüht man sich seit langem um die weitere Durchsetzung der sozialen Marktwirtschaft. So strebt die Europäische Union laut Lissabon-Vertrag eine sog. wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft mit Vollbeschäftigung und sozialem Fortschritt an. Während mit sozialer Marktwirtschaft vor allem Veränderungen bezüglich der Rechte von Arbeitnehmern und wirtschaftliche Existenzsicherung des Volkes in Verbindung gebracht werden, so lässt sich aber auch im Bereich des Verbraucherschutzes erkennen, dass den Ungleichheiten der freien Marktwirtschaft entgegengewirkt werden sollte. Die Ungleichheit im Verhältnis Unternehmen zu Verbrauchern wird besonders dadurch deutlich, dass oft vom sog. schutzbedürftigen Verbraucher die Rede ist. Somit kann der Verbraucherschutz als eine unausweichliche Folge des Übergangs zur sozialen Marktwirtschaft betrachtet werden.
Warum spielt das in dem Kontext dieses Buchs eine Rolle? Weil dadurch deutlich wird, dass der Schutz des Verbrauchers eine Facette im Kontext einer wesentlich größeren politischen Bewegung ist – eine Bewegung, die einen Grundpfeiler unserer Gesellschaft darstellt. Damit erhält der Verbraucherschutz wesentlich mehr Prägnanz als von der Gesamtbewegung losgelöst betrachtet. Lebendig wird die Stellung des Verbraucherschutzes in beidem, der Gesetzgebung und der Rechtsprechung. Das sollte jeder Unternehmer in seinen täglichen Handlungen immer im Hinterkopf haben; denn kommt es zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung zwischen Unternehmen und Verbraucher, wird es seitens der Gerichte (fast) immer heißen: in dubio pro Verbraucher! – im Zweifel für den Verbraucher!
B. Überblick
E-Commerce hat in den vergangenen Jahren bzw. Jahrzehnten eine beeindruckende Entwicklung vollzogen. Während zum Ende des letzten Jahrtausends die ersten Unternehmen zaghafte Versuche unternahmen, das Internet als innovativen Distributionskanal für sich zu entdecken, drängten schon kurz danach Start-ups an den Markt, für die Begriffe wie Multi-Channel-Vertrieb, Click-Funnel und Affiliate-Marketing nicht nur allgegenwärtige Betätigungsfelder darstellen, sondern vielmehr das Rückgrat des gesamten Geschäftsmodells bilden. Aber nicht nur durch mutige Gründer ist dem E-Commerce eine immense Bedeutung für den deutschen Handel beizumessen. Heute bilden die Start-ups von damals ein Cluster etablierter Unternehmen. Ein Netzwerk, das aus der heutigen Wirtschaft nicht mehr wegzudenken ist. Zalando SE beispielsweise hat im Jahr 2016 einen Umsatz von 3,6 Mrd. EUR erzielt.1 Amazon.com Inc. kommt sogar auf beachtliche 136 Mrd. USD (das entspricht circa 117 Mrd. EUR bei 1,16 EUR/USD).2
Vergleicht man diesen Umsatz mit der wirtschaftlichen Leistung von Nationen (mit Hilfe des PPP-Ansatzes), läge Amazon nach Schätzungen des IWF im Ranking auf Platz 77 – noch vor Tunesien, Guatemala und Puerto Rico.3 Bemerkenswert ist, dass circa 45 % des Amazon-Umsatzes auf rund 64.000 einzelne Händler zurückzuführen sind, die über den Fulfillment Service von Amazon (FBA) ihre Kunden bedienen.4
C. Motivation
E-Commerce hat sich innerhalb rund zweier Dekaden zwar zu einem bedeutenden Pfeiler der Warenverteilung an private Haushalte und zu einem ebenso bedeutenden Wirtschaftszweig als Sublandschaft innerhalb des Einzelhandels etabliert. Jedoch birgt diese Sublandschaft nicht für alle einen leichten Zugang zu neuen Absatzmärkten. So gelingt es z.B. jungen Unternehmen kaum, ins Ausland zu expandieren. Dabei ist gerade der Internethandel für die Internationalisierung prädestiniert, ist doch das Internet grenzüberschreitend präsent und jeder Konsument in der Lage, sogar von unterwegs per Klick jeden beliebigen Online-Shop der Welt gleichermaßen zu erreichen. An Zahlungssystemen über die Landesgrenzen hinaus fehlt es dank der ausgedehnten FinTech-Landschaft in den Bereichen E-Payment und Blockchain-basierter Kryptowährungen ebenfalls nicht. Auch Marketing-Tools, z.B. soziale Medien, bieten grenzüberschreitend die Möglichkeit einer zielgruppenorientierten Adressierung von Werbung. Es ist für Händler aus technischer Sicht leichter als je zuvor, mit ihrem Warenangebot im Ausland einen Cashflow zu generieren. Dennoch stehen Entrepreneure hierbei erheblichen Markteintrittsbarrieren gegenüber. Neben sprachlichen und kulturellen Hürden sind es besonders die rechtlichen Hindernisse. In einer Studie der Universität Regensburg werden die rechtlichen Unsicherheiten von rund 67 % der befragten deutschen Online-Händler als die größte Schwierigkeit bezüglich der Internationalisierung gesehen.5 Diese Unsicherheit ist nachvollziehbar, denn rechtliche Risiken im internationalen E-Commerce bergen eine weitgehend unbekannte Gefahr, da die rechtlichen Rahmenbedingungen schwer zugänglich sind. Diese schwer durchdringbare Rechtslage steht in einem Missverhältnis zu den Möglichkeiten der Marktteilnehmer.
Dies trifft aber nicht nur für internationale Expansionen zu. Viele junge Gründer fühlen sich von der Fülle der rechtlichen Gegebenheiten überwältigt und sehen dieses nebulöse Dickicht als große Hürde, um überhaupt erst mit einer Unternehmung zu beginnen. Dazu gehört auch, dass der Verbraucherschutz in Deutschland und der EU sehr stark ist, dass es Verbraucherschutzeinrichtungen und Ratgeber gibt, um Verbraucher bestmöglich zu schützen, und dass die Rechtsprechung häufig zu Ungunsten der Unternehmer ausfällt. Prinzipiell ist es zwar durchaus wünschenswert, dass in unserem Rechtssystem der schutzbedürftigen Partei zum Kampf auf Augenhöhe verholfen wird, jedoch darf dabei der Unternehmer nicht vergessen werden. Denn florierende Unternehmen sind die Grundlage unserer Wirtschaft und essentiell für die Schaffung von Arbeitsplätzen.
Unternehmern fällt es schwer, sich auf rechtliche Risiken der Geschäfte vorzubereiten, wenn deren Ausmaß gänzlich unbekannt ist. Genau diese Unsicherheiten möchte die vorliegende Arbeit ausräumen. Es soll ein Nachschlagewerk entstehen, das die rechtliche Thematik nicht nur umreißt, sondern durchdringt und somit den Unternehmer für alle gängigen Situationen im Online-Handel wappnet.
D. Abgrenzung
Die zugrunde liegende Untersuchung fokussiert sich auf den klassischen Warenkauf eines Verbrauchers (gem. § 13 BGB) bei einem Online-Händler, der diesen Handel professionell betreibt – also zu einem beruflichen bzw. unternehmerischen Zweck. Bei derartigen B2C-Warenkäufen kann es zu Unstimmigkeiten zwischen Verbraucher und Online-Händler kommen. Diese Unstimmigkeiten stellen in Volumen und Qualität ein Risiko für das Unternehmen dar. Diese Unwägbarkeiten werden dabei aus zwei verschiedenen Perspektiven bewertet, basierend auf der vertraglichen Verpflichtung gem. § 433 BGB: Zum einen kann es dazu kommen, dass ein Verbraucher seine durch Rechtsgeschäft entstandenen Ansprüche unerfüllt sieht, zum anderen kann es vorkommen, dass das Unternehmen eine Diskrepanz zwischen Soll- und Ist-Leistung des Verbrauchers zu erkennen glaubt. Beide Varianten können zu einer rechtlichen Auseinandersetzung führen, die eine Berührung mit deutschem oder sogar außerdeutschem Recht zur Folge haben kann. Daraus resultieren Risiken für das Unternehmen. Beide Blickwinkel auf unternehmerische Unwägbarkeiten werden im Folgenden untersucht mit dem Anspruch, Optionen für das Unternehmen aufzuzeigen, diese Risiken zu reduzieren – im Idealfall ex ante einer gerichtlichen Auseinandersetzung bzw. noch vor Entstehung des Kaufvertrags. Ausgangspunkt ist somit ausschließlich eine Streitigkeit aus § 433 BGB (vertragliche Verpflichtungen). Kaum behandelt werden hingegen Gesetzesberührungen, die sich aus der Distribution spezieller Waren und Dienstleistungen ergeben, wie z.B. das Anbieten von Finanzdienstleistungen automatisch das WpHG mit einbeziehen würde. Alle erdenklichen produktspezifischen Sondervorschriften in diesem Rahmen zu behandeln wäre nicht möglich. Es obliegt vielmehr dem Leser, selbst zu recherchieren, welche besonderen Vorschriften im vorliegenden Geschäftsmodell greifen könnten.
1 Zalando, Pressemitteilung vom 1. März 2017: Zalando peilt nach starkem Geschäftsjahr weiter hohes Wachstum an.
2 Amazon, Q4 2016 Financial Results.
3 Wikipedia, Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt.
4 Wortfilter, Mark Steiger, Amazons Händler sind für 45 % des Umsatzes verantwortlich.
5 E-Commerce-Leitfaden, c/o ibi research der Universität Regensburg, Pressemitteilung vom 13.06.2016: Internationaler E-Commerce – eine lohnende Investition?
III. Grundlagen
A. Entwicklung des deutschen Rechts
Das deutsche Recht hat seine Wurzeln im antiken Rom. Während viele natur- und geisteswissenschaftliche Errungenschaften der Antike ihren Ursprung im alten Griechenland haben, ist die Entwicklung der Rechtswissenschaft ein Erfolg der Römer. Beim Aufbau dieser Disziplin bedienten sich die Römer allerdings der griechischen wissenschaftlichen und philosophischen Methoden. Das römische Recht galt ursprünglich nur für das römische Stadtgebiet, später entfaltete es seine Wirkung auf das ganze Gebiet des römischen Imperiums, das von Spanien bis Armenien und von Schottland bis Nubien reichte. Dadurch kam es zu den ersten Berührungspunkten in Gebieten des heutigen Deutschlands mit dem römischen Recht. Entstanden in der Spätantike um 500 n. Chr. und im sog. Corpus Iuris Civilis aufgezeichnet, war das römische Recht nach dem Untergang des Weltreichs nicht immer präsent, sondern wurde erst im Mittelalter in (größtenteils) Bologna wiederentdeckt. Bis in das 19. Jahrhundert wurde dieses Recht in den meisten Staaten Europas als maßgebliche juristische Grundlage betrachtet. Wiederzufinden sind die Wurzeln des römischen Rechts demnach in den großen Kodifikationen, wie z.B. der französische Code Civil von 1804, das österreichische ABGB von 1812, das deutsche BGB von 1900 und das schweizerische ZGB von 1912. Das erklärt die große Ähnlichkeit der gesetzlichen Grundlagen in vielen europäischen Staaten – vorgelagert der modernen supranationalen EU-Gesetzgebung durch Brüssel.
Vor dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs war das Zivilrecht in dem 1871 gegründeten Deutschen Reich sehr unterschiedlich ausgeprägt. Das bis dahin angewandte gemeine Recht, entstanden aus dem bereits erwähnten römischen Corpus Iuris Civilis, vermischt mit germanischen Stammesrechten, fand nur subsidiäre Anwendung und konnte nicht abschließend für eine Vereinheitlichung im Reich sorgen. So kamen in einigen Ländern autarke Kodifikationen zum Einsatz, wie z.B. in Preußen das Preußische Allgemeine Landrecht von 1794, in den linksrheinischen Gebieten der Code Civil von 1804 oder in Bayern der Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis von 1756. Daher wurde nach der Gründung des Deutschen Reichs 1871 der Ruf nach einer einheitlichen Gesetzesgrundlage laut. Eine eigens dafür einberufene BGB-Kommission hatte die Aufgabe, dies zu erarbeiten, und musste sich zunächst mit den unterschiedlichen Kodifikationen des Reichs befassen. Nach langjähriger Konsultation in zwei Expertenkommissionen und intensiven öffentlichen Debatten wurde als Folge im Jahr 1896 das BGB erarbeitet – übrigens mit erheblichem Einfluss von Frauenbewegungen, was für die damalige Zeit bemerkenswert ist.
Mit der Einführung des BGB am 01.01.1900 war die privatrechtliche Gesetzesgestaltung aber nicht abgeschlossen. Vielmehr unterliegt das BGB noch immer einem dynamischen und kontinuierlichen Entwicklungsprozess. Zum einen wurde das BGB laufend durch zusätzliche Gesetzestexte erweitert, zum anderen wurden die bestehenden Gesetze gemäß dem gesellschaftlichen Fortschritt und der laufenden Rechtsprechung abgeändert, erweitert oder eliminiert. Um mit dem Wandel der Zeit schrittzuhalten, war und ist das dringend notwendig, bedenkt man z.B., dass bei der Entstehung des BGB Technologien wie das Internet und die daraus resultierenden Online-Shops noch eine unbekannte Größe waren. Ferner erfordern das Zusammenwachsen der europäischen Binnenmärkte und die daraus resultierende zunehmende Handelsfreiheit ein Reagieren der Gesetzgeber. So gab es z.B. zum 01.01.2018 einige Änderungen im sog. Schuldrecht, die auch Online-Händler betreffen (dazu später mehr). Die kontinuierliche Weiterentwicklung der gesetzlichen Grundlage unseres Zusammenlebens erfordert es, dass sich Unternehmer dieser Dynamik bewusst sind und dass Mechanismen entwickelt werden, um diese Änderungen zeitnah zu erfassen, zu bewerten und ggf. darauf zu reagieren – sei es z.B. durch Umgestaltung des Online-Shops, Abänderung der AGB oder sogar Adaption des Warenangebots.
B. Einordnung der Rechtsquellen
Um als Unternehmer die gesetzlichen Spielregeln einschätzen und verfolgen zu können, bedarf es einer Strukturierung dieser Regeln. So sollte ein Grundverständnis vorhanden sein, wie Gesetze einzuordnen sind, wie sie entstehen, welchen Änderungen sie unterliegen und wo sie zu finden sind. Darüber hinaus werden die Gesetze durch die laufende Rechtsprechung ergänzt, die je nach Ausgangslage verbindlichen Charakter aufweist.
Das Wort „Gesetz“ wird umgangssprachlich sehr oft verwendet – teilweise in Bereichen, die mit dem juristischen Arbeiten nichts zu tun haben, wie z.B. in der Physik oder in der Religion. Alle diese Anwendungsbereiche haben jedoch eins gemeinsam: Ein Gesetz formuliert abstrakt eine allgemeingültige Regel, die auf unterschiedliche Einzelfälle anzuwenden ist und somit Ordnung forcieren soll. In der Rechtswissenschaft ist diese Ordnung darauf ausgerichtet, im Idealfall Konflikte in zwischenmenschlichen Begegnungen ex ante zu vermeiden. Oft werden Gesetze im juristischen Sinn auch als Rechtsnorm bezeichnet.
Gesetze müssen nicht immer schriftlich verfasst sein; das ist zwar die Regel, aber nicht zwingend vorgegeben. So gibt es z.B. in Deutschland ein sog. Gewohnheitsrecht (= ausschließlich materielles Recht). Voraussetzung für das Gewohnheitsrecht sind eine bestimmte Praktizierung über einen längeren Zeitraum und die (ggf. konkludente) Übereinkunft der Beteiligten, dass dies rechtliche Verbindlichkeit erlangen soll.6, 7 Hierzu kann z.B. das Recht gehören, bestimmte Wege auf einem fremden benachbarten Grundstück zu nutzen. Wird z.B. einem Nachbarn über einen längeren Zeitraum der Zugang zu seinem Grundstück über das eigene gebilligt, zieht das i.d.R. eine dauerhafte Dienstbarkeit nach sich. Vom Gewohnheitsrecht zu unterscheiden sind Sitte und Moral, die zunächst zwar vor allem gesellschaftliche Verbindlichkeit haben, aber in der Rechtsprechung keinesfalls vernachlässigt werden. Ein Beispiel hierfür ist § 138 BGB, wonach ein Rechtsgeschäft (z.B. ein Kaufvertrag) unwirksam ist, wenn dieser gegen die guten Sitten verstößt. Darunter fallen z.B. sog. Knebelverträge oder Wucher. Für die Ausübung unternehmerischer Tätigkeiten im E-Commerce spielen aber i.d.R. nur die vom Gesetzgeber verabschiedeten und schriftlich verfassten Gesetzestexte eine Rolle (= materielles und formelles Recht). Diese sind für jeden öffentlich zugänglich. Das macht es für einen Unternehmer ein Stück weit überschaubarer. Online lassen sich in Deutschland Gesetzestexte z.B. über www.gesetze-iminternet.de einsehen, eine Website des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz. Weitere Informationen und Bekanntmachungen finden sich auch z.B. unter www.bundesanzeiger.de, ein sog. Amtsblatt, das neben dem Bundesgesetzblatt ein weiteres Verkündungs- und Bekanntmachungsorgan der deutschen Bundesbehörden darstellt. Im US-amerikanischen Recht z.B. ist der Zugang zu rechtlichen Grundlagen wesentlich schwieriger. So spielt in der Rechtsentwicklung die laufende Rechtsprechung eine größere Rolle (sog. case law) und der Zugang zu Präzedenzfällen kann mitunter mit finanziellen und systematischen Hürden einhergehen; dazu später mehr.
Eine wesentliche Eigenschaft von Rechtsnormen ist, dass sie der staatlichen Gewalt entspringen. Das muss nicht immer der Bundestag sein, auch z.B. Anstalten des öffentlichen Rechts können per Beschluss verbindliche Normen erlassen. Natürlich treffen auch natürliche oder juristische Personen (wie z.B. Kapitalgesellschaften) rechtlich relevante Regelungen, wie z.B. Kaufvertrag oder AGB, diese entfalten aber, im Gegensatz zu Gesetzen der Staatsgewalt, nur zwischen den Vertragspartnern Wirkung und sind gegenüber Dritten i.d.R. ungültig.
Eine Normenquelle muss aber nicht immer externer Natur sein, auch ein selbst formulierter Vertrag enthält Vorgaben, die es einzuhalten gilt. Vertragliche Regelungen zwischen Personen unterliegen zwar der sog. Privatautonomie, in unserer freiheitlich verfassten Rechtsordnung soll jedem Individuum grundsätzlich so viel Freiraum wie möglich gelassen werden, der Staat gibt aber den notwendigen rechtlichen Rahmen vor, innerhalb dessen sich jeder bewegen muss. Nach dieser Konzeption kann grds. jeder frei entscheiden, mit wem vertragliche Bindungen eingegangen werden sollen (Abschlussfreiheit) und zu welchen Bedingungen dies geschehen soll (Inhaltsfreiheit). Diese Entscheidungsfreiheit wird erst dann beschnitten, wenn z.B. verfassungsmäßige Grundwerte in Frage gestellt werden. Die Abgrenzung zwischen Vertragsfreiheit und gesetzlichen Vorgaben ist stets Gegenstand rechtspolitischer Kontroversen und Auseinandersetzungen. Eine Grundannahme als Bedingung der Privatautonomie setzt zudem voraus, dass sich Personen mit annähernd gleicher Stärke gegenüberstehen. So werden z.B. Verbraucher, die einem Unternehmer gegenübertreten, als strukturell unterlegen angesehen, was bestimmte Schutzvorschriften auslöst, die nicht umgangen werden können – selbst wenn alle Beteiligten dem zustimmen würden. Ein weiteres Beispiel ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz vom 14.08.2006, das in den Rechtsnormen §§ 3, 7 und 19 AGG eine Rechtspflicht stellt, Personen in vergleichbaren Situationen in gleicher Weise zu behandeln. Benachteiligungen aufgrund von Geschlecht, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung oder aufgrund von Behinderungen sind unzulässig. Das scheint zunächst logisch und für ein E-Commerce-Unternehmer kaum relevant, aber im betrieblichen Alltag berührt dies mitunter den Umgang mit Kunden, Auftragnehmern, Mitarbeitern und Bewerbern. Darüber hinaus bestehen die in manchen Fällen geltenden Kontrahierungszwänge bei lebenswichtigen Grundbedürfnissen. So darf z.B. eine Apotheke die Bedienung eines Kunden nicht verweigern, auch wenn sie in der Vergangenheit Probleme mit diesem bestimmten Kunden hatte.
Die Normen des Gesetzgebers sollten aber nicht als lästige Schranken oder unbequeme Vorgaben gesehen werden. In den seltensten Fällen haben die Vertragsparteien alle Eventualitäten im Vorfeld bedacht und entsprechend einer im Sinne aller fairen Übereinkunft schriftlich festgehalten. In allen anderen Fällen springt der Gesetzgeber mit allgemeingültigen Regelungen ein. Somit kann das Gesetz auch als Service-Funktion gesehen werden, die i.d.R. dafür ausgelegt ist, keinen der Vertragspartner zu benachteiligen. Ein Streit kann somit in vielen Fällen abgewendet werden. Ein einfaches Beispiel dafür ist § 433 BGB. Diese Rechtsnorm definiert für Käufer und Verkäufer die Pflichten bei einem Kaufvertrag. Haben die Parteien z.B. nicht festgehalten, ob nach Vertragsabschluss die Ware tatsächlich abgenommen werden muss oder ob z.B. bis zur Abholung oder Zahlung ein Rücktritt möglich ist, so besagt § 433 Abs. 2 BGB, dass der Käufer sich verpflichtet, den Kaufpreis zu zahlen und die Ware abzunehmen.8 Man kann sich vorstellen, dass viele eine Einigung im Vorfeld des Kaufs über diese eventuell eintretende Situation nicht getroffen hätten und dass es im täglichen Handel an dieser Stelle oft zu Uneinigkeiten kommen könnte, da jede Partei je nach eigenem Vorteil ihre eigene Einschätzung der Lage hat. Der Staat bietet somit eine Problemlösung an, die allgemeingültig einspringt, wo eine Regelungslücke eintreten könnte.
Im Allgemeinen sind die Rechtsquellen sehr vielfältig in Entstehung, Form und Art. Das mag zunächst verwirren. Im geschäftlichen Umgang, und vorrangig bei Verbraucherverträgen, werden sich die Rechtsquellen jedoch meist auf das BGB und die zugehörige Rechtsprechung begrenzen.
C. Hierarchie der Rechtsquellen
Die Gesetzgebung in Deutschland ist in unterschiedliche Ebenen unterteilt. Diese Ebenen gehen mit der Entstehung der Gesetze einher. So gibt es z.B. Bundes- und Landesgesetze. Bundesgesetze werden vom Deutschen Bundestag (mit Mitwirken des Bundesrats) beschlossen, Landesgesetze vom jeweiligen Landtag. Die meisten gesetzlichen Regelungen, die einen Unternehmer betreffen, sind Bundesgesetze, wie z.B. das BGB. Landesrecht sind z.B. die Polizeigesetze und die Landesbauordnungen. Viele Bundesgesetze werden aber auch durch Landesgesetze ergänzt, so z.B. durch Regelungen zur Zuständigkeit. In der unternehmerischen Praxis hat dies z.B. zur Folge, dass beim Mutterschutz Rechtsquelle und zuständige Behörde auseinanderfallen. Bei genauerer Betrachtung der Rechtsquellen sieht man darüber hinaus auch, dass Gesetze nicht immer als solches bezeichnet werden. Die Gewerbeordnung z.B. wird aus historischen Gründen so genannt, es handelt sich aber genauso um ein Gesetz.
Als Folge des föderalen Staatsaufbaus in Deutschland ergibt sich der sog. Staatsvertrag als Sonderform der Gesetzesgestaltung. Dabei handelt sich um Verträge, die einzelne Bundesländer miteinander schließen oder der Bund mit einzelnen oder allen Bundesländern schließt, um bestimmte Bereiche zu regeln. So beruht z.B. die Gründung der Zentralvergabestelle für Studienplätze auf einem Staatsvertrag.
Des Weiteren haben Regierungen und Minister im begrenzten Rahmen die Befugnis zur Rechtssetzung. Möglich ist das nur soweit, wie das Parlament diese Befugnis per Gesetz übertragen hat. In vielen Fällen wird eine Rechtsnorm also nicht vom Parlament, sondern direkt vom zuständigen Ministerium stammen. Diese Rechtsnormen werden als Rechtsverordnung bezeichnet. Ein Beispiel hierfür ist die jedem Autofahrer bekannte Straßenverkehrsordnung, die demnach nicht vom Deutschen Bundestag beschlossen, sondern vom Bundesverkehrsminister erlassen wurde und ohne Zutun des Bundesrats ihre Wirkung entfaltet.
Ferner gibt es in Deutschland noch die Rechtsnormen der Gemeinden und Selbstverwaltungskörperschaften. Diese verlieren im Kontext des E-Commerce-Unternehmers aber an Bedeutung, was dazu führt, dass nicht näher darauf eingegangen wird. Gleiches gilt für Verwaltungsvorschriften.
Da in Deutschland auf verschiedenen Ebenen Rechtsnormen entstehen, ergibt sich unweigerlich die Frage, wie zu verfahren ist, wenn die Rechtsnormen dieser Ebenen kollidieren. Hierbei lassen sich zunächst zwei Grundätze festhalten:
1. Bundesrecht verdrängt Landesrecht. Das ergibt sich aus Art. 31 GG, in dem es wörtlich heißt: „Bundesrecht bricht Landesrecht.“.
2. Die Verfassung geht den Parlamentsgesetzen, Rechtsverordnungen und Rechtssetzungsakten von Gemeinden oder anderen Körperschaften vor. Dies resultiert aus dem Rechtsstaatsgebot.
Aus diesen beiden Grundsätzen abgeleitet ergibt sich folgende Hierarchie der Rechtsnormen:
1. Grundgesetz,
2. Bundesgesetz,
3. Verordnungen des Bundes,
4. Landesverfassung,
5. Landesgesetz,
6. Verordnungen der Länder,
7. Rechtssetzungsakte der Gemeinden und Selbstverwaltungskörperschaften.
Diese Hierarchie ist aber zuweilen irreführend, denn Deutschland ist kein zentralistischer Einheitsstaat. Historisch bedingt hat dies der Verfassungsgeber vermeiden wollen und daher ein System gegenseitiger Kontrolle und Machtverteilung entwickelt (vertikale Form der Gewaltenteilung). So gibt es Bereiche, die von den Gesetzgebungskompetenzen des Bundes nicht erfasst sind und nur den Bundesländern zustehen. Das bewirkt, dass eine Bundesverordnung in diesen Bereichen unwirksam wäre und landesrechtliche Regelungen nicht verdrängt würden. So stehen z.B. Gemeinden gem. Art. 28 GG verfassungsrechtliche Garantien zur Seite, mit denen höherrangige Regelungen in ihrer Wirkung begrenzt werden. Seit der sog. Föderalismusreform ist es für bestimmte Bereiche auch möglich, dass die Gesetzgebungskompetenz zwischen Bund und Ländern variiert.
Dem aufmerksamen Leser mag aufgefallen sein, dass im Rahmen der hierarchischen Strukturierung der Rechtsnormen in Deutschland die EU bisher nicht erwähnt wurde. Die rechtliche Einordnung der EU-Gesetzgebung ist nicht immer einfach. Grds. existieren keine internationalen Gesetze (im strengen Sinne), da man der Ideologie folgt, dass es keine welthöchste Staatsgewalt gibt. Bisher war der internationale Bereich vorrangig durch völkerrechtliche Verträge geprägt. Völkerrechtliche Verträge werden bi- oder multilateral geschlossen und sind zunächst innerstaatlich ohne Wirkung. Erst nach der sog. Ratifizierung (Transformationsakt des Gesetzgebers) erfolgt die Umsetzung in innerstaatliches geltendes Recht. Ein prominentes Beispiel für einen völkerrechtlichen Vertrag ist die Europäische Menschenrechtskonvention.
Die Europäische Gemeinschaft ist jedoch weit mehr als nur ein völkerrechtlicher Vertrag; diese Gemeinschaft als europäischen Bundesstaat zu bezeichnen führt allerdings zu weit. Man behilft sich daher damit, dass man sie als Staatenverbund bzw. eine Institution eigener Art bezeichnet. Bezüglich der Rechtsquellen unterscheidet man primäres und sekundäres Gemeinschaftsrecht. Ersteres bezieht sich auf die Verträge der Gemeinschaft selbst, wie z.B. der Maastrichter Vertrag, Letzteres auf die Normsetzungsbefugnisse durch die Organe der Gemeinschaft. Als Organe werden der Europäische Rat, die Europäische Kommission und das Europäische Parlament bezeichnet. Vor allem durch den Erlass von EG-Verordnungen und EG-Richtlinien gem. Art. 249 EGV werden diese Organe rechtssetzend tätig. Ähnlich den Verordnungen in Deutschland entfaltet eine EG-Verordnung unmittelbare Wirkung. Eine EG-Richtlinie hingegen stellt nur einen Auftrag an die Mitgliedstaaten der EU dar, eine bestimmte Gesetzeslage herbeizuführen.
Folglich kann je nach Sachverhalt der oben genannten Hierarchie ggf. eine supranationale EU-weite Regelung vorstehen, die gleichlautend oder anderslautend kollidiert.
D. Rechtsprechung
Bisher lag der Fokus auf Gesetzestexten als Erkenntnisquelle für rechtliche Regelungen, was im Aspekt der horizontalen Gewaltenteilung den alleinigen Blick auf die Legislative richtet. Die Judikative als rechtsprechende Gewalt sollte als juristische Erkenntnisquelle aber ebenfalls betrachtet werden. Unter Rechtsprechung versteht man im Allgemeinen die Akte der Staatsgewalt, durch die in Einzelfällen Ungewissheit über das Recht beseitigt wird. Durch das Einbeziehen dieser Einzelfälle als Informationsquelle erlangt man zusätzliche Einblicke in die Auslegung und Anwendungspraxis in verschiedenen Situationen.
Geht es um Streitigkeiten zwischen z.B. Bürgern oder juristischen Personen des Privatrechts (GmbH, Aktiengesellschaft etc.), wird der Rechtsweg der sog. ordentlichen Gerichte der Zivilgerichtsbarkeit eingeschlagen. Hier werden z.B. Streitigkeiten entschieden, die aus einem Warenkauf resultieren.
Je nach Angelegenheit und Streitwert beginnt die Sache erst nach einem Schlichtungsversuch beim örtlich zuständigen Amtsgericht (AG) oder Landgericht (LG) und führt dann ggf. über eine zweite Instanz, die entweder beim Landgericht oder beim Oberlandesgericht (OLG) liegt, zum Oberlandesgericht oder womöglich sogar bis zum Bundesgerichtshof (BGH). Das Urteil der ersten Instanz wird mit der Berufung angefochten. Gegen das Urteil der zweiten Instanz, die sog. Berufungsinstanz, kann dann ggf. Revision eingelegt werden. Mit der dritten Instanz, die Revisionsinstanz, ist dieser Instanzenzug am Ende angekommen. Es bleibt dann nur noch die Verfassungsbeschwerde an das Bundesverfassungsgericht (BVerfG), bzw. der Weg zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, was in Zivilsachen zwischen Online-Händler und Verbraucher eher unwahrscheinlich ist. Die ranghöchste Instanz für Zivilsachen ist demnach der BGH, neben den anderen vier Bundesgerichten, z.B. der Bundesfinanzhof (BFH) für Zoll- und Steuersachen. Als Basis dieser Entscheidungen dienen zwei Verfahrensordnungen, die Zivilprozessordnung (ZPO) und das Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (FGG).
Die Form der gerichtlichen Entscheidung heißt entweder „Urteil“ oder „Beschluss“. Diese Differenzierung ist historisch bedingt und folgt kaum systematischen Prinzipien. Grds. kann man davon ausgehen, dass unter einem Urteil i.d.R. eine das Verfahren abschließende Sachentscheidung zu verstehen ist.
1. Bindungswirkung
In Deutschland ist ein Richter gem. Art. 97 Abs. 1 GG unabhängig und keinen Weisungen unterworfen. Das gilt auch für Weisungen einer höheren Instanz. Das heißt, im regulären Instanzenzug muss die Rechtsauffassung höherer Gerichte von einem Richter nicht beachtet werden (es gibt hier aber einige Ausnahmen, so z.B. im Falle der erfolgreichen Einlegung einer Revision). Das kommt daher, dass in Deutschland im Allgemeinen der Grundsatz gilt, dass Urteile ausschließlich zwischen den streitenden Parteien bindend wirken. Dies hat wiederum auch zur Folge, dass Urteile nicht auf ähnlich gelagerte Fälle übertragen werden können. Hat also z.B. ein Kunde vor Gericht gegen einen Online-Shop erfolgreich auf Schadensersatz geklagt, ist der Shop-Betreiber durch das Urteil nicht verpflichtet, gegenüber anderen Kunden mit identischer Ausgangslage ebenfalls Schadensersatz zu leisten. Vielmehr müssten auch alle anderen Kunden ein Urteil erwirken, wenn sie entschädigt werden möchten.
Trotzdem geht von den Entscheidungen höherer Instanzen eine faktische Bindungs- bzw. Beeinflussungswirkung aus. Zum einen kann durch eine gefestigte ständige Rechtsprechung eines höheren Gerichts ein Gewohnheitsrecht entstehen. Man spricht hier von Richterrecht bzw. Richtergewohnheitsrecht. Inwieweit ein solches Richterrecht eine bindende Rechtsauslegung sein kann, ist umstritten. Zum anderen kann keinem Richter bzw. keinem Gericht daran gelegen sein, wenn die Entscheidungen ständig von höheren Instanzen aufgehoben werden. Vielmehr ist davon auszugehen, dass Urteile getroffen werden, die die Rechtsprechung der übergeordneten Gerichte berücksichtigen und die dortige Rechtsauffassung und Argumente integrieren. Dies kommt einer faktischen Bindungswirkung gleich.
2. BVerfG und EuGH
Ganz anders verhält es sich mit der Bindungswirkung für die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG). Diese Entscheidungen sind, wie aus § 31 Abs. 1 BVerfGG hervorgeht, in ihrer Bindungswirkung für die gesamte Staatsgewalt (Parlament, Verwaltung und Rechtsprechung) obligatorisch. In manchen Fällen haben die Entscheidungen des BVerfG gem. § 31 Abs. 2 BVerfGG sogar Gesetzeskraft, was dazu führt, dass die Beschlüsse im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn in der Entscheidung die Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes durch das Bundesverfassungsgericht festgestellt wird und dadurch das entsprechende Gesetz nichtig ist bzw. überarbeitetet werden muss.
Eine generelle Bindungswirkung haben auch die Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), wenn darin über die Auslegung von europäischem Gemeinschaftsrecht entschieden wird. Diese Auslegung ist in der Folge für alle Mitgliedstaaten der EU bindend und die faktische Wirkung dieser Entscheidungen ist sehr weitreichend.
3. Widersprechende Urteile
Bei Urteilen der niedrigeren Instanzen kann es zu einer Diskrepanz bezüglich der Urteile bei ähnlich gelagerten Fällen kommen. Das kommt daher, dass bei geringen Streitwerten höhere Instanzen zur Überprüfung der Entscheidungen des Öfteren nicht angerufen werden. Als Folge fehlt es womöglich an einer richtungsweisenden Leitfunktion von oben. Das heißt nicht, dass Urteile niedriger Instanz ggf. falsch sind, vielmehr erlaubt die Interpretation der Sachlage in einigen Fällen unterschiedliche Auslegungen. Daher ist bei Urteilen der Eingangsinstanzen Vorsicht geboten, was sich im weiteren Kontext auch auf die Presse bezieht. Viele Journalisten nehmen keinen Bezug auf das Urteil oder die Gesetzestexte, die als Basis ihrer Arbeit dienten, was als Unternehmer beim Erarbeiten einer rechtlichen Entscheidungsgrundlage grds. dazu führen sollte, derartige Texte zu ignorieren.
In den folgenden Kapiteln wird sehr oft auf die Rechtsprechung Bezug genommen, um über die Rechtsnormen hinaus in Einzelfällen Klarheit zu bestimmten Sachverhalten zu erlangen. Auch wenn diese Entscheidungen nicht grds. allgemeingültig oder dauerhaft sein mögen, so erlauben sie zumindest einen Einblick in die Interpretation der Rechtslage und werden daher oft als richtungsweisend gesehen; wohl wissend, dass künftige Entscheidungen bei einem ähnlich gelagerten Fall anders ausfallen könnten oder Entscheidungen von höherer Instanz gekippt werden können.
Als Quelle für Gerichtsentscheidungen bietet sich für Unternehmer z.B. der sehr praktische Weg über die einschlägigen Webseiten an, die neben den offiziellen Gesetzestexten auch die zugehörige Rechtsprechung auf der Seite der Paragrafen mit beinhalten. Ferner können Entscheidungen aber auch bei den Gerichten selbst angefordert werden (wenn Datum und Aktennummer bekannt sind) oder das jeweils zuständige Gericht veröffentlicht die Entscheidungen direkt online in einer Entscheidungsdatenbank, so z.B. auf der Website des BGH (www.bundesgerichtshof.de).
Die Liste der Erkenntnisquellen ist damit nicht abgeschlossen. Des Weiteren stehen bei der Auslegung der Rechtsnormen weitere Texte wie z.B. Kommentare oder Aufsätze zur Verfügung, ggf. auch Erwägungsgründe. Die beiden erstgenannten sind i.d.R. aber nur entgeltlich zugänglich und daher vor allem für Juristen von Bedeutung. Zudem erfordern diese im Allgemeinen ein fundiertes Rechtsverständnis, was es für Laien unter Umständen schwer macht, einen Nutzen aus diesen Texten zu ziehen. Die Erwägungsgründe hingegen sind zwar i.d.R. öffentlich zugänglich, aber nicht immer existent. Erwägungsgründe sind einem Rechtstext vorangehende Erläuterungen bestimmter Tatsachen, die aufzeigen sollen, welche Überlegungen zum Erlass des Rechtsakts geführt haben. Daher sind sie in der Auslegung der zugehörigen Rechtsnorm sehr aufschlussreich. Häufig werden Erwägungsgründe zu EU-Rechtsakten, wie z.B. der Datenschutz-Grundverordnung, veröffentlicht.
E. Aufbau des BGB
Wie bereits mehrfach angedeutet, werden sich die rechtlichen Grundlagen für Unternehmer im Handel mit Verbrauchern größtenteils im BGB finden lassen. Das BGB kann mit seinen fünf Büchern als Grundgesetz des Privatrechts gesehen werden. Inhaltlich gehen diese fünf Bücher natürlich weit über den Rechtsbereich der Kaufverträge hinaus. Das BGB besteht aus einem Allgemeinen Teil, dem Schuldrecht, dem Sachenrecht, dem Familienrecht und dem Erbrecht. Der Allgemeine Teil des BGB hat die Aufgabe, bestimmte Regelungen für die folgenden vier Bücher als allgemeingültig vorzuziehen. Diese erhalten dadurch für alle Bereiche des BGB allgemeine Gültigkeit. Als E-Commerce-Unternehmer in Geschäftsbeziehungen mit Verbrauchern wird man sich i.d.R. im allgemeinen Teil und im Schuldrecht bewegen. Im Allgemeinen Teil ist z.B. die Thematik der Willenserklärungen erfasst (Angebotsabgabe, Zugang des Angebots etc.), das Schuldrecht hingegen behandelt z.B. die Wirkungen des Kaufvertrags und den Schadensersatz. Mit dem Sachenrecht wird man ggf. auch Berührungspunkte haben, da eine im Online-Shop gekaufte Ware i.d.R. im rechtlichen Sinn eine Sache darstellt. Familien- und Erbrecht erklären sich von selbst und werden nicht weiter erwähnt.
Die Grundidee der allgemeinen Regelungen, die dann ggf. modifiziert werden müssen, liegt dem Aufbau des BGB auch eine Ebene tiefer, im zweiten Buch (Buch der Schuldverhältnisse), zugrunde. So wird dieses Buch ebenfalls durch einen eigenen Allgemeinen Teil (§§ 241 bis 432 BGB) eingeleitet.
Selbstverständlich sind die juristischen Berührungspunkte eines Online-Händlers nicht ausschließlich auf das BGB bzw. auf zwei bis drei Bücher dieses Gesetzes reduziert. Vielmehr hat ein Unternehmen, das Handel betreibt und online präsent ist, eine Vielzahl von Gesetzesgrundlagen zu konsultieren. Wie eingangs mit Hilfe der Abgrenzung erwähnt, bleiben diese Rechtsbereiche im Folgenden aber weitgehend unbehandelt. Es wird hauptsächlich auf den Kaufvertrag mit dem Verbraucher eingegangen, was meist nur den Umgang mit dem BGB erfordert. Im internationalen Handel mit Verbrauchern ergeben sich ggf. noch weitere gesetzliche Grundlagen, wie z.B. die Regelungen der internationalen gerichtlichen Zuständigkeit oder das internationale Privatrecht, ein sog. Verweisungsrecht, das bestimmt, welches nationale Recht anzuwenden ist. Dazu später an gegebener Stelle mehr.
F. Rechtssubjekt Verbraucher
Der Verbraucher ist die zentrale Figur des Themas und bedarf daher der genauen Definition. Der Verbraucher genießt in Gesetzgebung und Rechtsprechung einen besonderen Schutz, da er im Verhältnis zu Unternehmen typischerweise als unterlegen angesehen wird.9 Daher kommt ein Unternehmen im E-Commerce häufig mit Regelungen in Berührung, die diesen besonderen Schutz der Verbraucher entfalten lassen.
1. Definition Verbraucher
Laut Gesetzestext ist jede natürliche Person Verbraucher, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB). Diese Definition gilt es näher zu betrachten.
Zum einen heißt es „jede natürliche Person“, womit juristische Personen grds. per Gesetz vom Verbraucherschutz ausgenommen sind. Da unter juristischen Personen Zweckvereinigungen mit rechtlicher Selbstständigkeit zu verstehen sind, scheint das einleuchtend. Eine GmbH als Kapitalgesellschaft oder eine GbR als Personengesellschaft z.B. können nicht als Verbraucher auftreten. Dazu zählen auch Idealvereine und gemeinnützige Stiftungen.10
Des Weiteren heißt es in § 13 BGB, dass die Rechtsgeschäfte weder gewerblichen noch selbstständigen Tätigkeiten zugeordnet werden dürfen, um als Verbraucher klassifiziert zu werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Verbraucher im beruflichen Sinne ebenfalls Unternehmer gem. § 14 BGB oder Kaufmann gem. HGB ist. Lediglich der Zweck des aktuellen Kaufvertrags ist von Bedeutung. Wie genau der Zweck des Kaufs zu werten ist, lässt sich der laufenden Rechtsprechung entnehmen. So zählen zum privaten Zweck z.B. Urlaub, Freizeit, Gesundheitsvorsorge oder die Verwaltung des eigenen Vermögens.11 Fraglich ist dabei die Beweislast. Sprich, wer hat zu kontrollieren, ob es sich um einen privaten oder gewerblichen Zweck handelt? Oder muss das Unternehmen, um seine Risiken zu beleuchten, im Kaufprozess des Online-Shops vorab für eine eindeutige Identifikation des Kundenstatus sorgen? Dabei sei zunächst gesagt, dass der innere Wille des Käufers keine Rolle spielt. Vielmehr ist die rein objektive Betrachtung des Vorgangs von zentraler Bedeutung. Eine Zurechnung entgegen dem mit dem Handeln objektiv verfolgten Zweck kommt nur in Betracht, wenn die dem Vertragspartner erkennbaren Umstände zweifelsfrei darauf hinweisen, dass eine natürliche Person in Verfolgung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt.12 Soll aus praktischer Sicht heißen: Wenn ein Käufer im Online-Shop objektiv nicht erkennen lässt, dass es sich um einen gewerblichen bzw. beruflichen Kauf handelt, ist dieser als Verbraucher anzusehen. Eindeutige Indizien gegen den Verbraucherstand wären z.B. die Angabe eines Firmennamens als Rechnungsadresse oder eine Handelsregisternummer. Der Kauf selbst kann aber schon Indiz sein. Wird z.B. eine Software gekauft, die in ihrer Funktion für mittelständische Unternehmen ausgelegt ist, und enthält das Angebot eine Vielzahl von Nutzungslizenzen für Mitarbeiter, kann kaum von einem Kauf für private Nutzung ausgegangen werden. Weniger eindeutig wäre allerdings der Einkauf von Schreibwaren durch einen Lehrer. Werden die Schreibwaren für die Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit oder für rein private Zwecke erworben? Diese Beispiele zeigen, dass die Unterscheidung nicht immer einfach und vor allem nicht ohne weiteres für einen Online-Shop standardisierbar ist. Um das Risiko für das eigene Unternehmen einzudämmen, könnten man z.B. im Zweifel immer von einem Verbraucher ausgehen und dem Kunden die vollen Rechte einräumen, die damit einhergehen. Eine Alternative dazu wäre es, im Verkaufsprozess des Shops den Kunden explizit nach diesem Status zu fragen.
Die Definition des Verbrauchers ist allerdings innerhalb der EU nicht homogen. Während nach dem Recht der EU jeder Bezug zu selbstständiger oder gewerblicher Tätigkeit den Verbraucherschutz aufhebt, wird in der deutschen Rechtsprechung nach dem überwiegenden Zweck gesucht. Diese Abweichung vom Gemeinschaftsrecht ist nur deshalb möglich, weil dadurch keine Beschränkung, sondern eine Ausdehnung des Verbraucherschutzes erreicht wird.13 Weitere Informationen zur Definition des Verbrauchers auf EU-Ebene finden sich im Abschnitt zur Regelung der internationalen Zuständigkeit der Gerichte (EuGVVO).
2. Definition Unternehmer
Dem Verbraucher steht bei einem Verbrauchervertrag der Unternehmer gegenüber, der in § 14 BGB definiert ist. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt (Abs. 1), darunter fallen demnach auch Freiberufler, Handwerker, Landwirte und Kleingewerbetreibende.
Nach § 14 Abs. 1 BGB ist Unternehmer deshalb auch, wer z.B. als Architekt, Steuerberater, Übersetzer oder Zahnarzt tätig ist bzw. in jedweder selbstständiger Weise Dienstleistungen ausführt, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Wie bereits erwähnt, muss das Rechtsgeschäft aber in Ausübung dieser Tätigkeit erfolgen, um die Partei als Unternehmer einzustufen; kauft der Architekt als Privatperson, so ist er Verbraucher.
Das HGB bietet ebenfalls Hilfe bei der Einstufung als Unternehmer. Die Adressaten des Handelsgesetzbuchs (HGB) sind nur gewerbliche Unternehmer. Daraus folgt, dass jeder, der gem. HGB als Kaufmann einzustufen ist, zugleich auch Unternehmer ist (aber nicht jeder Unternehmer ist Kaufmann).
Im E-Commerce hat sich über die Jahre eine eigene Definition des Unternehmers herausgebildet. Als eine gewerbliche Tätigkeit kann auch eine planvolle, auf gewisse Dauer angelegte, selbstständige und wirtschaftliche Tätigkeit, die nach außen hervortritt, verstanden werden. Eine Einzelperson, die mit einem gewissen organisatorischen Mindestaufwand wiederkehrend Waren auf einer Plattform wie bei z.B. Ebay oder Amazon verkauft, kann aus rechtlicher Sicht als Unternehmer gewertet werden. Insbesondere ist dies bei sog. Powersellern anzunehmen, die mindestens 300 Artikel pro Monat bei Ebay verkaufen oder einen eigenen Ebay-Shop einrichten. Grds. muss bei einem Geschäft über Ebay zwar der Käufer die Unternehmereigenschaft des Verkäufers nachweisen, ist der andere jedoch Powerseller, findet nach Ansicht des OLG Koblenz eine Beweislastumkehr statt, was dazu führt, dass die Privatperson nachweisen muss, dass sie genau das ist und eben kein Unternehmer.14
Abschließend sollte zu den Definitionen von Verbraucher und Unternehmer besonders hervorgehoben werden, dass der Verbraucherschutz nur greift, wenn ein Rechtsgeschäft zwischen Verbraucher und Unternehmer stattfindet. Schließen Verbraucher oder Unternehmer untereinander einen Vertrag, ist keine der beiden Parteien strukturell unterlegen und die Schutzfunktionen des Verbraucherschutzes greifen i.d.R. nicht; siehe dazu auch die Legaldefinition „Bei Verträgen zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher (Verbraucherverträge) […]“ aus § 310 Abs. 3 BGB.
3. Umfang des Verbraucherschutzes
Ist ein Verbrauchergeschäft gegeben, hat dies weitreichende rechtliche Folgen. Wie in den folgenden Kapiteln zu sehen ist, existiert aber kein gesondertes Verbraucherschutzgesetz, das alle Fragen des Verbraucherrechts zentral regeln würde. Stattdessen gibt es eine Vielzahl von Einzelgesetzen, die immer dann eingreifen, wenn der Gesetzgeber eine rechtliche Norm für Verbraucher als inadäquat erachtet. So ergibt es sich, dass die Gesetze, die dem Verbraucherschutz dienen, weit über das BGB verstreut sind. Das hat zur Folge, dass die Übersicht leidet. Kennt man eine zum Schutz des Verbrauchers eingreifende Norm nicht, kann dies schnell dazu führen, dass das „reguläre“ Recht zurate gezogen wird. Dazu ein einfaches Beispiel: Im Versendungsverkauf trägt i.d.R. der Käufer das Risiko eines zufällig eintretenden Transportschadens (§ 447 BGB). Damit wiegt sich der Online-Händler womöglich in Sicherheit. Allerdings sagt § 475 Abs. 2 BGB i.V.m. § 474 BGB, dass dies bei Verbrauchergeschäften nicht zutrifft.
Um die heterogenen Auswirkungen des Verbraucherschutzes vorab grob zu umreißen, wird im Folgenden eine rudimentäre Auflistung von Rechtsnormen gegeben, die durch das Bejahen eines Verbrauchergeschäfts ausgelöst werden und i.d.R. auch nicht umgangen werden können:
• Regelungen zu unbestellten Leistungen (§ 241a BGB).
• Vorschriften über die Grundsätze bei Verbraucherverträgen und besonderen Vertriebsformen (§§ 312 bis 312k BGB).
• Regelungen zum Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen (§§ 355 bis 361 BGB).
• Vorschriften zum Verbrauchsgüterkauf (§§ 474 bis 479 BGB),
• Teilzeit-Wohnrechteverträge, Verträge über langfristige Urlaubsprodukte, Vermittlungsverträge und Tauschsystemverträge (§§ 481 bis 487 BGB).
• Verbraucherdarlehnsverträge (§§ 491 bis 505e BGB).
• Regelungen über Finanzierungshilfen zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher (§§ 506 bis 509 BGB).
• Ratenlieferverträge (§ 510 BGB).
• Anwendung auf existenzgründende Verbraucher (§§ 512 und 513 BGB).
• Regelungen zur Vermittlung von Verbraucherdarlehensverträgen (§§ 655a bis 655e BGB).
• Gewinnzusagen (§ 661a BGB).
• Vorschriften über Allgemeine Geschäftsbedingungen (§§ 305 bis 310 BGB).
In diesem Buch werden nicht alle diese Auswirkungen behandelt. Wie in der Abgrenzung bereits erläutert, gibt es Spezialgesetze, die z.B. besondere Branchen betreffen oder aus anderen Gründen für den Online-Handel wenig von Relevanz zu sein scheinen.
4. Schutzbedürftigkeit des Verbrauchers
In vielen wissenschaftlichen Disziplinen, wie auch in Teilen der Rechtswissenschaften, wird noch immer davon ausgegangen, dass der Verbraucher ein mündiges Rechtssubjekt ist, das selbst Entscheidungen zum Besten des eigenen Wohls treffen kann (der sog. Homo oeconomicus). Die Realität sieht leider anders aus.
Tatsächlich ist der Verbraucher nicht nur bei jeder Kaufentscheidung auf eine Vielzahl von Informationen angewiesen, sondern er kann davon auch nur eine bestimmte Menge aufnehmen (sog. information overload), und letztendlich handelt er dennoch nicht rational. Diese Erkenntnis wird von vielen Unternehmen zum eigenen Vorteil ausgenutzt, indem z.B. in der Werbung nicht umfassend bzw. objektiv informiert wird. Des Weiteren wird der Verbraucher bewusst mit unterschwelligen Kaufanreizen zum schnellen irrationalen Kauf verleitet. Diese Praktiken sind keineswegs illegal, begründen aber aus Sicht des Verbraucherschutzes das Leitbild des schutzbedürftigen Verbrauchers. Es wird grds. davon ausgegangen, dass der Verbraucher strukturell dem Unternehmer unterlegen ist und ihm nicht das gleiche Fachwissen bzw. dieselben Überprüfungsressourcen zur Verfügung stehen. Dieses Leitbild des Verbrauchers (mangelnde Rechtskenntnis, wirtschaftliche Unterlegenheit, psychologische Hindernisse, unübersehbares Warenangebot) hat sich in der Arbeit des Gesetzgebers weitgehend manifestiert und führt dazu, dass der Unternehmer durch eine Vielzahl von gesetzlichen Ausprägungen auf die strukturelle Benachteiligung des Verbrauchers Rücksicht nehmen muss.
Parallel dazu hat der EuGH über die Jahre ein Verbraucherleitbild entwickelt, das hierzulande in der Rechtsprechung i.d.R. Berücksichtigung findet. Denn in den Überlegungen zur Schutzbedürftigkeit des Verbrauchers bleibt zunächst offen, wie ein Maßstab bezüglich der strukturellen Unterlegenheit angesetzt werden kann. Der BGH stellte bisher relativ niedrige Anforderungen an die empirischen und intellektuellen Fähigkeiten des Verbrauchers, was im internationalen Kontext oft zu Kollisionen führte. Der EuGH hat diese Kontroverse in einem Beschluss im Jahr 2005 klargestellt: Maßgeblich für den Verbraucherschutz ist der „[…] normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher […]".15 Die Definition scheint zu-nächst abstrakt, gibt aber einen wichtigen Anhaltspunkt, wie Gerichte „den Verbraucher“ zu verstehen haben. Letztlich wird es aber darauf ankommen, wie die Gerichte das Verbraucherleitbild des EuGH fallbezogen konkretisieren.
5. Kritik am Verbraucherschutz
Wie zu erwarten, ist der Verbraucherschutz nicht unumstritten. Aus Sicht des Unternehmers ergeben sich durch die Spezialgesetze Verpflichtungen, die sehr unangenehm oder auch kostspielig werden können. So wird z.B. die Vertragsfreiheit eingeschränkt und ein Geschäftsmodell ist durch die Verbraucherschutzvorschriften evtl. nicht in der Art durchführbar wie ursprünglich angedacht.
Andere sind der Ansicht, dass das Verursacherprinzip teilweise ausgehebelt werde und dadurch Kosten von den Unternehmen getragen werden müssten, obwohl diese eigentlich durch den Verbraucher entstanden seien, sich aber wegen des Verbraucherschutzes nicht auf diesen umlegen lassen würden.
Aber nicht nur aus ökonomischer Sicht ergeben sich Kritikpunkte. Einige Wissenschaftler sind der Meinung, dass durch einen zu strengen Verbraucherschutz die Innovation gehemmt werde. Als Beispiel führt der Ökonom Milton Friedman die Arzneimittelbranche an. Er kritisiert, dass Verbraucherschutzeinrichtungen aus Angst vor schädlichen Medikamenten überzogene Tests fordern würden. Dies führe dazu, dass einige Medikamente zu spät auf den Markt kommen würden, was zu Schäden oder sogar zum Tod einiger Patienten führe. Ähnliches lässt sich auch in der Finanzbranche beobachten. Die Hürden für neue Finanzdienstleistungsinstitute sind derart hoch, dass es für viele Gründer kaum möglich ist, technisch innovative Ideen umzusetzen.
Grundsätzlich steht auch die Frage im Raum, inwieweit die Verbraucherrechte den Verbraucher unaufmerksam werden lassen. Wenn sich Konsumenten auf das Eingreifen des Staates verlassen können, schwindet dadurch die Intention, selbst für angemessene Vertragsverhältnisse zu sorgen. Viele kennen das womöglich aus dem Alltag: Wer liest tatsächlich die AGB beim Abschluss eines Vertrags? Unbewusst verlässt sich der Verbraucher i.d.R. darauf, dass der Gesetzgeber einen vernünftigen Rahmen geschaffen hat, um die AGB gefahrlos zu machen. Dies führt nach Ansicht einiger Ökonomen (z.B. Mark Armstrong) dazu, dass Verbraucherschutz in Summe schädlich für den Verbraucher sei.
Ebenfalls fraglich ist auch, inwieweit der Verbraucherschutz überhaupt durchgesetzt werden kann. Wenn einem Verbraucher nur ein geringer finanzieller Schaden entsteht, lohnt sich eine Klage für ihn i.d.R. nicht bzw. bringt unverhältnismäßige Risiken mit sich. Viele große Unternehmen sind sich dessen bewusst und setzen sich darum immer wieder über die Gesetze des Verbraucherschutzes hinweg.
6. Zusammenfassung
• Von Verbrauchergeschäften geht man aus, wenn ein Verbraucher mit einem Unternehmer ein Rechtsgeschäft abschließt.
• Ein Verbraucher ist gem. § 13 BGB eine Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
• Dem steht als Vertragspartner der Unternehmer gegenüber, der i.S.d. § 14 BGB bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
• Zwei Privatpersonen oder zwei Unternehmen untereinander können demnach im rechtlichen Sinne kein Verbrauchergeschäft abschließen.
• Bei Verbrauchergeschäften treten unabdingbar Schutzgesetze in Kraft, die weitreichende Folgen für Unternehmer und Verbraucher haben.
• Diese wurden eingeführt, um die Position der Verbraucher als tendenziell schwächere und schutzbedürftigere Personen gegenüber den Unternehmern zu stärken.
G. Vertragsschluss im Internet
Um im Folgenden näher betrachten zu können, welche Auswirkungen bestimmte nationale und internationale Regelungen auf Verbraucherverträge haben können und welche Risiken für Unternehmer daraus entstehen, muss zunächst veranschaulicht werden, wie solch ein Rechtsgeschäft zustande kommt. Denn es bedarf zum einen mehrerer Schritte und Voraussetzungen, um einen Kaufvertrag (bzw. im Speziellen den Verbrauchervertrag) entstehen zu lassen, zum anderen kann das Scheitern bzw. Aufheben solch eines Vertrags an unterschiedlichen Stellen des Entstehungsprozesses eingreifen. So kann ein Kaufvertrag z.B. zu einem späteren Zeitpunkt durch einen Rücktritt aufgelöst werden (ex nunc), oder der Vertrag wird durch Anfechtung von Anfang an als nicht zustande gekommen gewertet (ex tunc). Dies ist für die Auswirkungen solcher Störungen auf einen Kaufvertrag ausschlaggebend und daher ist es wichtig, den Kaufvertrag im Detail zu kennen und zu verstehen. Dieser Vorgang wird im Folgenden in seinen groben Zügen dargestellt.
1. Übereinstimmende Willenserklärungen
Grds. bedarf es für einen wirksamen Kaufvertrag zweier übereinstimmender Willenserklärungen. Diese Willenserklärungen müssen die sog. essentialia negotii enthalten. Das ist der notwendige Mindestinhalt, der zwischen zwei Vertragspartnern definiert werden muss, um einen Vertrag eines bestimmten Typus rechtswirksam entstehen zu lassen. Die essentialia negotii bei einem Kaufvertrag sind lediglich Kaufgegenstand und Kaufpreis – im Grunde auch, wer die Vertragspartner sind. Das ist weniger im Sinne einer Identifizierungspflicht per Ausweis zu verstehen (das wäre z.B. beim Bäcker etwas umständlich), sondern eher dahingehend, dass für beide erkennbar sein muss, wer einen Vertrag schließt. Einen Formzwang wie z.B. Schriftform gibt es beim Warenkauf nicht, somit kann ein Kaufvertrag auch mündlich geschlossen werden.16
2. Wirksames Angebot
Aber nicht so schnell. Betrachten wir das Zustandekommen Schritt für Schritt, zunächst in der Offline-, dann für die Online-Welt. Zunächst muss von einem potentiellen Vertragspartner ein Angebot vorliegen, der sog. Antrag gem. § 145 BGB. Angenommen ein Kunde hat Ware in einem Schaufenster gesehen und dadurch wurde der Bedarf geweckt. Der Kunde geht in das Geschäft und möchte die gesehene Ware kaufen. Dabei stellt sich bereits die Frage, ob das Ausstellen der Ware im Schaufenster inkl. Preisangabe ein Angebot i.S.d. BGB darstellt. Sprich, hat der Händler einen Antrag abgegeben? Wenn ja, dann wäre das Angebot gem. § 145 BGB bindend! Das hätte zur Folge, dass der Verkäufer das Angebot nicht zurückziehen kann. Das könnte für den Händler bisweilen sehr unangenehme Folgen haben: Es könnte z.B. sein, dass die Ware bis auf das Ausstellungsstück ausverkauft ist oder die Ware in der passenden Ausfertigung nicht vorliegt (z.B. Kleidergröße). Wäre das Ausstellen ein bindendes Angebot, könnte der Kunde es durch Abgabe seiner Willenserklärung annehmen und es käme ein Kaufvertrag mit schuldrechtlichen Verpflichtungen zustande, ohne dass der Verkäufer das wollte und ohne dass die Ware geliefert werden könnte.
Man behilft sich daher mit einem Modell, das besagt, dass das Ausstellen der Ware lediglich eine Aufforderung zur Angebotsabgabe darstellt (invitatio ad offerendum). Der Verkäufer ist somit nicht an ein Angebot gebunden, sondern der Kunde ist aufgefordert, dem Verkäufer seine Absicht auf einen Kaufvertrag zuerst mitzuteilen. Ist die Ware dann nicht wie erwartet auf Lager, gibt es keine übereinstimmenden Willenserklärungen, die zu einem Vertrag führen. Ein weiterer Vorteil dieser Rechtskonstruktion ist, dass Preise ggf. korrigiert werden können. Würde der Händler versehentlich die Ware mit einem falschen Preis ausgezeichnet haben, wäre er auch preislich an das Angebot gebunden. Stellt das Auslegen der Ware hingegen noch kein verbindliches Angebot dar, ist eine Korrektur des Preises noch möglich.17
Ähnlich dem Auslegen der Ware in einem Geschäft, folgen auch Kataloge, Preislisten, Speisekarten, Plakate etc. dem gleichen Grundprinzip – ein verbindliches Angebot ist damit noch nicht abgegeben.
Der Kunde ist somit derjenige, der seine Willensabsicht in Form eines Angebots im Sinne des § 145 BGB zuerst abgibt. In einem Ladengeschäft sieht man aber in den seltensten Fällen jemanden sagen: „Ich möchte diese Ware gerne zu x EUR kaufen!“; ist diese Willenserklärung vielleicht entbehrlich? Das ist sie nicht, denn ohne Abgabe können keine übereinstimmenden Willenserklärungen zu einem Vertrag führen; vielmehr geschieht die Abgabe einer Willenserklärung in diesem Fall stillschweigend, durch das Auflegen der Ware auf das Warenband z.B.; man sprich hier von einer Willenserklärung, die durch schlüssiges Handeln abgeleitet werden kann, eine sog. konkludente Willenserklärung.18
Der Verkäufer nimmt i.d.R. das Angebot des Kunden an und generiert somit die zugehörige Willenserklärung, um den Vertrag entstehen zu lassen.19 In der Praxis, um beim Beispiel Ladengeschäft zu bleiben, geschieht das i.d.R. ebenfalls konkludent durch schlüssiges Handeln, wie in etwa das Einscannen der Ware in die Kasse etc. Das BGB liefert hierzu eine Rechtsnorm, nach der es für die Annahme explizit keiner Erklärung bedarf, wenn entsprechend der Verkehrssitte gehandelt wird (siehe § 151 BGB).
Im Grunde liegt nun durch das Auflegen der Ware an der Kasse und das Einscannen in die Kasse ein Aufeinandertreffen von zwei gleichgerichteten Willenserklärungen und somit ein gültiger Kaufvertrag vor, der schuldrechtliche Rechte und Pflichten für beide Vertragspartner auslöst. Zu erwähnen bleibt hierbei, dass die beiden Willenserklärungen empfangsbedürftig sind20. Das heißt, ohne dass sie beim ausgesuchten Empfänger angekommen sind, entfalten sie keine Wirkung. Das klingt zwar plausibel, in der Rechtswissenschaft gibt es aber Willenserklärungen, die ohne Zugang wirken und die auch einseitig (ohne das Aufeinandertreffen zweier gleichgerichteter Willenserklärungen) ihre Gültigkeit erlangen; solche Fälle können im Bereich des Warenhandels aber vernachlässigt werden.21 Unter Anwesenden ist der Zugang der empfangsbedürftigen Willenserklärung i.d.R. kein Streitpunkt, unter Abwesenden wird der Sachverhalt womöglich unübersichtlich und ist in § 130 BGB grundsätzlich geregelt und über die Rechtsprechung weiterentwickelt.
3. Wirksamkeit elektronischer Willenserklärungen
Im Internet ergeben sich Besonderheiten gegenüber haptisch geschlossenen Verträgen. Als das BGB am 01.01.1900 in Kraft gesetzt wurde, waren die Willensabgabe und das Zustandekommen von Verträgen via elektronische Datenübermittlung noch nicht absehbar. Die Rechtsprechung hat sich jedoch über die Jahre mit dem Thema auseinandergesetzt und klare Orientierungen vorgegeben. So stellt das BGH in seinem grundlegenden Urteil am 07.11.2001 fest, dass Verträge durch auf den Vertragsabschluss gerichtete, einander entsprechende Willenserklärungen i.d.R. durch Antrag und Annahme nach § 145 ff. BGB, bei Versteigerungen durch Gebot und Zuschlag (§ 156 BGB) zustande kommen; und „Diese Willenserklärungen können […] auch durch elektronische Übermittlung einer Datei im Internet – online – abgegeben und wirksam werden.“22 Somit wurde definiert, dass der Vertragsabschluss im Internet denselben rechtlichen Grundsätzen folgt, wie sie in der analogen Welt zur Anwendung kommen. Die „elektronische Übermittlung einer Datei“ ist hierbei semantisch nicht auf das bewusste Verschicken z.B. einer Datei per E-Mail zu begrenzen, denn auch eine Website bzw. deren Inhalte stellen eine Datei dar und der Einkauf über einen Online-Shop geht im Hintergrund immer mit dem Versenden von Datenpaketen einher. Somit ist eine Willenserklärung über eine Website (Online-Shop) ebenfalls mit diesem Leitsatz des BGH abgedeckt und es kommt ein gewöhnlicher Kaufvertrag mit den entsprechenden vertragstypischen Pflichten der Parteien gem. § 433 BGB zustande.
4. Zugang elektronischer Willenserklärungen
Um durch die Abgabe einer elektronischen Willenserklärung einen Vertragsschluss herbeizuführen, muss diese dem potentiellen Vertragspartner zugehen. Fehlt dieser Zugang, kann sie gem. § 130 BGB nicht wirksam werden. Aber wann ist diese tatsächlich beim Empfänger rechtskräftig eingegangen? Auch beim Zugang der Willenserklärungen folgt die Rechtsprechung der Logik der nicht elektronischen Kommunikation.23





























