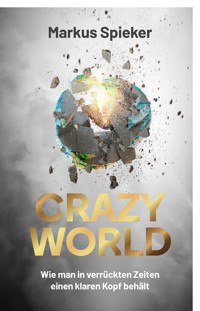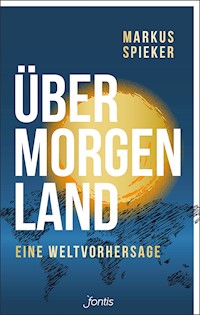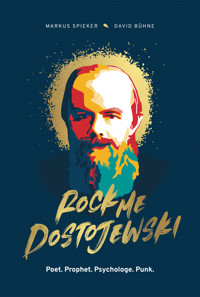
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fontis AG
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dos-to-jew-ski! Zum 200. Geburtstag erscheint das große Buch zum großen Schriftsteller. Als Würdigung. Und als Wachmacher. Denn Dostojewski rüttelt auf, durch seine Werke genauso wie durch den faszinierenden Werdegang: vom Sohn eines Armenarztes, Literatur-Wunderkind, Revolutionär und Zwangsarbeiter in Sibirien – zum Medienunternehmer, Blogger (tatsächlich!) und schließlich gefeierten Nationaldichter. Ganz zu schweigen von seiner Zockerei, seinen Liebesverrücktheiten und vielen Krankheiten. Ist Dostojewski von gestern? Von wegen! Seine Tiefe und Schärfe lässt viele heutige Autoren flach und brav aussehen. Hochaktuell sind seine Warnungen vor einem Hyper-Individualismus und den Folgen der Abkehr von Gott. Höchste Zeit, ihn ganz frisch zu entdecken: als Erzähler, Seelenforscher, Weisheitslehrer. Auf der Grundlage der neuesten Dostojewski-Forschung werden seine Lebensstationen vorgestellt. Dabei kommt er auch ausführlich selbst zu Wort: in einem «Best of» seiner Bücher, Zeitschriften, Briefe und Notizen. Dieser einzigartige Mix aus Biografie und Anthologie steht unter dem Motto, das Dostojewski sich als 17-Jähriger gegeben hatte: «Der Mensch ist ein Geheimnis. Man muss es enträtseln.»
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 603
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus Spieker & David Bühne
Für Tabitha,
Markus Spieker David Bühne
Rock Me, Dostojewski!
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Der Fontis-Verlag wird von 2021 bis 2024 vom Schweizer Bundesamt für Kultur unterstützt.
© 2021 by Fontis-Verlag Basel
Umschlag: CaroGraphics, Carolin Horbank, Leipzig Bild Cover und nach Inhalt: Harry Hummel, Berlin E-Book-Vorstufe: InnoSet AG, Justin Messmer, Basel E-Book-Herstellung: Textwerkstatt Jäger, Marburg
ISBN (EPUB) 978-3-03848-698-5
Inhalt
Vorprogramm
Kapitel 1: Sohn
Kapitel 2: Träumer
Kapitel 3: Rebell
Kapitel 4: Sträfling
Kapitel 5: Patient
Kapitel 6: Romantiker
Kapitel 7: Familienmensch
Kapitel 8: Feminist
Kapitel 9: Kinderfreund
Kapitel 10: Tierschützer
Kapitel 11: Ästhet
Kapitel 12: Schriftsteller
Kapitel 13: Psychologe
Kapitel 14: Zeitkritiker
Kapitel 15: Lebenslehrer
Kapitel 16: Prophet
Kapitel 17: Russe
Kapitel 18: Mitmensch
Kapitel 19: Zweifler
Kapitel 20: Pilger
Zugabe
Quellen- und Literaturhinweise
Zeittafel, Fotos, «Die Autoren»
Vorprogramm
Mit Dostojewski kann man nichts falsch machen.
Dachte sich auch Marilyn Monroe, als sie sich Anfang der fünfziger Jahre bei dem Regisseur Samuel Fuller um eine Filmrolle bewarb. Um ihr Image als oberflächliche Blondine zu bekämpfen, kam sie mit einem dicken Buch unterm Arm zum Vorsprechen. Mit dem Wälzer wollte sie Eindruck machen. Es war ein Buch von Dostojewski. Der Name stand für maximalen Tiefgang.
Steht er heute noch.
Aber eben auch für Vergangenheit.
Was hat ein toter, tief aus dem 19. Jahrhundert kommender Russe uns im 21. Jahrhundert zu bieten?
Wie wär’s mit: Wahrheit? Wirklichkeit? Weisheit?
Dostojewski rockt.
Get ready.
Auf den meisten Bildern, die es von ihm gibt, wirkt er etwas freudlos. Das bekannteste Porträt stammt aus dem Jahr 1872. Da schrieb er gerade an dem Buch «Die Dämonen» und fühlte sich zeitweise auch, als wären böse Geister hinter ihm her.
Der Maler Wassili Perow zeichnet ihn mit matten Augen und mit nach innen gekehrter Miene. Dabei konnte er auch ganz anders schauen: mit leuchtendem Blick, berauscht von Mensch und Natur. Dostojewski war beinahe so vielschichtig, wie seine Bücher Seiten haben. Ein Titan – und zwar nicht nur in literarischer Hinsicht. Er überragt bei Weitem die klischeehafte Vorstellung, die viele Menschen von ihm haben. Dass er irgendwie schwierig ist. Dass seine Bücher doch bloß von den dunklen Seiten des Lebens handeln. Harte Kost, beinahe unverdaulich für moderne Zeitgenossen.
Stimmt.
Das sagt aber mehr über unsere Zeit aus als über ihn.
Wenn er zu tief ist, sind wir zu flach.
Dostojewski zu lesen strengt an. Aber es rüttelt auch auf. Und wenn man sich an seinen stilistischen Groove gewöhnt hat, unterhält es auch prächtig. Von spaßfrei kann bei ihm keine Rede sein. Dostojewski sitzt der Schalk im Nacken. Und er betrachtet die Welt nicht mit trüben, sondern mit strahlenden Augen. So wie auf dem Cover dieses Buchs.
Unbestritten sind Dostojewskis Qualitäten als Autor. Er gilt als ein großer Schriftsteller.
Zu Unrecht, finden wir.
Er ist aus unserer Sicht noch mehr. Er ist der Größte.
Weil er mehr als nur fesselnd erzählen konnte. Er war auch Gesellschaftskritiker, Menschenkenner, Futurist, Philosoph, Seelsorger. Seine Tätigkeit beschränkte sich längst nicht nur auf die Belletristik. Er leitete ein Medien-Start-up, arbeitete als Journalist, betätigte sich mit dem «Tagebuch eines Schriftstellers» als Vorläufer heutiger Blogger. Dabei folgte er keinen Moden, sondern setzte die Trends.
Ein Innovator, ein Rebell, ein Punk.
In puncto Produktivität konnte es keiner mit diesem Tausendsassa aufnehmen. In gerade mal fünfundzwanzig Jahren beruflicher Aktivität veröffentlichte er um die 20 Romane und Novellen, dazu rund 20 Kurzgeschichten, über 200 Aufsätze, hinterließ mehr als 700 Briefe.
Was für ein Werk.
Und was für Werke!
Die Highlights sind bekannt, aber oft nicht in ihrer bahnbrechenden Bedeutung gewürdigt: Die philosophisch-psychologisch-theologischen Kriminalromane «Schuld und Sühne» und «Die Brüder Karamasow»; der epische Kleinstadt-Thriller «Die Dämonen»; das tragisch-monumentale Antihelden-Meisterwerk «Der Idiot»; die Randgestalten-Soaps «Arme Leute» und «Erniedrigte und Beleidigte»; das Psycho-Drama «Der Doppelgänger»; die Gefängnis-Memoiren «Aufzeichnungen aus einem Totenhaus»; der existentialistische Aufschrei «Aufzeichnungen aus dem Kellerloch»; die Zockerei-Anatomie «Der Spieler»; die Träumerei-Romanze «Helle Nächte»; die Moral-Posse «Eine dumme Geschichte»; die Kapitalismus-Groteske «Das Krokodil»; die Spuk-Komödie «Bobok»; die Dreiecks-Geschichte «Der ewige Gatte»; die Suizid-Aufarbeitung «Die Sanfte»; die fiebrige Science-Fiction-Erzählung «Traum eines lächerlichen Menschen».
Und erst die Charaktere!
Lauter unvergessliche Typen: wie der Weltverbesserungs-Raubmörder Raskolnikow, der Christus-Narr Myschkin, der Dunkel-Fürst Stawrogin, der Klugscheißer-Kosmopolit Wersilow, die heilige Hure Sonja, die verführerischen Diven Nastassja und Gruschenka; die Glaubenslehrer Makar und Sossima; und schließlich der ganze Karamasow-Clan, banal und grandios, mit Lustmolch Papa Fjodor und seinen Söhnen: Playboy Dimitri, Verstandesmensch Iwan, Hoffnungsträger Aljoscha und Bastard-Freak Smerdjakow.
Es ist eine Lust, Dostojewski zu lesen.
Aber Vorsicht!
Wer sich am Feierabend in eine stille Ecke zurückzieht, die Leselampe anknipst und mit Dostojewski chillen will, muss sich darauf gefasst machen, bald senkrecht im Zimmer zu stehen. Denn die Bücher rütteln auf, elektrisieren, schockieren. Krawumm statt Düdeldü. Keine Bässe dröhnen tiefer als die aus Dostojewskis Kellerloch, und nie zwitschern die Vögel heller als unter seinem Himmelsgewölbe. Er fährt uns in die Magengrube und füllt uns das Herz. Er entführt uns nicht in weit entfernte Welten, sondern tief ins eigene Ich. Er konfrontiert uns mit den großen Fragen auch unserer eigenen Zeit. Er ist auf verstörende Art hochaktuell.
Woran liegt das?
Dostojewski lebte zwar im vorvorigen Jahrhundert. Aber die damaligen Herausforderungen sind gar nicht so anders als die heutigen.
Die drei Mega-Trends waren Globalisierung, Individualisierung, Industrialisierung. Ersetzt man das letztgenannte Wort durch «Digitalisierung», sind das dieselben Veränderungs-Katalysatoren wie heute. Auch damals wurden Grenzen verschoben, Strukturen aufgebrochen, neue Potenziale und alte Ängste freigelegt. Die alten Eliten wurden abgelöst oder zumindest geschwächt. In den Familien verschoben sich die Kräfteverhältnisse langsam, aber sicher von den Alten zu den Jungen, von den Männern zu den Frauen.
Was zu Dostojewskis Zeiten aufkeimte, blüht längst oder welkt schon. Er sah viele Entwicklungen voraus, war besorgt um die Zukunft «unseres mächtigen, selbstgewissen und gleichzeitig kranken Jahrhunderts, das voll ist von noch ungeklärtesten Idealen und unstatthaftesten Wünschen» (Tagebuch eines Schriftstellers, Juni 1876).
Die Fragen, die damals in der Oberschicht aufblitzten, sind inzwischen auch auf die Basis heruntergerieselt: Ist da oben wer? Wenn nicht, und wenn doch – was folgt daraus? Wer ist der Mensch, und was ist seine Bestimmung, wenn es überhaupt einen höheren Sinn gibt?
Mit diesen Fragen ringt Dostojewski sein ganzes Leben lang. Er nennt sich ein «Kind des Zweifels» und liegt damit genau auf der Wellenlänge der meisten unserer Zeitgenossen.
Seine Antworten, die er unter anderem in Strafgefangenenlagern und in Klöstern fand, verpackt er nicht in subtilen Formulierungen, sondern proklamiert sie knallhart. Als chronischer Nonkonformist ist er alles, nur nicht politisch korrekt, und immer zwischen allen Stühlen. Den Rechten zu progressiv, den Linken zu konservativ. Er beginnt als revolutionärer Romantiker und endet als traditionsbewusster Realist. Mit seinem Roman «Die Dämonen» schafft er es, gleichzeitig die Aufklärungs-Apostel und die frommen Saubermänner zu verärgern. Weil einige Passagen obszön wirken, werden sie erst Jahrzehnte später veröffentlicht. Dostojewski ist ein Agent der Disruption, der heilsamen Unterbrechung.
Dabei äußerte sich Dostojewski nie von oben herab. Er war ein Mann der Basis, stellte das Bekenntnis zu den einfachen Menschen ins Zentrum seiner schriftstellerischen Arbeit. Seine größte Sympathie galt denen, die keine oder nur eine schwache Lobby hatten: Frauen, Kindern, auch Tieren.
Ihre Tiefe verdanken die Bücher von Dostojewski seinem ganzheitlichen Weltverständnis. Er betrachtete die Menschen nicht isoliert, sondern immer in ihren Beziehungsverhältnissen: horizontal und vertikal, zu den Mitmenschen und zu Gott. Liebe, Glaube und Hoffnung sind die Dimensionen seines Denkens. Deshalb greifen alle wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit ihm zu kurz, die seine Frömmigkeit als bloßen Spleen oder als leere Pose abtun.
Vor allem in seinen Essays und Briefen wiederholt er mit beinahe obsessiver Penetranz sein Credo: Wenn Christus nicht Gott ist und das Leben nicht in die Ewigkeit hinüberreicht, dann ist alles sinnlos.
Dieses Bekenntnis mit der Welt zu teilen ist sein wichtigstes Anliegen. Damals zogen die progressiven Bildungsbürger irritiert die Augenbrauen hoch. Heute ist vielen die religiöse Emphase des Dichters erst recht peinlich, sein Patriotismus ein absolutes No-Go. Er warnte vor den Folgen eines überzogenen Individualismus. Davor, dass die Volksgemeinschaft in lauter rivalisierende Mini-Identitäten zersplittern würde.
Seine Ausführungen bergen immer noch Zündstoff. Einem Shitstorm entgeht Dostojewski dadurch, dass er schon so lange tot ist. Das ist der Vorteil, wenn man ihn heute zu Wort kommen lässt. Too late to cancel.
Wenn man bei einigen seiner Zitate nicht weiß, dass sie von ihm kommen, denkt man unwillkürlich: «Der traut sich was.» Oder: «Endlich sagt’s mal einer.» Die Beschäftigung mit ihm ist relevanter und brisanter denn je.
Zugegeben: Nicht alles, was ihm aus der Feder fließt, ist unproblematisch oder gar sakrosankt. Mit einigen Polemiken schießt Dostojewski weit über das Ziel hinaus. Er wäre der Erste, der dafür bereitwillig Prügel einstecken würde. Wer nicht wagt, ergebnisoffen zu denken, Irrtumsmöglichkeit eingeschlossen, der gewinnt keine neuen Erkenntnisse.
Wenn es um die kleinen Leute und ihre Sorgen geht, zieht Dostojewski sich Samthandschuhe über; wenn er sich die elitären Bescheidwisser vornimmt, schwingt er die Abrissbirne. So oder so schreibt er gegen den Status quo.
Woher nimmt er die Chuzpe? Woher die Legitimation? Was hat er, was andere nicht haben?
Klug wird man bekanntlich aus Erfahrung. Und davon hatte Dostojewski mehr als Kant, Hegel und Nietzsche zusammengenommen. Das geht aus seiner eindrucksvollen Biographie hervor.
Wenn es stimmt, dass das Leben die besten Geschichten schreibt, dann hat es sich bei Dostojewski die allergrößte Mühe gegeben. Was er erlebt, ist noch faszinierender, als was er seinen Romanfiguren andichtet.
Aus seinen persönlichen Aufzeichnungen und den Berichten seiner Bekannten sind wir detailliert über seinen Werdegang informiert. Über ihn wurden mehr Biographien verfasst als über die allermeisten anderen Schriftsteller. Die längste ist fünf Bände dick. Im Vorwort erklärt der amerikanische Autor Joseph Frank, dass er sich vor allem auf das literarische Werk des Dichters konzentriert. Sonst wäre er im Ganzen womöglich bei vier- statt zweitausend Seiten gelandet. So viel ist über Dostojewski zu sagen.
Liest man diese oder andere Lebensschilderungen, sind heruntergeklappte Kinnläden vorprogrammiert.
Was für ein Leben!
Was für eine Quälerei!
Was für ein Happy End!
Wow!
Was Dostojewski in seinen 59 Jahren erlebte, reicht nicht nur für mehrere Folgen einer Fernsehserie, sondern für viele Staffeln. Aufgewachsen in einem Armenkrankenhaus, schaffte er es bis zum gern gesehenen Gast des Zarenpalastes. Zwischendurch irrlichterte er durch Knast und Salons, zwischen der kasachischen Steppe und dem Genfersee, ist umgeben von Serienkillern und Gottesmännern. Und nicht als neutraler Beobachter, sondern als Betroffener.
Über weite Strecken ist sein Lebenslauf ein Leidenslauf.
Er war noch keine 18 Jahre alt, da hatte er schon beide Eltern verloren. Mit 36 befand er sich in der Verbannung, hinter ihm lagen eine Scheinhinrichtung und vier Jahre in einem Straflager. Im Alter von 46 hat er bereits seinen geliebten Bruder, seine erste Frau und eine Tochter begraben.
Auch von seinen Romanzen endeten die meisten unglücklich – bis das Glück in Gestalt einer jungen Stenographin an die Tür seiner schäbigen Mietswohnung klopfte.
Kein anderer der großen russischen Schriftsteller seiner Zeit musste so hart für sein tägliches Brot arbeiten, keiner erlebte so viele Abstürze und feierte so umjubelte Comebacks. Das Schreiben war für Dostojewski überlebenswichtig – um nicht zu verhungern und um nicht durchzudrehen. Wie alle anderen hochbegabten Schreibkünstler war er ein schwieriger Patient, launisch, hypersensibel, aber in puncto Menschenfreundlichkeit dann doch eine Ausnahmeerscheinung. Von vielen Geistesgrößen seiner Zeit kann man das nicht behaupten.
Dabei verfolgte er eine Mission, die er bereits als 17-Jähriger formulierte:
«Der Mensch ist ein Geheimnis. Man muss es enträtseln.»
Was bei der Rätsel-Lösung herausgekommen ist, verrät dieses Buch.
Es ist keine gewöhnliche Biographie, denn erstens gibt es davon schon genug und zweitens über Dostojewskis Leben seit Jahren keine wirklich neuen Erkenntnisse mehr. Die Archive sind leergesucht, jeder Notizfetzen ausgewertet. Was noch fehlt, ist eine Gesamtschau der Weisheiten, die Dostojewski uns mitzuteilen hat. Dieses Buch ist deshalb keine klassische Lebensgeschichte, eher eine Lebensschule, besser noch: eine Weisheitsschule.
Die 20 Kapitel folgen zwar einer chronologischen Ordnung, beginnen mit Dostojewskis Geburt und enden mit seinem Tod. Sie sind dabei aber primär an seinem Projekt «Mensch-Enträtselung» orientiert. Und so, wie uns der junge Sträfling Dostojewski auch noch in den letzten Romanen begegnet, hat der alte Dostojewski bei uns auch schon ganz vorn einige Auftritte. Es geht vor und zurück in seinem Leben, hin und her zwischen seinen privaten Notizen und seinen veröffentlichten Werken, dazu kommt das, was seine Zeitgenossen über ihn sagten.
Die stärkste Wirkung ist immer die unmittelbare. Aus diesem Grund kommt Dostojewski wo immer möglich im O-Ton zu Wort. Die Bühne gehört ihm. Collagenhaft haben wir zusammengestellt und kommentiert, was wir für die Erkenntnis-Essenz seines Schaffens und Lebens halten. Dass wir Dostojewski direkt zu uns reden lassen, passt auch zu seinem eigenen Stil. In seinen Romanen wird ausgiebig palavert. Dostojewski war überzeugt davon, dass Menschen sich der Wahrheit am besten im Dialog annähern. Leben ist schließlich Beziehungssache.
Und so ist auch dieses Buch im Gespräch entstanden, als Kollaboration von zwei sehr guten Freunden. Wir teilen unter anderem Dostojewskis christliches Bekenntnis, sind aber in anderen Bereichen so gegensätzlich wie manche Charakter-Paare in seinen Romanen: der eine, Markus, ein Geisteswissenschaftler aus Leipzig, der gerne joggt und Lounge-Pop hört; der andere, David, ein Sportwissenschaftler aus Köln, der Kampfsport und knochenharten Metal bevorzugt. Bei Dostojewski, der sowohl zart als auch hart kann, sind wir ein Herz und eine Seele.
Wir laden alle Leserinnen und Leser ein, sich ebenfalls von ihm rocken zu lassen.
Und damit genug des Warm-ups.
Vorhang auf für Fjodor Michailowitsch Dostojewski.
Kapitel 1:
Sohn
Dostojewski steht permanent unter Hochspannung. In seinen Büchern und im Leben. Mal kommt der Druck von außen, von den Umständen; mal wird er im Inneren erzeugt, durch Träume und Triebe. Und dann sind da noch die frühen Prägungen und späteren Erfahrungen, die ihn quälen, reizen, stimulieren.
Was für Dostojewski gilt, das gilt für alle Menschen. Wer sie begreifen will, muss auch die Herkunft und Kindheit ins Blickfeld nehmen. Dort wird die Saat gesät, die jeweils ihre ganz eigenen Früchte trägt. Im Fall von Dostojewski mischt sich unter die gute Saat jede Menge Unkraut. Beides geht gemeinsam auf und verwächst sich zu einer Person mit einem atemberaubenden Facettenreichtum. Deshalb ist sein Werk auch so vielschichtig, die darin enthaltene Weltsicht so komplex.
Alles beginnt am 11. November 1821, nach damaliger russischer Kalenderrechnung am 30. Oktober.1 Der Ort, an dem er geboren wird, passt zum Titel seines ersten Romans, «Arme Leute».
Dostojewski kommt unter den Ärmsten der Armen zur Welt, genauer: den Krankesten der Armen. Im Moskauer Armen-Krankenhaus, etwas außerhalb des Stadtzentrums gelegen. Zum Kreml sind es drei Kilometer. Heute liegt das Dostojewski-Domizil an einer Hauptverkehrsstraße und nahe einer U-Bahn-Station, die nach dem Dichter benannt ist. Von einem solchen Prestige ist die Familie damals weit entfernt. Vater Michail arbeitet als Arzt. Die Dienstwohnung befindet sich in einem Nebentrakt des Krankenhauses. Hier wächst der kleine Fjodor auf, in alltäglicher Nachbarschaft zu Leid, Siechtum, Tod.
Die Eltern wollen verhindern, dass aus der Nachbarschaft Freundschaft wird. Sie wollen ihre Kinder nicht dem rauen Ton und den schlechten Manieren der Patienten aussetzen. Gegen ihr strenges Verbot sucht Fjodor dennoch die Nähe dieser «Erniedrigten und Beleidigten», wie sein zweiter Roman heißt. Er schleicht sich durch den Privatgarten der Eltern hin zum Gitter des angrenzenden Krankenhausgartens.
«Fjodor liebte es sehr, mit diesen Kranken heimlich, das heißt, wenn es sich irgendwie unbemerkt machen ließ, Gespräche anzuknüpfen, besonders, wenn Knaben unter ihnen waren; das aber war uns ein für alle Mal streng verboten, und der Vater war äußerst ungehalten, wenn ihm etwas von einem derartigen Ungehorsam zu Ohren kam.» (Andrej Dostojewski)2
Später nutzt er die Erfahrungen für seine ersten schriftstellerischen Arbeiten. Die Helden seiner frühen Werke bewohnen etwa einen abgetrennten Bereich der Küche einer Wirtschaft mit «fauligem, scharf süßlichem Geruch» (Arme Leute), den «dunkelsten und bescheidensten Winkel» (Herr Prochartschin), ein Zimmerchen mit «schmutzig grünen, verräucherten, staubigen Wänden» (Der Doppelgänger), eine «hässliche und feuchte Wohnung» (Erniedrigte und Beleidigte).
«Ich hatte die Beobachtung gemacht, dass in einem engen Zimmer sich sogar die Gedanken beengt fühlen.» (Erniedrigte und Beleidigte)
Damit könnte er sein eigenes Zuhause beschrieben haben. Sein Kinderzimmer, einen kleinen und fensterlosen Raum, teilt er sich mit seinem älteren Bruder Michail. Mit diesem wächst er in einer Großfamilie auf. Je drei Brüder und drei Schwestern hat er, dabei ein besonders enges Verhältnis zu Michail und den beiden Nächstgeborenen, der Schwester Warwara und dem Bruder Andrej.
Ab dem 18. Lebensjahr muss sich Dostojewski als Vollwaise durchs Leben schlagen, als orientierungsloser «Jüngling», so der Titel seines vorletzten Romans.
In vielen Dostojewski-Büchern geht es um Familien, meistens kaputte, zusammengewürfelte oder auseinandergerissene. Rein äußerlich gesehen ist seine eigene Familie intakt und sogar vorbildlich.
Aber der heile Schein trügt.
Immerhin: Dostojewski erfährt, was viele seiner Roman-Charaktere schmerzlich vermissen – Nestwärme. Der Familienalltag ist außerdem von Frömmigkeit geprägt. Dostojewski selbst wird später behaupten, er sei in einer Musterfamilie aufgewachsen; nur seine fiktionalen Bücher lassen eine andere Sicht der Vergangenheit durchschimmern. Mit Anfang fünfzig schreibt er:
«Soweit ich nur zurückdenken kann, erinnere ich mich der Liebe meiner Eltern zu mir. In unseren Familien waren wir mit dem Evangelium beinahe seit der frühesten Kindheit vertraut. Ein jeder Besuch des Kremls und der Moskauer Kathedralen war für mich stets ein feierliches Ereignis. Die anderen hatten vielleicht keine solchen Erinnerungen wie ich. Ich denke oft darüber nach und frage mich: Was für Eindrücke nimmt wohl der größte Teil unserer jetzigen Jugend aus der Kindheit ins Leben mit?» (Tagebuch eines Schriftstellers, 1873)
Unter den berühmten Schriftstellern seiner Zeit ist Dostojewski mit seiner christlichen Erziehung die Ausnahme. Weder Tolstoi noch Turgenjew, Balzac, Flaubert, Dickens oder Thackeray hatten besonders geistlich ausgerichtete Eltern.
Gleichzeitig gilt: Viele der bedeutendsten christlichen Denker – unter anderem Augustinus, Pascal, Kierkegaard – sogen den Glauben buchstäblich mit der Muttermilch auf. Ihre Mütter – im Fall von Pascal und Kierkegaard auch die Väter – waren überzeugte Christen. Für sie alle war, wie für Dostojewski, der Glaube nichts Angelesenes und Angelerntes, sondern eine Wirklichkeit, in die sie hineinwuchsen.
«Unsere Eltern waren beide sehr religiös, besonders die Mutter. An jedem Sonn- und Feiertage mussten wir pflichtgetreu zum Frühgottesdienste gehen und am Abend vorher zur Abendmesse.» (Andrej Dostojewski)
Nicht nur die religiöse Unterweisung, sondern die gesamte schulische Erziehung findet bis zu seinem elften Lebensjahr zu Hause statt. Dostojewski ist das Produkt einer «Home Schooling»-Ausbildung. Vor allem seiner Mutter gelingt es, das kreative Talent ihres hochbegabten Sohns zu fördern. Rückblickend sieht Dostojewski sich hier im Vorteil gegenüber Kindern, deren Potenzial durch rigiden Frontalunterricht zerstört wird.
«Die Phantasie ist eine dem Menschen angeborene Fähigkeit; sie überwiegt bei einem Kinde alle anderen Fähigkeiten und muss unbedingt genährt werden. Wenn man der Phantasie eines Kindes keine Nahrung gibt, kann sie leicht absterben, oder auch im Gegenteil – sich aus eigener Kraft übermäßig entwickeln, was ebenfalls schädlich ist.» (Brief an Nikolai Osmidow, 18.8.1880)3
Der ansonsten knickerige Vater geizt nicht, wenn es um die Anschaffung von Literatur geht. Die Dostojewskis abonnieren ein monatliches Magazin, in dem einige der besten Romane der damaligen Zeit als Fortsetzungsgeschichte erscheinen. Im Hause Dostojewski gibt es außerdem regelmäßige Lektüreabende. Die Eltern lesen abwechselnd vor, später dürfen auch Michail und Fjodor die Werke großer Autoren rezitieren.
«Diese Lektüre hat zwar meine Phantasie und Empfindlichkeit außerordentlich angeregt, sie aber auf gute und nicht auf schlechte Bahnen gelenkt; ich habe aus dieser Lektüre viele schöne und erhabene Eindrücke geschöpft, die meiner Seele eine große Widerstandskraft gegen andere verführerische, leidenschaftliche und verderbliche Eindrücke verliehen haben.» (Brief an Nikolai Osmidow, 18.8.1880)
«Der Mensch darf nicht ohne Keime des Positiven und Schönen aus der Kindheit ins Leben treten. Ohne Keime des Positiven und Schönen darf man keine Generation ins Leben ziehen lassen.» (Tagebuch eines Schriftstellers, Juli/August 1877)
Als Kind spielt Dostojewski mit Freunden aus der Nachbarschaft «Cowboy und Indianer».
«Natürlich war Fjodor, als der Erfinder dieses Spieles, auch der Häuptling und Anführer des wilden Stammes. Michail dagegen beteiligte sich nur selten unmittelbar. Es passte nicht zu seinem Charakter. […] Ein anderes Spiel, das nur wir zwei spielten, war ‹Robinson und Freitag›, bei dem ich den Freitag spielen musste, da Fjodor selbstredend Robinson war.» (Andrej Dostojewski)
Ihn faszinieren Reiseberichte über ferne Länder, aber auch Geschichtsbücher, außerdem die Dramen von Friedrich Schiller.
«In meiner unendlichen Phantasie sah ich mich bald als Perikles, bald als Marius, dann als einen Christen unter Kaiser Nero, als Teilnehmer an einem Ritterturnier.» (Petersburger Träume)
«Mit zehn Jahren sah ich zu Moskau eine Aufführung der ‹Räuber› […], und ich kann nur sagen, dass der starke Eindruck, den diese Aufführung auf mich gemacht hatte, auf meine ganze weitere geistige Entwicklung überaus befruchtend gewirkt hat.» (Brief an Nikolai Osmidow, 18.8.1880)
Dostojewskis Verhältnis zu seinen Eltern ist ambivalent. Die Mutter liebt er zärtlich, seinen Vater respektiert und fürchtet er.
Das Psychoanalyse-Urgestein Sigmund Freud, 35 Jahre jünger als Dostojewski, attestierte ihm einen ausgeprägten «Ödipus-Komplex». Der Befund ist überzogen, aber nicht aus der Luft gegriffen. Dostojewskis Vater ist eine schwierige Persönlichkeit, und der kleine Fjodor empfindet ihm gegenüber mehr Angst als Zuneigung. Zu körperlichen Misshandlungen, die in vielen Elternhäusern die Regel waren, kommt es allerdings nicht.
«Hier muss ich aber bemerken, dass unsere Eltern, ungeachtet der Heftigkeit des Vaters, uns Kinder sehr ‹human› behandelten; nie sind wir körperlich bestraft worden, und ich kann mich auch nicht erinnern, dass einer von den älteren Brüdern einmal auf die Knie befohlen oder in den Winkel gestellt worden wäre. Die größte Strafe bedeutete für uns eben dieses Aufbrausen des Vaters. So war es auch in den Lateinstunden: Bei dem geringsten Fehler der Brüder ärgerte er sich, nannte sie Faulpelze, Dummköpfe, und im äußersten Falle warf er sogar das Buch hin, ohne die Stunde zu beenden, und das war für uns immer die schlimmste Strafe.» (Andrej Dostojewski)
Mordgelüste gegenüber seinem Vater hegt der junge Dostojewski sicherlich keine. Aber es ist nicht von ungefähr, dass sein letzter Roman «Die Brüder Karamasow» von einem Vatermord handelt. Auch sonst kommen Väter bei Dostojewski überwiegend in den Varianten «abwesend», «unfähig», «böse» und «tot» vor. Mütter werden von ihm in der Regel sehr viel positiver dargestellt.
Vermutlich dachte er auch an seine Mutter, als er ein paar Jahre vor seinem Tod die Novelle «Die Sanfte» verfasste. Darin geht eine junge Frau an der Lieblosigkeit und Selbstbezogenheit ihres zwanghaften Gatten zugrunde. Nachdem sie sich in ihrer Verzweiflung aus dem Fenster in den Tod gestürzt hat, erkennt der Ehemann sein Versagen. Er erinnert sich:
«Sooft ich abends ins Haus kam, empfing sie mich ganz begeistert, erzählte mir mit ihrer kindlichen Stimme […] von ihrer Kindheit und Jugend, von ihrem Elternhause, von Vater und Mutter. Ich dämpfte aber ihre Ekstase sofort mit einem kalten Wasserstrahl. Darin bestand eben mein ganzer Plan. Ihr Entzücken beantwortete ich mit Schweigen, mit einem zwar wohlwollenden Schweigen, aus dem sie aber leicht hätte schließen können, dass ich ein ganz anderer Mensch als sie und eigentlich ein Rätsel sei.» (Die Sanfte)
Ganz deckungsgleich mit der Beziehung von Maria und Michail Dostojewski ist diese Passage freilich nicht. Die Eheleute lieben einander tatsächlich, zeigen sich das auch. Aber dennoch: Ihre Beziehung ist kompliziert. Sehr sogar. Und die emotionalen Qualen der Mutter bleiben den Kindern nicht verborgen.
«Es war in diesen Kindheitsjahren, als etwas Düsteres und Schweres von Fjodor Michailowitsch Besitz ergriff.» (Stepan Janowski, in einem Brief an Anna Dostojewski, 1884)4
Maria ist etwa zehn Jahre jünger als ihr Mann und gerade mal 20, als sie Fjodor zur Welt bringt. Dem Wesen nach eine Frohnatur, leidet sie sehr unter der depressiven Veranlagung ihres Ehemanns. Was alles noch schlimmer macht, ist dessen krankhafte Eifersucht und Knauserigkeit. Immer wieder wirft er seiner an sich sparsamen Frau Verschwendungssucht vor.
Eine schriftliche Korrespondenz zwischen den beiden aus dem Jahr 1835, zwei Jahre vor ihrem Tod, dokumentiert auf erschütternde Weise den ehelichen Nervenkrieg. Michail ist verreist. Sich und seinen dunklen Gedanken überlassen, malträtiert er seine Frau mit seinen Leidens-Briefen. Der Briefwechsel, hier in Auszügen wiedergegeben, könnte aus einem der Romane ihres Sohnes stammen:5
Michail: «Ich bin über alle Maßen traurig.»
Maria: «Warum ängstigst du dich?»
Michail: «Meine Angst bringt mich um!»
Maria: «Denk doch an meine Liebe und die deiner Kinder!»
Michail: «Warum sind deine Briefe an mich so kalt?» (Subtext: Was läuft da mit anderen Männern?)
Maria: «Deine Briefe machen mich fertig. Du folterst dich selbst mit Verdächtigungen, die uns beide ruinieren.»
Michail: «In dieser Woche war ich wieder traurig und wusste nicht ein und aus.»
Maria: «Die Jahre vergehen, das Gesicht wird runzlig, und innere Freude verwandelt sich in schwere Trübsinnigkeit. Das ist wohl mein Schicksal, mein Lohn dafür, dass ich dich ausdauernd, leidenschaftlich geliebt habe. Ich muss mich wohl daran gewöhnen.»
Manchmal hören die Kinder die Mutter hysterisch schluchzen, weil sie die Vorwürfe ihres Gatten nicht mehr ertragen kann. Kurz nach der Geburt ihres letzten Kindes erkrankt sie an Tuberkulose. Die Mitt-Dreißigerin stirbt 1837. In ihren letzten Stunden versammelt sich die ganze Familie um ihr Bett.
«Sie bat um die Jesus-Ikone, segnete dann zuerst alle ihre Kinder und fügte kaum hörbare Segenswünsche und Ermahnungen hinzu. Dann tat sie das Gleiche mit Vater. Die Szene war herzzerreißend, und wir schluchzten alle. Bald darauf verlor sie das Bewusstsein.» (Andrej Dostojewski)
Womöglich macht Dostojewski sich später Vorwürfe dafür, dass er als Kind die Nöte seiner Mutter nicht ausreichend wahrgenommen hat. In einem unvollständig gebliebenen Roman, 13 Jahre nach dem Tod der Mutter verfasst, lässt er einen Teenager sagen:
«Jetzt erst begreife ich die ganze Qual ihres Lebens und kann nicht ohne stechenden Schmerz im Herzen an ihr Martyrium denken.» (Njetotschka Neswanowa)
Noch schwerer nimmt der Vater den Verlust. Zu den wenigen Details, die Dostojewski seiner zweiten Frau Anna aus seiner Jugend erzählt, gehören die folgenden Sätze über die beinahe selbstmörderische Trauer seines Vaters.
«Er stöhnte und ächzte, lief in seinem Zimmer auf und ab und rammte seinen Kopf immer wieder gegen die Wand.» (Anna Dostojewski)6
Teilweise auf eigenen Erfahrungen beruht der folgende Absatz aus einem Essay, das Dostojewski als 55-Jähriger verfasst. Darin betonte er die Bedeutung intakter Familienverhältnisse für das Kindeswohl und geht speziell auf die wichtige Rolle der Väter ein:
«Die Not und die Sorgen der Väter hinterlassen in ihren Herzen von Kind auf die düstersten Bilder, die giftigsten Erinnerungen. Die Kinder erinnern sich bis ins späte Alter an den Kleinmut der Väter, an die Streitigkeiten in den Familien, an Zank, an die gegen sie als ‹überflüssige› Münder gerichteten Anklagen, bitteren Vorwürfe und sogar Flüche; und was das Schlimmste ist, sie erinnern sich zuweilen der Gemeinheit der Väter, ihrer niedrigen Handlungen, um eine Stelle oder Geld zu erlangen, ihrer hässlichen Intrigen und ihres abscheulichen Sklavensinns.» (Tagebuch eines Schriftstellers, Juli/August 1877)
Der obrigkeitshörige «Sklavensinn», den Dostojewski bei manchen Vätern kritisiert, ist bei seinem Vater ganz und gar nicht vorhanden. Von ihm erbt er ganz im Gegenteil ein ausgeprägtes Autonomiestreben. Der Freiheitsdrang des alten Dostojewski zeigt sich darin, dass er eine jahrhundertealte Familientradition aufkündigt. Seine männlichen Vorfahren waren Priester, und auch für ihn ist die klerikale Laufbahn vorherbestimmt. Aber Michail Dostojewski begehrt auf. Er verlässt das Priesterseminar, bricht die Brücken zur Familie ab, wird Arzt. Seinem Glauben bleibt er dennoch treu. In den Briefen, die von ihm erhalten sind, wimmelt es von entsprechenden Zeugnissen.
Wenn Michail Dostojewski von seiner beruflichen Neuorientierung einen freudvolleren Berufsalltag als den eines Dorfpriesters erwartet hat, wird er grausam enttäuscht. Die Endphase seines Studiums fällt mit Krieg und Massensterben zusammen. Statt sich in einer ruhigen Privatpraxis um die Wehwehchen reicher Adliger zu kümmern, sägt Michail in Feldlazaretten schreienden Schwerstverletzten faulige Gliedmaßen ab. Er ist bei der berühmt-blutigen Schlacht von Borodino dabei, auch bei der Evakuierung Moskaus. Er erlebt hautnah, wovon später der Schriftsteller Leo Tolstoi aus der Distanz in «Krieg und Frieden» schreibt. Manche Versehrte kann Michail Dostojewski retten, viele sterben ihm unter den Händen weg. Das traumatisiert ihn, macht ihn hart, verstärkt den Hang zur Schwermut.
Als er seine Frau heiratet und mit ihr eine Familie gründet, ist er bereits seelisch fertig. Daran ändert sich auch nicht viel, als er mit vierzig Jahren endlich befördert wird, mehr Geld, einen Adelstitel und ein Landgut inklusive rund hundert Leibeigener bekommt.
Auch das gehört zur Vergangenheit von Dostojewski. Sein Vater ist ein Sklavenbesitzer und wird – dazu gleich mehr – womöglich von seinen eigenen Sklaven ermordet. Auch deshalb wird Fjodor als Student zum erbitterten Gegner der Leibeigenschaft – und bleibt es bis zu deren Abschaffung 1861.
Nach dem Tod seiner Frau geht es mit Vater Michail endgültig bergab. Er versucht seine Depressionen im Alkohol zu ertränken. Mit der Trauer und dem Griff zur Flasche kommt die Bosheit. Während Sohn Fjodor aus gesundheitlichen Gründen später nur kleine Mengen von Alkohol vertragen wird, kann er an seinem Vater die tragischen Folgen der Sucht beobachten. Entsprechend häufig kommen Alkoholkranke in seinem Œuvre vor:
«Je mehr ich trinke, desto mehr gräme ich mich. Darum eben trinke ich, weil ich aus diesem Getränk die Empfindungen des Mitleids und des Grams schöpfe. Ich trinke, weil ich doppelt leiden will.» (Schuld und Sühne)
«Wie alle immer bezechten Leute war [er] sehr empfindsam, und wie alle zu tief gesunkenen Trinker ertrug er Erinnerungen an eine glückliche Vergangenheit schwer.» (Der Idiot)
Sind die väterlichen Schnaps-Exzesse, sein Selbstmitleid und seine Wuttiraden für die Kinder schon schwer verdaulich, sind seine Sex-Eskapaden noch verstörender. Michail ist kaum Witwer geworden, da macht er die jugendliche Haushälterin zu seiner Mätresse, schwängert sie sogar. Das gemeinsame Kind lebt allerdings nicht lange.
Gemunkelt wird auch, dass er ein anderes minderjähriges Mädchen aus der Nachbarschaft vergewaltigt hat. In beiden Fällen handelt es sich um Nichten bzw. Töchter von Leibeigenen. Heutzutage würde er aufgrund des schweren sexuellen Missbrauchs von Abhängigen zu einer hohen Haftstrafe verurteilt, damals ist sein Verhalten trauriger Standard unter Gutsbesitzern. Allerdings nicht für idealistische, sensible Gemüter wie Sohn Fjodor.
Der zweitälteste Dostojewski-Spross lebt zu dieser Zeit bereits im weit entfernten Petersburg. Der moralische Absturz seines Vaters bleibt Fjodor nicht verborgen, wenngleich er das ganze Ausmaß der Schlechtigkeit wohl höchstens erahnt. Seinem älteren Bruder schreibt er:
«Der arme Vater tut mir leid! Er hat einen so merkwürdigen Charakter! Wie viel Kummer hat er schon erlebt! Es ist so bitter, dass man ihn mit nichts trösten kann! Weißt Du übrigens: Papa steht der Welt ganz fremd gegenüber. […] Die Welt hat ihn enttäuscht, und ich glaube, dass das unser aller Schicksal ist.» (Brief an Bruder Michail, 31.10.1838)
Den brieflichen Austausch zwischen Vater und Sohn dominiert dagegen ein Thema, das auch Dostojewskis sonstigen Postverkehr leitmotivisch durchzieht:
Geld. Oder vielmehr: der Mangel daran.
Dostojewski wird ein Leben lang von finanziellen Sorgen geplagt sein. Das liegt nicht zuletzt daran, dass er schlichtweg nicht mit Geld umgehen kann. Die Ursachen dieses Unvermögens lassen sich bis in die Kindheit zurückverfolgen.
«Ich erinnere mich nicht, dass meine Brüder auch nur etwas Kleingeld zu ihrer Verfügung gehabt hätten; wahrscheinlich lernten sie erst in Petersburg den Wert des Geldes kennen, als der Vater sie dort allein zurückließ. Ich habe bereits erwähnt, dass der Vater es nicht liebte, uns Moral zu predigen, aber wie mir jetzt scheint, hatte er in der Beziehung doch eine kleine Schwäche: Er wiederholte nämlich ziemlich oft, dass er arm sei, dass seine Kinder, besonders die Söhne, sich darauf vorbereiten müssten, sich selbst ihren Weg zu bahnen, dass sie nach seinem Tode mittellos dastehen würden, und dergleichen mehr.» (Andrej Dostojewski)
In seinen Briefen aus Petersburg appelliert Dostojewski immer wieder an den Vater, ihn ähnlich finanziell auszustatten wie die anderen Eltern ihre Söhne. Im Frühjahr 1839 schreibt der 17-Jährige: «Ich muss mich, ob ich will oder nicht, nach den Gepflogenheiten meiner jetzigen Umgebung richten. […] Warum soll ich ein Außenseiter sein? So etwas ist oft von den größten Unannehmlichkeiten begleitet.»
Der Vater erhört den Bettelbrief und schickt dem Sohn das gewünschte Geld. In dem Begleitschreiben macht er Fjodor aber, wie früher seiner Frau, schwere Vorwürfe. Sinngemäß schreibt er ihm: Mit deiner Prasserei und Statussucht bringst du mich noch ins Grab.
Zehn Tage später, am 6. Juni 1839, ist er tatsächlich tot.
Die offizielle Diagnose lautet: Schlaganfall. Aber in der Nachbarschaft tuschelt man, einige seiner Leibeigenen hätten ihn totgeschlagen. Als Rache dafür, dass er sie ausbeutete, sie schlug und sich an ihren Mädchen verging. Zu einer Anklage kommt es nie, entweder aus Mangel an Beweisen oder weil man an einer Aufklärung des Falls nicht interessiert ist.
Ob Fjodor Dostojewski an einen natürlichen Tod seines Vaters oder einen Mord glaubt, ist bis heute unklar. Öffentlich äußerte er sich nicht dazu. Sein Freund und Arzt Stepan Janowski erinnert sich daran, dass Dostojewski äußerst ungern über seinen Vater und seine Mutter redete, weil die Erinnerung an beide zu schmerzlich war.
In Dostojewskis familiärem Umfeld geht man, wie aus den Memoiren seines Bruders Andrej und seiner Tochter Ljuba hervorgeht, von einem Mord am Vater aus.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass sich Dostojewskis letzter Roman um die Ermordung eines lüsternen Vaters dreht. Der Täter ist sein unehelicher, als Folge einer Vergewaltigung geborener Sohn, der bei ihm als Diener angestellt ist.
Ganz nebenbei: Der Name der Sippe, «Karamasow», hat Ähnlichkeit mit «Karl Moor», dem Helden des bereits erwähnten Lieblingsdramas des jungen Dostojewski, Schillers «Die Räuber». Darin geht es um den Konflikt eines freiheitsliebenden Sohnes mit seinem bornierten Vater.
In persönlichen Gesprächen lässt Dostojewski zeitlebens dennoch nichts auf seinen Vater kommen. Er weiß, was er ihm verdankt: nicht nur die behütete Kindheit, sondern auch das Fundament seiner Schriftsteller-Karriere. Der Vater hat die Ausbildung seiner Söhne zur Chefsache gemacht, Bücher angeschafft, Tutoren engagiert, die Zulassung zur Top-Universität des Landes organisiert. Weil Michail und Fjodor bei ihrem französischen Privatlehrer kein Latein lernen, bringt der Vater es ihnen persönlich bei. Er will seinem Nachwuchs den Weg zu einer lukrativen Laufbahn ebnen. Andere Söhne wären an dem Leistungsdruck womöglich zerbrochen. Für Fjodor, den «High Potential»-Schüler, erweist sich der väterliche Drill langfristig als vorteilhaft.
Die Schwächen des Vaters rufen deshalb nicht seine Empörung, sondern sein Mitleid hervor. Sein Bruder Andrej erinnert sich an eine Unterhaltung. Fjodor ist damals schon weit über fünfzig.
«Ich kam auf unsere Kindheit zu sprechen und erwähnte den Vater. Da ergriff mein Bruder plötzlich lebhaft meinen Arm oberhalb des Ellenbogens – das war so seine Angewohnheit, wenn er beim Sprechen seine Seele zu öffnen begann – und sagte mit Inbrunst: ‹Ja, weißt du auch, Bruder: Das waren doch die vorbildlichsten Menschen, die Fortgeschrittensten! […] Und solche Mustereltern, solche Väter könnten wir, Bruder, nie sein!›» (Andrej Dostojewski)
Bei allen negativen Charakterzügen ist Dostojewskis Vater auch engagiert und idealistisch. In dieser Hinsicht schneidet Michail Dostojewski durchaus positiv ab, wenn sein Sohn ihn vier Jahrzehnte später mit den Vätern der nachfolgenden Generation vergleicht.
«Die heutigen Väter haben […] nichts Gemeinsames, nichts Verbindendes. In ihren Herzen fehlt eine große Idee, es fehlt der große Glaube an eine solche Idee. Aber nur ein solch großer Glaube ist imstande, in den Erinnerungen der Kinder etwas Schönes zu erzeugen, selbst trotz der grausamsten Umstände ihrer Kinderjahre, trotz der Armut und trotz des moralischen Schmutzes, der sie schon in der Wiege umgeben hat.» (Tagebuch eines Schriftstellers, Juli/August 1877)
Allen autobiographischen, journalistischen und belletristischen Texten von Dostojewski ist die Überzeugung gemeinsam: Väter sind wichtig. Schwierige Väter sind besser als gar keine. Starke Väter immunisieren gegen die Schmerzen, die das Leben mit sich bringt.
Die Streitereien der Eltern und deren früher Tod sind nicht die einzigen traumatischen Erfahrungen für den jungen Dostojewski. Eine neunjährige Spielkameradin, die Tochter eines Krankenhausangestellten, wird vor seinen Augen von einem Säufer vergewaltigt. Dostojewskis Vater versucht vergeblich, das Mädchen zu retten. Die Kleine stirbt.
Dieser Vorfall und auch die Affären seines Vaters erklären, warum das Thema sexueller Missbrauch für Dostojewski geradezu zu einer fixen Idee wird. Viele Zeitgenossen wundern sich, warum in so vielen seiner Werke heranwachsende Mädchen vergewaltigt werden. Die Antwort auf die Frage findet sich in Dostojewskis eigener Kindheit und Jugend. Kein anderer Schriftsteller seiner Zeit, Charles Dickens ausgenommen, rückte die Verletzlichkeit von Kindern und Jugendlichen derart in den Mittelpunkt des eigenen Schaffens.
Es ist bezeichnend, dass Dostojewski seinen eigenen schriftstellerischen Werdegang nicht als Flucht vor den Gespenstern seiner Kindheit interpretierte, sondern als Frucht der guten Saat, die in seinen ersten Jahren von zwar fehlerhaften, aber gutwilligen Eltern gesät worden war.
«Es gibt nichts, was höher, stärker, gesünder und für das bevorstehende Leben nützlicher wäre als eine gute Erinnerung, und besonders eine, die noch aus der Kindheit, aus dem Elternhaus herrührt. Man erzählt Ihnen viel von Ihrer Erziehung, aber eine schöne, heilige Erinnerung, die man sich aus der Kindheit bewahrt hat, ist vielleicht die allerbeste Erziehung. Wer viele solche Erinnerungen mit ins Leben nimmt, ist fürs ganze Leben gerettet. Und selbst wenn sich nur eine einzige gute Erinnerung in unserem Herzen erhält, so kann auch die uns einmal zur Rettung dienen.» (Die Brüder Karamasow)
Die «heiligen Erinnerungen» beziehen sich nicht zuletzt auf die frühen Begegnungen mit der Heiligen Schrift. Die Mutter liest den Kindern aus einer «Kinderbibel» vor, die aus dem Deutschen übersetzt worden war.
«Dieses Buch war mit einigen schlechten Steindrucken versehen, die die Erschaffung der Welt, Adam und Eva im Paradiese, die Sintflut und andere biblische Geschehnisse darstellten. Als ich vor nicht langer Zeit, Ende der siebziger Jahre, mit meinem Bruder Fjodor auf unsere Kindheit zu sprechen kam und u. a. auch dieses Buch erwähnte, erzählte er mir geradezu begeistert, dass es ihm gelungen sei, dieses alte Buch, aus dem wir gelernt hatten, wiederzufinden, und dass er es nun wie ein Heiligtum aufbewahre.» (Andrej Dostojewski)
Es ist ausgerechnet eines der rätselhaftesten Bücher der Bibel, «Hiob», das einen besonders starken Eindruck auf den jungen Dostojewski ausübt.
«Dieses Buch […] war eines der ersten im Leben, das mich tief beeindruckt hat, ich war damals fast noch ein kleines Kind!» (Brief an seine Frau Anna, 22.6.1875)
Vielleicht ahnt Dostojewski, dass auch sein Glaube durch viele leidvolle Erfahrungen getestet und letztendlich gestärkt werden wird. Möglicherweise wirkt in dieser Begeisterung auch die Erinnerung an eine Brandkatastrophe mit. Das Landgut der Familie fängt Feuer und wird völlig zerstört. Dostojewskis Tochter Ljuba berichtet davon in ihren Erinnerungen:7
«Im ersten Augenblick glaubten meine Großeltern, sie wären vollkommen ruiniert; aber anstatt zu jammern, warfen sie sich vor den Heiligenbildern zu Boden und baten Gott, ihnen die Kraft zu geben, um die von ihm geschickte Prüfung würdig zu tragen. […] Wie oft hat wohl mein Vater sich dieser Szene erinnert in seinem so unruhigen und so unglücklichen Leben.» (Ljuba Dostojewski)
Die geistliche Erziehung hinterlässt ihre Spuren. Als Student bekommt Dostojewski von den Kommilitonen den Spitznamen «der Mönch». Er sticht hervor durch seine emsige Bibellektüre, das Studium christlicher Schriften und den regelmäßigen Kirchenbesuch. Nach dem Gottesdienst verstrickt er die Priester in theologische Debatten.
Am meisten hingezogen fühlt Dostojewski sich allerdings nicht zu klerikalen Würdenträgern. Ihn berührt die Frömmigkeit der kleinen Leute. Deren authentische Gottergebenheit unterscheidet sich vom religiösen Schaulaufen der Wohlhabenden und Angesehenen.
«Ich erinnerte mich, wie ich als Kind in der Kirche zuweilen das einfache Volk betrachtete, das sich an der Tür drängte und jedem Träger von dicken Epauletten, jedem dicken Herrn und jeder reichgeputzten, aber außerordentlich frommen Dame, die unbedingt zu den vordersten Plätzen gingen und bereit waren, sich um diese ersten Plätze zu streiten, den Weg freigab. Ich hatte damals den Eindruck, dass dort am Eingange anders gebetet wurde als bei uns; demütig, andächtig, mit tiefen Verbeugungen und mit vollem Bewusstsein der eigenen Erniedrigung.» (Aufzeichnungen aus einem Totenhaus)
Es passt ins Bild, dass Dostojewski das intensivste religiöse Kindheitserlebnis einem Leibeigenen seines Vaters verdankt. Einige Jahrzehnte lang verschwindet die Episode aus seinem Gedächtnis. Während seiner Haftzeit erinnert er sich wieder daran. Fortan wird die Begegnung mit dem Bauern Marei für ihn zum Sinnbild der mütterlich-fürsorgenden Liebe Gottes.
Er ist damals etwa zehn Jahre alt. Während er alleine im Wald spielt, glaubt er, einen Ruf zu hören: «Ein Wolf! Ein Wolf!» Dieser Schreckensschrei ist, so erkennt er später, nur ein Produkt seiner Einbildung. Echt ist die Todesangst, die daraus resultiert. Er rennt auf das freie Feld hinaus und in die Arme des großen, schon etwas älteren Marei. Der Bauer tröstet den schluchzenden Jungen, sichert ihm Schutz zu und macht schließlich mit seiner erdverschmutzten Hand das Kreuzzeichen: «Christus sei mit dir, jetzt kannst du ruhig gehen.»
«Nur Gott allein hat vielleicht von oben zugesehen, mit wie tiefem und allwissendem Menschengefühl, mit wie spürsinniger, nahezu weiblicher Zärtlichkeit das Herz manch eines tierisch unwissenden leibeigenen russischen Bauern erfüllt sein kann.» (Tagebuch eines Schriftstellers, Februar 1876)
Die naive Selbstverständlichkeit, mit der Marei seinen Glauben artikuliert, ist dem erwachsenen Dostojewski nicht gegeben. Aber er sehnt sich danach. Die Erinnerung an den Bauern Marei sorgt dafür, dass er die Antworten auf seine Glaubensfragen nicht von theologischen Experten erwartet, sondern sich eher ungebildete Gläubige zum Vorbild nimmt.
Mit elf Jahren endet für Fjodor der Heim-Unterricht. Mit seinem Bruder Michail kommt er auf eine Privatschule, dann auf ein renommiertes Internat, noch immer allerdings in der Nähe der elterlichen Wohnung. Unter ihren Mitschülern gelten sie als Sonderlinge.
«So wie sie erzogen worden waren, […] unbekannt mit dem Leben, ohne Kameraden, ohne jemals in Gesellschaft gewesen zu sein, waren sie wie große Kinder, naive und romantische Träumer. Eine leidenschaftliche Freundschaft umschloss die beiden Brüder. Sie lebten in einer Traumwelt.» (Ljuba Dostojewski)
«Die Brüder pflegten überhaupt keinen Verkehr, auch nicht mit ihren Schulkameraden. […] Der Grund, weshalb sie mit keinem ihrer Mitschüler verkehrten, ist wohl allem Anscheine nach in dem anspruchsvollen Misstrauen der Eltern, namentlich des Vaters, zu suchen, der in einer so wichtigen Sache, wie es die Wahl von Freunden ist, offenbar nicht wählerisch genug sein konnte. Fjodor hat selbst mehrfach erzählt, dass er beständig das Verlangen nach Freunden gehabt habe, doch infolge seiner überaus großen Empfindlichkeit sei es ihm nicht gegeben gewesen, Freundschaft zu pflegen. Es ist anzunehmen, dass seine Feinfühligkeit die unter Jungen üblichen derben Späße nicht ertrug. Dafür hat er, wie einer seiner Mitschüler sich erinnert, immer andere, besonders Neulinge, gegen die gleichfalls in allen Schulen üblichen Anrempelungen oder rüden Ausfälle der älteren Schüler verteidigt.» (Andrej Dostojewski)
Bald nach dem Tod der Mutter werden die Brüder getrennt. Zunächst reisen sie gemeinsam nach Petersburg. Dort sollen sie die «Militärische ingenieurtechnische Universität» besuchen. Michail fällt aber beim Gesundheitscheck durch. Er landet auf einer anderen Hochschule, wechselt schließlich ins vierhundert Kilometer entfernte Reval, das heutige estländische Tallinn.
Fjodor hat die Aufnahmeprüfung hingegen mit Bravour bestanden. Er soll zum technischen Zeichner ausgebildet werden. Das entspricht ganz und gar nicht seinem Wunsch, aber dem Willen seines Vaters. Er hält die literarischen Ambitionen seiner Söhne für Flausen.
Schriftstellerisch ist der Sechzehnjährige bis dahin noch nicht in Erscheinung getreten. Alles deutet auf eine solide Beamtenkarriere hin. Aber wie bei seinem Vater und bei seinem literarischen Helden Karl Moor erweist sich bei Dostojewski der Freiheitsdrang stärker als die familiären Vorgaben.
Kapitel 2:
Träumer
Vor der Schriftstellerei als Beruf kommt die Berufung.
Manchmal kommt der Ruf von außen, durch Lehrer und Mentoren.
Im Fall von Dostojewski ist es die innere Stimme, die ihn immer deutlicher in eine Profession drängt, die es damals eigentlich noch gar nicht als Beruf gibt. Schreiben gilt als Luxus derjenigen, die es sich neben dem Bewirtschaften der geerbten Güter leisten können. Aber Träume kosten nichts, und der junge Dostojewski lässt es sich ebenso wie sein Bruder nicht nehmen, wenigstens in Gedanken eine literarische Laufbahn einzuschlagen.
«Ich und mein Bruder strebten damals nach einem neuen Leben, träumten von allem Schönen und Erhabenen. […] Wir glaubten leidenschaftlich an etwas. […] Wir dachten nur an die Poesie und die Dichter. Mein Bruder schrieb Verse, täglich an die drei Gedichte, selbst unterwegs, ich aber arbeitete im Geiste an einem Roman aus dem venezianischen Leben.» (Tagebuch eines Schriftstellers, Januar 1876)
Die beiden sind unterwegs nach Petersburg, als sie von der harten Wirklichkeit eingeholt werden. Auf den idealistischen Höhenrausch folgte die eiskalte Dusche.
Bei einem Zwischenstopp beobachten die Jugendlichen, wie ein angetrunkener Militärbeamter eine Postkutsche besteigt. Vor das Gefährt sind drei Pferde gespannt. Der Fahrgast, ein Feldjäger, setzt sich hinter den Kutschbock. Der Wagen hat sich kaum in Bewegung gesetzt, …
«… als der Feldjäger sich plötzlich erhob, schweigend, ohne ein einziges Wort, mit seiner kräftigen rechten Hand ausholte und sie oben schmerzhaft auf den Nacken des Kutschers niedersausen ließ. Dieser erzitterte, beugte sich vor, hob die Peitsche und hieb aus Leibeskräften auf das Mittelpferd ein. Die Pferde stürmten vorwärts, aber dies vermochte den Feldjäger nicht zu besänftigen. Es war eine Methode dabei und keine Erbostheit, es war etwas Vorbestimmtes und auf langjähriger Erfahrung Begründetes; die schreckliche Faust hob sich und sauste wieder auf den Nacken hinab.» (Tagebuch eines Schriftstellers, Januar 1876)
«So wird es die ganze Strecke gehen», werden die beiden geschockten Brüder von ihrem Kutscher aufgeklärt. Der Feldjäger sei ein regelmäßiger Passagier und würde sich immer so aufführen, seine Kollegen übrigens auch. Fjodor malt sich aus, wie der verprügelte Kutscher mit seinen geschundenen Pferden von der Fahrt zurückkehrt, sich betrinkt und anschließend seine Wut an seiner Frau auslässt. Um tags darauf die Faust des nächsten sadistischen Feldjägers in seinem Nacken zu spüren. Ein Reigen sinnloser Gewalt.
«Dieses entsetzliche Bild blieb mir mein ganzes Leben lang in Erinnerung. Niemals konnte ich diesen Feldjäger und vieles andere Schändliche und Grausame im russischen Volk vergessen und war dann später unwillkürlich lange Zeit geneigt, dies alles natürlich viel zu einseitig zu erklären.»
Mit «einseitig» meint Dostojewski ein Weltbild, in dem die Vertreter der staatlichen Obrigkeit pauschal böse und die Untertanen grundsätzlich schuldlos an der eigenen Misere sind. Er spielt an auf die sozialistischen Ideen, denen er in seinen zwanziger Jahren zeitweise anhing.
Mit der Kutscher-Szene ist ihm die Kluft zwischen der ritterlichen Welt, die er sich erträumt, und der grausamen Realität schmerzlich bewusstgeworden.
Der nächste Realitätsschock ereilt ihn, als er in Petersburg ankommt.
Mit der Hauptstadt und Kulturmetropole verbindet Dostojewski während seines ganzen restlichen Lebens eine Hassliebe. Er kann nicht mit ihr – zumindest nicht sich unbeschwert fühlen. Aber noch weniger kann er ohne sie – nämlich schreiben, denken, das pralle Leben erfahren. Er ist in Moskau aufgewachsen, allerdings abgeschottet vom urbanen Trubel. Seine schönsten Erlebnisse verbindet er mit dem Landgut seiner Eltern, wo er die Ferien verbrachte und sich in Sagenwelten hineinphantasierte.
Das Ambiente, das er in Petersburg vorfindet, erweist sich als viel stimulierender. Aber eben auch als viel anstrengender. Petersburg und seine Bevölkerung bescheren ihm emotionale Wechselbäder, lassen ihn zur Hochform auflaufen, drücken ihn gleichzeitig nieder. Ein symbiotisches, hochproduktives «Verhältnis», aber keine Liebesbeziehung.
Dostojewski hat ein Faible für alles, was organisch von unten gewachsen ist, aus der Volksseele kommt, sich auf tiefe russische Muttererde gründet. All das ist Petersburg gerade nicht, sondern etwas mehr als 100 Jahre zuvor aus dem sumpfigen Boden gestampft worden – als Kopfgeburt des West-fixierten Zaren «Peter des Großen», unter erzwungener Mitwirkung von zigtausenden Arbeitskräften.
So extrem wie die Petersburger Historie ist auch das Klima, mit langen kalten Wintern und kurzen heißen Sommern. Und die Menschen erst! Ein kompliziertes Volk – aber gerade deshalb Manna für Kreative.
«In Petersburg gibt es viele Leute, die im Gehen Selbstgespräche halten. Es ist eben eine Stadt von Halbverrückten. […] Es gibt wenige Orte, wo sich so viele düstere, starke, seltsame Momente, die auf die menschliche Seele wirken, vereinigt finden wie in Petersburg. Wie mächtig sind allein schon die Einwirkungen des Klimas! Und dabei ist nun Petersburg der administrative Mittelpunkt von ganz Russland, so dass der Charakter dieser Hauptstadt auf das ganze Reich zurückwirken muss.» (Schuld und Sühne)
Das Studium erlebt Dostojewski als freudlos.
Er flüchtet sich in die Literatur, liest neben Romanen auch christlich-philosophische Werke, etwa von Blaise Pascal, verfällt schließlich in Melancholie.
Er vermisst seinen Bruder.
Fjodor berichtet Michail von den «trüben Gedanken», die ihn heimsuchen. Liegt die Schwermut an seiner besonderen psychischen Disposition? Oder ist es ganz normal für einen Menschen, sich in einem Moloch wie Petersburg innerlich zerrissen zu fühlen?
«Die Atmosphäre der Seele besteht aus einer Vermengung des Himmlischen mit dem Irdischen: Was für ein unnatürliches Kind ist also der Mensch. […] Unsere Erde erscheint mir als ein Fegefeuer für himmlische Geister, die von sündigen Gedanken getrübt worden sind. Mir scheint, dass unsere Welt eine negative Größe geworden ist und dass alles Erhabene, Schöne und Geistige sich in eine Satire verwandelt hat.» (Brief an Bruder Michail, 9.8.1838)
Futsch ist schon bald die Aufbruchsstimmung, mit der er nach Petersburg gereist war. Immer weniger kann er sich mit dem Gedanken anfreunden, sein künftiges Leben in einer ministerialen Schreibstube zu verbringen.
«Wenn ich vorwärtsschaue, so graut mir vor der Zukunft.» (Brief an Bruder Michail, 31.10.1838)
Dabei hätten viele russische Jugendliche nur zu gerne mit ihm getauscht. Schließlich steht einer lukrativen Karriere nichts im Weg. Die «Militärische ingenieurtechnische Universität» hat damals in Russland denselben Ruf wie heute weltweit Oxford, Harvard oder das «Massachusetts Institute of Technology». 1810 zur Zeit von Napoleon gegründet, soll sie der französischen Kaderschmiede, der «Ecole Polytechnique», Paroli bieten. Dostojewski bekommt hier eine wissenschaftliche Grundlagenausbildung, dazu eine Spezialqualifikation: Er wird zum technischen Zeichner qualifiziert, eine Tätigkeit, die damals so gefragt ist wie heute das Entwickeln von Software.
Das Studium, zu dem auch eine militärische Ausbildung gehört, dauert fünf Jahre. Dieser Aspekt in Dostojewskis Vita wird oft zu wenig gewürdigt. Bevor er als Autor von sich reden macht, ist er ein bestens ausgebildeter Ingenieur. Er lernt mit den klügsten Köpfen seiner Zeit, kann mit Zahlen jonglieren, präzise Skizzen anfertigen. Aber innerlich ist er oft in anderen Gefilden unterwegs.
«Wie rein waren wir damals, wie unverdorben! […] Was habe ich in meiner Jugend nicht alles geträumt, was habe ich nicht alles mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele in goldenen und fieberhaften Träumen, wie in einem Opiumrausch erlebt. Es hat in meinem Leben keine volleren, heiligeren und reineren Augenblicke gegeben. Ich verirrte mich so weit in meine Träume, dass ich meine ganze Jugend verpasste, und als mich das Schicksal plötzlich auf die Beamtenlaufbahn stieß, so diente ich musterhaft. Aber sobald die Amtsstunden zu Ende waren, eilte ich in meine Dachkammer, zog meinen durchlöcherten Schlafrock an, schlug einen Band Schiller auf und träumte und berauschte mich, und litt Schmerzen, die süßer waren als alle Genüsse der Welt, und ich liebte, liebte.» (Petersburger Träume)
Der Bücherwurm fühlt sich nicht zu Nischenproduktionen hingezogen, sondern zu den Bestsellern seiner Zeit. Fjodor ist ein Träumer, aber kein Spinner oder Esoteriker. Er interessiert sich für die Romane, die noch heute als Meisterwerke gelten. Und davon erscheinen in seinen jungen Jahren, den 1820ern und 1830ern, jede Menge. J. F. Cooper veröffentlicht seinen «Letzten Mohikaner» (1826), Alessandro Manzoni «Die Verlobten» (1827), Stendhal «Rot und Schwarz» (1830). Dostojewski kennt diese Bücher. Seine persönlichen Vorlieben sind jedoch andere.
Seine Begeisterung für Friedrich Schiller ist bereits erwähnt worden. Der Enthusiasmus für den deutschen Dichter geht so weit, dass Dostojewski ein Schiller-Drama – «Maria Stuart» – teilweise ins Russische übersetzt. Die Themen, die Schiller umtreiben, Generationenkonflikt, Freiheitsdrang, Zivilcourage, bewegen auch ihn.
Wenig angetan ist Dostojewski hingegen von Goethe, er findet dessen Kunstverliebtheit lebensfremd; außerdem stößt ihn Goethes Pantheismus ab. Später bezeichnet er Goethe verächtlich als «alten Heiden». Dass auch Schiller nicht gerade ein rechtgläubiger Christ war, stört Dostojewski nicht.
«[Schillers] Poesie ist dem Herzen zugänglicher als die Poesie Goethes und Byrons, und das ist sein großer Verdienst.» (Notizen zur Weltliteratur)8
Während Dostojewski an Schiller dessen Stil und Haltung beeindrucken, ist es bei Honoré de Balzac dessen ungeschminkte Darstellung der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Der französische Schriftsteller arbeitet zwischen Ende der zwanziger und Mitte der vierziger Jahre an seiner groß angelegten Reihe «Die menschliche Komödie». Er veröffentlichte darin Geniestreiche wie «Vater Goriot», «Verlorene Illusionen» und «Das Chagrinleder».
Von einem Balzac-Roman, «Eugénie Grandet», fertigt Dostojewski wie bei Schiller eine russische Übersetzung an. Der tragische Plot von «Eugénie Grandet» entspricht genau seinem Geschmack: Eine Unschuld vom Lande wird zwischen ihrem steinreichen, geizigen Vater und ihrem attraktiven, selbstsüchtigen Cousin aufgerieben. Ähnliche Konflikte behandelte Dostojewski später in seinen eigenen Erzählungen, wenn auch auf weniger zynische Art. An Balzac bewundert er das psychologische Gespür, mit dem dieser seine Figuren zeichnet.
«Balzac ist groß! Seine Charaktere sind Schöpfungen eines weltumfassenden Geistes.» (Brief an Bruder Michail, 9.8.1838)
Mehr noch als Balzac schließt Dostojewski einen anderen französischen Dichter ins Herz: Victor Hugo. Während Balzac sich darauf versteht, die Menschen schonungslos ehrlich darzustellen, gelingt es Victor Hugo auf bemerkenswerte Weise, Mitgefühl mit ihnen zu wecken, etwa in «Der Glöckner von Notre Dame» (1831), vor allem aber drei Jahrzehnte später in «Die Elenden» (1862).
«Seine Idee ist die Grundidee der ganzen Kunst des neunzehnten Jahrhunderts. […] Die Idee ist christlich und hochmoralisch. […] Ihre Formel ist die Aufrichtung eines zugrunde gegangenen Menschen, der unter dem ungerechten Druck der Umstände, des Stillstandes und der öffentlichen Vorurteile zusammengebrochen ist. Diese Idee ist die Rechtfertigung der erniedrigten und von allen verworfenen Parias der Gesellschaft.» (Notizen zur Weltliteratur)
Noch in Dostojewskis Teenagerzeit erstrahlt ein neuer Stern am Literaturhimmel: Charles Dickens. Innerhalb weniger Jahre veröffentlicht der zehn Jahre ältere Engländer «Die Pickwickier», «Oliver Twist», «Nicholas Nickleby» und «Der Raritätenladen». Beim letztgenannten Roman rührt Dostojewski das Schicksal des tugendhaften Waisenmädchens Nell, das von einem Geldverleiher in den Tod getrieben wird, so sehr, dass er in «Erniedrigte und Beleidigte» seine eigene Titelheldin danach benennt. Dostojewski bezeichnet Dickens später als einen «großen Christen», unter anderem deshalb, weil er es geschafft hatte, in «fast jedem Roman […] erniedrigte Menschen, Gerechte, […] Nachgebende, Bedrückte und Narren in Christo auftreten zu lassen» (Tagebuch eines Schriftstellers, Juni 1876).
Eine ganz andere Art der Seelenverwandtschaft als bei Dickens empfindet Dostojewski, wenn er die Bücher des preußischen Beamten E. T. A. Hoffmann liest.
«Was für ein echter, reifer Humor, was für eine Kraft der Wirklichkeit, was für eine Bosheit, was für Typen und Porträts und dabei was für eine Sehnsucht nach dem Schönen, was für ein lichtes Ideal.» (Notizen zur Weltliteratur)
Dickens versteht sich auf die Schilderung sozialer Missstände, Hoffmann auf das Ausloten seelischer Abgründe. Wer dem Menschen literarisch gerecht werden will, das spürt Dostojewski, muss sich in beiden Dimensionen auskennen.
Es ist nicht die Klassik vergangener Epochen, die Dostojewski anzieht. Er bevorzugt Literatur, die sein Blut in Wallung bringt, die ihm Türen zu unbekannten Welten öffnet, die heiße Eisen anfasst.
Seine Vorliebe für das Neue und das Wilde wird nirgendwo so deutlich wie bei der französischen Schriftstellerin George Sand. Sie gilt zu seiner Zeit als Skandalnudel und Revoluzzerin, wird von manchen Kritikern als sentimentale Vielschreiberin verhöhnt. Dostojewski sieht das ganz anders. Ihm schreibt George Sand aus der Seele. Tatsächlich gibt es einige überraschende Übereinstimmungen zwischen ihm, dem artigen Arztsohn, und der fast zwanzig Jahre älteren rauchenden, hosentragenden, promiskuitiven Adelsfrau.
George Sand hatte eigentlich einen ganz femininen, vornehmen Namen: Amantine Aurore Lucie Dupin de Francueil. Sie wuchs zwar in zerrütteten Familienverhältnissen, aber sonst behütet auf, besuchte eine Klosterschule, fügte sich in eine arrangierte Ehe mit einem älteren, saufenden Tunichtgut. Um ihr dreißigstes Lebensjahr vollzog sie den biographischen Relaunch. Sie trennte sich von ihrem Mann, ließ sich auf Affären ein. Mit ihren Romanen wurde sie zur Erfolgsautorin. Meistens geht es darin um Frauen oder Männer, die sich über die Bigotterie ihrer Umwelt hinwegsetzen, aber nie destruktiv agieren, sondern das Gute erstreben.
Von seiner ersten Sand-Lektüre weiß Dostojewski später noch genau, dass er «danach eine ganze Nacht fieberte», weil er «alles das, wovor er damals so behütet und beschützt wurde, aus diesen Romanen herauszulesen verstand». Diese Sätze finden sich in einem Nachruf, den er kurz nach George Sands Tod verfasst. Darin erläutert Dostojewski die Gründe für seine unveränderte Bewunderung der Dichterin. Sie verkörpert sein Ideal einer radikal unabhängigen, gleichzeitig werteorientierten Wahrhaftigkeit.
«Sie konnte nicht anders als Größe lieben, sie konnte sich nicht mit Niedrigem aussöhnen. […] Neben Geduld und der Anerkennung der Pflichtschuldigkeit trat auch ein ganz außergewöhnlicher Stolz der Anforderung und des Protestes hervor. Dieser Stolz war gerade deshalb kostbar, weil er aus jener höheren Wahrheit hervorging, ohne die die Menschheit sich niemals auf ihrer ganzen moralischen Höhe hätte erhalten können. Dieser Stolz basiert nicht auf der falschen Überzeugung, dass ich sozusagen besser bin als Du, und Du schlechter bist als ich, sondern ist einzig und allein das Gefühl der keuschesten Unfähigkeit, sich mit Unwahrheit und Laster auszusöhnen.» (Tagebuch eines Schriftstellers, Juni 1876)
Nicht alle Bücher, die den jungen Dostojewski ins Schwärmen bringen, sind importiert. Zum ersten Mal in der Geschichte Russlands produziert das Land eigene Schriftsteller von internationalem Format.
Der 26-jährige Michail Lermontow zeichnet in seinem Roman «Ein Held unserer Zeit» (1840) ein erschütterndes Porträt seiner Generation, die er als phlegmatisch, orientierungslos und unfähig zu echter Leidenschaft darstellt. «Meine Seele ist von der Welt verdorben, meine Phantasie ist unruhig, mein Herz unersättlich», klagt der Protagonist, ein Anti-Held. Er seufzt: «Das Traurige mutet uns lächerlich, das Lächerliche traurig an, und im Grunde sind wir, um die Wahrheit zu sagen, gegen alles recht gleichgültig, außer gegen uns selbst.»
Man kann sich vorstellen, dass Dostojewski bei der Lektüre zumindest innerlich heftig mit dem Kopf nickt.
Nikolai Gogol, fünf Jahre älter, macht sich in seiner Komödie «Der Revisor» (1836) über die naive Autoritätsgläubigkeit seiner Landsleute lustig. 1842 nimmt er deren Statusfixierung aufs Korn. In der Novelle «Der Mantel» leitet ein kleiner Beamter seinen Selbstwert von einem edlen Kleidungsstück ab und geht zugrunde, als der Mantel ihm gestohlen wird.
Dostojewskis größtes literarisches Idol, von seiner Jugend an bis zu seinem Tod, ist jedoch Alexander Puschkin. Als dieser an den Folgen eines Duells stirbt, trifft das Fjodor und Michail fast so sehr wie der Tod der eigenen Mutter.
«Als meine Brüder von seinem Tode erfuhren und noch alle schrecklichen Einzelheiten hörten, glaubten sie, den Verstand zu verlieren. Fjodor sagte mehrmals in seinen Gesprächen mit Michail, dass er, wenn wir nicht schon Familientrauer hätten, den Vater bitten würde, um Puschkin Trauer tragen zu dürfen.» (Andrej Dostojewski)
Als die beiden Dostojewski-Brüder 1838 nach Petersburg umziehen, sehen sie darin auch eine Art literarische Wallfahrt.
«Ich einigte mich unterwegs mit meinem Bruder, gleich nach der Ankunft in Petersburg die Stelle des Duells aufzusuchen und in die einstige Wohnung Puschkins einzudringen, um das Zimmer zu sehen, in dem er seine Seele ausgehaucht hatte.» (Tagebuch eines Schriftstellers, Januar 1876)
Wie bei George Sand ist es bei Puschkin nicht nur dessen handwerkliches Können, das Dostojewski fasziniert. Puschkin ist der Elvis seiner Zeit. Ein lebender Epochenbruch. 1799 geboren, sticht er schon durch seinen dunklen Teint hervor. Sein Urgroßvater Hannibal, ein Page am Hof von Peter dem Großen, stammte aus dem heutigen Äthiopien. Einige Stationen seines Lebenslaufs haben Parallelen zu denen von Dostojewski: die Geburt in Moskau, die Zeit in der Verbannung, der Tod in Petersburg. Schon zu Lebzeiten ist Puschkin eine Legende. Seine Werke treffen ins Herz einer Jugend, die sich von Bevormundung befreien und ihren eigenen Weg finden will.
Puschkins zentrale Botschaft fasst Dostojewski später in seiner berühmten Rede zusammen, die er bei der Einweihung eines Denkmals für den Dichter hält:
«Die Wahrheit ist nicht außerhalb deiner, sondern in dir selbst. Finde sie in dir, füge dich ihr selbst, bemächtige dich deiner selbst, und du wirst die Wahrheit sehen. Nicht in den Dingen ist diese Wahrheit, nicht außerhalb deiner, nicht irgendwo jenseits des Meeres, sondern vor allem in deiner eigenen Mühe an dir selbst. Wenn du dich besiegst, wenn du dich bändigst, wirst du so frei sein, wie du es dir niemals geträumt hast, und du wirst ein großes Werk beginnen und die andern freimachen und das Glück sehen. Denn dein Leben wird voll werden, und du wirst endlich dein Volk und seine heilige Wahrheit begreifen.» (Tagebuch eines Schriftstellers, August 1880)
Besonders hoch rechnet Dostojewski seinem Vorbild an, dass Puschkin die Antwort auf die russischen Fragen nicht bei ausländischen Experten gesucht hatte.
«Überall hört man bei Puschkin seinen Glauben an den russischen Charakter, an dessen geistige Kraft heraus; und wo dieser Glaube ist, da ist auch eine Hoffnung, die große Hoffnung auf den russischen Menschen. […] Kein russischer Schriftsteller, weder vor ihm, noch nach ihm, hatte sich so herzlich und verwandtschaftlich mit seinem Volk vereinigt wie Puschkin.» (Tagebuch eines Schriftstellers, August 1880)
Dostojewski ist bereits 58 Jahre alt, als er diese Gedanken formuliert. Als jugendlicher Leser ist sein Zugang zu Puschkin natürlich mehr intuitiv als intellektuell. Ihm eröffnet der hyper-vitale Puschkin den Zugang zu einer neuen aufregenden Welt. Hier werden nicht artig alte Traditionen beschworen. Hier wird das Leben gefeiert und der Möglichkeitssinn geschärft.
Eine besondere Wirkung üben zwei Puschkin-Werke auf Dostojewski aus. Zum einen die Erzählung «Pik-Dame», in der ein Soldat erst der Spielleidenschaft, dann dem Wahnsinn verfällt; zum anderen das Gedichtfragment «Kleopatra und ihre Liebhaber». Als Student deklamiert Dostojewski die wilden Zeilen mit Inbrunst vor seinen Kommilitonen. Sie sind begeistert von seiner Performance.
Der Inhalt ist alles andere als jugendfrei. In dem Gedicht bietet sich die ägyptische Königin römischen Soldaten zum Sex an – unter einer grausamen Bedingung: Wer mit ihr schläft, muss anschließend sterben.
«Schauer fasste jeden, die Herzen zittern im Verzicht – und sie vernimmt die Flüsterreden mit stolzer Kälte im Gesicht, und streift das mutlose Gedränge