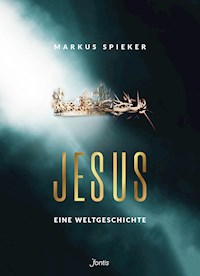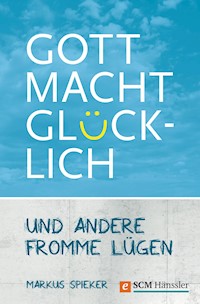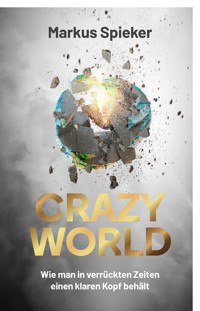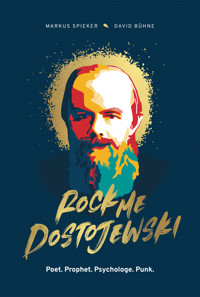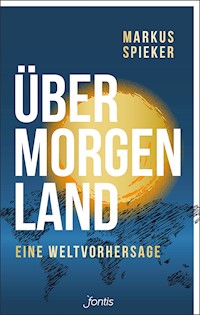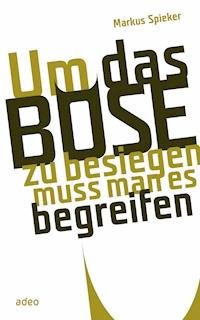
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: adeo
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Es gibt gute Gründe dafür, sich mit dem Bösen auseinanderzusetzen. Das Böse ist nämlich immer. Und überall. Es muss nicht gleich die große Apokalypse sein. Die kleine reicht auch schon. Einmal ins falsche S-Bahn-Abteil zu den falschen Leuten gestiegen und man liegt kurz darauf am Boden, während es Tritte und Schläge hagelt. Sadistische Lehrer, brutale Mitschüler, mobbende Chefs, stalkende Kollegen, Ehrabschneider und Gerüchtestreuer - sie alle können unser Leben infernalisch machen. Darauf muss man sich gefasst machen. Markus Spieker weiß: Erst, wenn man das Böse begreift, kann man es auch bekämpfen. Der ARD-Hauptstadtkorrespondent erzählt die Geschichte des Bösen. Dabei nimmt er Bezug auf aktuelle Tragödien, die die Welt erschüttert haben, aber auch auf alltägliche Gefahren im Leben jedes Einzelnen. Und er zeigt, wie man sich gegen das Böse wappnen kann, wenn man es erst erkannt hat. Am Ende, da ist er sich sicher, ist die Liebe stärker.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Schwester Gaby, die Gute
Inhalt
Ein Mann will nach unten
Warum ich dem Bösen auf den Abgrund gehen will
Teil 1
Licht aus
1 Jenseits von Gut
Das Böse in der Theorie
2 Leichen pflastern seinen Weg
Das Böse in Geschichte und Gegenwart
3 Der Wille zur Nacht
Das Böse in mir
4 Ich will doch nur spielen
Die Lügen des Bösen
5 Der Feind in meinem Kopf
Böse Veranlagungen
6 Schiefgewickelt
Böse Prägungen
7 Gefahrenzone
Böse Umstände
8 Horrorshow
Böse Fantasien
9 Wer ist der Teufel, und wenn ja, wie viele?
Das Ur-Böse
Teil 2
Licht an
10 Schweigende Killer
Das Böse verstehen
11 Unrechtsfreier Raum
Das Böse vermeiden
12 Das Imperium zieht zurück
Das Böse bekämpfen
13 Letzte Konsequenzen
Das Böse bestrafen
14 Höchststrafe
Die Hölle
15 Ich habe ein Trauma
Die Opfer des Bösen
16 Ein Mann sieht weiß
Das Böse verzeihen
17 Relaunch
Die Besserung der Bösen
18 Reiner Tisch
Die Erlösung vom Bösen
Du kannst die Augen wieder aufmachen
Die Anti-Böse-Strategie
Literatur
Ein Mann will nach unten
Warum ich dem Bösen auf den Abgrund gehen will
»Wer kann Hinweise geben?«, steht auf dem Polizei-Plakat, das an einer Hauswand klebt. Jemand hat ein Gebäude in der Nachbarschaft angezündet. Eine Mutter und ihre drei Kinder sind in den Flammen umgekommen. Dabei sieht die Straße im Zentrum von Berlin ganz friedlich aus. Einige Mädchen kommen mir auf Fahrrädern entgegen. Vielleicht kannten sie die Opfer, haben mit ihnen gelacht und gealbert, bevor das Böse zugeschlagen hat. Mein Blick wandert zwischen ihnen und dem Plakat hin und her. Ich bin zu einem Freund unterwegs. Aber die Lust auf eine lockere Unterhaltung ist mir vergangen. Die Fragilität des Lebens wird mir mit einem Schlag bewusst. Als ich die Straße entlanggehe, beäuge ich die Passanten eine Spur misstrauischer.
Eigentlich bin ich Experte für das Böse. Durch meinen beruflichen Alltag zieht sich eine Blutspur. Ich arbeite schließlich als Nachrichtenjournalist. Und schlechte Nachrichten sind, gemessen an Einschaltquoten und Auflagenzahlen, gute Nachrichten. Das kennt jeder Autofahrer. Mehr als die schönste Landschaft fesselt der Anblick eines Autowracks, vor allem, wenn es noch raucht. Noch größer werden unsere Augen, wenn wir sehen, wie Menschen aufeinander losgehen. Oder wie massakrierte Leichen herumliegen. So sind wir. Unglücksjunkies. Solange es um das Unglück der anderen geht. Wenn anderen eine Grube gegraben wird, stehen wir daneben und gucken fasziniert zu. Zumindest, wenn wir es bequem vom Fernsehsessel aus tun können. Oder wie ich vom Redakteursstuhl.
Trotzdem wird mir immer wieder bewusst, wie wenig ich tatsächlich vom Bösen verstehe. Von seinen Ursachen, seinem Wesen, seinen Auswirkungen. Vielleicht hätte ich statt Geschichte und Filmwissenschaften lieber Theologie und Philosophie studieren sollen. Oder einfach gründlicher recherchieren, was sich hinter den negativen Schlagzeilen tatsächlich verbirgt.
Zugegeben: Mit den besonders schrecklichen Auswüchsen menschlichen Fehlverhaltens werde auch ich nur selten konfrontiert. Ich bin politischer Korrespondent. Das heißt: Meistens beschäftige ich mich mit Menschen, die zivilisiert miteinander umgehen. Zumindest nach außen hin. Die Spitzenpolitiker, die in meinen Beiträgen zu Wort kommen, haben nicht mehr und nicht weniger kriminelle Energie als andere Bürger. Manche lassen sich im Urlaub von ihren reichen Freunden freihalten. Andere schreiben bei ihrer Doktorarbeit ab. Kleinkram.
Doch zuweilen bricht das nackte Grauen ohne Vorwarnung auch in meine Arbeit ein. Dann stehe ich mit meinen Kollegen zusammen, und wir schütteln fassungslos die Köpfe, bevor wir uns an die Arbeit machen. Bilder drehen. Reaktionen einholen. Das Unfassbare in Zwei-Minuten-Beiträge packen. Ich habe in meinen zehn Jahren als Hauptstadtkorrespondent mehrere Hundert Pressekonferenzen besucht, mehrere Tausend Interviews geführt, unzählige Informationen zu Beiträgen aufbereitet. Das meiste davon habe ich vergessen. Woran ich mich erinnere, sind die Momente, in denen ich gespürt habe, dass ich gerade mit dem unverhüllt Bösen konfrontiert werde.
Wie damals an einem sonnigen Spätsommernachmittag, als ich mich auf einen frühen Dienstschluss freute und auf meinem Computermonitor plötzlich eine Eilmeldung rot aufleuchtete: Angriff auf das World Trade Center. Ein paar Minuten später stand ich mit anderen Kollegen und dem Chefredakteur in dessen Büro, und wir starrten fassungslos auf den Bildschirm, auf dem sich das zweite Flugzeug in den anderen Turm bohrte und beide Türme kurz darauf kollabierten.
Oder damals auf dem Kongress in Berlin, auf dem ich Jugendlichen etwas über gesellschaftliche Verantwortung erzählen sollte, als die Nachricht vom Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium hereinplatzte. Ich wurde zurück zu meinem Sender kommandiert, um beim ARD-Brennpunkt mitzuhelfen, und musste 200 junge Leute verstört und fragend zurücklassen.
Oder beim Besuch der Deutschen Botschaft in Bagdad. Ich schlenderte auf dem von fünf Sicherheitsmauern umgebenen Innenhof herum. Ein Wachmann bot mir an, mir die Stelle zu zeigen, an der ein paar Monate zuvor eine Bombe die äußerste Mauer zerstört hatte. Der Sprengsatz hatte auch seine linke Gesichtshälfte weggesprengt – und den Kopf seines Bruders.
Oder auf dem Rückflug von Afghanistan. Dort hatte ich über den Beginn des Truppenabzugs berichtet. Wir waren in einem Panzerwagen herumkutschiert worden. Zusätzlich mussten wir uns kugelsichere Westen umschnallen. Es passierte nichts. Keine Bombenattentate. Keine tödlichen Schüsse. Im gefährlichsten Land der Welt hatte das Böse eine Pause eingelegt. Kurz bevor wir in Berlin landeten, kam ein erschütterter Guido Westerwelle in den hinteren Teil des Flugzeugs gelaufen: Der Außenminister meldete, dass in Norwegen ein Attentat verübt worden war. Über Täter und Hintergründe hatte er noch keine Informationen.
Wir zeichneten rasch ein Interview mit ihm auf. Westerwelle zeigte sich betroffen und drückte sein Mitgefühl mit den Angehörigen der Opfer aus. Er hätte sich natürlich viel drastischer geäußert, wenn er die tatsächliche Dimension des Verbrechens und den wahren Täter gekannt hätte. Ein milchgesichtiger Junggeselle, Anders Breivik, hatte planvoll 77 Leben ausgelöscht. Unter seinen Opfern befanden sich vor allem idealistische Jugendliche, die auf einer idyllischen Insel über eine bessere Welt diskutierten. Die Mordtat ereignete sich ausgerechnet in und kurz vor Oslo, einer der friedlichsten Hauptstädte der Welt. Als ich das letzte Mal dort gewesen war, hatten junge Leute auf der Hauptstraße Gratis-Umarmungen an wildfremde Menschen verteilt.
Wir werden immer öfter mit dem Bösen konfrontiert, weil es im Internetzeitalter immer weniger Geheimnisse gibt. Früher konnten Leichenberge noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit verscharrt werden. Heute findet sich immer jemand, der eine Handykamera draufhält und den Clip anschließend um die Welt schickt.
Wer sich für das Böse interessiert, muss allerdings nicht Youtube-Clips aus Norwegen, Syrien, dem Iran oder dem Jemen angucken.
Das Böse ist auch unter uns.
Dabei denke ich nicht nur an die Salafisten, die an Bahnhöfen scheinbar harmlos Korane verteilen, während ihre Gesinnungsgenossen in anderen Ländern Kirchen abbrennen und Andersgläubige töten. Oder an die Neonazi-Szene, die in der Mordserie des selbst ernannten »Nationalsozialistischen Untergrunds« ihre militante Fratze gezeigt hat. Oder an die ehemaligen Wärter des Stasi-Gefängnisses in Berlin-Hohenschönhausen, die jahrzehntelang Regimegegner drangsaliert haben und jetzt immer noch Informationsabende über die SED-Diktatur mit pöbelnden Zwischenrufen sprengen. Oder an in Deutschland illegal arbeitende Prostituierte, denen die Kinder nach der Geburt weggenommen werden, um sie an Pädophile zu verkaufen.
Ich denke auch an Alltagsschurken, die unbemerkt von der Öffentlichkeit ihren Mitmenschen die Lebensfreude rauben: prügelnde Eltern, betrügerische Geschäftsleute, sadistische Lebenspartner, verleumderische Nachbarn.
Mir kommt eine Freundin in den Sinn, die mir irgendwann die Ursache für ihre nicht enden wollende Traurigkeit erzählte. Sie war als Studentin vergewaltigt worden, und mit der Erinnerung an dieses Trauma schlief sie jeden Abend ein, um mit demselben Gedanken wieder aufzuwachen. Sie hatte den Täter vorher gekannt und wollte über seine Person nur so viel sagen: »Er sagte, er sei mein Freund.«
Dann ist da noch der junge Mann, der mir den Grund für seinen Hass auf das Christentum erzählte. Er war in einer angeblich strenggläubigen Familie aufgewachsen. Sein Vater hatte ihn jahrelang missbraucht. Sowohl seine Mutter als auch die Leitung der Kirchengemeinde hatten die Tat gedeckt oder zumindest nicht auf die Hilferufe des Jungen reagiert.
So schlimm wie weitverbreitet sind auch die Erfahrungen eines Freundes. Ich traf ihn auf einem Sommerfest, nachdem er gerade aus der Reha-Klinik entlassen worden war. Sein Chef hatte ihn in das Burn-out gemobbt. Kaum war mein Freund zurück an seinem Arbeitsplatz, setzte der Boss die Schikanen fort. »Er hat einfach Spaß daran, Menschen zu demütigen und zu quälen«, sagte mein Freund, während seine Frau tröstend ihren Arm um ihn legte. Und ich habe mich gefragt: Was hat zu der charakterlichen Deformation dieses Vorgesetzten geführt? Und welche Möglichkeiten gibt es für einen Untergebenen, sich gegen solche giftigen Attacken zu immunisieren?
Was ist das Böse und wie kann es bekämpft werden? Vor allem diesen beiden Fragen will ich nachgehen. Deshalb habe ich diesen Anti-Böse-Ratgeber verfasst. Er bildet einen Gegenakzent zu den vielen Anleitungen zum Glücklichwerden und zur Daseinsoptimierung. In der ersten Hälfte des Buches beschreibe ich das Gift und seine Wirkung. In der zweiten Hälfte skizziere ich mögliche Gegenmaßnahmen. Mein Ziel ist es, dabei zu helfen, das Böse zwar nicht zu eliminieren, aber zu reduzieren.
Das Böse zu outen.
Das Böse zu beschreiben und zu erklären.
Das Böse in die Defensive zu bringen.
Denn das Böse breitet sich da aus, wo es unerkannt, unverstanden und unwidersprochen bleibt. Wo es ohne Aufmerksamkeit und ohne Gegenwehr verstören und vergiften kann.
Wie wichtig Schlechtigkeitsprophylaxe ist, wusste keiner besser als Jesus. Man muss nur das bekannteste Gebet der Christenheit lesen, das Vaterunser. Jesus beginnt mit einer Anrede des Allmächtigen: »Vater unser im Himmel«. Dann folgen sieben Bitten, von denen die ersten drei der Verherrlichung Gottes gewidmet sind (»Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe«). Bleiben vier Bitten, die sich auf das Leben im Hier und Jetzt beziehen. Eine Art Wunschkatalog, mit dem wir Gott in den Ohren liegen sollen.
Die erste Bitte lautet: »Unser tägliches Brot gib uns heute.« Jesus beginnt auf der untersten Stufe der Bedürfnispyramide. Die Grundversorgung soll gewährleistet sein. Darauf baut er aber nicht etwa mit Bitten um Wohlstand, Partnerschaftsglück oder Selbstverwirklichung auf, sondern er geht buchstäblich in die Tiefe.
Die zweite Bitte heißt: »Und vergib uns unsere Schuld, während wir auch unseren Schuldnern vergeben.« Das bezieht sich auf das Böse, das wir bereits getan haben oder das uns angetan wurde. Es muss bewältigt werden.
Die dritte Bitte: »Und führe uns nicht in Versuchung.« Hier geht es um das Böse, das wir in Zukunft tun könnten.
Die vierte Bitte: »Und erlöse uns von dem Bösen.«
Amen.
Das klingt, als wäre Jesus ziemlich defizitorientiert gewesen. Ein Schwarzseher. Ein Pessimist. Oder einfach nur weltweise. Jesus wusste: Zu einem gelingenden Leben gehört es vor allem, den inneren Schweinehund zu besiegen, von fiesen Typen verschont zu bleiben und den Teufel auf Abstand zu halten. Sein eigenes Leben war gerahmt und durchzogen von moralischen Scheußlichkeiten. Kurz nach seiner Geburt wurden Dutzende von Säuglingen und Kleinkindern in Bethlehem massakriert. Er selbst wurde mit der qualvollsten Hinrichtungsart, der Kreuzigung, zu Tode gemartert. Und ein paar Jahrzehnte später wurde ganz Israel zerstört. Historiker gehen von bis zu einer Million Toten aus.
Und seitdem?
Zwar haben wir in Europa Krieg, Folter und Todesstrafe abgeschafft und das Zeitalter des ewigen Friedens eingeläutet. Aber wie lange hält der wirklich? Und was passiert, wenn die Währungs- und Schuldenkrise sich zu einer echten ökonomischen Katastrophe auswächst?
Das habe ich mich gefragt, als ich zuletzt das Deutsche Historische Museum in Berlin besucht habe. Ich war nicht allein dort, sondern hatte ein Kamerateam und einen Geschichtswissenschaftler dabei, den ich zur Lage auf den Finanzmärkten interviewte. Ich postierte ihn dabei vor einem Bildschirm, über den Originalaufnahmen aus dem Jahr 1932 flimmerten. Deutschland auf dem Höhepunkt der letzten großen Depression. Panische Bürger, hilflose Politiker und Nazis, die frech aufmarschierten, während die Polizisten mal brutal dreinschlugen, mal untätig zuschauten. Zwischen damals und heute gebe es einige Parallelen, meinte der Geschichtsexperte. Der Fernsehbeitrag lief vor einem Interview mit einem führenden Bundespolitiker. Der reagierte stinksauer, schimpfte über die angeblich unverantwortliche Panikmache. Später gab er im Vieraugengespräch zu, dass er die Lage ebenfalls für äußerst bedrohlich hielt. Und seitdem verschärft sich die wirtschaftliche Krise immer weiter.
Auch andere Entwicklungen geben Anlass zur Sorge.
Laut Kriminalstatistik steigt auch die Anzahl der politisch motivierten Delikte. Die Bindekraft von Familien, Vereinen und Kirchen nimmt ab. Die Volksgemeinschaft franst an den Rändern aus. Die Zukunftsängste nehmen zu. Überall klaffen Risse und Krater des Misstrauens und des Egoismus. Darin kann sich das Böse einnisten, bis es irgendwann wieder an die Oberfläche kriecht. In Gestalt von Populisten, Demagogen, Hasspredigern.
»Man soll nicht immer das Schlimmste denken. Wo führt das hin! Ich will meine Ruhe und meinen Frieden haben«, schimpft der Protagonist in Max Frischs Drama »Biedermann und die Brandstifter«. Während sein Haus von Terroristen zur Kommandozentrale für einen Anschlag umfunktioniert wird, verschließt er aus Bequemlichkeit die Augen: »Schließlich lebe ich nur einmal!« Am Ende fliegt die ganze Stadt in die Luft und der Chor singt: »Was nämlich jeder voraussieht lange genug, dennoch geschieht es am End.«
Es muss ja nicht gleich die große Apokalypse sein.
Die kleine Apokalypse reicht auch schon. Die alltägliche Begegnung mit dem schnöden Gemeinen. Einmal ins falsche S-Bahn-Abteil zu den falschen Leuten gestiegen, und schon liegt man am Boden, während es Tritte und Schläge hagelt. Einmal auf der falschen Party mit den falschen Leuten und zu viel Alkohol gefeiert und kurz darauf ist man Opfer einer Vergewaltigung. Einmal einen narzisstischen Choleriker als Chef vor die Nase gesetzt bekommen und irgendwann landet man mit Nervenzusammenbruch oder gar Herzinfarkt im Krankenhaus.
Ich selbst habe bisher nur flüchtige persönliche Begegnungen mit dem Bösen gehabt. Ich bin beklaut, abgezockt, verleumdet und belogen worden, aber noch nie wirklich schlimm verletzt. Aber meine vermeintliche Glückssträhne kann schnell reißen. Wenn die echten Schurken aus den Kulissen hervorgekrochen kommen und über mich herfallen, will ich – so gut wie irgendwie möglich – vorbereitet sein. Und wer weiß: Vielleicht drängen mich ja auch meine eigenen destruktiven Tendenzen irgendwann in die falsche Richtung.
Für mich bedeutet dieses Buch außerdem den Abschluss einer vierteiligen Serie über die wesentlichen Fragen des Lebens. Nachdem ich mich in drei Büchern mit dem Glauben (»Mehrwert: Glaube in heftigen Zeiten«), der Hoffnung (»Faithbook: Ein Journalist sucht den Himmel«) und der Liebe (»Mono: Die Lust auf Treue«) beschäftigt habe, wende ich mich nun der Gegenseite zu, der dunklen Seite, dem Bösen. Ich räume meinen Platz an der Sonne und starte zu einer literarischen Höllenfahrt, einer Expedition ins Grauen, einer Reise ins Herz der Finsternis.
So viel kann ich vorwegnehmen: Die Finsternis hat kein Herz, kein Kraftzentrum, keine Größe. Das Reich des Bösen gleicht nicht dem schauerlich-schönen Land Mordor im »Herrn der Ringe« – eher einer von Würmern und Maden bevölkerten Mülltonne. Das Böse schluckt nur, aber es produziert nichts. Der Teufel existiert – und gleichzeitig doch nicht. Seine Essenz ist sein Mangel. Er ist eine Null, ein seelenloser Seinsvernichter, ein erbärmlicher Runterzieher.
Respekt oder gar Ehrfurcht ist deshalb nicht angebracht. Aber Vorsicht, denn die Fouls des Teufels können tödlich sein.
Teil 1
Licht aus
1 Jenseits von Gut
Das Böse in der Theorie
Komplizierte Sachverhalte in aller Kürze erklären – dafür werde ich bezahlt. Was ist ein Überhangmandat? Oder die Vorratsdatenspeicherung? Oder die Flexi-Frauenquote für die Aufsichtsräte von Dax-Unternehmen? Kann ich alles problemlos beantworten, gerne auch in einer Minute.
Und was, bitte schön, ist genau das Böse?
Äh …
Die Schwierigkeit beginnt bereits auf der sprachlichen Ebene. Wenn wir ein positives Qualitätsurteil abgeben, brauchen wir dafür nur ein Wort: »gut«. Für ein negatives Verdikt können wir zwischen »schlecht« und »böse« wählen, je nachdem, ob wir moralische Kriterien anlegen oder nicht. Schlecht ist der Tod, der Schmerz, der Mangel. Böse dagegen ist der Vorsatz, die Tat, der Verbrecher, eben die menschliche Triebkraft hinter der Schlechtigkeit. Die Welt ist mitunter schlecht, nämlich dann, wenn sie Krankheiten, Naturkatastrophen und Hungersnöte hervorbringt. Destruktivität, die aus menschlichem Vorsatz geschieht, nennen wir böse.
Das amerikanische Nachrichtenmagazin Time hat einmal eine »Top Ten« angeblich böser Tiere veröffentlicht. Ganz oben stand der asiatische Karpfen, der die Vegetation ganzer Seen leer frisst; auf den folgenden Plätzen rangierten die Tsetse-Fliege und der Bandwurm. Allesamt fiese Kreaturen, die allerdings nur Ekel und Furcht, aber keine Entrüstung hervorrufen. Denn ihnen fehlt die Kapazität zur freien Willensentscheidung. Tiere können nicht böse sein. Nur schädlich.
Die böse Tat setzt einen Entschluss voraus, der über blinden Triebgehorsam hinausgeht. Wie »frei« solche Entschlüsse tatsächlich sind, danach werde ich in den folgenden Kapiteln forschen. Zunächst interessiert mich das »Böse« an sich und was es ausmacht.
Manchen Menschen attestieren wir einen »guten Kern«. Gibt es auch Menschen mit einem »bösen Kern«? Oder klafft bei ihnen anstelle der Seele ein schwarzes Loch, das sie mit ihren Untaten zu stopfen versuchen?
Viel spricht dafür, dass das Böse keine eigene Substanz hat, sondern ein reines Mangelphänomen ist. Das bestätigen auch Gerichtspsychiater, die sich mit Serienmördern beschäftigen. Sie beschreiben solche Täter als Menschen, die aus einem tief empfundenen Mangel an sich selbst zu Bestien werden.
Die Bösen sind Minus-Menschen. Sie subtrahieren von dem, was existiert. Sie bauen nicht auf, sondern buchen ab. Die Bösen sind wie die ungezogenen Kinder, die die Sandburgen der anderen zertreten. Schlechte Verlierer. Aggressive Unerfüllte. Ihre Größe besteht allein in dem Schrecken, den sie verbreiten. Wir irren, wenn wir hinter ihrer inneren Leere eine charakterliche Tiefe vermuten.
Das Böse ist der schäbige Wadenbeißer der Menschheit. Ihr Herpes. Ihr Krebs. Papst Johannes Paul II. hat das Böse als das bezeichnet, »was zum Leben selbst im Gegensatz steht«. Gut ist, was dem Leben und der Liebe dient. Schlecht ist, was das Leben und die Liebe zerstört. Böse ist, was die Humanität schwächt, das Leben vermiest oder es auslöscht. Wer von der Nichtigkeit des Bösen ausgeht, meint damit nicht dessen Nicht-Existenz. Das Böse und seine schmerzhaften Folgen sind höchst real, aber eben nicht als eigenständige Essenz, die unabhängig vom Guten existieren könnte. Das Böse ist durchweg parasitär. Das hat im späten Mittelalter bereits Thomas von Aquin erkannt: »Böses ohne Gutes kann es nicht geben.« Der Gegenentwurf zur Schöpfung, der teuflische Plan B zum göttlichen Plan A, ist die Schädigung des Seins.
Am besten vergisst man deshalb die Darstellungen des Bösen in der Popkultur: Sauron in »Der Herr der Ringe«, Darth Vader in »Star Wars«, Lord Voldemort bei Harry Potter.
Neben Gänsehaut und Angstschweiß sollte das Böse vor allem eine Reaktion auslösen: Brechreiz.
Zum Kotzen war mir zumute, als immer mehr Details über den norwegischen Massenmörder Anders Breivik an die Öffentlichkeit kamen. Das Böse hat viele Gesichter und es hat sich für den 22. Juli 2011 das von Breivik ausgeliehen. Der selbst ernannte »Tempelritter« wiederum hatte sich auch eine Maske übergezogen, die Maske der Mitmenschlichkeit. Er tarnte sich als Freund und Helfer, als Polizist. Damit erschlich er sich das, was in zwischenmenschlichen Beziehungen einen besonders großen Wert hat: Vertrauen. Als die Teilnehmer eines Jugendcamps vor ihm saßen, nervös, aufmerksam, vertrauensvoll, begann er, auf sie zu schießen. Das Mitgefühl hatte er sich vorher mit monatelangen Selbstabstumpfungsübungen abtrainiert.
Mit »seelischer Verwahrlosung« beschreibt der englische Moralphilosoph Terry Eagleton den inneren Zustand der Bösen. Sie eliminieren das Beste in ihnen, das, was sie zu Menschen macht und über die anderen Säugetiere stellt: ihre Mitmenschlichkeit.
Deshalb ist das schlechte Gewissen, das Täter plagt, oft disproportional zur Schwere ihrer Delikte. Die furchtbarsten Tyrannen verspüren die größte Seelenruhe, weil da nichts mehr in ihnen ist, was gegen ihre Scheußlichkeiten aufbegehren könnte.
Überhaupt ist ein Charakteristikum des Bösen seine Unverhältnismäßigkeit.
Die schlimmsten Monstrositäten entstehen oft aus mickrigen Umständen.
Ich denke dabei an Gavrilo Princip. Ein Typ, der nichts gebacken kriegte. Trotzdem schaffte er es, mitschuldig zu werden am Tod von Millionen von Menschen. Einige Tausend seiner »Opfer« sind nahe der ostfranzösischen Kleinstadt Verdun begraben. Hier befindet sich die bekannteste Gedenkstätte für die Opfer des Ersten Weltkriegs. Zigtausende von Kreuzen sind dort in die hügelige Erde gerammt, wo vor hundert Jahren fast eine Million Deutsche und Franzosen in den Schützengräben umkamen. Als ich zwischen den Kreuzen hindurchgelaufen bin, habe ich an einen anderen Ort gedacht, an den ich ein paar Jahre zuvor gereist war. Eine harmlos aussehende Häuserecke in Sarajevo, an der Princip den Startschuss für den Ersten Weltkrieg gab und damit den großen »Weltbrand« entzündete.
Gavrilo Princip war Serbe, 19, schmächtig und kränklich. Auf den Fotos, die es von ihm gibt, fallen seine tief liegenden Augen auf. Er wollte bei der militärischen Befreiung seines Volkes helfen, wurde aber als untauglich ausgemustert. Also schulte er um auf Terrorist. An einem Sommermorgen lauerte er mit zwei Freunden an einer Häuserecke in Sarajevo dem österreichischen Thronfolger auf und schleuderte ihm einen Sprengsatz ins Auto. Die Bombe kullerte aus dem Wagen und detonierte, ohne großen Schaden anzurichten. Princip flüchtete. Doch dann bekam er den stärksten Verbündeten überhaupt: das Schicksal. Das sorgte dafür, dass der leicht verletzte Thronfolger aufgrund einer fehlerhaften Routenplanung erneut geradewegs in die Arme des Terroristen chauffiert wurde. Der brauchte nur noch abzudrücken und damit so ziemlich alle Völkerkriege des 20. Jahrhunderts einzuleiten. Gavrilo Princip, der schmächtige Wutbürger, hatte den Stein ins Rollen gebracht, der eine Lawine von Grausamkeiten auslöste.
Die meisten Verbrechen gegen die Menschlichkeit werden nicht in Friedenszeiten von Amokläufern und Serienkillern begangen, sondern in Kriegszeiten von ganz normalen Menschen.
Und schon stellt sich die Frage nach der Messbarkeit von Boshaftigkeit. Wer ist böser: Iwan der Schreckliche, der regelmäßig in der Bibel las und dessen Basilius-Kathedrale bis heute den Roten Platz in Moskau ziert, der aber auch seinen Sohn erschlug, seine Ehefrau ertränkte, seinen Minister zentimeterweise zerstückelte und Zehntausende Menschen pfählen, häuten und auf andere fantasievolle Arten zu Tode foltern ließ? Oder Napoleon, der sich als Aufklärer und Menschenfreund verstand, dessen Großmannssucht aber zu weitaus mehr Toten führte als die Grausamkeit des schrecklichen Zaren? Und was ist mit George W. Bush und seinen Beratern, die aus fadenscheinigen Gründen den Irak-Krieg anzettelten und deren unfähige Besatzungspolitik das Land noch weiter ins Chaos stürzte – mit Hunderttausenden Todesopfern als Folge? Können sie sich damit herausreden, dass sie aus besten Absichten handelten und dass Saddam Hussein ein weitaus größerer Schurke war? Was ist wichtiger: das Motiv einer Tat oder die Blutspur, die sie nach sich zieht? Die Perfidität des Täters oder das Leid des Opfers?
Darüber, was gut und gerecht ist, gibt es zwischen allen Völkern der Welt eine ziemlich große Übereinstimmung. Überall als »gut« gelten: Gerechtigkeit, Unversehrtheit, Integrität, Loyalität, Respekt vor Autoritäten. Aber was ist böse? Bei Kindesmissbrauch, Vergewaltigung und Morddelikten bestehen keine Zweifel. Bei Steuer- und Verkehrsdelikten oder bei illegalen Downloads aus dem Internet schon eher.
Meine eigene Faustformel, die ich weder mit Theologen noch mit Rechtsphilosophen abgeglichen habe, lautet so: Böse ist, was das Leben und das menschliche Miteinander beziehungsweise die Liebe mindert.
Der Grad der Bösartigkeit bemisst sich am Vorsatz zur Tat, an deren Schwere und an den Folgen. Folgt man dem amerikanischen Neurowissenschaftler und Moderator einer TV-Show, Michael Stone, kann jedes Delikt irgendwo in einer 22-stufigen Skala des Bösen einsortiert werden. Ganz oben, das heißt im harmlosen Bereich, siedelt Stone die Handlungen an, die ungeplant und aus Notwehr geschehen. Ganz unten werden sadistische und geplante Verbrechen erfasst. Die Bandbreite des Bösen bewegt sich demnach zwischen spontanem Selbstschutz und planvoller Grausamkeit.
Meine eigene Bösen-Skala hat nur drei Etappen:
Die erste ist der blanke Egoismus. Selbstbezogene Menschen, die blind und taub für die Probleme anderer sind, verhalten sich nicht etwa neutral, sondern böse. Weil alle Menschen auf gegenseitige Unterstützung angewiesen sind, insbesondere in den Schwächephasen von Kindheit, hohem Alter und Krankheit, agiert der Egoist in seiner Selbstbezogenheit immer wieder auch zerstörerisch. Oder, um es mit einem abgewandelten Spruch von Wilhelm Busch zu sagen: »Das Böse, das steht fest, ist stets das Gute, das man lässt.« Eine Stufe unter dem passiven Egoismus steht die aggressive Ich-Sucht. Hier setzen Selbstsüchtige ihre Interessen gewaltsam gegen andere durch, schädigen sie aktiv durch üble Nachrede, Betrug, Diebstahl bis hin zu Vergewaltigung und Mord.
Ganz unten im Sumpf der moralischen Degeneration befinden sich die Psycho- und Soziopathen, die Lust dabei empfinden, andere zu quälen, die Gewalt- und Herrschaftsfantasien auf Kosten anderer ausleben, bei denen der Vernichtungstrieb ungebremst ausgelebt wird und die Schreie der Opfer nur als hassverstärkende Klangkulisse wahrgenommen werden.
Was ist nun das Ergebnis meiner Definitionssuche? Was ist das Böse?
Moralische Kaputtheit?
Seelische Verwahrlosung?
Aggressive Egozentrik gepaart mit reduzierter Mitmenschlichkeit?
Oder, wie der Kirchenvater Augustinus es einfach und prägnant formulierte, einfach »Die Abwesenheit des Guten«?
Ich stelle mir das leutselige Lächeln von Adolf Eichmann vor, das feiste Teddybär-Grinsen von Idi Amin, die harmlosen Visagen von Ratko Mladic, dem serbischen Kriegsverbrecher, und Charles Taylor, dem Schlächter von Liberia. Oder die beinahe sanftmütige Prophetenmiene von Osama bin Laden. Sieht so das Böse aus? Nein. Denn das Böse zeigt sich nicht in den Gesichtern der Täter, die hervorragend darin geübt sind, sich selbst und andere zu belügen. Sondern es spiegelt sich auf den Gesichtern der Opfer. Es zeigt sich in ihren Tränen, äußert sich in ihrem Schluchzen, bleibt haften in ihren Leidensgeschichten.
Wer die Charakteristika des Bösen kennen will, stellt am besten den bekannten Liebeshymnus aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther auf den Kopf. Aus dem »Hohelied der Liebe« wird dann ein »Abgesang auf das Böse«. Und der klingt so:
Das Böse ist ungeduldig und unfreundlich.
Das Böse schadet dem anderen.
Das Böse ist launisch, willkürlich und aufgeblasen.
Das Böse ist obszön, selbstverliebt, reizbar, rachsüchtig.
Das Böse fördert die Gemeinheit und die Lüge.
Das Böse schenkt dem anderen nichts.
Das Böse glaubt nichts.
Das Böse hofft nichts.
Das Böse vergibt nichts.
Das Böse bleibt nicht.
Die letzte Feststellung ist die tröstlichste: Das Böse ist ein Provisorium und überhaupt nur existent als vorübergehende Beeinträchtigung des Guten.
Falsch sind deshalb dualistische Welterklärungsversuche, bei denen gute und böse Kräfte im ewigen Clinch miteinander liegen. Genauso irreführend sind monistische Ansätze, bei denen Gott oder ein allumfassendes Prinzip sowohl das Gute als auch das Böse in sich vereinigen.
Es gibt nur das Gute.
Und es gibt die Möglichkeit, sich davon zu entfernen. Sehr weit sogar.
»Jeder Mensch ist ein Abgrund, es schwindelt einem, wenn man hinabsieht«, lässt Georg Büchner den Soldaten Woyzeck seufzen. Dann steigt dieser selbst hinab und wird zum Mörder.
Schwarz vor den Augen und schwindlig im Kopf kann es einem auch werden, wenn man die Tiefpunkte der Menschheitsgeschichte auslotet: bei unserer nächsten Station auf der Safari durch den Dschungel des moralischen Übels.
2 Leichen pflastern seinen Weg
Das Böse in Geschichte und Gegenwart
Das Grab ist eineinhalb Meter lang. Vor dem Grabstein hat jemand einen Strauß Blumen abgelegt. Weit und breit sind keine Besucher zu sehen. Das Grab liegt ganz weit im Westen von Berlin, in einer abgelegenen Ecke des Landschaftsfriedhofs von Gatow. Ich bin eine halbe Stunde herumgeirrt, bis ich die Stelle gefunden habe. Dafür, dass es sich um eine Art Gedenkstätte handelt, scheint das öffentliche Interesse am tragischen Schicksal von Hatun Sürücü spärlich.
Ein paar Jahre zuvor war ich im Kriminalgericht von Moabit dabei, als Hatuns Mörder verurteilt wurde. Der Deutschtürke Ayhan saß zusammen mit seinen zwei älteren Brüdern hinter einer Glaswand. Im Zuschauerraum befanden sich Freunde der Familie. Sie applaudierten, als der Richter das Urteil verkündete: Ayhan wurde nach dem Jugendstrafrecht zu neun Jahren Haft verurteilt, die beiden anderen Brüder wurden aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Dabei war für Prozessbeobachter ziemlich offensichtlich, dass alle drei die Erschießung ihrer Schwester geplant und durchgeführt hatten. Weil sie sich nicht verhielt, wie es sich für eine muslimische Frau geziemte. Sie war aus einer Zwangsehe geflüchtet, war Affären mit verschiedenen Männern eingegangen. Dafür war sie exekutiert worden. Bevor das Verfahren neu aufgerollt werden konnte, setzten sich die beiden älteren Brüder in die Türkei ab. Der Grabstein für Hatun Sürücü ist immer noch nicht bezahlt. Die Familie weigert sich, für die Kosten aufzukommen. Stattdessen schenkten die Eltern dem verurteilten Ayhan eine wertvolle Uhr, offenbar ein Zeichen ihrer Anerkennung und Solidarität.
Der Fall sorgte auch deshalb weit über die Grenzen von Berlin hinaus für Schlagzeilen, weil es sich nicht um einen Einzelfall handelte. Ungefähr zehn Ehrenmorde soll es pro Jahr in Deutschland geben – ein Import aus weniger zivilisierten Regionen, ein Relikt aus barbarischen Zeiten. »So was – mitten unter uns!«, haben sich wohl viele Deutsche zugeraunt, als sie von dem Ehrenmord in der Tagesschau oder einer anderen Nachrichtensendung erfuhren. Denn eigentlich gehen wir alle doch ganz nett miteinander um, oder? Wir haben schließlich aus der Geschichte gelernt. Das denken wir jedenfalls.
Tatsächlich ist das Böse in dieser Welt zwar permanent präsent, aber unterschiedlich stark ausgeprägt. Die besten und die bösesten aller Zeiten gehen manchmal unmittelbar ineinander über. In den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts wurde in Berlin wild getanzt. In den Dreißigerjahren strammgestanden. In den Vierzigerjahren stumm dagelegen, nämlich in Gräbern. Das Böse kommt und geht wellenförmig. Es schwappt wie die Flut über uns und zieht sich wie bei der Ebbe zurück.
Im Moment herrscht in Deutschland wieder einmal Ebbe. Und dabei hoffen wir, dass die Flut so schnell nicht wiederkommt. Denn wir haben hohe Dämme dagegen errichtet. Wir haben die Anreizsysteme geändert. Wir haben gelernt, dass Kooperation sich mehr auszahlt als gewaltsamer Konflikt.
Gewalt ist out.
Zumindest in Europa und den meisten anderen Industrienationen. Hier ist man aus Schaden klug geworden, vorläufig jedenfalls. Denn Fakt ist: Gewalt zahlt sich in den seltensten Fällen aus. Terroristen erreichen fast nie ihre Ziele. Bankräuber und Mörder werden fast immer geschnappt. Schurkenstaaten werden geächtet.
Der Anthropologe Steven Pinker, der ein Mammutwerk über die Entwicklung der Gewalt veröffentlicht hat, kommt zu dem Schluss: »Menschen sind nicht von Geburt an gut, aber sie sind von Anfang an mit Motiven ausgestattet, aufgrund derer sie sich weg von Gewalt und hin zu Kooperation entwickeln können.«
Und sie tun es auch. Nicht immer, aber immer öfter.
Man kann die Menschheitsgeschichte analog zu den verschiedenen Phasen des Lebens verstehen. Kinder kränkeln oft und Pubertierende befinden sich im jahrelangen Ausnahmezustand. Erwachsene sind resistenter gegen Stress und gehen sorgfältiger mit ihrer Energie um. Allerdings: wenn sie zuschlagen, dann richtig.
Auf die Weltgeschichte übertragen heißt das: In der Stein- und Bronzezeit herrschte das Gesetz der Stärke; da wurde nicht lange diskutiert, sondern gleich zugeschlagen, nicht nur mit der Faust, sondern auch mit der Axt und dem Schwert. Im Mittelalter war die Mordrate auch noch ungefähr fünfzig Mal so hoch wie heute.
Seitdem haben die Menschen ihre Triebkontrolle und Aggressionssteuerung verbessert. Nicht von ungefähr blicken wir Westeuropäer auf die längste Friedenszeit überhaupt zurück.
Seit es die Menschen gibt, herrschen Gewalt, Verwundungen und Tod. Als das fünftausend Jahre alte Skelett des Eismanns Ötzi gefunden wurde, stellte sich heraus, dass der Bergbewohner nicht etwa an einem Herzinfarkt oder einer Kreislaufschwäche gestorben war – sondern an einem Pfeil, den ihm jemand in die Schulter geschossen hatte. Der Mythos vom friedliebenden Tiroler Ur-Burschen war damit gestorben.
Mit einem Mord beginnt bekanntlich auch die biblische Urgeschichte. Kain, der sesshafte Ackerbauer, erschlägt Abel, den nomadisierenden Hirten. Aus dem blutigen Kampf zwischen Männern wird bald der Kampf zwischen Stämmen, später ganzen Völkern. Ein Imperium nach dem anderen steigt auf, unterjocht die Nachbarländer und fällt wieder. Städte werden dem Erdboden gleichgemacht, die Bevölkerung kollektiv ermordet oder versklavt, die Frauen vorher oft vergewaltigt.
So war sie, die böse alte Zeit. Der israelische König David, der vor ungefähr dreitausend Jahren lebte, klagte: »Denn diese Lügner sind überall, und die Gemeinheit unter den Menschen nimmt ständig zu.«
Ein paar Jahrhunderte später konstatiert der Prophet Micha: »Im ganzen Land gibt es keine rechtschaffenen Menschen mehr, keiner fragt mehr nach Gott. Einer lauert dem anderen auf und legt ihn herein, so wie der Jäger sein Wild ins Fangnetz treibt. Sie gehen sogar über Leichen.«
Und sein Kollege Habakuk assistierte: »Unterdrückung und Gewalt, wohin ich blicke, Zank und Streit nehmen kein Ende! Niemand nimmt mehr das Gesetz ernst – wie soll da noch ein gerechtes Urteil gefällt werden? Der Gottlose treibt den Unschuldigen in die Enge, Recht wird in Unrecht verdreht.«
Selbst die Gottesfürchtigen dieser frühgeschichtlichen Epoche verhielten sich nicht viel besser als heutzutage die Taliban. Sie peitschten, steinigten und zitterten selbst die ganze Zeit um ihr Leben.