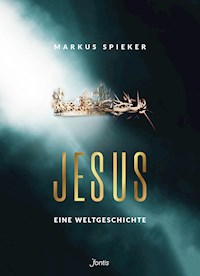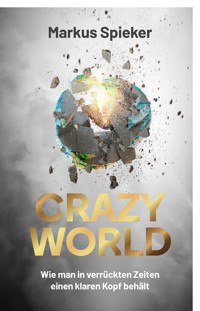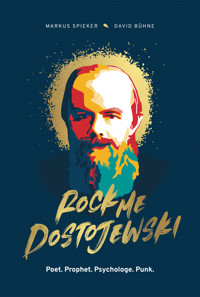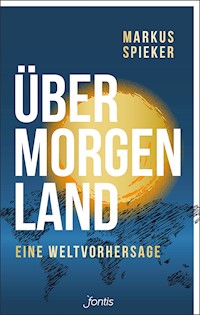
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fontis AG
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die Welt ändert sich. Und nirgendwo so radikal wie in Asien. Als Leiter des ARD-Studios Neu Delhi hat Markus Spieker vier Jahre von den Frontlinien des Wandels berichtet: in einem Gebiet rund um Indien, in dem fast zwei Milliarden Menschen leben. Er ist durch Afghanistan gereist, durch Rohingya-Flüchtlingscamps gelaufen, hat sich aber auch in den Hightech-Metropolen Shanghai, Singapur und Seoul umgesehen. Jetzt kommt er zurück mit einer schlechten Nachricht: Wir werden im Weltvergleich immer weniger, immer älter, immer bedeutungsloser. Vor allem viele Führungskräfte sind von gestern, gefangen im Irrglauben, dass das Beste der 80er und 90er auch das Beste von heute ist. "Die Eliten und Institutionen von heute gründen sich auf die Ideen von gestern und sind deshalb unfähig, die Probleme von morgen in den Griff zu kriegen", schreibt Spieker. Doch er hat auch eine gute Nachricht: Wir können wieder Spitze werden, krisenfester und glücklicher. Wenn wir die Nabelschau beenden, unsere schrulligen Multikulti- und Gender-Debatten ad acta legen und uns stattdessen den globalen Herausforderungen stellen. Spieker präsentiert zwanzig Top Trends der Weltentwicklung, darunter einige überraschende: Trotz aller Schwierigkeiten wird die Sicherheitslage insgesamt besser, nimmt das Bildungsniveau weltweit zu. Nichts boomt so sehr wie die Religionen, allen voran das Christentum. In einer Zeit, in der sich alles ändert, zählt das Bleibende und ist Tradition der neue Fortschritt. – Eine rasante Zukunftsschau, die nicht auf Theorien beruht, sondern auf Erste-Hand-Begegnungen rund um die Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus Spieker Übermorgenland
Für Tabitha, meinen Sonnenaufgang1
Markus Spieker
Übermorgenland
Eine Weltvorhersage
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
© 2019 by Fontis-Verlag Basel
Umschlag: Olaf Johannson, Spoon Design, Langgöns Bild Umschlag U1: IIIerlok_Xolms/Shutterstock.com E-Book-Vorstufe: InnoSet AG, Justin Messmer, Basel E-Book-Herstellung: Textwerkstatt Jäger, Marburg
ISBN (EPUB) 978-3-03848-520-9
Inhalt
Prolog
Nacht
(Hammelburg & Berlin)
Erster Teil
Gesternland
Warum wir die Welt nicht mehr verstehen
1. Hilfe, wir haben uns selbst geschrumpft!
Warum wir immer weniger wichtig werden
2. Sorry, aber wir sind gerade mit uns selbst beschäftigt
Wie Asien an uns vorbeizieht
3. Wir Weltverbesserer
Auf dem falschen Trip mit dem Außenminister
4. Von Marco Polo zu Pippi Langstrumpf
Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt
5. Das Judas-Prinzip
Was Macht mit uns macht
6. Des einen Leid ist des anderen Karrieresprungbrett
Der morbide Charme der Medien
7. Fake History
Wie uns moderne Mythen in die Irre führen
8. Guru-Dämmerung
Grau ist alle Gender-Theorie. Oder: Welchen Experten wir vertrauen können
9. Besuch beim Herrn des Universums
Wie die Welt wirklich tickt
10. Generation Hanno
Warum die Jugend von heute von gestern ist
Zweiter Teil
Morgenland
Wohin die Welt sich wirklich entwickelt
1. Die Welt wird widersprüchlicher
Irre! Uns geht es schlechter, weil es uns besser geht
2. Die Welt wird voller
Mehr Berghain wagen
3. Die Welt wird wärmer
Morgenstund hat Staub im Mund
4. Die Welt wird jünger
Isch mach disch Altersheim!
5. Die Welt wird wütender
Völker, hört die Randale!
6. Die Welt wird härter
Last Exit Duisburg
7. Die Welt wird klüger
Es war einmal eine Bildungsnation
8. Die Welt wird weiblicher
Männerbeben
9. Die Welt wird autoritärer und populistischer
Der Sufi, der von Hitler schwärmte
10. Die Welt wird ungleicher
Breaking News: Das obere eine Prozent … sind wir selbst!
11. Die Welt wird sicherer
Schlagzeilen sind vom Mars, das Kleingedruckte ist von der Venus
12. Die Welt wird unruhiger – vor allem für Christen
Stell dir vor, es ist Krieg, und keiner sieht hin
13. Die Welt wird frommer (außer bei uns)
Der heißeste Trend des Jahrhunderts
14. Die Welt wird islamischer
Mullahs ante portas
15. Die Welt wird sinnloser
Warum es immer mehr Gottlose gibt, aber sie sich trotzdem nicht vermehren
16. Die Welt wird künstlicher
Hilfe, die Liebesroboter kommen!
17. Die Welt wird schmutziger
Die Revolution verfüttert ihre Kinder
18. Die Welt wird familienorientierter
Volle Dröhnung Oxytocin
19. Die Welt wird exklusiver
Zurück zum Stammesfeuer
20. Die Welt geht unter
Der Killer-Trend
Dritter Teil
Übermorgenland
Wie wir besser, krisenfester und unsterblich werden
1. Volk ohne Traum
Fokus verändern
2. Wo vorne ist, und wie wir dahin kommen
Stärken stärken
3. Zurück zu King Kong
Tradition ist der neue Fortschritt
4. Lob des Sozialkapitalismus
Gemeinschaft festigen
5. Wo der Dalai Lama Recht hat – und wo nicht
Konsumdiät machen
6. Und die beste Religion aller Zeiten ist …
Sinn suchen
7. Der Engel von Karachi
Glück bringen
8. Erleuchtung im Himalaya
Gott glauben
9. Jenseits von links und rechts
Wegweiser finden
10. Agenda 2030
Kirche leben
Epilog
Tag(Brooklyn, New York)
Anmerkungen
Bildteil
Prolog
Nacht
(Hammelburg & Berlin)
Es ist stockdunkel.
Seit vier Stunden und einer gefühlten Ewigkeit hocke ich mit verbundenen Augen auf dem Boden. Ich weiß nicht, wo ich bin. Aus einem Lautsprecher scheppert orientalische Tanzmusik. Ich habe Durst, aber traue mich nicht, um Wasser zu bitten. Ich wage nicht einmal, meine Sitzposition zu verändern. Wenn ich mit meinem Hintern zur Seite rutsche, bellt eine Stimme auf Englisch, dass ich mich gefälligst nicht rühren soll. Dass ich Dreck bin.
«Sag, dass du Dreck bist. Sag, dass du gehorsam sein wirst.»
«Ich werde gehorsam sein», sage ich.
«Lauter!»
«ICH WERDE GEHORSAM SEIN!»
«Mitkommen!»
Jemand packt mich am Arm. Ich werde aus dem Zelt geführt, über einen Hof, in ein Gebäude.
«Setz dich.»
Ich sacke auf einen Stuhl. Einige Männer mit barschen Stimmen verhören mich. Ich habe keine Ahnung, wie viele. Für wen ich spioniere, wollen sie wissen.
«Ich bin Journalist», verteidige ich mich.
«Du lügst!», schreien sie mich an.
Nach einer Viertelstunde werde ich abgeführt, muss mich wieder zu den Kollegen hocken, die zusammen mit mir verschleppt wurden.
Am frühen Morgen haben sie uns entführt, aus einer schäbigen Herberge. Ich hatte nur ein paar Stunden geschlafen, als ich Lärm hörte, Schritte, Schüsse. Eine Gruppe Vermummter stürmte das Haus, trieb alle dort Anwesenden zusammen. Wir mussten die Hände hochnehmen, bekamen Säcke über die Köpfe gestülpt, wurden in einen Kleinbus bugsiert. Nach einer wilden Fahrt kamen wir in unserem Gefängnis an. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind und wie unsere Entführer aussehen.
Das ändert sich plötzlich. Meine Augenbinde, die nicht fest genug zugebunden war, löst sich von selbst. Ich kann darunter durchblicken. Ich sehe einige bärtige Männer, die wiederum Blickkontakt zu einer Frau halten.
Sie ist um die dreißig, blond, sieht ganz und gar nicht wie eine islamistische Terroristin aus.
Es ist die Bundeswehrpsychologin, die aufpasst, dass die Übung nicht aus dem Ruder läuft. Sie blickt auf die Uhr. Dann nickt sie den als Terroristen verkleideten Soldaten zu.
Das Gejaule aus den Lautsprechern stoppt. Das Krisenvorbereitungstraining für Journalisten ist beendet. Die anderen Kollegen und ich nehmen die Augenbinden ab und freuen uns, dass bald der Zug abfährt. Aus Hammelburg in Unterfranken geht es dann zurück in unsere verschiedenen Redaktionen.
Ich habe jetzt eine ungefähre Vorstellung davon, was mich in meiner künftigen Einsatzregion erwartet. Ich soll als Fernsehkorrespondent aus Südasien berichten. Mein Berichtsgebiet umfasst, grob gesagt, die Länder, die zwischen dem Himalaya und der Antarktis liegen. Fast zwei Milliarden leben hier, die meisten davon in Indien, die übrigen in Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Bangladesch, Pakistan, Afghanistan. Und, nicht zu vergessen, auf den Malediven.
Aber an dieses Inselparadies denkt mein Chef sicher nicht, als er mir bei der Abschiedsfeier in Berlin mit auf den Weg gibt: «Sie reisen in das gefährlichste Korrespondentengebiet.» Mein Hals wird trocken. Ich nippe an meiner Apfelschorle.
Inzwischen ist meine Korrespondentenzeit um.
Die gute Nachricht für mich ist: Ich lebe noch. Die schlechte Nachricht für uns alle ist: Jetzt geht der Stress erst richtig los.
Ursprünglich wollte ich ein Buch über meine spannendsten Reporter-Erlebnisse am Hindukusch und am Ganges schreiben. Bis ich mir eingestehen musste: Es gibt eine Geschichte, die wichtiger ist und die alle meine Erlebnisse überlagert. Es ist die Geschichte einer Welt, die sich im Krisenmodus befindet.
Krise bedeutet nichts anderes als Wendepunkt oder Umstellung. Wir erleben gerade die größte anzunehmende Umstellung aller Zeiten, einen welthistorischen GAU.
Im 21. Jahrhundert kommen drei Megatrends zusammen, die jeder für sich genommen alle bisherigen Revolutionen in den Schatten stellen und die zusammen den perfekten Sturm, den maximalen «Wind of Change» erzeugen: Die Globalisierung. Die Digitalisierung. Die Individualisierung.
Alles ändert sich gerade, die Weltordnung, die Arbeitswelt, die Beziehungsstrukturen. Mehr Wandel erfordert mehr Anpassung, das Einüben neuer Entscheidungsprozesse kostet viel Energie, was wiederum anstrengt, Stress verursacht, Burn-out bewirkt. Deshalb bewegen sich immer mehr Gesellschaften am Rande des Nervenzusammenbruchs.
Mein Chef hatte Recht. Es wird gefährlich. Für uns alle.
Bei meinen Reisen durch Asien und bei Urlaubsbesuchen in der Heimat habe ich einen Vorgeschmack auf die Zukunft bekommen. Ich habe eine Welt im Aufbruch erlebt und Gesellschaften, die unter extremen Wachstumsschmerzen leiden.
Ich habe aber auch gesehen, wie eine Welt untergeht. Die Welt, in der wir uns wohlig eingerichtet haben. Die Welt, in der es immer weiter aufwärtsgeht – mit uns an der Spitze. In der es immer gerechter zugeht – selbstverständlich auf unserem Niveau. Die Welt, die wir kennen, die wir mögen und kontrollieren. Diese Welt ist Geschichte. Das 19. Jahrhundert gehörte uns Europäern, im 20. Jahrhundert dominierten die USA, und das 21. Jahrhundert wird am stärksten von asiatischen Ländern geprägt werden. Die Musik spielt immer lauter da, wo die Sonne früher aufgeht als bei uns: im Morgenland.
Mich treibt in diesem Buch die Frage um: Was kommt auf uns zu, was verschwindet, was bleibt? Wie können wir uns für die neuen Herausforderungen wappnen – wirtschaftlich, politisch, kulturell?
So weit, so vernünftig.
An dieser Stelle ist eine Warnung angebracht. Vor mir selbst. Einige Leser werden sich an einigen Stellen verwundert die Augen reiben. Dann nämlich, wenn ich vom Pfad der journalistischen Beobachtung abweiche und zum religiösen Bekenner mutiere.
Dass Asien seinen Besuchern die Köpfe verdreht, ist nichts Neues. Das ging schon dem Lieblingsautoren meiner Kindheit so. Karl May (1842–1912) war berühmt geworden mit schnörkellosen Abenteuergeschichten über Länder, die er nie gesehen hatte. Dann reiste er selbst in den Orient und quälte anschließend seine Fans mit allegorischen Romanen über die Fantasiereiche «Ardistan» und «Dschinnistan» und mit Spekulationen über das «Reich der Edelmenschen».
Auch ich werde mich auf einen zuweilen schrägen Trip begeben. Ich werde die in meiner Branche übliche nüchtern-skeptische Haltung aufgeben und mich klar positionieren. Allem voran als Christ. Mein Lebensmotto ist nun einmal der Ratschlag, den ein anderer Pfarrerssohn und Journalist, Matthias Claudius (1740–1815), seinem Sohn gegeben hat: «Gehe nicht aus der Welt, ohne deine Liebe und Ehrfurcht für den Stifter des Christentums durch irgendetwas öffentlich bezeugt zu haben.»2
Dass ich das Thema Religion sehr ausführlich behandeln werde, hat aber auch einen professionellen Hintergrund. Anders als im säkularisierten Europa sind die Religionen in Südasien allgegenwärtig und überdeutlich sichtbar. Ich habe in den letzten Jahren mehr Mönche, Mullahs und Priester interviewt als Politiker oder Wirtschaftsbosse. Für sie, genau wie für die meisten Menschen in Asien, sind diesseitige und jenseitige Dinge, Tradition und Fortschritt ganz selbstverständlich miteinander verbunden. Sie sind davon überzeugt, dass zukünftiges Wachstum nur möglich ist, wenn man seine eigenen Wurzeln pflegt.
Und ich bin davon überzeugt, dass wir in dieser Hinsicht von Asien lernen können.
Aber keine Angst: Ich werde nicht den Propheten geben. Ich werde zwar viele Prognosen machen und versuchen, sie mit Statistiken und Anekdoten zu begründen. Mein hauptsächliches Anliegen besteht aber darin, Denkmöglichkeiten aufzuzeigen und neue Vorstellungsräume aufzuschließen. Meine Ausführungen beruhen nicht auf Offenbarungen, sondern auf Gedankenblitzen, die mir in den letzten vier Jahren gekommen sind. Ich verstehe mich als Pilger, der in einer Zeit der rasanten Beschleunigung und der extremen Horizonterweiterung versucht, sich selbst und anderen Orientierungshilfen zu geben.
Einen präzisen Zukunftsfahrplan lege ich nicht vor. Ich beschreibe Eindrücke und Ahnungen, bin mir aber im Klaren darüber, dass sie schon in wenigen Monaten überholt sein können.
Damit die Lektüre auch dann noch Wissen vermittelt und Spaß macht, habe ich das Buch so angelegt, dass es auch als Reisebericht funktioniert. Ich war schließlich da unterwegs, wo Sindbad der Seefahrer herumirrte und wo das historische Vorbild von Robinson Crusoe ums Überleben kämpfte,3 in den Ländern, in denen Pfeffer, Chili und Curry und andere natürliche Geschmacksverstärker wachsen.
In diesem Sinn hoffe ich, dass Übermorgenland kein Unwohlsein verursacht, sondern bei aller heftigen Kost Appetit auf die Zukunft macht.
Erster Teil
Gesternland
Warum wir die Welt nicht mehr verstehen
Vor dem Aufbruch ins Morgen kommt der Abschied vom Gestern.
Ich gehe zwanzig Jahre zurück: 1999. Damals begann meine journalistische Laufbahn. Die Regierungschefs hießen Schröder, Blair, Clinton, Jelzin, der islamistische Terrorismus war nur eine ferne Bedrohung, China immer noch ein bloßer Geheimtipp und Deutschland zehn Jahre nach dem Fall der Mauer obenauf.
Bei der Millennium-Party am Brandenburger Tor feierte ich mit einer Million Menschen aus Ost und West den Anbruch des neuen Jahrtausends. Modern Talking sang «You’re My Heart, You’re My Soul», und Otto Waalkes riss seine alten Kalauer. Die Show müffelte nach Vergangenheit, aber die Atmosphäre war dennoch von Aufbruchsstimmung geprägt.
Mittlerweile ist das so weit weg, dass ich mich insgeheim frage, warum die abgespeicherten Bilder in meinem Kopf nicht schwarzweiß sind. Die Selbstverständlichkeit von damals ist jedenfalls futsch, genau wie die Idee, das Ende der Geschichte sei erreicht und man könne die nächsten Jahrhunderte im Chill-Modus verbringen. 1989 ging nicht die Geschichte zu Ende, sondern nur das kommunistische Projekt. Mittlerweile ist auch das liberal-kapitalistische Projekt in der Krise.
«Wir leben in verrückten Zeiten», höre ich oft. Das erinnert mich an den berühmtesten Theaterhelden: Hamlet.
«Die Zeit ist aus den Fugen», klagt er, weil er die Ereignisse um sich herum nicht einsortiert kriegt. Dabei ist das Hauptproblem er selbst. Er schwankt zwischen Aktionismus und Zaudern. Am Ende liegen fast alle Protagonisten, er selbst eingeschlossen, tot auf der Bühne.
Ganz so schlimm wird es uns schon nicht treffen. Mit «uns» meine ich vor allem uns Deutsche, aber auch uns Europäer, uns Westler, uns Bewohner des christlichen Abendlandes. Von Hamlet können wir lernen, wie man es besser macht. Nämlich indem man die Zeichen der Zeit korrekt diagnostiziert und dann angemessen reagiert.
Es folgen einige sachdienliche Hinweise.
1. Hilfe, wir haben uns selbst geschrumpft!
Warum wir immer weniger wichtig werden
Auch Politiker haben Mantras: Sprüche, die sie so oft aufsagen, dass man glauben könnte, sie wollten damit die Welt verändern. Besonders gut gefällt mir das Mantra von Volker Kauder, dem langjährigen Vorsitzenden der Unions-Bundestagsfraktion. Ich kann mich an kaum ein Gespräch mit ihm erinnern, in dem er es nicht aufgesagt hat. Es lautet:
«Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit.»
Er hat Recht. Nur könnte man seine Einsicht von der Politik auf die gesamte menschliche Existenz erweitern. Klug ist, wer sich der Realität stellt. Umgekehrt ist Wirklichkeitsverlust das wichtigste Kennzeichen von Wahnsinn.
Zur Wirklichkeitserfassung gehört die Einschätzung der eigenen Wichtigkeit. Und hier fängt bei vielen Debatten in Deutschland das Problem an. Wir tun so, als würde der Rest der Welt mit großem Interesse auf uns schauen, als wären wir eine Großmacht.
Sind wir aber nicht. Und zwar immer weniger.
Vor hundert Jahren war einer von fünfundzwanzig Erdbewohnern deutsch.
Heute nur noch einer von hundert.
1 Prozent.
Das ist, jedenfalls in puncto Personenstärke, unser Gewicht in der Welt. Am Ende des 21. Jahrhunderts werden es kaum mehr als 0,5 Prozent sein. Wir werden in der Welt dann ungefähr dieselbe Machtstellung haben wie heute das kleine Slowenien in Europa.
Wir machen unsere geringere Quantität auch nicht durch gesteigerte Qualität wett. Weil ich ein Bücherliebhaber bin, suche ich in allen Metropolen der Welt, die ich bereise, Buchläden auf. In der Abteilung «Klassiker» stoße ich immer noch auf die Werke von Thomas Mann und Günter Grass. Neuere deutsche Literatur: Fehlanzeige. Und deutsche Kinofilme zeigt in den meisten Ländern höchstens das Goethe-Institut.
Der deutsche Export läuft zwar immer noch auf Hochtouren, aber einige Statistiken zeigen, dass unsere Wirtschaft sich im Stagnations- oder sogar Abstiegsmodus befindet. Wir fallen zurück in den Kategorien Produktivität, Patent-Anmeldungen, Gesamtwirtschaftsstärke.
Auch unsere Infrastruktur ist in vielen Bereichen entfernt von der Weltspitze. Der Internet-Empfang ist in manchen Himalaya-Dörfern besser als in einigen deutschen Landkreisen. Unsere wichtigsten öffentlichen Bauvorhaben machen uns weltweit zur Lachnummer:
In derselben Zeitspanne, in der es immer noch nicht gelungen ist, den Berliner Flughafen BER fertigzustellen, sind alleine in Indien hundert hochmoderne Flughäfen entstanden. Und in den meisten davon geht die Abfertigung ruckzuck.
Ganz anders in Deutschland: Wenn ich von Frankfurt nach Delhi zurückflog, wurde manchmal gestreikt. Oder die Anfahrt verzögerte sich wegen zahlloser Baustellen. Oder die Geräte bei der automatischen Passkontrolle waren defekt. Oder die Schlangen beim Sicherheitscheck reichten fast bis zum nächsten Terminal, weil zu viele Sicherheitskräfte gerade krank waren.
Hochsommerliche Bahnfahrten in Deutschland wurden für mich zur Tortur, weil immer wieder die Klimaanlage ausfiel. Und auf der Autobahn kam ich wegen der vielen Baustellen oft langsamer voran als auf Wüstenpisten in Rajasthan.
Zukunftsfähigkeit sieht anders aus.
Doch die meisten scheint das nicht zu stören. Unsere wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit treibt uns weniger um als das Abschneiden bei der Fußball-WM oder beim European Song Contest. Wer unsere Zeitungen liest, könnte meinen, der entscheidende Wettbewerb finde vor allem zwischen Parteien statt – um Prozentpunkte bei Umfragen. Dabei ist der Wettbewerb zwischen Volkswirtschaften natürlich viel wichtiger. Es geht um Marktzugänge, Fachkräfte, Innovationen.
Junge deutsche Linke, die gegen die Milliardäre im eigenen Land wettern, lassen außer Acht, dass die meisten Milliardäre längst nicht mehr in Europa, auch nicht in Amerika, sondern in Asien zuhause sind – und irgendwann versuchen werden, auch Aldi, Siemens und Mercedes aufzukaufen.
Es hat bekanntlich über hundert Jahre gedauert, bis unsere Vorfahren den Schock der kopernikanischen Wende verdaut hatten. Jetzt kommt die nächste Zumutung, an der wir ebenfalls etwas länger kauen werden, bis wir sie herunterschlucken.
Die Welt dreht sich zwar, aber sie dreht sich nicht um uns und unsere Wünsche.
Deutschland, mit seinen sauber ausgearbeiteten Verwaltungsvorschriften, erinnert mich immer mehr an einen Zoo, der allmählich in die Jahre kommt. Die Welt da draußen ist ein Dschungel. Und dort herrscht das älteste und gnadenloseste Recht: das des Stärkeren. Es reicht nicht, gut zu sein, um sich durchzusetzen. Man muss besser sein.
Dafür brauchen wir keine neuen Feindbilder. Denn eigentlich will uns niemand etwas Böses. Da, wo die Konkurrenz stärker wird, findet man uns im Gegenteil ganz gut. Deutschland gehört seit Jahren konstant zu den beliebtesten Ländern schlechthin. In Asien, wo wir in den letzten Jahrhunderten anders als die Franzosen, Engländer und Amerikaner nicht durch Kolonialverbrechen und Kriege negativ aufgefallen sind, haben wir vielleicht sogar die meisten Fans.
«I like Germany», habe ich fast jedes Mal gehört, wenn ich mich als deutsch geoutet habe. Als Begründung kam meistens eine der 3-M-Antworten: Merkel. München – nicht die Stadt, sondern der FC Bayern. Und Mercedes – oder ganz allgemein Maschinen und Motorwagen. Wenn ich durch die Gassen in Delhi laufe, halten mir die Anwohner ihre hochgestreckten Daumen entgegen oder wollen Selfies mit mir knipsen.
Krasse Erkenntnis: Die Menschen mögen uns.
Wie der freundliche Unbekannte in Delhis vollster U-Bahn-Station, der mir vom Fahrkartenschalter bis zum weit entfernten Bahnsteig hinterherrannte – mit einem Geldschein, den ich liegen gelassen hatte. Zehn Rupien, umgerechnet zwölf Cent. Ich war perplex und sagte, er könne das Geld gerne behalten. Er bestand darauf, dass ich es einsteckte, um dann zu fragen, woher ich käme.
Auf meine Antwort hin strahlte er: «I like Germany.» Er nannte mir auch den Grund. Irgendwas mit M.
Beliebt statt stark und wichtig, vielleicht ist das gar keine so schlimme Entwicklung. Solange man akzeptiert, dass man sich davon nicht so viel kaufen kann.
2. Sorry, aber wir sind gerade mit uns selbst beschäftigt
Wie Asien an uns vorbeizieht
Was habe ich gelacht damals. 1998 brachte der Comedian Rüdiger Hoffmann eine CD heraus. «Asien. Asien.» Eine spöttische Auseinandersetzung mit dem Asien-Hype, den es damals schon gab. Wirklich daran geglaubt, dass China und seine Nachbarn uns eines Tages überholen würden, haben außer dem 2015 verstorbenen Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt aber die wenigsten.
Wer nach Peking und Shanghai reiste, kam mit Uhren und DVD-Raubkopien im Gepäck zurück. Und mit der Gewissheit: Die sind noch lange nicht so weit.
Inzwischen ist uns das Lachen vergangen. Viele asiatische Länder ziehen an uns vorbei – zumindest architektonisch. Neun der zehn höchsten Gebäude der Welt befinden sich östlich des Bosporus, dazu viele andere Beton-, Stahl- und Glas-Extravaganzen.
Wer Doha besucht, die Hauptstadt des Golf-Staats Katar, kommt aus dem Kopfschütteln nicht heraus. Wer hat sich diese Zick-Zack-Türme, diese Ostereier-Hochhäuser ausgedacht, und wer hat das Geld dafür ausgegeben?
Mein futuristischer Lieblingsbau steht in Dubai, im Schatten des (momentan) weltweit höchsten Gebäudes, des Burj Khalifa. Von dessen Aussichtsplattform kann man den «Dubai Frame» sehen, eine Art Triumphbogen, der wie ein Bilderrahmen aussieht, hundertfünfzig Meter hoch.
Für mich hat der Rahmen eine symbolische Bedeutung. Statt des Abendlands rückt neuerdings das Morgenland die Dinge ins Bild, setzt die Maßstäbe, gibt Orientierung. Das Momentum, die Dynamik, das größte Wachstumspotenzial liegen im Osten. Fast zwei Drittel der Weltbevölkerung leben in Asien. Zählt man Istanbul dazu, befinden sich neun der zehn größten Städte der Welt auf diesem Kontinent.
Aber es kommt ja nicht nur auf die Größe an.
Eher bescheiden sind die Ausmaße der Wolkenkratzer in Singapur, sechstausend Kilometer weiter östlich. Der Stadtstaat am Äquator wurde zur «Smartest City» weltweit gewählt. Nirgendwo ist die Infrastruktur moderner, sind die Verkehrsmittel besser aufeinander abgestimmt, ist der Wohlstand größer. Ein riesiger Einkaufstempel mit den führenden Luxusläden reiht sich an den anderen. Und im Nationalmuseum erklärt der Staatsgründer Lee Kuan Yew (1923–2015) in einem Video aus dem Jahr 1965 das nationale Ziel: Man wolle ein multikulturelles Musterland werden.
Das ist gelungen, wenn auch um den Preis erheblicher Freiheits-Einschränkungen und drakonischer Strafbestimmungen. Für Drogenschmuggel gibt es die Todesstrafe, für Graffiti-Schmierereien Prügel, für Kaugummi-Einfuhr Gefängnis oder eine hohe Geldstrafe. Singapur gilt, gerechnet auf das Pro-Kopf-Einkommen und die Lebenshaltungskosten, als reichste Stadt Asiens und als teuerste Stadt der Welt.
Wer sich davon nicht vor Ort überzeugen will, kann das stattdessen im Kino tun. Singapur ist der Schauplatz eines der erfolgreichsten Kinofilme des Jahres 2018: «Crazy Rich Asians». Wie der Name verrät, geht es um obszön wohlhabende Asiaten, die eine dekadent opulente Hochzeit feiern.
Der Vorspann der knallbunten Komödie spricht für sich: Rückblende in die neunziger Jahre. Eine Chinesin betritt in London ein Luxushotel und will die für sie reservierte Suite beziehen. Der Rezeptionist kann die Buchung nicht finden und schlägt ihr stattdessen herablassend vor, im Stadtviertel Chinatown nach einem Zimmer zu suchen: «Das passt bestimmt besser für Sie.»
Die Chinesin hat eine andere Idee. Sie geht kurz vor die Hoteltür, erledigt einen Anruf, kauft das Hotel.
Szenen wie diese haben den Film vor allem bei Asiaten zu einem Riesenhit werden lassen. Sie sind stolz darauf, es den arroganten Schnöseln im Westen zu zeigen.
Ein paar Filmszenen später folgt, zumindest für westliche Zuschauer, die nächste Zumutung. Wir sehen die stolze Hotel-Käuferin in ihrem Palast in Singapur. Sie trifft sich mit anderen wohlhabenden Frauen – zum Bibelkreis. Gemeinsam studieren sie die Paulus-Briefe. Die Szene entspricht der Wirklichkeit: Christen bilden in Singapur die zweitgrößte Religionsgemeinschaft. Im teuren Zentrum der Metropole gibt es ebenso viele Kirchen wie Shopping-Malls.
Singapur ist da keine Ausnahme. Auch in anderen asiatischen Ländern boomt das Christentum, vor allem in Südkorea, aber auch in China. Dort gibt es mittlerweile mehr Christen als in Deutschland. Nicht nur finanziell, auch christlich-spirituell läuft Asien dem Abendland den Rang allmählich ab.4
Technologisch sowieso.
Im Spätsommer 2018 habe ich Shanghai besucht. Schon die Fahrt vom Flughafen in die Innenstadt hat mich schwer beeindruckt. Mit 301 Stundenkilometern schießt der Transrapid durch die Vororte. Theoretisch könnte der Zug noch 130 km/h zulegen, aber dafür ist die Strecke zu kurz.
Als ich aussteige, bin ich umzingelt von Wolkenkratzern, von denen der «Shanghai Tower» mit 632 Metern am höchsten ragt. An den Straßenlaternen hängen Plakate für die große «Künstliche Intelligenz»-Weltkonferenz, die gerade stattfindet. Ich habe leider keine Zeit, selbst hinzugehen.
Und wie sieht es bei uns aus?
Auf meinem Handy schaue ich nach, welche Nachrichten die Kollegen in der deutschen Heimat beschäftigen. Es gibt mal wieder Riesen-Zoff in der GroKo. Der Streit um den Noch-Verfassungsschutzchef Maaßen spitzt sich zu. Es geht um sein zukünftiges Gehalt, um die hundertfünfzigtausend Euro im Jahr, ein paar Tausend Euro mehr als vorher. Die Aufregung ist groß. Die Diskussionen darüber, wie er künftig eingruppiert werden soll, wird die deutsche Nation tagelang in Atem halten.
Von der Künstliche-Intelligenz-Konferenz lese ich dagegen nirgendwo etwas. Auch nicht davon, dass die Stadt Shanghai in den nächsten Jahren fünfzehn Milliarden Euro für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz ausgeben will.
Und China ist gerade in Spendierlaune. Ich erinnere mich an eine Schlagzeile, die erst ein paar Wochen her ist: Da hat die Regierung in Peking für Projekte in Afrika insgesamt sechzig Milliarden Dollar lockergemacht.
Wir beschäftigen uns lieber mit uns selbst. Auch wenn es krass klingt: So führen sich Verlierer auf. Selbstbezogen und blind für das, was sich draußen zusammenbraut. Wenn wir uns vor äußeren Bedrohungen fürchten, dann vor den falschen. In der aktuellen Rangliste der «Ängste der Deutschen» stehen der amerikanische Präsident Donald Trump und seine Weltpolitik ganz vorne.5 Die Leute plappern hier die Phantom-Ängste nach, die ihnen von den Medien souffliert werden.
In Wirklichkeit werden unser Wertesystem und unser wirtschaftlicher Wohlstand von ganz anderer Seite bedroht. Das habe ich jedenfalls in vielen Gesprächen mit hochrangigen deutschen Diplomaten gelernt. Sie sehen allesamt China als die größte Herausforderung. Sie zeichnen gleichzeitig ein differenziertes Bild des Fernen Ostens. Der ist nämlich bei Weitem nicht so einig wie Europa, im Gegenteil. Sämtliche Nachbarn Chinas fürchten das Reich der Mitte und setzen deshalb auf Bündnisse mit Europa und den Vereinigten Staaten.
Dass Asien unterschätzt wird, liegt auch an der Berichterstattung über den Kontinent. Hundert Tote in Afghanistan haben Vorrang vor einem Hundert-Milliarden-Euro-Investment der Chinesen. Ich habe bei meinen eigenen Beiträgen nicht genau nachgezählt, aber ich schätze, in den deutschen Nachrichtensendungen und auf den ersten Seiten unserer Tageszeitungen kommt «Terror Made in Asia» zehnmal öfter vor als «Business Made in Asia».
Umgekehrt würde es mehr Sinn ergeben. Denn scheiternde Staaten wie Afghanistan sind traurige Ausnahmen einer insgesamt boomenden, hochdynamischen Region, für die Experten ein «Zeitalter des Ehrgeizes»6 ausgerufen haben. Die Innovationen, die im asiatischen Raum geschaffen werden, die Energieströme, die hier freigesetzt werden, die Sogkräfte, die hier entstehen, werden uns massiv verändern – und unter Druck setzen.
Vielleicht wollen wir uns damit einfach nicht beschäftigen, weil diese Entwicklung uns nicht in den Kram und ins Bild passt.
Asien, zumindest ein großer Teil davon, macht uns verrückt, weil einerseits der technologische Fortschritt und der wachsende Wohlstand nicht zu leugnen sind. Und weil andererseits die Freiheitsrechte eingeschränkt werden und die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht. Der Fortschritt ist unübersehbar – aber er verläuft quer durch die bewährten Kategorien links und rechts, progressiv und traditionell, liberal und autoritär. Und wir kommen nicht mehr mit.
Eines der berühmtesten Zitate der Filmgeschichte lautet: «Vergiss es, Jake, das hier ist Chinatown.» Damit endet der Krimi-Klassiker «Chinatown» (1974). Ein naseweiser Detektiv, gespielt von Jack Nicholson, muss erkennen, dass im asiatischen Teil von Los Angeles völlig andere Gesetze gelten und dass er mit seinen guten Absichten genau das Gegenteil erreicht hat. Ihm wird zum Verhängnis, dass er glaubt, sich auszukennen. Er hat damit denselben Fehler gemacht wie viele deutsche Idealisten, die dem Irrtum aufsitzen: Am deutschen Levitenlesen wird die Welt genesen.
Doch im Rest der Welt ist das Interesse an Moralin der Marke «Made in Germany» gering. Die Musik, nach der global getanzt wird, kommt eben zunehmend aus Asien und nicht aus Europa.
Das muss keine schlechte Nachricht für uns sein.
Erstens, weil Asien uns nicht als gegnerische Großmacht gegenübersteht. Dazu ist Asien viel zu heterogen und sind die dortigen Interessensgegensätze zu groß. Zwischen dem libanesischen Beirut und dem südkoreanischen Busan, zwischen dem kasachischen Astana und dem jemenitischen Aden gibt es viel Platz und keine gemeinsame Linie.
Zweitens, weil es nach jahrhundertelangem Wissenstransfer von West nach Ost zur Abwechslung wir selbst sind, die bei anderen in die Schule gehen dürfen. Von Asien lernen heißt unter anderem: lernen, wie man seine eigenen Traditionen hochschätzt, wie man der Familie und überhaupt dem Kollektiv eine große Bedeutung einräumt.
Drittens, weil die asiatische Herausforderung uns dazu zwingt, unseren Fokus zu verlagern: weg von unseren lähmenden Befindlichkeitsdebatten hin zu dem, was uns in der globalisierten Welt Wohlstand sichert und Frieden beschert.
Und schließlich tut es auch einfach gut, sich nicht immer für das Weltwohl und Weltweh hauptverantwortlich zu fühlen.
Sich dafür interessieren und sich für eine bessere Welt einsetzen sollte man trotzdem.
3. Wir Weltverbesserer
Auf dem falschen Trip mit dem Außenminister
Wie schnell die Zeit vergeht, wird mir immer bewusst, wenn ich an Guido Westerwelle (1961–2016) denke. Er war einer der talentiertesten Politiker der deutschen Nachkriegszeit. Ich erwähne ihn an dieser Stelle nicht, weil er irgendetwas falsch gemacht hat, sondern weil er eine Welt repräsentiert, die Geschichte ist.
Anfang 2010 sonnte er sich noch im Glanz des besten FDP-Bundestagswahlergebnisses aller Zeiten. Er war quicklebendig, Vizekanzler, Außenminister. Ich begleitete ihn auf einer seiner ersten Auslandsreisen. Es ging nach Peking. Die neue Stärke des «Reichs der Mitte» hatte sich inzwischen herumgesprochen. Aber der deutsche Blick auf China glich immer noch dem eines noblen Großbürgers, der einen grobschlächtigen Neureichen für dessen üble Manieren verachtet.
Bei China waren es – damals wie heute – die Menschenrechtsverletzungen, die übel aufstießen. Das Ziel des China-Besuchs war damit gesteckt: Die Bundesrepublik sollte der Volksrepublik Benimm beibringen. Das jedenfalls war die Erwartung der Öffentlichkeit, auch der meisten Journalisten, die Westerwelle begleiteten.
Er selbst wusste natürlich, dass humanitäre Appelle wenig ausrichten würden und dass es für Deutschland vor allem um gute Handelsbeziehungen ging. Aber er bemühte sich, den Anforderungen gerecht zu werden, er wollte schließlich weg vom Image des herzlosen Neoliberalen. Auf dem Hinflug redete er ausführlich darüber, wie sehr ihm der Dalai Lama, die diskriminierten Tibeter und überhaupt die Menschenrechte in China am Herz lagen. Man müsse sich nur diplomatisch verhalten und die Akzente geschickt setzen. Die Journalisten nickten aufmunternd.
Westerwelle hielt Wort: Bei der Pressekonferenz in Peking schockte er seinen chinesischen Amtskollegen damit, dass er gleich mehrmals von «Meinungsverschiedenheiten» beim Thema Menschenrechte sprach.
Die Journalisten hämmerten hektisch die Überschriften in ihre Laptops und schickten sie nach Deutschland: «Westerwelle fordert mehr Menschenrechte!»
Die Chinesen waren sauer auf den unhöflichen Gast, Westerwelle dennoch zufrieden über seine Performance, die deutschen Pressevertreter gnädig gestimmt. Einige von ihnen fuhren anschließend in ein riesiges Einkaufszentrum, um billig Uhren und Elektrogeräte einzukaufen.
Guido Westerwelle hatte das, was er in China an Wirtschaftsaufbruch gesehen hatte, offenbar doch schwer beeindruckt. Jedenfalls schimpfte er kurz nach seiner Rückkehr über die deutsche Anspruchsmentalität, die er sogar mit «spätrömischer Dekadenz» verglich. Die Menschenrechtler-Maske war ab, der herzlose Neoliberale hatte sich geoutet, die Presse fiel über ihn her.
Das ist fast zehn Jahre her.
Seitdem hat sich einiges geändert, auch die Handelsbeziehungen, zunehmend zu unseren Ungunsten. China entwickelt sich vom lukrativen Absatzmarkt zum Handelsrivalen, schert sich immer noch nicht um Patentrechte, macht uns auch auf anderen Märkten Konkurrenz.
Und der chinesische Staatsrat stößt sich immer weniger an Vorhaltungen aus dem Westen.
Nicht, dass es falsch wäre, gegen die Verfolgung von Minderheiten oder gegen anti-christliche Schikane zu protestieren. Aber man muss die Kräfteverhältnisse richtig einschätzen. Da Politiker naturgemäß einen guten Machtinstinkt haben, fällt ihnen das eigentlich nicht schwer. Außerdem haben sie ja die Botschaften mit ihren hochqualifizierten Diplomaten, die sie ziemlich zuverlässig über die Zustände in ihren Konkurrenz-Ländern informieren.
Aber viele Politiker sind getrieben. Von Erwartungen, die oft wenig mit der Realität zu tun haben. Viele dieser Erwartungen entstehen in der «Berliner Blase», dem Hauptstadtmilieu, in dem sich neben Politikern allerlei andere Funktionäre, dazu Akademiker, Lobbyisten, Kulturschaffende tummeln.
Es ist schon ironisch: Ausgerechnet diejenigen, die ein besonders gutes Sensorium für neue Entwicklungen haben wollen, sind oft stumpf für das, was wirklich passiert. Wenn es nämlich ihren eigenen Überzeugungen entgegensteht.
Ich habe inzwischen fast hundert Theaterinszenierungen auf den verschiedenen Berliner Bühnen gesehen. Oft habe ich mich gut unterhalten gefühlt oder zumindest geistig stimuliert.
Gleichzeitig bin ich überzeugt: Die Meinungsvielfalt in einem pietistischen Bibelseminar ist größer als im Berliner Theaterbetrieb. Unvorstellbar, dort ein Stück über die Vorzüge freien Unternehmertums auf dem Spielplan zu finden oder ein Drama, in dem eine funktionierende christliche Großfamilie im Mittelpunkt steht.
Es gibt zwar auch immer weniger klassenkämpferische Abgesänge auf den Kapitalismus oder das Patriarchat. Dafür gibt es immer mehr postmoderne Befindlichkeits-Inszenierungen, bei denen hinterher keiner weiß, was richtig und was falsch ist.
Mit einer solchen Inszenierung kam meine Lieblings-Bühne aus Berlin nach Indien. Die Charlottenburger «Schaubühne». Eingeladen vom Goethe-Institut, bezahlt aus deutschen Steuergeldern, gab sie ein paar Gastspiele, das erste in der Hauptstadt Delhi.
Aufgeführt wurde «Ein Volksfeind» von Henrik Ibsen (1828–1906). Die Handlung ist zeitlos aktuell. Ein Arzt an einem Kurort entdeckt, dass ausgerechnet die Heilquelle verseucht ist und krank statt gesund macht. Er geht an die Öffentlichkeit. Aber weil er damit den wirtschaftlichen Standort gefährdet, verleumden ihn die Kommunalpolitiker, und die Lokalzeitung weigert sich, seinen Artikel mit der brisanten Entdeckung zu drucken.
Der Stoff passt zu den Problemen in Indien: schmutziges Grundwasser, reformunwillige Behörden, korrupte Journalisten – trauriger Alltag in vielen Kommunen. Das Stück ist in Indien bekannt, es gibt sogar eine erfolgreiche Bollywood-Verfilmung, in der die Handlung den lokalen Verhältnissen angepasst wurde.
Der Schaubühne ging es allerdings eher ums Grundsätzliche, das heißt das, was Berliner Hipster darunter verstehen: das Unwohlsein in der durchökonomisierten Gesellschaft, das Aufbegehren gegen die repressive Toleranz der pseudo-liberalen Mehrheit, die Verzweiflung des Einzelnen, sich die eigene Lebendigkeit zu beweisen.
Irgendwann wichen die Schauspieler, wie an fortschrittlichen deutschen Theatern üblich, vom Original-Text ab, hielten Monologe und forderten das Publikum schließlich zum Mitmachen auf. Mit mäßigem Erfolg.
Die Zuschauer im Saal, viele davon Studenten, rutschten verunsichert auf ihren Plätzen herum. Statt von der Weltrevolution träumen sie davon, sich einmal eine eigene Wohnung leisten und eine Familie gründen zu können.
Die Interaktion mit dem Publikum lief nur schleppend an. Die Schauspieler versuchten es mit Fragen: Was könne der Arzt denn tun, wenn ihn die Presse boykottieren würde?
«Twittern», schlug ein Zuschauer vor.
Nach der Aufführung gestand einer der Schaubühnen-Mimen: «Mein Eindruck war auch, dass diese Themen hier gar nicht durchdringen. Es ist ein echtes Luxusproblem, mit diesen Fragen zu kommen, wenn sechshundert Millionen Menschen auf der Straße schlafen», das sei eine «typisch europäische Hybris».
Da hatte er Recht. Mit der Hybris, nicht mit den 600 Millionen Obdachlosen; tatsächlich liegt die Zahl der Obdachlosen in Indien bei knapp zwei Millionen.7 Was nicht heißt, dass es vielen der anderen 598 Millionen nicht auch dreckig geht.
Viele Westeuropäer, die sich mit den neuen globalen Herausforderungen beschäftigen, kommen mit den besten Absichten, aber auch jeder Menge Klischees im Gepäck. Das ist menschlich, genau wie der Irrtum an sich. Solange man bereit ist, sich von den Realitäten vor Ort korrigieren zu lassen.
4. Von Marco Polo zu Pippi Langstrumpf
Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt
Bevor ich von Marco Polo zu Pippi Langstrumpf komme, springe ich von Guido Westerwelle und der Schaubühne zu Margot Käßmann.
Es gibt vieles, was ich an Deutschlands bekanntester Protestantin bewundere: Sie hat Charisma, Geist und kennt sich in der Welt aus.
Aber nicht unbedingt in Zentralasien.
«Nichts ist gut in Afghanistan», verkündete die damalige EKD-Vorsitzende und Bischöfin Margot Käßmann am Neujahrsfest 2010. Vermutlich hatte sie diese Einschätzung aus den Medien. Womöglich hatte sie sogar einen meiner Tagesschau-Beiträge zum Thema gesehen.
Ich hatte zu diesem Zeitpunkt Afghanistan zwar noch nie besucht, aber oft über Anschläge und die Reaktionen deutscher Politiker darauf berichtet. Mich hatte der Satz von Margot Käßmann deshalb nicht sonderlich verwundert. Da aber, wie meistens am Jahresanfang, sonst nicht viel los war in der Hauptstadt, machte der «Nichts ist gut»-Spruch tagelang Schlagzeilen. Ich bekam den Auftrag, die Bischöfin zu interviewen: in der Lobby eines schicken Hauptstadthotels.
Frau Käßmann verteidigte ihre pazifistische Sicht der Dinge. Der Einmarsch in Afghanistan habe nun einmal keinen Frieden gebracht, und in diesem Sinne sei dort eben nichts gut.
Damals konnte ich dem nichts entgegenhalten.
Heute schon.
Nach fast einem Dutzend Aufenthalten in Afghanistan fällt mir einiges ein, was dort gut läuft und jedenfalls viel besser als unter den Taliban. Vor allem fallen mir viele Menschen ein, denen es besser geht.
Negin zum Beispiel, die zierliche junge Frau, die im «Nationalen Musikinstitut» von Afghanistan ein Frauenorchester leitet. Sie musste sich nicht nur gegen den Widerstand ihrer Sippe durchsetzen, sondern auch eine schmerzhafte Handverletzung wegstecken. Statt Pianistin ist sie nun Dirigentin, die sogar beim Weltwirtschaftsforum in Davos auftreten durfte.
Soosan, die nach der Vertreibung der Taliban mit ihrer Familie aus dem iranischen Exil zurückkam, sich zunächst als Teppichknüpferin durchschlug und nun als afghanische «Hip-Hop-Queen» gegen Korruption und Frauendiskriminierung rappt.
Zulala, die sich trotz Morddrohungen bei der Talent-Show «Afghanistan sucht den Superstar» anmeldete und dort den zweiten Platz belegte.
Ein Jahr nach ihrer «Nichts ist gut …»-Predigt hielt Margot Käßmann ihre nächste vielbeachtete Rede. Inzwischen war sie nicht mehr EKD-Chefin, sondern Hochschulprofessorin in Bochum. Vor fast zweitausend Zuhörern im «Auditorium Maximum» hielt sie ihre Antrittsvorlesung. Thema war: «Die multikulturelle Gesellschaft – Wurzeln, Abwehr und Visionen.»8
Ich war nicht dabei, habe nur anschließend den Vortragstext gelesen. Ich konnte verstehen, warum die Ex-Bischöfin viel Applaus für ihre Ausführungen bekommen hatte. Sie stellte die Situation dar, nannte auch die Probleme beim Namen und endete mit dem positiven Appell, die «kreative Kraft der Differenz zu entdecken».
In der Zwischenzeit war sie immer noch nicht in Afghanistan gewesen. Leider. Denn dort hätte sie unter anderem gesehen, dass das Nebeneinander unterschiedlicher Kulturen oft mehr destruktive als kreative Kräfte freisetzt. Ich selbst habe inzwischen gelernt, dass eine Hauptursache der Konflikte in Afghanistan die Vielzahl unterschiedlicher Volksstämme ist. Paschtunen, Usbeken, Hazara, Tadschiken, Turkmenen, Nuristani, Belutschen – um nur einige der Stämme zu nennen – begegnen einander oft mit Misstrauen und sogar Hass.9 Die inner-afghanischen Unterschiede unterstreichen die Alltagsweisheit:
«Gleich und gleich gesellt sich gern.» Oder, noch zutreffender: «Ähnlich und ähnlich gesellt sich gern.»
Ethnische und kulturelle Vielfalt produziert in der Regel mehr Stress als Harmonie.
«Denn sie wissen nicht, wovon sie reden» gilt für viele aktuelle Essays und Reden zum Thema «Multikulturelle Gesellschaft». Weder leben die Autoren in Stadtvierteln, die von Ghettobildung betroffen sind, noch haben sie Gesellschaften erforscht, die von kulturellen Gegensätzen zerrissen sind. Und schon gar nicht haften sie dafür, wenn ihre Vorschläge, statt Harmonie zu produzieren, vor allem sozialen Unfrieden auslösen. Stattdessen bedienen sie die Selbstvergewisserungswünsche einer akademischen Oberschicht, deren Kinder keine Brennpunktschulen besuchen müssen und später gute Chancen haben, in Princeton oder Oxford studieren zu können.
Hier liegt ein Grundübel aktueller Diskussionen darüber, wie wir uns in der neuen Welt zurechtfinden sollen. Eigene Befindlichkeit geht vor Weltklugheit, Ideologie vor Empirie, Ideen vor Tatsachen. Statt an Marco Polo (1254–1324), der China und Indien erst erkundete, bevor er darüber schrieb, orientieren sich viele Welterklärer heute an Pippi Langstrumpf. Der erste Pippi-Film kam 1969 in die Kinos, auf dem Höhepunkt der Hippie-Bewegung. Der bekannte Titelsong beschreibt immer noch ziemlich treffend die unter Idee-Ologen verbreitete Haltung: «Ich mach mir die Welt, widdewidde, wie sie mir gefällt …»
Mehr Wirklichkeitskonstrukt als Tatsachenfeststellung war auch einer der meistzitierten und umstrittensten Sätze der letzten Jahre, das Bundespräsidenten-Dekret: «Der Islam gehört zu Deutschland.» In der originalen Rede war das Zitat etwas länger: «Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.»
Der Redner Christian Wulff hatte sicher die beste Absicht, nämlich: den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Die Rede kam auch ganz gut an. Die meisten Zeitungen feierten Wulff für sein Bekenntnis zu einem multikulturellen Deutschland.
Ich fand die Aussage eher verwirrend als hilfreich. Die theoretische Frage, ob der Islam und welche Strömung davon zu Deutschland gehört, führt nicht weiter, schließlich können auch Mormonen, Zen-Buddhisten oder Wünschelrutengänger für sich das Etikett «Gehört zu Deutschland» reklamieren. Die praktische Frage, die sich die meisten Deutschen stellen, ist:
Gehört auch die weltweit dominierende Ausrichtung des Islams, nämlich die sunnitisch-konservative, zu Deutschland? Gehören die Vorschriften des Propheten, die in der «Scharia» zusammengefasst sind, zu Deutschland? Nützt der Islam Deutschland?
Damit verknüpft sind wieder eine Reihe anderer Fragen, zum Beispiel: Sollen christliche Traditionen und Institutionen in Deutschland weiterhin privilegiert bleiben? Ist der deutsche Mainstream, in den sich die hier lebenden Muslime integrieren sollen, säkular oder multireligiös oder leitet er sich aus dem christlich-abendländischen Erbe ab?
Christian Wulff hatte vor seiner Rede sicher keine ausführliche Koran-Exegese betrieben. Er reichte auch keine detaillierte Begründung nach, sondern ließ die Sache sacken. Ein Jahr nach der Rede hatte er die Gelegenheit, ein Land zu besuchen, in dem der Islam nicht nur dazugehört. Sondern vielmehr: das ganze Land dem Islam gehört.
In der «Islamischen Republik Afghanistan» liegt der Anteil der Muslime an der Gesamtbevölkerung bei sage und schreibe 99,9 Prozent. Wulff flog unter anderem in die drittgrößte Stadt von Afghanistan, Masar-e Scharif, deren Blaue Moschee ein wichtiger islamischer Wallfahrtsort ist. Wie bei Staatsbesuchen in gefährlichen Ländern üblich, blieb der Kontakt mit Land und Leuten auf Blicke aus dem Auto- und Flugzeugfenster beschränkt.
Auf dem Rückflug machte er mir gegenüber eine Bemerkung, die mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Weil sie viel klüger war als alles, was er zur Rolle des Islams in Deutschland gesagt hatte. Er erzählte mir, dass er über eine neue Rede nachdenke. Er hatte schon ein Thema: die Demut, angeblich seine Lieblingstugend.
Ich horchte auf. Die Demut ist auch meine Lieblingstugend, die bei mir immerhin so weit ausgeprägt ist, dass ich weiß, dass ich viel zu wenig davon habe.
Ich ermutigte ihn, die Rede zu halten. Wulff war sich nicht sicher. Waren die Deutschen bereit dafür? Würde man ihm, dem ersten Mann im Staat, das Thema überhaupt abnehmen oder das Ganze irgendwie peinlich finden?
«Trotzdem», sagte ich, «das Thema ist goldrichtig, die Zeit ist reif.»
Ich hätte die Rede gerne gehört. Aber der Bundespräsident hatte keine Gelegenheit mehr, sie zu halten. Ein paar Monate später sah er sich zum Rücktritt gezwungen – auf zutiefst demütigende Weise.
Während ich seinen «Islam-Satz» immer noch sehr skeptisch sehe, kann ich sein Lob der Demut nur nachdrücklich bekräftigen. Und dazu gehört auch intellektuelle Demut. Die Bereitschaft, sich seine Wissenslücken einzugestehen und sich umfassend zu informieren, bevor man große Sprüche macht.
Aber das fällt nicht nur Politikern und Pastorinnen schwer. Ich schüttele immer wieder den Kopf, wenn etwa Medienleute sich aufführen, als wären sie habilitierte Religionswissenschaftler. Im Brustton der Überzeugung proklamieren sie Sätze wie: «Der Buddhismus ist die friedlichste Religion.» – «Der Hinduismus ist die älteste Religion.» – «Der Islam war dem Christentum lange Zeit hoch überlegen und überhaupt viel toleranter.»
Stimmt alles nicht, zumindest nicht so eindeutig.
Warum, erkläre ich später. Jetzt möchte ich die Kollegen in Schutz nehmen. Denn ihr Wissen verdanken sie Experten, die ihre Erkenntnisse ebenfalls oft nicht aus Praxiserfahrungen haben, sondern aus Textanalysen.
Dieses Primat der Theorie vor der Praxis hat eine jahrhundertealte Tradition.10 «Die Inder sind der sanftmütigste Stamm der Menschen», behauptete aus der Distanz der Dichter Johann Gottfried Herder (1744–1803). Persönliche Kontakte mit Indern hatte er freilich keine.
Der Philosoph Arthur Schopenhauer (1788–1860) feierte nach der Lektüre hinduistischer Schriften die im indischen Kastenwesen ganz oben angesiedelten Brahmanen als «edelstes und seltenstes Volk».
Der Pastorensohn Friedrich Nietzsche (1844–1900) benutzte die nichtchristlichen Weltreligionen, um den Glauben zu verunglimpfen, in dem er selbst erzogen worden war. In seiner Hasstirade Der Antichrist lobte er die «Erfahrung, Klugheit und Experimental-Moral» der alten Hindus. Der Buddhismus schien ihm «hundertmal realistischer als das Christentum». Er schwärmte von der buddhistischen «Sanftmut und Liberalität der Sitten», die er auf das dortige milde Klima zurückführte.
Tatsächlich ist es in Bodhgaya, dem Ort, an dem Buddha seine Erleuchtung erfuhr, meistens brütend heiß. Aber mit der Realität hatten die Nietzsche-Elogen auf fremde Religionen ohnehin wenig zu tun, am wenigsten, wenn er beim Islam den dort herrschenden «Freigeist» hervorhob.
«Wenn man mich fragen würde, wo die menschliche Vernunft die kostbarsten Früchte hervorgebracht hat, wo die Grundfragen des Lebens am gründlichsten durchdacht wurden», schrieb ein renommierter Kulturforscher des 19. Jahrhunderts, Max Müller (1823–1900), «dann würde ich auf Indien zeigen.»
Max Müller, Sohn des «Winterreise»-Dichters Wilhelm Müller, verfasste ein schwärmerisches Buch: Was wir von Indien lernen können.11 Passender wäre ein anderer Titel gewesen: «Was ich von meinen Übersetzungen alter indischer Texte gelernt habe.» Müller war nämlich nie über die Donau hinausgekommen.
Selbst die unappetitlichsten Bräuche bekamen noch einen hübschen Anstrich verpasst. Die Poetin Karoline von Günderrode (1780–1806) reimte sich die Verbrennung von Witwen als eine Art finalen Valentinstag zusammen: «Zum Flammentode gehen an Indusstranden / mit dem Gemahl in Jugendherrlichkeit / die Frauen ohne Zagen, ohne Leid / geschmückt festlich, wie in Brautgewanden.»
Flammen der Liebe – huch, wie romantisch! Die irrwitzigen Verse kamen mir in den Sinn, als ich die Festungsanlage in Jodhpur besucht habe. An einem der Eingangstore haben fünfzehn junge Witwen, kurz bevor sie auf ihre Scheiterhaufen gestiegen sind, ihre kleinen Handabdrücke hinterlassen. Ich habe mir ihr Stöhnen und ihr Schreien vorgestellt, als erst ihre Brautkleider verkohlten und dann das Feuer die Haut von ihren Knochen schälte.
In Indien gibt es immer noch fanatische Hindus, die den Brauch der Witwenverbrennung («Sati») für eine gute Tradition halten. Im Westen findet man natürlich keine Befürworter mehr. Aber es gibt immer noch die Tendenz, die Defizite des eigenen kulturellen Erbes grell zu beleuchten und extra scharf zu konturieren, dafür andere Kulturen in warmem Licht zu baden und weichzuzeichnen.
Im 18. Jahrhundert waren die europäischen Geistesgrößen berauscht von der Exotik der islamischen Welt, im 19. Jahrhundert von den Lehren der frisch übersetzten indischen Upanischaden, im 20. Jahrhundert von den Meditationstechniken der Buddhisten.
Das Christentum hingegen gilt vielen immer noch als Synonym für Kreuzzüge, Inquisition, Prüderie. Seine heiligen Texte wurden mikroskopisch auf Fehler analysiert, im Zweifel für den Zweifel, während die anderen großen Glaubenssysteme gönnerhaft mit dem Teleskop angezwinkert wurden.
Wenn ich hier in Delhi auf Deutsche mit geisteswissenschaftlichem Hintergrund treffe, schwärmen sie oft von der Tiefe hinduistischer Weisheitsbücher, der Schönheit des Sufismus, der Relevanz des Lao-Tse. Bringe ich das Gespräch auf Kirchen oder christliche Hilfswerke, rollen sie mit den Augen. Anders als Marco Polo, der mit offenen Augen und gleichzeitig einer großen Loyalität zum eigenen Glauben in die unbekannte Welt aufbrach, kommen sie vollbeladen mit fragwürdigem Bücherwissen und einer Herablassung gegenüber dem eigenen kulturellen Erbe.