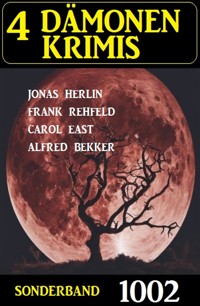4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Romane: Wenn Angst dich nicht mehr atmen lässt (Frank Rehfeld) Wenn die Todesglocke läutet (Frank Rehfeld) Der Tod als Hochzeitsgast (Frank Rehfeld) Eine Gräfin im Norden (Jonas Herlin) Der junge, sehr berühmte und erfolgreiche Rennfahrer Rick Sanders lernt während eines Krankenhausaufenthalts die hübsche Krankenschwester Susan kennen. Daraus entwickelt sich eine große Liebe, die nur durch eine Hochzeit besiegelt werden kann. Allerdings passieren immer wieder schreckliche Mordanschläge auf Susan und Dinge, die niemand erklären kann. An ihrem Hochzeitstag gerät Susan wieder in Lebensgefahr und diesmal ist sie hoffnungslos auf sich alleine gestellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Frank Rehfeld, Jonas Herlin
Romantic Thriller Viererband 1019
Inhaltsverzeichnis
Romantic Thriller Viererband 1019
Copyright
Wenn Angst dich nicht mehr atmen lässt
Wenn die Todesglocke läutet
Der Tod als Hochzeitsgast
Eine Gräfin im Norden
Romantic Thriller Viererband 1019
Frank Rehfeld, Jonas Herlin
Dieser Band enthält folgende Romane:
Wenn Angst dich nicht mehr atmen lässt (Frank Rehfeld)
Wenn die Todesglocke läutet (Frank Rehfeld)
Der Tod als Hochzeitsgast (Frank Rehfeld)
Eine Gräfin im Norden (Jonas Herlin)
Der junge, sehr berühmte und erfolgreiche Rennfahrer Rick Sanders lernt während eines Krankenhausaufenthalts die hübsche Krankenschwester Susan kennen. Daraus entwickelt sich eine große Liebe, die nur durch eine Hochzeit besiegelt werden kann. Allerdings passieren immer wieder schreckliche Mordanschläge auf Susan und Dinge, die niemand erklären kann. An ihrem Hochzeitstag gerät Susan wieder in Lebensgefahr und diesmal ist sie hoffnungslos auf sich alleine gestellt.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author / COVER FIRUZ ASKIN
© dieser Ausgabe 2021 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Wenn Angst dich nicht mehr atmen lässt
Romantic Thriller von Frank Rehfeld
Der Umfang dieses Buchs entspricht 116 Taschenbuchseiten.
Die siebzehnjährige Melody ist am Boden zerstört. Sie kann es nicht fassen, dass ihre Eltern wirklich tot sind. Nun hat sie nur noch einen Verwandten, ihren Onkel George. Sie entschließt sich, bei ihm zu wohnen, bis sie volljährig ist. In ein Heim will sie nicht gehen. Aber nach nur ein paar Tagen auf Morton-Manor fragt Melody sich, ob sie sich nicht doch falsch entschieden hat, denn sie wird das Gefühl nicht los, dass der Onkel ihr Erbe für sich beanspruchen will. Und dann geschieht das erste Unglück ...
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker
© by Author
© dieser Ausgabe 2018 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
1
"Nein", schluchzte Melody. Ihre Augen waren vor Entsetzen weit aufgerissen. Sie krampfte ihre Finger so fest um die Lehne des Sessels, dass die Knöchel weiß hervortraten, dann hob sie die Hände langsam, wie in Zeitlupe, und bedeckte ihr Gesicht damit. Drei, vier Sekunden verharrte sie in dieser Haltung, dann sprang sie plötzlich auf.
"Nein!", wiederholte sie, aber diesmal schrie sie das Wort mit überschnappender Stimme. "Sie lügen! Meine Eltern sind nicht tot, das ist nicht wahr!"
Die beiden in Zivil gekleideten Polizeibeamten auf der anderen Seite des Tisches wechselten einen vielsagenden Blick mit dem grauhaarigen Arzt, der bislang noch nicht Platz genommen hatte, sondern am Türpfosten lehnte.
"Doch, Miss Sandfort", sagte einer der Beamten mit belegter Stimme. "Es ist wahr, so leid es mir auch tut, Ihnen diese Nachricht überbringen zu müssen. Aber es ist geschehen, und keine Macht der Welt kann daran noch etwas ändern."
"Nein!", schrie Melody ein drittes Mal. Die Gedanken jagten wie beißende Ratten durch ihren Kopf, doch es war ihr unmöglich, einen davon wirklich zu Ende zu denken. Die Gesichter der Männer, deren Namen sie sich gar nicht erst gemerkt hatte, verschwammen zu konturlosen Schemen. Sie fühlte sich wie in einem grausamen Alptraum gefangen, wollte kreischen und um sich schlagen, irgendetwas tun, nur um aus diesem Traum aufzuwachen. Ohne sich dessen selbst bewusst zu sein, packte sie einen schweren Kristallaschenbecher, der vor ihr auf dem Tisch stand, und schleuderte ihn mit solcher Wucht gegen eine Wand, dass er klirrend zerbarst. Als sie auch nach einem Glas griff, um damit das Gleiche zu tun, packte einer der Polizisten ihren Arm, nahm ihr das Glas aus den Fingern und stellte es auf die Tischplatte zurück.
"Bitte, Miss Sandfort, so kommen Sie doch zur Vernunft", sagte er. "Dr. Fulton wird Ihnen eine Beruhigungsspritze geben. Es ..."
"Ich will keine Spritze, und ich will auch nicht zur Vernunft kommen! Ich will meine Eltern!", brüllte Melody. Verzweifelt stemmte sie sich gegen den Griff des Mannes, versuchte ihre Hand loszureißen, aber gegen seine Kräfte kam sie nicht an. Nach einigen Sekunden erlosch ihr Widerstand. Nur eine schreckliche, saugende Leere in ihrem Inneren blieb zurück. Kraftlos ließ sie sich wieder in den Sessel sinken. Die Tränen schossen ihr in die Augen, und sie hatte nicht einmal mehr die Kraft, sie fortzuwischen. Es waren Tränen der Verzweiflung, nicht der Trauer.
Alles war viel zu schnell gegangen. Vor zwei Tagen hatten in der Schule ihre Sommerferien begonnen. Mit ihren siebzehn Jahren war sie nur noch ein Jahr vom Examen entfernt, und sie war eine gute Schülerin. Bislang hatte sie ein weitestgehend glückliches Leben geführt. Sie stammte aus reichem Elternhaus, war mit viel Liebe erzogen worden, und über ihr Aussehen brauchte sie sich auch nicht zu beklagen. Sie war von schlankem, fast zierlichem Wuchs, doch ihr Körper war längst schon zu dem einer Frau herangereift. Auch ihr Gesicht mit den sinnlichen Lippen und den strahlend blauen Augen war hübsch geschnitten. Es wurde von einer wahren Flut kupferroten Haares eingerahmt, auf das sie besonders stolz war, und das vor allem bei Sonnenschein wie Feuer leuchtete.
Diese Ferien wollte sie gemeinsam mit ihren Eltern in der Südsee verbringen. Es war bereits alles geplant und vorbereitet. In drei Tagen wären sie geflogen, und sie freute sich auf diesen gemeinsamen Urlaub umso mehr, da ihr Vater als Aufsichtsratsvorsitzender einer großen Firma viel auf Reisen war und sie selten Gelegenheit fand, etwas mit ihm gemeinsam zu unternehmen.
An diesem Abend waren ihre Eltern zu einer Feier gefahren. Melody war allein Zuhause geblieben, bis es vor ein paar Minuten geklingelt hatte und die drei Männer vor der Tür gestanden hatten, um ihr möglichst taktvoll die schreckliche Hiobsbotschaft zu überbringen.
John und Mary Sandfort waren tot!
Etwas in Melody weigerte sich noch, die Wahrheit wirklich zu begreifen, so dass der Schmerz bislang nicht vollends bis in ihr Bewusstsein vorgedrungen war. Aber er würde kommen, auch wenn sie ihn zu verdrängen versuchte, und je länger ihre jetzige Betäubung andauerte, umso schlimmer würde er sein.
Melody nahm nur unbewusst wahr, dass der Arzt neben ihr niederkniete. Er öffnete seine Tasche, und nahm irgendetwas heraus. Kurz darauf spürte sie einen Einstich im Arm. Es tat nicht weh, und Sekunden später durchpulste sie eine Woge von Hitze, und ein wohliges Gefühl breitete sich in ihrem Körper aus.
"Fühlen Sie sich jetzt etwas besser?", fragte der Arzt.
Melody nickte kaum merklich.
"Ja", murmelte sie leise, wobei sie den Blick zur Decke gerichtet hielt. Die Antwort kam fast automatisch über ihre Lippen, und sie wusste nicht einmal, ob sie der Wahrheit entsprach oder eine Lüge war. Das beruhigende Medikament dämpfte ihre Empfindungen und verdrängte den Schmerz, aber Melody empfand gerade diese künstliche Betäubung als fast noch schlimmer.
"Wie ... wie ist es passiert?", fragte sie stockend. In einem automatischen Reflex griff sie nach den Zigaretten vor sich und zündete sich eine an.
Einer der Polizeibeamten stand auf, trat an den Kaminsims und nahm einen anderen Aschenbecher herunter, während er antwortete: "Wie schon gesagt, es handelte sich um einen Verkehrsunfall. Ein Reifen ist geplatzt. Der Wagen Ihrer Eltern kam ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Ihr ..." Er machte eine kurze Pause und räusperte sich, ehe er fortfuhr: "Ihr Vater war sofort tot. Ihre Mutter starb, bevor ein Krankenwagen die Unfallstelle erreichte. Ich ... ich kann nur noch einmal sagen, wie leid mir das tut, Miss Sandfort."
Seine letzten Worte hörte Melody kaum noch. Ihr Blick irrte zu dem Foto ihrer Eltern, das in einem Regal des Wohnzimmerschrankes stand. Obwohl sie genau wusste, wie trügerisch diese Hoffnung war, klammerte sie sich mit einem letzten Rest ihres Verstandes an den Gedanken, dass alles doch nur ein schrecklicher Traum war.
Aber es war keiner.
2
Die folgende Woche war die bislang schlimmste in Melodys Leben. Eine Sozialpädagogin kümmerte sich während der ersten Tage um sie, bis ihr weiteres Schicksal und alle mit dem Erbe ihres Vaters verbundenen Vermögensangelegenheiten geregelt waren. Natürlich würde Melody als einziges Kind der Sandforts alles erben, aber sie war noch nicht erwachsen, und bis zum Tag ihrer Volljährigkeit musste ein Vormund ihre Erziehung und die Verwaltung des beachtlichen Vermögens übernehmen. Dieser fand sich in George Morton, dem Bruder von Melodys Mutter und einzigem nahen Verwandten.
Schon seit vielen Jahren hatte Melody keinen Kontakt mehr zu ihm und kannte ihn so gut wie gar nicht. Sie wusste nur, dass er bereits um die sechzig Jahre alt war und in einem großen, alten Haus an der Küste Cornwalls lebte, aber es war ihr lieber, von einem fast unbekannten Onkel erzogen zu werden, als für das nächste halbe Jahr in die Obhut des Jugendamtes zu kommen und die finanziellen Geschäfte einem Notar übertragen zu müssen. Sicherlich würde es ihr schwerfallen, in eine andere Schule zu wechseln und ihre Freunde aufgeben zu müssen, aber sie sagte sich, dass es vielleicht sogar besser wäre, London zu verlassen, wo alles sie an ihre Eltern erinnerte. So konnte sie zu allem etwas Abstand gewinnen und damit beginnen, sich ein neues Leben aufzubauen, auch wenn es ihr jetzt noch schwerfiel, sich überhaupt vorzustellen, dass sie jemals wieder würde fröhlich sein könnte.
Leider war es ihrem Onkel aufgrund einer plötzlichen Krankheit nicht möglich, selbst nach London zu kommen, so dass er seinen Diener Henry Brannigan schicken musste. Brannigan war Mitte der Vierzig, ein bulliger Mann mit schütterem braunem Haar. Der Blick seiner Augen war stechend, und um seine Mundwinkel lag stets ein kaltes Lächeln, das ihn Melody zusammen mit seiner schweigsamen, eigenbrötlerischen Art sofort unsympathisch machte. Vielleicht war es nicht richtig, einen Menschen nach dem ersten Eindruck zu beurteilen, aber ihre instinktive Ablehnung dem Mann gegenüber war stärker als das, was der Verstand ihr sagte.
Brannigan traf einen Tag nach der Beerdigung von Melodys Eltern in London ein und blieb zwei Tage lang dort, so dass sie genug Zeit hatte, alles Notwendige zu packen und sich von ihren Bekannten zu verabschieden.
Immer noch war Melody wie betäubt. Alles schien an ihr vorbeizufliegen. Sie fühlte sich fast wie ein unbeteiligter Beobachter all dessen, was um sie herum geschah; schien über allem zu schweben und sich selbst aus der Ferne zuzuschauen. Erst als sie auf dem Beifahrersitz von Brannigans Wagen saß und sie die Stadtgrenze ihrer Heimatstadt hinter sich ließen, fand sie wieder etwas zu sich selbst.
Unsicher musterte sie Henry Brannigan von der Seite. Es war, als sähe sie ihn zum ersten Mal, obwohl er die letzten Tage mit ihr unter einem Dach gewohnt hatte. Aber auch jetzt war er ihr noch nicht viel sympathischer geworden. Er bemerkte ihren Blick und wandte ihr den Kopf zu.
"Was gibt es denn so zu starren?", knurrte er unfreundlich.
"Nichts", erwiderte Melody leise und richtete ihren Blick wieder auf die Straße. Während der Fahrt nach Cornwall musste sie Henry Brannigan noch ertragen, aber sie hoffte, ihn anschließend so selten wie möglich zu Gesicht zu bekommen.
Die Fahrt verlief weitgehend schweigsam. Zeitweilig schaltete Melody ihren Walkman ein und setzte die Kopfhörer auf, um sich durch die Musik abzulenken. Dann wieder versuchte sie die Langeweile durch Lesen zu vertreiben, aber es gelang ihr nicht, sich auf den Inhalt des mitgebrachten Buches zu konzentrieren. So beschränkte sie sich schließlich darauf, aus dem Fenster zu schauen und die Umgebung zu betrachten.
Der Verkehr auf den Straßen nahm ab, je weiter sie nach Westen vordrangen. Im Gegensatz zum schönen Wetter der letzten Tage hatte es sich an diesem Vormittag ein wenig bewölkt, und die Sonne konnte immer nur für wenige Minuten durch die Wolkendecke brechen. Einmal gerieten sie sogar in einen Regenschauer.
Das triste Wetter passte zu Melodys Stimmung, aber es machte sie auch noch trübsinniger, als sie ohnehin schon war. Ihrem Vater wären bestimmt schon längst ein paar lustige Sprüche eingefallen, mit denen er sie aufgemuntert hätte, aber das konnte sie natürlich von Henry Brannigan nicht erwarten. Ihm schien es völlig egal zu sein, wie sie sich fühlte, denn er schaute stur nach vorne und kümmerte sich nicht um sie.
Melody stiegen die Tränen in die Augen. Unauffällig wischte sie sie fort, denn sie wollte vor Brannigan keine Schwäche zeigen, obwohl es in ihrer Situation sicherlich verständlich gewesen wäre. Sie musste den Gedanken gewaltsam verdrängen, dass sie sich normalerweise jetzt an der Seite ihrer Eltern an irgendeinem Südseestrand in der Sonne räkeln würde.
Die Landschaft war von einschläfernder Monotonie. Immer seltener werdende Wälder wechselten sich mit Wiesen, Kornfeldern und gelegentlichen kleinen Dörfern ab. Nur als gegen Mittag in der Ferne erstmals das Meer zu sehen war, und fast gleichzeitig die Sonne wieder durch die Wolken brach, riss der Anblick Melody noch einmal kurz aus ihrem Halbschlaf.
Kurz darauf schlief sie tatsächlich ganz ein, und als sie wieder erwachte, weil der Wagen plötzlich langsamer fuhr und dann ganz anhielt, hatten sie das Ziel ihrer Reise erreicht.
Vor ihnen lag Morton-Manor, das Haus in dem George Morton wohnte.
3
Der Anblick schlug Melody sofort in seinen Bann, aber das Haus erfüllte sie mit so zwiespältigen Gefühlen, dass ihr gleichzeitig eine Gänsehaut über den Rücken rann. Sie hatte nur noch eine ganz vage Erinnerung an Morton-Manor, denn es lag bestimmt zehn Jahre zurück, dass sie zuletzt hier gewesen war. Schon damals war ihr das Haus unheimlich gewesen. Jetzt flößte es ihr Furcht ein.
Es war ein gewaltiges altes Herrenhaus im viktorianischen Baustil, mit zahlreichen Erkern, Türmchen, Schrägdächern und Balkonen. Der größte war mit Säulen abgestützt und überdachte die breiten Stufen, die zu dem Eingangsportal hoch führten. Die ganze Bauweise wirkte seltsam gestaucht und verdreht, als hätte ein Riese das Haus genommen, ein wenig daran herum geknetet, und es schließlich achtlos liegengelassen. Auch war es nicht gerade in bestem Zustand - gelinde ausgedrückt!
Die Farbe der Außenfassaden war fast völlig abgeblättert, die Wände sahen schmutzig und baufällig aus. Der Regen hatte hässliche dunkle Streifen in das Mauerwerk gewaschen. Einige Dächer waren eingesunken oder ganz heruntergebrochen, Regenrinnen hingen schräg herab. Die Wände waren rissig, vielfach war der Putz abgebröckelt, und stellenweise klafften sogar kopfgroße Löcher im Mauerwerk. Alles machte einen düsteren und trostlosen Eindruck. Fast bedauerte Melody jetzt schon, hergekommen zu sein.
"Wir sind da, falls du es noch nicht gemerkt hast", sagte Brannigan grob. "Möchtest du nicht endlich aussteigen?"
Seine Worte rissen Melody aus ihren Grübeleien. Sie schrak auf.
"Doch, natürlich", murmelte sie verwirrt und stieg aus dem Wagen.
Brannigan führte sie auf das große Eingangsportal zu und betätigte den wuchtigen Türklopfer. Eine Tür innerhalb des Portals wurde geöffnet, und eine geduckte Gestalt erschien in der Öffnung.
George Morton war wirklich alt. Er sah sogar älter aus, als Melody erwartet hatte. Sein bereits angegrautes Haar lag wirr um seinen Kopf, und in sein Gesicht hatten sich tiefe Falten eingekerbt. Dünne, blutleere Striche bildeten seinen Mund, und seine gekrümmte Nase hatte Ähnlichkeit mit einem Adlerschnabel. Er musste sich beim Gehen auf einen Stock stützen, doch als er Melody erblickte, trat ein freudiges Funkeln in seine Augen.
"Melody!", rief er. "Wie freue ich mich, dich zu sehen." Er trat noch einen Schritt vor, ließ den Stock fallen und schloss sie in die Arme.
Melody versteife sich. Im ersten Moment wollte sie sich gegen die Umarmung wehren. Die Berührung der gichtigen Hände war ihr zuwider. Vielleicht lag es daran, dass sie dadurch wieder an Alter und Tod erinnert wurde, aber dann wurde ihr bewusst, dass sie sich unmöglich benahm. Sie gab ihren Widerstand auf und legte ebenfalls die Arme um den schmächtigen Körper ihres Onkels.
"Es tut mir leid, was mit deinen Eltern passiert ist", murmelte George Morton. "Du weißt, dass ich mich mit deinem Vater nie gut verstanden habe, aber als ich von dem schrecklichen Unglück hörte, war ich doch entsetzt."
Melody sagte nichts. Sie musste wieder gegen die Tränen ankämpfen. Seine Worte hatten die noch längst nicht verheilte Wunde in ihrem Inneren erneut aufgerissen. Obwohl er fast doppelt so alt wie ihre Mutter war, sah er ihr doch ähnlich.
"Komm, gehen wir ins Haus!", schlug er schließlich vor. "Es ist feucht und kühl hier draußen, und ich spüre das Wetter in meinen alten Knochen. Henry wird dein Gepäck gleich hereinbringen."
Melody folgte ihm in einen düsteren, muffig riechenden Flur. Es gab nur ein einziges kleines Fenster über der Tür, das höchstens einer ausgehungerten Fliege Platz geboten hätte, und außerdem war die Scheibe vom Schmutz fast blind geworden. Eine hölzerne Treppe führte in die Höhe, doch sie gingen daran vorbei und traten in ein altmodisch eingerichtetes Wohnzimmer. Auch hier roch es muffig, als würden die alten Möbel den Mief der Jahrhunderte ausatmen, die sie sicherlich schon alt waren.
Melody schaute sich aufmerksam um, darum bemüht, sich ihre Enttäuschung nicht anmerken zu lassen. Sie sehnte sich schon jetzt nach der großen, lichtdurchfluteten und modern eingerichteten Villa in London zurück, die jetzt leer stand, in die sie nach ihrem achtzehnten Geburtstag aber wieder zurückziehen würde.
Morton-Manor stellte eine große Enttäuschung für sie dar. Dies sollte ihr neues Heim sein? Sie konnte sich kaum vorstellen, jetzt für mehr als ein halbes Jahr hier wohnen zu müssen.
"Setz dich doch!", sagte Onkel George und deutete auf einen Sessel, während er selbst in einem anderen Platz nahm. Melody kam der Aufforderung nach. Noch einmal schaute sie sich aufmerksam um, doch was sie sah, gefiel ihr auch jetzt nicht besser als beim ersten Mal.
Das Zimmer war vollgestopft mit alten Möbeln aller Stilrichtungen und Zeitalter. Die wuchtigen Ledersessel waren verschlissen und ließen sich überhaupt keinem bestimmten Kunstalter zuordnen. In einer Ecke stand ein Rokoko-Tischchen, daneben ein Schrank, der dem Zeitalter des Barock entstammte, und in diesem kunterbunten Chaos, das jedem einigermaßen kunstgeübten Auge Hohn sprach, ging es weiter. Vielleicht wäre es noch angegangen, wenn die Möbel sich wenigstens in gutem Zustand befunden hätten. Das aber war beileibe nicht der Fall. Wie das Haus selbst war auch seine Einrichtung heruntergekommen, so dass sogar die alten Möbel nicht viel mehr als Plunder darstellten.
Am schlimmsten aber war, dass der Raum völlig überfüllt mit ihnen war. Man konnte sich kaum dazwischen bewegen, ohne irgendwo anzustoßen. Melody fühlte sich eingeengt, fast wie gefangen. Die muffige Luft machte ihr das Atmen schwer. Es wäre dringend nötig gewesen, einmal gründlich zu lüften, doch sie wagte nicht, darauf hinzuweisen.
"Wenn ich richtig gezählt habe, liegt unser letztes Zusammentreffen jetzt bereits mehr als elf Jahre zurück", setzte George Morton das Gespräch fort. "Es ist schade, dass erst so ein schlimmes Unglück uns wieder zusammengeführt hat."
"Ja", erwiderte Melody bedrückt. "Ich freue mich auch, dich wiederzusehen, Onkel George. Ich weiß zwar noch, dass ich damals schon mal hier gewesen bin, aber ich konnte mich weder an dich, noch an das Haus erinnern."
"Das ist kein Wunder." Er lachte leise. "Damals bist du erst sechs Jahre alt gewesen und kamst gerade in Schule. Dann kam dieser elende Streit mit deinem Vater. Ich weiß nicht einmal mehr, um was es dabei ging. Aber wir haben uns im Streit getrennt und seither den Kontakt verloren. Doch lassen wir diesen unangenehmen Teil der Vergangenheit ruhen. Du musst mir unbedingt erzählen, wie es dir in den vergangenen Jahren ergangen ist. Ich weiß ja überhaupt nichts über dich. Beim letzten Mal warst du noch ein kleines Kind, und jetzt sehe ich mich plötzlich einer hübschen jungen Dame gegenüber."
Melody erröte ein wenig bei dem Kompliment, da es so unerwartet kam. Gerade in ihrer augenblicklichen Situation griff sie begierig nach jedem Strohhalm, der ihr half, ihr angeknackstes Selbstvertrauen wieder aufzubauen.
In der folgenden Viertelstunde berichtete sie in groben Zügen von dem Leben, das sie in den letzten Jahren geführt hatte. Vieles von dem, was für sie wichtig war, ließ sie allerdings aus. Sie konnte zu einem für sie immer noch fremden Menschen, wie Onkel George es war, nicht offen über alles sprechen, was tief in ihrem Herzen vorging, und so behielt sie das Meiste für sich.
George Morton hörte ihr geduldig zu und stellte oft Zwischenfragen, aber Melody spürte trotz seiner gespielten Neugier, dass ihn nach einiger Zeit nicht mehr wirklich interessierte, was sie erzählte. Vielleicht lag es daran, dass sie altersmäßig so verschieden waren, und das Großstadtleben für ihn, der seit vielen Jahren hier in einsamer Abgeschiedenheit lebte, ein Buch mit sieben Siegeln darstellte.
Nach einer Weile unterbrach er sie plötzlich.
"Was bin ich doch für ein schlechter Gastgeber!", rief er aus. "Nach der langen Fahrt musst du hungrig und durstig sein. Bis Henry das Essen fertig hat, wird es noch eine Weile dauern, aber zumindest etwas zu Trinken kann ich dir anbieten. Möchtest du einen Fruchtsaft?"
"Gerne", sagte Melody und nickte. Erst jetzt, als sie daran erinnert wurde, merkte sie, wie sehr ihr Mund vom Sprechen ausgetrocknet war. Das Frühstück lag mehr als fünf Stunden zurück, und seither hatte sie nichts mehr gegessen und getrunken. Ihr Magen begann bereits zu knurren, und beim alleinigen Gedanken an einen gedeckten Mittagstisch lief ihr das Wasser im Mund zusammen.
Onkel George stand auf und humpelte in die Küche. Ein paar Sekunden später kam er mit einem Glas und einer Flasche Saft zurück. Beides stellte er vor ihr ab. Melody schenkte sich ein und trank das Glas in einem Zug leer. Automatisch griff sie nach ihren Zigaretten, dann erst fiel ihr wieder ein, dass sie bislang nur Gast in diesem Hause war.
"Darf ich rauchen?", fragte sie.
Missbilligend schaute ihr Onkel sie an. Sein Gesicht verfinsterte sich.
"In deinem Alter solltest du dir deine Gesundheit nicht damit ruinieren", tadelte er und schüttelte den Kopf. "Es hat wohl wenig Sinn, wenn ich es dir verbiete. Aber mit meiner Lunge steht es nicht mehr zum Besten. Deshalb möchte ich dich bitten, wenigstens in meiner Anwesenheit auf das Rauchen zu verzichten."
"In Ordnung", sagte Melody. Sie konnte verstehen, wenn der alte Mann sich als Nichtraucher belästigt fühlte.
"Auf deinem Zimmer kannst du es tun", fuhr er fort. "So habe ich mich auch mit Henry geeinigt. Er wohnt übrigens ebenfalls in Morton-Manor und raucht nur in seinen eigenen Räumen. Ich werde ihn bitten, dir einen Aschenbecher zu geben. Aber sei bitte vorsichtig, dass du keine Brandflecken oder Schlimmeres verursachst! Hier ist viel aus Holz, und ein Feuer würde verheerenden Schaden anrichten."
"Ich werde aufpassen", versprach Melody.
"Gut. Möchtest du, dass ich dir dein Zimmer direkt zeige? Dann kannst du deine Sachen auspacken und dich vor dem Essen noch etwas frisch machen."
"Das wäre mir am liebsten", stimmte Melody sofort zu, verschwieg jedoch den wahren Grund, warum sie sofort auf ihr Zimmer wollte. Es ging ihr weniger um den Raum, als vielmehr einfach nur darum, aus der Nähe ihres Onkels zu kommen und eine Weile allein zu sein, um über alles in Ruhe nachdenken zu können.
4
Den Gang zu ihrem Zimmer nutzte Onkel George aus, ihr das ganze Haus zu zeigen, zumindest den Haupttrakt, der als einziger Teil bewohnt war, denn die Seitenflügel standen leer.
Im Erdgeschoss gab es mehrere Wohn- und Speisezimmer, eine große, wohlsortierte Bibliothek, sowie die Küche und andere Wirtschaftsräume. Auch Henry Brannigan hatte hier einen eigenen kleinen Trakt für sich allein.
Die meisten Räume im ersten Stock standen ebenfalls leer. Wandte man sich am Kopf der Treppe nach rechts, gelangte man in George Mortons Schlafräume, und auch sein Arbeitszimmer lag dort.
"Dieser Trakt ist mir allein vorbehalten", erklärte er. "Ich möchte, dass du sie auf gar keinen Fall betrittst, solange ich dich nicht ausdrücklich dazu auffordere. Hast du das verstanden?"
Melody nickte, und ihr Onkel führte sie eine weitere Treppe hoch und über einen Korridor, bis er vor einer Tür stehenblieb und sie öffnete.
"So, das ist dein Zimmer."
Der Anblick überraschte Melody. Vor ihr erstreckte sich ein Raum, der fast so groß wie das Wohnzimmer war, doch längst nicht so altmodisch eingerichtet. Die Möbel entsprachen zwar nicht ganz ihrem Geschmack, dennoch würde sie sich bestimmt daran gewöhnen können. Alles war sauber, in der Luft hing trotz des geöffneten Fensters noch ein leichter Geruch nach Putzmittel. Vor dem Bett standen ihre Koffer und Kartons.
"Gefällt es dir?", fragte Onkel George.
Melody konnte nur nicken. Insgeheim hatte sie gefürchtet, dass ihr Zimmer ebenfalls eine finstere Rumpelkammer wäre. Stattdessen erinnerte der große, lichtdurchflutete Raum eher an ein Hotel-Appartement.
"Du kannst ja noch ein wenig umräumen und alles deinem Geschmack entsprechend einrichten, wenn du möchtest."
"Ein paar kleine Änderungen, ja", stimmte Melody zu.
"Sollten die Möbel dir gar nicht gefallen, können wir auch noch neue kaufen. Reich genug bist du ja, und ich möchte, dass du dich hier wohlfühlst. Auch wenn du mehr Platz haben möchtest, brauchst du es nur zu sagen. Die angrenzenden Räume stehen ohnehin leer. Du kannst sie dir gerne auch einrichten, so dass du eine richtige Wohnung hast."
"Vorerst lässt es sich auch so aushalten. Vielen Dank, Onkel."
"Gut, dann lasse ich dich jetzt allein. Hinter der Tür dort vorne liegt ein Badezimmer, das du ganz für dich allein hast."
Noch einmal bedankte sich Melody. Dann schloss sich die Tür hinter ihrem Onkel, und sie war allein. Als Erstes schaute sie sich alles in ihrem Zimmer genau an. Neben dem Fenster gab es sogar noch eine Glastür, die auf einen kleinen Balkon hinausführte. Von dort aus konnte sie das Meer sehen. Es lag nicht einmal weit entfernt, einige Minuten Fußweg höchstens. Etwa eine Meile vor der Küste erstreckte sich eine kleine Insel, auf der sich die Ruine einer alten Burg erhob. Melody rauchte eine Zigarette und genoss den Blick auf die grüne Landschaft und die graublaue, bis zum Horizont reichende Wasserfläche, die dahinter lag.
Dann trat sie wieder ins Zimmer zurück. Sie stellte einen Tisch mit den dazugehörenden Sesseln anders hin, rückte eine Kommode von einer Wand zur anderen und befestigte einige Bilder und Poster an den Wänden. Anschließend packte sie auch die anderen Sachen aus. Ein Foto, das ihre Eltern zeigte, stellte sie auf die kleine Konsole neben ihrem Bett. Innerhalb von kaum einer halben Stunde bekam das Zimmer ein ganz anderes Gesicht, und erstmals keimte in Melody wieder ein wenig Zuversicht auf, was ihre Zukunft betraf. Sie duschte kurz und fand gerade noch Zeit, ihr Haar zu föhnen, dann wurde sie auch schon gerufen.
Das Mittagessen verlief weitgehend schweigend. Zu Anfang erzählte Onkel George ihr noch etwas über die Umgebung und über Morton-Manor. So erfuhr Melody beispielsweise, dass der nächstgelegene Ort Gorlwingham hieß und es etwa fünf Meilen bis dorthin seien, aber bald schon versickerte das Gespräch im Sande.
Nach dem Essen beschloss Melody, sich ein wenig in der Umgebung umzusehen, zumal ihr Onkel sich ohnehin eine Weile hinlegen wollte.
Morton-Manor lag zwischen grasbewachsenen, sanften Hügeln eingebettet. Eine Straße führte bis direkt vor das Haus und setzte sich dahinter als schmaler Pfad fort. Er führte in Richtung der Küste, wurde aber offensichtlich nicht häufig benutzt. Melody folgte dem Pfad. Das Wetter hatte inzwischen aufgeklart. Die Sonne war durch die Wolken gebrochen und verbreitete angenehme Wärme. Eine sanfte Brise wehte vom Meer her auf das Festland zu und trug den Geruch von Salzwasser und Tang heran. Melody atmete tief durch und genoss die würzige Luft. Sie verspürte nicht einmal Appetit auf die obligatorische Verdauungszigarette, die sie nach dem Essen immer zu rauchen pflegte.
Nach einer Weile drehte sie sich um. Wie eine geballte, steinerne Faust erhob sich Morton-Manor auf einem Hügel; ein wuchtiger Klotz, der gegen das Licht der Sonne wie ein finsteres Loch in der Wirklichkeit aussah. Aus der Entfernung wirkte das Haus noch düsterer, als wenn man direkt davor stand. Das Licht der Sonne brach sich in den Fensterscheiben und gab ihnen das Aussehen glitzernder, böser Augen, die Melody feindselig musterten. Die im Laufe der Jahrhunderte geschwärzten Mauern schienen einen Hauch des Unheimlichen zu verströmen; viel stärker, als es bei anderen so alten und einsam stehenden Herrenhäusern oft der Fall war. Aber das war nicht alles. Noch etwas anderes nistete in dem alten Gemäuer, etwas Seltsames dass sich nicht sehen oder hören, noch beschreiben ließ. Aber es war da, und Melody konnte diesen Eindruck nicht abschütteln, obwohl sie es gern getan hätte. Es handelte sich um eine beinahe körperlich spürbare Kälte, die aus dem Haus zu kriechen und sich auf dürren Spinnenbeinen in ihre Seele zu schleichen schien.
Keuchend wandte sie ab. Ihre Nerven spielen ihr einen Streich, das war alles. Morton-Manor war nur ein altes, zum Teil verfallenes Haus - nicht mehr. Häuser waren nicht lebendig, sie konnten nicht böse oder jemandem feindselig gesonnen sein. Vielleicht wollte sie einfach nicht, dass Morton-Manor ihr gefiel; eine instinktive Trotzreaktion ihres Unterbewusstseins.
Melody vergaß diese düsteren Grübeleien, als die Hügel plötzlich vor ihr zurückwichen und ihr den Blick auf das Meer und einen Streifen weißen Sandstrandes freigaben. Der Sand war so fein und beinahe ebenso weiß wie Puderzucker. Sanften Zungen gleich leckten die Wellen darüber und zogen sich wieder zurück. Ein Stück vor der Küste, von gischtender Brandung umspült, lag die kleine Felseninsel, die Melody schon von ihrem Fenster aus gesehen hatte. Wie gigantische Finger ragten die von Wind und Regen zernagten Türme der alten Burg darauf empor.
Nirgendwo war ein Mensch zu sehen. Melody hatte den ganzen Strand für sich allein. Der Anblick ließ sie zum ersten Mal die schlimme Zeit vergessen, die hinter ihr lag. Mit einem freudigen Jauchzen streifte sie die Schuhe von den Füßen und ließ sich in den Sand sinken. Spielerisch ließ sie ihn durch die Finger rieseln.
Mittlerweile brannte die Sonne richtig heiß vom Himmel herab. Am liebsten hätte Melody sich eine Weile gesonnt. Sie hatte ein paar Badeanzüge mitgebracht, aber diese lagen jetzt in ihrem Zimmer, und sie war zu faul, um zurückzugehen und sie zu holen. Aber schließlich war sie ja allein. Noch einmal schaute sie sich sorgsam um. Weit und breit hielt sich niemand auf. Kein Wunder, wenn Gorlwingham fünf Meilen entfernt lag. Wahrscheinlich war Morton-Manor das einzige Haus der näheren Umgebung. Es konnte sie also niemand sehen.
Nach kurzem Zögern zog sie sich die Jeans aus. Darunter trug sie noch einen Slip. Auch die Bluse streifte sie ab, obwohl sie nichts mehr darunter trug, aber schließlich war sie ein junges, bestimmt nicht prüdes Mädchen, und an vielen Badestränden galt es als völlig natürlich, sich oben ohne zu bräunen. Sie ließ sich in den Sand zurücksinken und genoss die Sonne und den milden Wind auf der Haut. Eine Weile blickte sie träge in den nun fast wolkenfreien Himmel, dann schloss sie die Augen und glitt in einen leichten Halbschlaf.
Melody wusste nicht, wie lange sie so dalag und vor sich hin döste, als ein Geräusch sie plötzlich auffahren ließ. Sie öffnete die Augen. Doch alles, was sie im grellen Sonnenlicht sah, war ein gewaltiger, dunkler Schatten, der sich auf sie stürzte und sie im nächsten Moment unter sich begrub.
5
Melody schrie entsetzt auf. Sie war noch benommen vom Schlaf, und ihre Augen tränten sofort im grellen Sonnenlicht. Sie sah nur einen Körper mit struppigem, braunem Fell und funkelnden Augen, der über ihr hockte und sie mit seinem Gewicht zu Boden drückte, so dass sie kaum noch atmen konnte. Nur wenige Handbreit vor ihrem Gesicht blitzten gewaltige, dolchartige Fangzähne im weit aufgerissenen Maul eines wahren Ungeheuers. Ein dumpfes Knurren ertönte.
Noch einmal schrie Melody, obwohl sie wusste, dass niemand sie hier draußen hören konnte. Dabei riss sie instinktiv die Arme in die Höhe. Sie verschwendete keinen Gedanken daran, woher das Ungeheuer gekommen sein mochte. In diesen Sekunden war sie vollends davon überzeugt, dass die Bestie sie umbringen würde. Das gewaltige Tier, das beinahe wie ein Wolf aussah, brauchte nur zuzuschnappen, um ihr die Kehle zu zerreißen. Verzweifelt stemmte sie ihre Hände gegen die Kehle des Tieres und versuchte es zurückzudrängen. Doch es war viel zu stark für sie. Immerhin aber näherten sich die Fänge auch nicht mehr weiter ihrem Gesicht. Das Grollen wurde lauter, drohender, doch Melody gab nicht auf, sondern verstärkte ihre sogar Anstrengungen noch. Ein verbissenes Ringen entspann sich zwischen den zwei ungleichen Gegnern. Melody glaubte, blanke Mordlust in den Augen der Bestie blitzen zu sehen. Sie versuchte, den Wolf von sich herunterzuwälzen, doch auch dafür reichten ihre Kräfte nicht aus. Im Gegenteil, sie spürte, wie sie rasch schwächer wurde. Dann aber war sie verloren. Schon jetzt hatte sie das Gefühl, dass die Bestie nur mit ihr spielte, so wie eine Katze eine Maus noch quälte, bevor sie das Interesse an diesem grausamen Spiel verlor und ihr Opfer tötete. Es beschränkte sich darauf, sie mit seinen Pfoten zu Boden zu drücken, anstatt ihr die Krallen in den Leib zu schlagen.
Wie kam ein solches Untier bloß in diese Gegend? Selbst als Kind der Großstadt wusste Melody, dass es in England seit langer Zeit schon keine freilebenden Wölfe mehr gab. Einen Zoo gab es ihres Wissens auch nicht in der Gegend, und dass sich ein Mensch eine solche Bestie als Haustier hielt, konnte sie sich auch nicht vorstellen. Aber vielleicht handelte es sich ja auch nur um einen Hund. Wenn dieser aber so einfach ohne Grund einen Menschen anfiel, konnte es nur bedeuten, dass das Tier an Tollwut erkrankt war, was eine weitere tödliche Gefahr darstellte.
Diese Gedanken schossen Melody in Bruchteilen von Sekunden durch den Kopf. Panische Angst hielt sie gefangen und verhinderte, dass sie klar überlegen konnte. All ihr Denken war nur noch darauf gerichtet, sich das Untier von der Kehle zu halten. Sie hatte das Gefühl, der Kampf würde schon Stunden dauern, obwohl es sich in Wahrheit wahrscheinlich nur um wenige Sekunden, höchstens eine halbe Minute handelte. Immer näher kamen die schrecklichen Zähne ihrer Kehle, während ihre eigenen Kräfte gleichzeitig immer mehr abnahmen …
Da nahm sie plötzlich aus den Augenwinkeln einen weiteren Schatten wahr, der sich ihr näherte.
"Wolf, zurück!", ertönte ein scharfer Befehl.
Augenblicklich ließ das Tier von Melody ab. Mit vor Entsetzen weit aufgerissenen Augen sprang sie auf. Vor ihr stand ein etwa gleichaltriger Junge in verschlissenen, über einem Knie sogar zerrissenen Jeans und einem ebenfalls nicht mehr brandneuen Baumwollhemd, das er über dem Bauch zusammengeknotet hatte. Dunkles Haar rahmte ein sonnengebräuntes, trotz der Jugend bereits leicht vom Wetter gegerbtes Gesicht ein, in dem besonders die strahlend blauen Augen auffielen. Mit einer Hand streichelte der Junge das Untier, das hechelnd, mit aus dem Maul hängender Zunge friedlich neben ihm stand.
"Du bist wohl verrückt!", fauchte Melody und wich unwillkürlich zurück. "Wie kannst du solch eine Bestie nur so frei hier herumlaufen lassen? Um ein Haar hätte sie mich umgebracht!"
Die Reaktion des Jungen fiel völlig anders aus, als sie erwartet hätte. Statt schuldbewusst zusammenzuzucken und sich zu entschuldigen, brach er in schallendes Gelächter aus.
Sein Gelächter machte Melody noch zorniger. Wütend stampfte sie mit dem Fuß auf.
"Was gibt es da zu lachen?", schrie sie. "Ich finde das überhaupt nicht lustig, das kannst du mir glauben."
"Tut mir leid", antwortete der Junge immer noch lachend. "Aber die Vorstellung, dass Wolf dich angeblich fast getötet hätte, ist zu komisch. Er ist zwar ein Wolfshund, aber trotzdem das bravste Tier, dass es überhaupt nur gibt. Er wollte lediglich ein wenig spielen."
"Spielen?", fauchte Melody. "Darunter verstehe ich etwas anderes." Aber ihr schlimmster Zorn war bereits verraucht und machte der Erleichterung Platz. Noch einmal musterte sie das Tier. Jetzt wirkte es wirklich beinahe harmlos, vor allem war es bei Weitem nicht so groß, wie es zuerst den Anschein gehabt hatte. Die Panik musste ihren Blick getrübt haben.
"Wolf ist noch jung und ziemlich verspielt. Aber er wollte dir bestimmt nichts antun. Ich kann mich nur nochmal entschuldigen, dass er dich erschreckt hat. Ich habe für einen Moment nicht auf ihn aufgepasst. Ach ja, ich heiße übrigens David - David Williams."
"Melody Sandfort", erwiderte sie und kam sich mit einem Mal ziemlich albern vor. Offensichtlich war alles nur ein Missverständnis gewesen. Das Funkeln, das auch jetzt noch in den Augen des Hundes geschrieben stand, war wohl nur der Freude zuzuschreiben, wie das Wedeln seines Schwanzes anzeigte. Sie war immer noch völlig durcheinander und verstand selbst nicht, wie sie sich so hatte täuschen können. Wahrscheinlich lag es an ihren angespannten Nerven und der Benommenheit, die sie nach dem Schlaf nicht sofort hatte abschütteln können.
Sie reichte dem Jungen die Hand, der sie ergriff und so kräftig schüttelte, dass es wehtat. Die ganze Zeit über hörte er nicht auf zu lächeln.
"Warum grinst du eigentlich dauernd?", fragte Melody gereizt, um ihre Unsicherheit zu überspielen.
"Man trifft selten fremde Leute hier", antwortete David gedehnt. "Und so leicht bekleidete Badenixen schon gar nicht."
Melody erschrak. Erst jetzt wurde ihr wieder bewusst, dass sie nur einen Slip trug. Mit einem Mal glaubte sie seine Blicke wie Dolchstöße zu spüren. Rasch griff sie nach ihrer Bluse und streifte sie über.
"Schade!", sagte der Junge spöttisch. "So übel war es vorher auch nicht."
"Nicht frech werden!", drohte Melody. "Wo kommst du eigentlich so plötzlich her?"
"Das Gleiche könnte ich dich fragen. Aber gut, ich wohne hier. Das Haus meiner Eltern liegt hinter dem Hügel da hinten. Und was ist mit dir? Ich habe dich hier noch nie gesehen."
"Geht auch schlecht, ich bin nämlich erst vor ein paar Stunden angekommen. Ich wohne bei meinem Onkel in Morton-Manor."
"Morton-Manor?", wiederholte David in einem Tonfall, der Melody gar nicht gefiel. Seine Augen weiteten sich. "Ist dein Onkel etwas George Morton?"
Sie nickte. "Ja. Warum fragst du?"
Aber sie bekam keine Antwort mehr. Der Junge starrte sie noch einige Sekunden lang schweigend an, und in seinem Gesicht lag nun eindeutig Schrecken. Dann fuhr er plötzlich herum und rannte mitsamt seinem Hund davon, so schnell er nur konnte.
Fassungslos starrte Melody ihm hinterher.
6
Der Vorfall verdarb ihr alle Freude an dem Strand und dem schönen Wetter. Sie zog sich ganz an und streifte noch ein wenig in der Gegend umher, bevor sie nach Morton-Manor zurückkehrte. So sehr sie auch nachgrübelte, sie fand keine Erklärung für Davids Verhalten. Wieso hatte es ihn bloß so erschreckt, dass George Morton ihr Onkel war und sie in seinem Haus wohnte?
Wieder im Haus erfuhr sie, dass ihr Onkel weggefahren sei. Um möglichst weit von Henry Brannigan entfernt zu sein, verbrachte sie fast den ganzen Nachmittag in ihrem Zimmer. Sie las ein wenig. Doch immer wieder glitten ihre Gedanken zu David Williams. Trotz der Größe des Raumes hatte sie das Gefühl, von den Wänden erdrückt zu werden. Dennoch wollte sie nicht noch einmal hinausgehen.
Onkel George kehrte erst wieder zum Abendessen zurück. Er war einsilbig und wirkte verschlossen. Seine Nichte schien für ihn kaum zu existieren, und diese Nichtachtung verstärkte Melodys Verwirrung noch. Sie hatte erwartet, dass man sich zumindest in den ersten Tagen intensiv um sie kümmern würde, um ihr das Einleben zu erleichtern, doch stattdessen kam sie sich überflüssig vor. Schlimmer noch: störend.
Jetzt erst begriff sie plötzlich, dass George Morton sie keinesfalls aus Liebe oder aus einem Gefühl der Verpflichtung seiner toten Schwester gegenüber hergeholt hatte. Wäre es so, dann würde er sich ihr gegenüber jetzt anders verhalten. Ganz offensichtlich ging es ihm nur um das Geld, denn dafür, dass er sie versorgte und ihr Vermögen bis zu ihrer Volljährigkeit verwaltete, erhielt er eine monatliche Abfindung. Zwar durfte er ihr Geld nicht für seine eigenen Zwecke verwenden, aber auch die Abfindung war nicht zu verachten.
Als Melody das bewusst wurde, stiegen ihr wieder die Tränen in die Augen. Nur mühsam konnte sie sich beherrschen, dass sie nicht zu weinen begann oder einfach vom Tisch aufsprang und in ihr Zimmer rannte.
Sie warf ihrem Onkel einen zornigen, fast hasserfüllten Blick zu, schwieg aber. Jetzt war es zu spät, um noch etwas zu ändern. Sie hatte sich ihr Schicksal selbst ausgesucht. Jetzt musste sie zusehen, wie sie das Beste daraus machen konnte.
Vielleicht irrte sie sich ja auch, und Onkel George war einfach nur schlecht gelaunt, oder er fühlte sich ebenso hilflos wie sie und wusste nicht, über was er mit ihr sprechen sollte. Es gab viele andere Erklärungen für sein abweisendes Verhalten, und Melody hoffte sehnsüchtig, dass eine davon zutraf. Der Gedanke, ein nur wegen ihres Geldes geduldeter, in Wahrheit aber ungeliebter Gast in Morton-Manor zu sein, erfüllte sie mit Schrecken. Wenn es so wäre, dann würde das Leben in der nächsten Zeit für sie zur Hölle werden. Das spürte sie ganz deutlich.
Sie war froh, als das Abendessen vorbei war, und sie wieder in ihr Zimmer zurückkehren konnte. Auf halbem Weg die Treppe hinauf entschied sie sich dann aber doch anders. Wenn sie sich wieder nur allein in ihrem Zimmer verkroch, würde ihr innerhalb kürzester Zeit erneut die Decke auf den Kopf fallen.
Schon jetzt vermisste sie London. Dort war es fast unmöglich, Langeweile zu empfinden. Sie konnte sich immer mit Freunden treffen, und vor allem konnte sie stets ausgehen, wenn sie nicht allein Zuhause bleiben wollte. Es gab zahlreiche Pubs und Discos, in denen sie immer ein paar Bekannte traf. Das fehlte ihr hier. Es gab nichts als Morton-Manor, den Strand, und eine ganze Menge langweiliger Hügel und Felder. Gorlwingham sollte zwar nur ein kleines Dorf sein, aber dort gäbe es möglicherweise etwas Abwechslung. Sie wollte ihren Onkel jetzt aber nicht fragen, ob er sie dorthin fahren würde, und zum Laufen lag der Ort viel zu weit entfernt. Also würde sie einen Spaziergang machen, um ein bisschen frische Luft zu schnappen.
Gedankenverloren schlenderte sie durch die Hügel. Ohne sich dessen bewusst zu sein, schlug sie die Richtung ein, in der nach David Williams Aussage das Haus liegen sollte, in dem er wohnte.
Tatsächlich entdeckte sie eine kleine Fischerhütte nahe des Strandes, als sie nach etwa einer halben Meile einen Hügel hinaufstieg. Erst jetzt wurde ihr bewusst, dass sie nicht zufällig in diese Richtung gegangen war. Das seltsame Verhalten des Jungen ließ ihr einfach keine Ruhe.
Einige Minuten lang starrte sie regungslos auf das Haus hinab. Dann ließ sie ein leises Geräusch hinter sich aufschrecken. Sie fuhr herum und entdeckte David, der mitsamt seines Wolfhundes nur ein paar Schritte hinter ihr stand und sie feindselig anstarrte.
"Verschwinde!", stieß er hervor. "Ich will nichts mit dir zu tun haben. Verschwinde, oder ich hetze Wolf auf dich! Und dann will er nicht mehr nur mit dir spielen wie heute Mittag."
"Nein!", sagte Melody bestimmt, und dieses eine Wort kostete sie beinahe alle Kraft, die sie aufbringen konnte. "Du kannst deinen Hund auf mich hetzen, aber ich werde nicht gehen."
7
Einige Sekunden lang herrschte Schweigen. Stumm musterten sich Melody und der Junge gegenseitig. Sein Blick war immer noch feindselig, aber es lag auch Fassungslosigkeit darin, dass sie es wagte, in diesem Ton mit ihm zu sprechen. Melody erwiderte seinen Blick so entschlossen, wie sie nur konnte. Schließlich verlor David dieses stumme Duell. Er senkte den Kopf.
"Also gut", murmelte er unfreundlich. "Was willst du?"
"Mit dir reden", antwortete Melody. "Ich möchte wissen, was dein Verhalten heute Mittag zu bedeuten hatte. Warum bist du so plötzlich weggerannt?"
"Du bist die Nichte von George Morton", sagte er, als wäre dies bereits Antwort genug. Melody jedoch reichte es nicht.
"Und?", hakte sie nach, als er nicht von sich aus weitersprach. "Ist das vielleicht ein Grund, mich einfach so stehenzulassen? Was hast du gegen meinen Onkel?"
"Du kennst ihn wohl selbst nicht besonders gut, wie?" Verächtlich spie David aus. "Er ist ein Ungeheuer. Jeder hier hasst ihn."
"Und warum?"
"Ach, lass mich in Ruhe! Ich will nicht mit dir darüber sprechen. Wenn meine Eltern wüssten, dass ich mich überhaupt mit einer Verwandten von diesem Morton unterhalten habe, würden sie mich bestrafen. Ich will nichts mit dir und deinem Ungeheuer von Onkel zu tun haben. Gar nichts, hast du das verstanden?"
Er wollte an ihr vorbeigehen, doch Melody hielt ihn am Arm fest. Der Hund an seiner Seite knurrte, und diesmal klang es wirklich drohend, aber sie ließ sich davon nicht einschüchtern.
"Jetzt hör mir mal zu!", sagte sie hart.
"Nein, ich will nichts hören. Lass mich sofort los!", unterbrach David sie und riss seinen Arm gewaltsam los.
"Zum Teufel, ich kann doch schließlich nichts für meinen Onkel", fauchte Melody. "Ich mag ihn selbst nicht besonders, aber das Gesetz hat mich in seine Obhut gegeben."
"Was ist denn mit deinen Eltern?", fragte David unschlüssig. Ihm war anzusehen, dass ihm immer noch am liebsten wäre, wenn er das Gespräch sofort beenden könnte, aber zumindest war er nicht mehr ganz so abweisend, wie gerade noch.
"Meine Eltern sind vor einer Woche gestorben."
"Oh", murmelte er betroffen und machte einige Sekunden Pause. "Das tut mir wirklich leid. Und jetzt hat man dich so einfach zu deinem Onkel gegeben? Konntest du denn nichts dagegen tun?"
"Ich kannte ihn ja vorher nicht. Zuletzt sah ich ihn als kleines Kind. Aber was ist denn eigentlich so schlimm an ihm?"
"Pah!" Erneut spie er aus. "Dein Onkel ist ein Blutsauger, der reinste Teufel in Menschengestalt. Ihm gehörten einmal ausgedehnte Landstriche hier. Genauer gesagt, gehörten sie ursprünglich seinen Eltern, also deinen Großeltern. Das waren freundliche und verständnisvolle Leute. Aber als sie starben und George Morton alles erbte, erhöhte er von einem Tag auf den anderen die Pachtzinsen derart, dass kaum noch jemand sie aufbringen konnte. So brachte er Hunger und Elend über viele Familien in der Umgebung. Auch über meine Eltern. Mein Vater musste seinen Hof aufgeben und auf die Fischerei umsatteln. Es reicht gerade so zum Leben."
Diesmal schwieg Melody betroffen. Davids Worte waren für sie eine Bestätigung für ihren Verdacht, dass Onkel George nur wegen des Geldes als ihr Vormund auftrat. Sie hätte sich selbst dafür ohrfeigen können, dass sie die Entscheidung nicht für ein paar Tage oder Wochen hinausgeschoben hatte, um ihren Onkel erst kennenzulernen, bevor sie sich so völlig in seine Gewalt begab. Das Jugendamt hätte sicherlich Verständnis dafür gehabt. Aber jetzt war es zu spät. Alle Papiere waren unterzeichnet. Es mussten sich schon schwerwiegende Gründe ergeben, um jetzt noch etwas rückgängig zu machen.
"Du sagtest, die Ländereien hätten meinem Onkel gehört" wandte sie nach einer Weile ein. "Ist das denn heute nicht mehr so?"
"Nein, Gott sei Dank nicht mehr. Morton hat in seinem Geiz und seiner Gier nach immer mehr Geld auch seine Bilanzen gefälscht. Vor nunmehr rund zehn Jahren kamen ihm die Behörden auf die Schliche. Er musste eine gewaltige Summe nachzahlen. Fast zur gleichen Zeit ging eine Firma, in deren Aktien er einen großen Teil seines Geldes angelegt hatte, Konkurs. Er verlor auf einen Schlag fast sein ganzes Vermögen, und das ist ihm recht geschehen. Es gibt wohl niemanden in der Umgebung von Gorlwingham, der ihn nicht hasst."
"Allmählich verstehe ich, warum du nichts mit mir zu tun haben willst", sagte Melody leise. "Aber ich kann schließlich nichts dafür, wie mein Onkel ist. Ich muss selbst unter ihm leiden. Bislang ist er noch einigermaßen freundlich zu mir gewesen, aber das wird bestimmt nicht mehr lange so bleiben."
"Kannst du denn nicht mehr von ihm fort?"
"Nein, das ist unmöglich. Er ist gerichtlich zu meinem Vormund bestellt worden. Die Einsamkeit hier wird in der nächsten Zeit bestimmt schlimm für mich werden. Du bist der einzige andere Mensch hier, den ich kenne. Könnten wir uns nicht vertragen? Dann würde alles für mich ein wenig leichter werden."
Unbehaglich scharrte David mit den Füßen im Gras. Sein Hund war nicht zu sehen. Er streifte irgendwo in der Umgebung herum.
"Du scheinst wirklich nicht viel mit deinem Onkel gemeinsam zu haben", sagte David schließlich. "Ich glaube schon, dass man mit dir auskommen kann. Aber du darfst mich auf keinen Fall besuchen kommen. Meine Eltern würden bestimmt ziemlich wütend werden, wenn sie erführen, wer du bist."
"Abgemacht. Ich freue mich, dass du nicht mehr böse auf mich bist. Treffen wir uns morgen?"
"Du findest mich am Strand. So, jetzt muss ich aber wirklich weg. Bis morgen dann."
"Bis morgen", verabschiedete sich Melody. Als sie sich auf den Rückweg nach Morton-Manor machte, sah die Welt nicht mehr ganz so düster für sie aus.
8
Melody hatte es nicht besonders eilig, nach Morton-Manor zurückzukehren, und so schlenderte sie noch eine Weile am Strand entlang. Die Sonne begann bereits unterzugehen, als sie schließlich wieder an das Portal klopfte. Henry Brannigan öffnete ihr und schaute sie wütend an.
"Wo bist du denn die ganze Zeit über gewesen?", blaffte er sie an.
Diese unfreundliche Begrüßung ließ Melody im ersten Moment zusammenzucken. Doch gleich darauf hatte sie sich wieder in der Gewalt.
"Ich glaube, das geht nur meinen Onkel und mich etwas an", gab sie heftiger zurück, als notwendig gewesen wäre.
Die Tür zum Wohnzimmer war nicht ganz geschlossen. Nun wurde sie geöffnet, und George Morton trat ebenfalls in den Flur. Seine Augen blickten Melody strafend an.
"Ich habe alles gehört und wünsche nicht, dass du in einem so unfreundlichen Ton mit Henry sprichst", sagte er streng. "Außerdem möchte ich ebenfalls wissen, wo du die ganze Zeit über gesteckt hast. Wir haben uns schon Sorgen um dich gemacht."
"Aber ich habe doch vorher gesagt, dass ich ein wenig spazieren gehe", erwiderte Melody.
"Ja, eine Weile, aber keine zwei Stunden."
"Ich bin aber wirklich nur umhergegangen und habe mir die Umgebung angesehen. Daran ist doch nichts Schlimmes. Du kannst dir doch vorstellen, dass mich alles interessiert, da ich hier neu bin."
"Das ist trotzdem kein Grund, einfach so lange fortzubleiben. Wir werden uns morgen noch darüber unterhalten. Jetzt geh auf dein Zimmer!"
Einige Sekunden lang starrte Melody ihren Onkel noch fassungslos an. Sie verstand nicht, wieso er so einen Aufstand machte, nur weil sie etwas spazieren gegangen war. Dann wandte sie sich wütend ab und rannte die Treppe hinauf. In ihrem Zimmer angekommen, knallte sie die Tür laut hinter sich zu.
Man behandelte sie ja wie ein kleines Kind, aber das würde sie sich nicht bieten lassen - ganz bestimmt nicht. Noch wusste sie nicht, was sie dagegen tun konnte, aber ihr würde schon etwas einfallen. Wenn sie nicht von Anfang an um ihre Rechte kämpfte, würde das später nur noch schwerer werden. Vielleicht war Onkel George in seiner Jugend übermäßig streng erzogen worden, aber das lag nun schon vierzig Jahre zurück. Die Zeiten hatten sich geändert. Er würde erkennen müssen, dass sie kein Gegenstand war, den man nach Belieben hin und her schieben konnte, sondern eine fast erwachsene Frau. Je eher er das einsah, desto besser war es für alle Beteiligten.
Wütend lief Melody in ihrem Zimmer auf und ab. Sie kam sich fast wie eine Gefangene vor. Die Luft war stickig und abgestanden, so dass sie auf den Balkon hinaustrat. Der Abendwind fuhr wie mit unsichtbaren Fingern über ihr erhitztes Gesicht und kühlte es. Die Sonne war zu einem rot glühenden Ball geworden, der bereits mit dem Horizont verschmolz und das Wasser rötlich färbte. Es sah aus, als würde er vom Meer verschlungen. Der Anblick tröstete Melody ein wenig über die unfreundliche Behandlung durch ihren Onkel hinweg. Solche Naturschauspiele führten ihr immer wieder vor Augen, welch eine unbedeutende Rolle der Mensch im Werk der Schöpfung doch spielte. Fasziniert beobachtete sie den Sonnenuntergang. Sie griff nach ihren Zigarette und zündete sich eine an. Dann trat sie an das hölzerne Geländer heran und legte eine Hand auf die Kante der Brüstung. Melody beugte sich noch ein bisschen weiter vor. Dann hörte sie urplötzlich ein verräterisches Krachen, das wie ein Donnerschlag in ihren Ohren widerhallte. Ein eisiger Schrecken durchfuhr sie und lähmte sie. Beinahe ohne jeden Widerstand gab das Geländer unter dem Druck ihres Körpers nach, brach vollends aus seiner Verankerung und stürzte in die Tiefe.
Melody schrie auf, als sie spürte, wie sie ebenfalls nach vorne kippte. Als sie ihre Erstarrung endlich abschütteln konnte und die Fassung wiedergewann, war es bereits zu spät, das Gleichgewicht noch zu halten. Im letzten Moment warf sie sich herum und bekam gerade noch die steinerne Kante des Balkons zu packen, an der sie sich festklammern konnte. Ein furchtbarer Ruck fuhr durch ihre Finger. Der Schmerz raste ihre Arme hinauf, explodierte in den Schultergelenken und drohte sie auseinanderzureißen. Glühende Nadeln schienen sich in Melodys Fleisch zu bohren. Sie hatte das Gefühl, brennende Lava würde statt Blut durch ihre Adern rinnen, und ihre Muskeln schienen nur noch dazu geschaffen zu sein, ihr Schmerzen zuzufügen.
Trotzdem ließ sie nicht los, sondern klammerte sich noch fester an die raue Steinkante. Voller Verzweiflung spürte sie, wie ihre vom Schweiß feuchten Finger abzurutschen begannen. Zwei Fingernägel brachen ihr ab. Tränen rannen über ihr Gesicht. Mit aller Kraft kämpfte sie gegen den Schmerz an, obwohl er so schlimm war, dass er ihr fast das Bewusstsein raubte. Nach einem flüchtigen Blick in die Tiefe, hob sie sofort wieder den Kopf. Zwei Stockwerke tiefer, mehr als sieben Yards unter ihr erstreckte sich eine steile Steintreppe, die in den Keller von Morton-Manor hinabführte. Einen Sturz dort hinab würde sie unmöglich überleben, und wenn doch, dann so schlimm zugerichtet, dass der Tod vielleicht sogar das gnädigere Schicksal wäre.
So laut sie nur konnte, schrie Melody um Hilfe. Alles schien wie in Zeitlupe um sie herum abzulaufen. Jede Sekunde dehnte sich zu Stunden, zu einer wahren Ewigkeit. Gar nicht weit von ihr entfernt gab es einige grobe Stuckverzierungen, die fast bis zum Boden hinabreichten. Es wäre nicht einmal übermäßig schwierig, daran hinunterzuklettern, aber sie befanden sich zu weit entfernt, um sie zu erreichen. Der einzige Weg zur Rettung führte zurück auf den Balkon. Immer noch schrie Melody, doch niemand schien sie zu hören. Das Wohnzimmer lag auf der anderen Seite des Hauses, und die dicken Mauern schluckten jeden Laut. Auf Hilfe konnte sie kaum hoffen; sie musste sich selbst retten.
Mühsam zerrte sie sich ein Stück in die Höhe und versuchte, mit den Fingern erneut irgendwo Halt zu finden. Doch der Stein war zu glatt. Sie rutschte zurück. Ein neuer Schmerz fuhr durch ihre Hände, als die Beine durch den Ruck in Pendelbewegung versetzt wurden und es ihr noch schwerer machten, sich weiterhin festzuklammern.
Melody wusste selbst nicht, woher sie die Kraft nahm, sich noch einmal in die Höhe zu ziehen. Ihr ganzer Körper schien nur noch aus brennendem, schier unerträglichem Schmerz zu bestehen. Dennoch schaffte sie es diesmal, sich mit einem Ellbogen aufzustützen. Sie musste eine kurze Pause machen, dann konnte sie auch den zweiten Unterarm aufstützen. Der schmerzhafte Druck verlagerte sich von ihren Händen auf die Ellbogen. Aber die entscheidende Kraft, sich vollends in die Höhe zu stemmen, fehlte ihr. Sie war schon zu erschöpft und musste es anders versuchen.
Ruckartig riss sie die Beine in die Höhe. Mit einem Fuß berührte sie die Balkonkante, doch nicht weit genug, denn ihr Schuh rutschte sofort wieder ab, und um ein Haar hätte sie ganz den Halt verloren.
Melody ließ sich davon nicht entmutigen. Sofort startete sie einen neuen Versuch. Sie spürte, dass es zugleich auch der letzte sein würde. Noch einmal würde sie die Kraft dafür nicht aufbringen können. Ihre Arme waren schon jetzt taub und gefühllos. Es konnte nur noch Sekunden dauern, bis die Kräfte sie endgültig verlassen würden.
Aber noch gab sie nicht auf. Da die Schuhe ihr zu wenig Halt boten, streifte Melody sie ab. Dann versetzte sie ihre Beine erneut in Pendelbewegung, ignorierte den Schmerz und riss ihre Fuß dann noch einmal mit aller ihr noch zur Verfügung stehenden Kraft in die Höhe. Auch diesmal sah es im ersten Moment so aus, als ob ihr Fuß von dem glatten Stein abrutschen würde, aber dann fanden ihre Zehen einen kleinen Vorsprung, ein abgesplittertes Reststück des Geländers, das noch fest im Boden verankert war. Mit dem Fuß und den Ellbogen zugleich gab sie sich den nötigen Schwung, sich ganz auf den Balkon zurückzurollen.
Melody war am Ende ihrer Kräfte angelangt. Sie schaffte es gerade noch, sich bis vor die Tür des Zimmers zu wälzen, dann blieb sie völlig erschöpft liegen. Blutige Schleier tanzten vor ihren Augen. Sie zitterte am ganzen Körper und hätte vor Schmerz geschrien, wenn sie nicht selbst dafür schon zu schwach gewesen wäre.
Ein schwarzer Schacht öffnete sich in ihrem Geist. Nur undeutlich nahm sie noch wahr, wie die Tür aufgerissen wurde und sich jemand über sie beugte - dann verlor sie endgültig das Bewusstsein.
9
Ein scharfer Geruch stach Melody in die Nase und riss sie aus der Ohnmacht. Sie musste niesen.
Stöhnend schlug sie die Augen auf. Sofort wühlte wieder der schreckliche Schmerz in ihrem Körper und ließ das Erwachen zu einer Qual werden. Melody kämpfte dagegen an und schaute sich verwirrt um. Sie lag angezogen auf dem Bett. Henry Brannigan stand vor ihr und schraubte gerade das Riechfläschchen zu, mit dem er sie geweckt hatte. Erst nach einigen Sekunden kehrte Melodys Erinnerung zurück. Mit einem keuchenden Schrei fuhr sie in die Höhe.
"Der Balkon …", stammelte sie. "Das Geländer ..."
"Ja, das Geländer. Dafür bist du uns wohl eine Erklärung schuldig", sagte Onkel George scharf. Er stand im Hintergrund des Zimmers, trat aber jetzt zu ihr an das Bett heran. "Was fällt dir ein, einfach die Sachen kaputt zu machen?"
"Die ..." Melody verstummte. Fassungslos rang sie nach Worten.
"Also?", fuhr George Morton unbeirrt fort. "Was hast du dir dabei gedacht? Vielleicht konntest du Zuhause einfach etwas zerstören, wenn du wütend warst, aber hier gibt es so etwas nicht. Erst knallst du die Tür so laut zu, dass sie fast aus den Angeln bricht, und dann zerstörst du noch das Geländer."
"Aber ich ... ich habe doch ... das kann doch nicht …", stammelte Melody hilflos und rang vergebens nach Worten. Ihre Augen weiteten sich vor fassungslosem Unglauben. Da war sie gerade dem Tod entkommen, und nun warf man ihr vor, alles absichtlich gemacht zu haben, um ihren Zorn abzureagieren.
"Es dürfte dir wohl klar sein, dass du den Schaden ersetzen wirst", sagte Onkel George.
Melodys Schrecken schlug jäh in Zorn um. Was man ihr vorwarf, war einfach grotesk.
"Aber ich habe das Geländer nicht kaputt gemacht!", schrie sie laut und schlug gleichzeitig mit den Fäusten auf die Bettdecke.
"Ach nein", entgegnete ihr Onkel ungerührt. "Wahrscheinlich ist es ganz von alleine abgebrochen, als du es nur angeschaut hast, wie?
"Ja, verdammt, ich habe ..."
"In meinem Haus wird nicht geflucht, merk dir das! Und du solltest gar nicht erst versuchen, mich für dumm zu verkaufen. Geländer brechen nicht einfach so von alleine ab. Ich werde die Brüstung von deinem Geld ersetzen lassen. Das soll dir eine Lehre sein, dass man anderer Leute Dinge nicht mutwillig zerstört. Und dann erwarte ich außerdem eine Entschuldigung von dir. Solange wirst du in deinem Zimmer bleiben, damit du dir über alles Gedanken machen kannst. Morgen hast du jedenfalls Hausarrest. Bist du bis dahin nicht zur Vernunft gekommen, werde ich weitere Maßnahmen ergreifen." Er gab Henry Brannigan ein Zeichen. Bevor Melody noch ein Wort sagen konnte, verließen beide das Zimmer. Sobald sie die Tür geschlossen hatten, wurde von außen ein Schlüssel im Schloss herumgedreht, dann waren nur noch ihre sich entfernenden Schritte zu hören.
Wie erstarrt blieb Melody auf ihrem Bett setzen. Erst nach fast einer Minute erwachte sie aus ihrer Erstarrung. Sie schrie vor Wut, so laut sie nur konnte. Aber niemand hörte sie.
10
In dieser Nacht fand Melody nur wenig Schlaf. Zuerst hielt die Wut sie wach. Immer wieder hämmerte sie mit den Fäusten gegen die Zimmertür, ohne dass sich jemand darum kümmerte. Sie fluchte und schimpfte auf ihren Onkel, bis sie schließlich die Sinnlosigkeit ihrer Anstrengungen einsah und sich wieder voller Groll auf ihr Bett zurücksinken ließ.
Sie begriff nicht, wie jemand so starrsinnig sein konnte, sich nicht wenigstens anzuhören, was sie zu sagen hatte. Sicher, auf den ersten Blick schien die Lage klar zu sein. Sie war wütend gewesen, und durch das laute Zuschlagen der Tür hatte sie den Verdacht noch genährt. Da Onkel George sie offenbar für ein verwöhntes Stadtkind hielt, war er von ihrer Schuld überzeugt. Aber an diesem Vorfall war sie wirklich unschuldig. Weder hatte sie absichtlich das Geländer zerstört, noch hatte sie sich besonders fest dagegen gelehnt. Es musste völlig vermorscht gewesen sein, dass es schon unter der leichtesten Berührung nachgab. Aber wie sollte sie das nur beweisen? Alles sprach gegen sie.
Nach einer Weile versorgte sie ihre vielen kleinen Wunden. Sie hatte sich die Hände und Knie aufgeschürft. Auch ihre abgebrochenen Fingernägel bluteten etwas und taten vor allem höllisch weh. Da sie weder Pflaster noch Verbandszeug besaß, nahm sie einige Taschentücher aus dem Schrank und legte sich damit notdürftige Verbände an, bevor sie sich auszog, ins Bett legte und auf den Schlaf wartete, der einfach nicht kommen wollte.
Sie wusste nicht, wie lange sie so dalag und zur Decke emporstarrte, bis sie irgendwann schließlich doch einschlief, aber immer noch wirkten der Schock und die Wut in ihr nach. Sie hatte Alpträume, aus denen sie immer wieder schreiend aufwachte und dann lange wach lag.