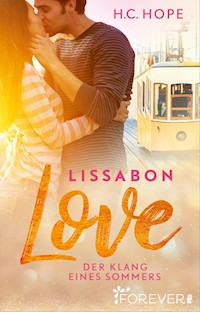Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Ein einziger Blick – ein ganz neues Leben? Der ergreifende Liebesroman »Rooftop Challenge – Bis zum Horizont« von H. C. Hope als eBook bei dotbooks. Paxton liebt den Thrill, das Abenteuer. Mit dem Rooftop Club erklimmt er illegal die Hochhäuser von Chicago. Nur dort oben, weit über der Stadt, fühlt er sich frei. Doch beim Besteigen des Chicago Med ertappt ihn der Sicherheitsdienst. Paxton muss flüchten. Er versteckt sich in einem der Krankenhauszimmer und sieht sich unverhofft Laila gegenüber, deren Mut ihn ebenso fasziniert wie ihre großen grünen Augen … Laila wartet auf die rettende Knochenmarkspende. Als plötzlich der mysteriöse Paxton in ihrem Zimmer auftaucht, verspürt sie, was sie nicht mehr für möglich gehalten hätte: Aufregung, Anziehung und Abenteuerlust. Aber sie muss sich aufs Gesundwerden konzentrieren. Für jemanden wie Paxton ist in ihrem Leben kein Platz – oder? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Die bewegende New-Adult-Romance »Rooftop Challenge – Bis zum Horizont« von H. C. Hope wird die Fans von Dustin Thao und dem Bestseller »Das Schicksal ist ein mieser Verräter« begeistern! Das Hörbuch und die Printausgabe sind bei SAGA Egmont erschienen. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:8 Std. 20 min
Sprecher:Lisa Sarah Brandstäter
Ähnliche
H. C. Hope
Rooftop Challenge – Bis zum Horizont
Roman
dotbooks.
Rooftop Challenge - Bis zum Horizont
eBook-Lizenzausgabe
Dieser Roman ist außerdem als Hörbuch und Printausgabe bei SAGA Egmont erschienen, www.sagaegmont.com/germany.
Copyright © der Originalausgabe 2022 H.C. Hope und SAGA Egmont
Copyright © der eBook-Lizenzausgabe dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Covergestaltung: Paulina Ochnio unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
ISBN: 978-3-98690-595-8
Triggerwarnung:
Dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte zu folgenden Themen: Verlust, Todesängste, Krankheit und depressive Episoden.
Für die Hoffnung, die wir in düsteren Momenten in uns tragen. Möge sie den Weg hell erleuchten.
Kapitel 1
– Laila –
Wie steht man zum Thema Hoffnung, wenn man seit einem Jahr gegen einen aggressiven Blutkrebs kämpft?
Leukämie.
Ich hasste das Wort.
Wenn ich in das ausgemergelte Gesicht meiner Eltern schaute, dann war die Hoffnung dort allgegenwärtig. Lag über ihren harten Zügen, die in zusammengepressten Lippen und eingefallenen Wangen endeten. Die Hoffnung trieb hin und wieder ein Lächeln in die von dunklen Rändern gezeichneten Augen.
Die Hoffnung war der Halm, an den sie sich klammerten. Sonst würden sie im Schatten der Depression versinken. Und die Depression war ein gefräßiges Monster.
Wenn ich die rapide Verschlechterung meiner Vitalwerte betrachtete, spürte ich die eisigen Klauen der Krankheit um mich. Ich wusste nicht, wie es meine Eltern schafften, noch einigermaßen aufrecht zu stehen. Ihre angespannten Schultern zeugten von der Last, die ich ihnen bereitete. Ein Gedanke, der mir die Kehle zuschnürte.
An manchen Tagen fiel mir das Hoffen besonders schwer. Ich stellte mir dann sogar meine eigene Beerdigung vor. An anderen Tagen verdrängte ich die Schatten durch Kindheitserinnerungen voller Liebe, für die ich bereit war, zu kämpfen.
Die Hoffnung trieb meine Eltern zur emotionalen Höchstform. Sie besuchten mich täglich in meinem bescheidenen Krankenzimmer im Chicago Med, in dem es von surrenden Geräten und Pieptönen nie auch nur eine Minute still war. Die Station war laut, obwohl ich mir nichts sehnlicher wünschte als Stille. Ich vermisste sie.
Meine Eltern würden alles für mich tun, das war es, was die Hoffnung ihnen eintrichterte. Sie sahen mich, Laila, nicht nur den Krebs.
Optimismus.
Wir beide hatten ein zwiegespaltenes Verhältnis zueinander. Der Optimismus war beides: mein Dämon und mein bester Freund. Wenn wir beide nicht immer wieder aufeinandergetroffen wären, dann hätte ich den Kampf vielleicht längst aufgegeben und läge in einer hölzernen Kiste unter der Erde.
Ganz ehrlich? Keine sonderlich schöne Vorstellung. Für mich mit siebzehn.
Ich schlug die Augen auf. Das stetige Piepen hatte Schwester Helen schon vor Stunden leiser gestellt. Trotzdem blieb ich hellwach. Es war eine Kunst, mit einem Sauerstoffschlauch im Nasenloch zu schlafen, der bei jeder Gelegenheit gegen die Nasenscheidewand pochte. Ich wünschte, meine wäre kerzengerade und nicht verkrümmt. Doch die krumme Nase war mein kleinstes Problem. Das viel Größere war der Grund, warum dieser Schlauch überhaupt in meiner Nase steckte. Durch mein angeschlagenes Immunsystem neigte ich zu Lungenentzündungen. Der Schlauch begleitete mich dann so lange, bis die Entzündung am Abklingen war.
Ich nannte ihn Engel, weil sich die kleinen Stöße Sauerstoff, die er in meine Nase schickte, anfühlten, als ob ein Engel seine Schwingen ausbreitete. Zumindest stellte ich mir so den Lufthauch vor, der einen dabei streifen musste.
Als krebskranke Patientin auf der Kinder- und Jugendonkologie im Chicago Med hatte ich viel Zeit für solche Gedankenspinnereien. Vergeudete Zeit. Zeit, die ich lieber anders genutzt hätte und nicht damit, Geräten und Schläuchen Namen zu geben. In einem kargen Krankenzimmer mit hellgelben Wänden und dem Bild von einem Tannenbaum an der Wand. Gefühlt jeden Pinselstrich hatte ich betrachtet, bevor meine Eltern mir endlich meinen Laptop brachten. Der setzte dem Tannenbaumstarren ein Ende. Mittlerweile prangten neben der Blume Fotos meiner Eltern, meiner Freunde und ein Foto plus Postkarten der Rocky Mountains. Eines Tages möchte ich sie durchstreifen. Wenn der Himmel mich lässt …
Nur Schwester Helen verstand mich. Sie sagte nach der Krebsdiagnose zu mir, dass es die Dinge vereinfachte, wenn man sie beim Namen nannte. Ein geduzter Krebs verliert an Schrecken.
Helen war die Erste, die eine Rocky Mountains Postkarte für mich an die Wand gepinnt hatte.
Ich setzte mich vorsichtig auf und achtete darauf, dass sich der Sauerstoffschlauch nicht verhakte. Das fiese an meinem Hoffnungsdilemma war, dass ich auf eine Knochenmarkspende wartete. Sie war die einzige Maßnahme, die mir eine Chance auf Heilung bot oder zumindest meine Lebenszeit verlängern konnte. Nach drei mehr oder weniger erfolglosen Chemotherapien.
Tja, Hoffen und Warten war eigentlich nie mein Ding gewesen. Und jetzt war es meine Hauptbeschäftigung.
Ich stand auf der Spenderliste weit oben und hoffte darauf, dass sich viele Menschen auf die passenden Stammzellen testen ließen. Meine Freunde hatten es mir versprochen. Doch ihre Besuche wurden spärlicher, je länger ich im Krankenhaus lag. Ich war nicht mehr spannend, hatte keinen Gossip auf Lager, sondern nur meine Krankheit. Ich war weit von den Partys und Ausflügen entfernt und erfuhr den neuesten Klatsch der alten Schule nur über WhatsApp-Gruppen oder meine beste Freundin Tori.
Diese Erkenntnis wog schwer. Ich vermisste die gemeinsamen Unternehmungen mit ihr. Natürlich tat ich das. Doch sie fand wenig Zeit für Besuche. Tori war ultraklug, und ich gönnte ihr von Herzen das Stipendium an der University of Chicago. Sie würde eine tolle Wissenschaftlerin abgeben. Davon war ich überzeugt.
Zum Glück war Schwester Helen zu einer Freundin geworden. Ohne sie wäre ich vermutlich schon lange auf Antidepressiva gewesen.
Mein früheres Ich, vor der Krankheit, hätte ungläubig gelacht beim Wort „Antidepressiva“. Ich hatte das Leben genossen. Damals trieb ich mich mit Freunden in Bars herum, tanzte für mein Leben gern in der Disco und genoss das Kitzeln eines Sonnenstrahls auf der Nase. Ich vermisste meine morgendlichen Joggingeinheiten im Hyde Park, bei denen ich gern mit Sammy, dem kleinen Pudel der alten Miranda, um die Wette gerannt war. Den Kaffee, den ich nach dem Wettrennen in der Hover-Bäckerei trank und sogar das regelmäßige Zuspätkommen in meinem Abschlussjahr in der Highschool. Den Abschluss würde ich nachholen müssen. Nach erfolgreicher Heilung.
Erfolgreiche Heilung … Ein kalter Schauer lief mir den Rücken entlang. Meine Zukunftspläne lagen auf Eis. Darüber wollte ich vorerst nicht weiter nachdenken. Denn was brachte das schon? Erst mal musste klar sein, dass ich überhaupt eine Zukunft hatte. Weil es die Chance gab, die Krankheit in den Griff zu kriegen.
Engel beatmete mich mit Krankenhausluft.
„Süße, hast du wieder Schlafprobleme?“ Helen stand mit warmem Lächeln und blauer Schwesternkluft in der Tür. Aufmerksam betrachtete sie mich.
„Du weißt, dass ich den Schlauch hasse. Er stört beim Einschlafen“, entgegnete ich – wohlwissend, dass sie ihn nicht rausnehmen würde. Natürlich hätte ich den verdammten Schlauch selbst entfernen können, aber jedes Mal, wenn ich es wagte, kam der Oberarzt angerannt, als würde die Station brennen. Dazu röhrte ein nervtötendes Schrillen durch den Flur. Dank dem Clip des Pulsoxymeters an meinem Finger. Er zeigte, wie es um die Sauerstoffsättigung meines Bluts stand. Nicht immer gut.
„Ich weiß, Laila. Der Schlauch ist kein angenehmer Zeitgenosse, aber notwendig.“ Sie trat zu mir ans Bett und musterte mich liebevoll.
Helen gelang es, mich zu behandeln, als wäre ich ein ganz normales Mädchen. Sie bedachte mich nicht heimlich mit mitleidigen Blicken, wie es viele andere Schwestern auf der Station taten.
Frustriert ließ ich den Kopf ins Kissen sinken.
„Soll ich dir Schlafmittel besorgen?“
„Nein. Lass mal. Von denen wird mir übel.“ Mein Magen war nicht mehr so resolut wie früher. Jede zu große Belastung quittierte er mit Übelkeit und Erbrechen.
Helen seufzte. „Die Chemo war erst kürzlich. Warte noch etwas. Dann wird das mit dem Magen besser.“
„Na super. Die Chemo hat nicht angeschlagen, aber immerhin werden die Magenschmerzen weniger“, spottete ich.
„Verdammter Krebs, was?“
Helen war die Einzige, mit der ich unbefangen über ihn sprechen konnte. Darüber, wie enttäuscht ich war. Welche Hoffnungen ich auf die letzte Chemo-Behandlung gesetzt hatte. Alle zerschlagen.
Rückschläge wollten meine Eltern nicht wahrhaben. Denn wenn sie solche Momente der Schwäche erst mal zugelassen hätten, wären sie wohl komplett ins Straucheln geraten. Also betrachteten sie alles von der positiven Seite und weinten vermutlich heimlich zu Hause. Damit ich es nicht sah.
„Ja, scheiß Krebs.“ Ich hasste ihn. Aber ich achtete darauf, dass der Hass nicht überhandnahm. Wegen der Antidepressiva-Sache. Mein Magen würde sich freuen.
Helen nahm die leere Wasserflasche. „Soll ich dir einen Schlaftee zubereiten?“
„Hast du so was?“ Der wäre wenigstens magenschonend. „Gibt es da keine Querwirkung zu den anderen Medis?“
In der Medizin war alles so kompliziert. Ich bewunderte Ärzte, wie Dr. Bones, der auf Anhieb wusste, welche Präparate miteinander eingenommen werden konnten und welche die Wirkung gegenseitig aufhoben oder schlimmeres.
„Ein läppischer Tee mit etwas beruhigendem Hopfen oder Lavendel wird dich nicht umbringen.“ Ein herausforderndes Grinsen schlich sich auf Helens Gesicht. Das blaue Schwesternshirt saß ein wenig zu locker um ihre schmalen Schultern.
„Einen Versuch ist es wert“, meinte ich.
Die Uhr zeigte schon zwanzig nach elf. Für gewöhnlich stampften die Schwestern ab sechs Uhr früh durch die Gänge, als müssten sie den Beelzebub vertreiben. Wenn ich nicht bald etwas Schlaf abbekam, würde der morgige Tag, inklusive Blutabnahme, ein schwindelbehafteter werden.
„Ich habe ihn in meinem Spind. Dachte, er könnte dir vielleicht helfen. Außerdem schmeckt er gar nicht mal so übel.“
„Du hast Schlafprobleme?“, erkundigte ich mich bei Helen, die entweder ihre Augenränder mit Concealer überdeckte oder sich mit koffeinhaltigen Getränken über Wasser hielt.
„Nein. Ich schlafe wie ein Stein. Aber ich probiere grundsätzlich, was ich den Patienten andrehe. Das alte Andickungspulver zum Beispiel war schrecklich. Ich habe es alle Schwestern auf Station probieren lassen. Eine Zumutung. Jetzt kriegen wir ein geschmacksneutraleres.“
Eine Magensonde hatte ich bisher, zum Glück, nicht benötigt. Ich hatte großen Respekt vor allen, die parallel zur Magensonde das Essen normaler Speisen trainieren mussten. Insbesondere dann, wenn ein bösartiger Tumor ihnen einen Teil der Zunge geraubt hatte und das Schlucken erschwerte. Angedickte Flüssigkeit und pürierte Kost waren nichts, das ich auf meinem Speiseplan wollte. Aber das änderte nichts daran, dass ich beispielsweise den alten Henry bewunderte, der tapfer das Schlucken trainierte, um endlich von der Ernährung per Sonde wegzukommen. Als mein Kreislauf es noch zugelassen hatte, hatte ich oft bei ihm gesessen und ihm geholfen, Apfelmus zu löffeln.
„Okay, dann serviere mir mal deinen Zaubertee.“
Helen verließ das Zimmer. Ein paar Minuten später kehrte sie mit einer dampfenden Teetasse zurück.
Skeptisch nahm ich das warme Gebräu entgegen und schnupperte daran. Er roch süßlich.
„Probier ihn“, forderte mich Helen auf.
Ich setzte vorsichtig meine spröden Lippen an den Tassenrand und trank. Eine zarte Himbeernote lag auf dem Lavendelgeschmack.
„Wirklich gar nicht so übel.“ Ich musste grinsen, als ich Helens zufriedenes Lächeln bemerkte.
„Los, weiter. Du musst ihn trinken, solange er warm ist. Dann wirkt er am besten.“
Sie zwinkerte mir noch einmal zu und ging dann aus dem Raum. Durch die Glasscheibe im oberen Türbereich mit der halb hochgezogenen Jalousie sah ich, wie sie eilig um die Ecke bog.
Wenige Schlucke später bildete ich mir ein, sanfte Müdigkeit zu spüren. Ich leerte die Tasse und ließ mich auf das große Kissen sinken. Danach dimmte ich das Licht mit dem Schalter, der am Triangelgriff hing. Ich horchte meinen Gedanken nach, als wären sie Besucher. Bunte Bilder flogen an mir vorbei. Aber ich ignorierte sie, zog mich zurück und setzte mich in eine kleine Ecke meines Selbst.
Zweifel streiften unbeachtet vorbei. Würde ich sie aufgreifen, würde ich zerbrechen. Also ließ ich sie im Nebel verschwinden.
Ich atmete ruhig. Im Rhythmus, in dem die Luft in meiner Nase kitzelte.
Ein … aus …
Meine Arme wurden schwer und sanken auf die Matratze. Ich schloss die Augen.
Ich erwachte, als ich eilige Schritte und Stimmengemurmel auf dem Flur hörte. Verschwommen und undeutlich.
Sofort richtete ich mich auf. Mein Herz pochte schnell. Was war da los? Ein Notfall?
Es war jedes Mal beängstigend, wenn auf den Fluren um ein Menschenleben gekämpft wurde. Hier auf der Onkologie-Abteilung traf mich das besonders hart. Denn in diesem Fall handelte es sich um einen meiner Leidensgenossen. Mich könnte das auch treffen.
Ich kniff die Augen zusammen.
Aber wenn es ein Notfall war, hätte doch eigentlich der Schein des roten Lämpchens, das im Schwesternbüro angebracht war, zu sehen sein müssen. Das Lichtspiel zwischen den Lamellen der Jalousie blieb aber aus.
Ein nervöses Kribbeln flutete meinen Bauch. Irgendetwas passte nicht. Die Schwestern waren nachts für gewöhnlich nicht sonderlich aktiv. Betteten sich abwechselnd in die Schwesternzimmer, um etwas Schlaf abzubekommen.
Mühsam reckte ich mich. Traute mich nicht, das Bett zu verlassen. Mein Kreislauf war nicht stabil genug. Die ersten Spaziergänge waren erst für übermorgen angedacht. Blöde Lungenentzündung!
Die Schritte näherten sich. Unkoordiniert. Verdammt!
Rannte dort jemand?
Dass einer meiner Leidenskollegen abhaute, konnte ich mir nicht vorstellen. Wenn es ihnen annähernd so beschissen ging wie mir, dann verließen sie ihr Bett nicht freiwillig. Schon gar nicht in dem Tempo, in dem sich derjenige auf dem Gang bewegte.
Bei einem Notfall war ein Pulk von rennenden Schritten zu hören, der gleichmäßig verebbte.
Mir schwante, dass da draußen jemand war, der nicht zur Nachtschicht gehörte.
Oh mein Gott!
Ein Amokläufer?
Ängstlich zog ich die Knie an meinen Brustkorb.
Mein Herz stolperte.
Vielleicht war es nur ein Handwerker, versuchte ich mich zu beruhigen, und sah, wie sich die dunkle Silhouette eines Mannes vor meinem Fenster abzeichnete.
Kapitel 2
– Paxton –
Wow. Das Adrenalin schoss wie ein heißer Strahl durch meine Venen. Ich heizte es mit einem Schluck Whiskey an. Mitten auf dem gekiesten Dach des Chicago Meds umgeben von funkelnden Sternen und der bunten Leuchtkulisse der Stadt.
Ein episches Gefühl!
Unbemerkt in den Gängen der Klinik herumzuschleichen und keiner Nachtschwester zu begegnen, war erst der Anfang gewesen. Die Betonfassaden vom fünften Stock bis aufs Dach hochzuklettern war der Rausch, nach dem ich süchtig war. Die schlecht griffige Betonfassade und der Thrill, jeden Moment in die Tiefe zu stürzen, wenn ich einen Handgriff verfehlte. Das ließ mich spüren, dass ich noch am Leben war. Frei von allen Fesseln.
Das Kribbeln im Magen war das Gefühl, von dem ich nie genug haben konnte. Die Rooftop-Challenge mit den Jungs und das Gefühl der Freiheit, wenn ich Chicago überblickte, waren es mir wert, jedes Risiko einzugehen. Dafür würde ich auf den höchsten Wolkenkratzer steigen. Ungesichert.
Der Whiskey aus meinem kleinen Flachmann rann brennend die Kehle hinab. Ich setzte ihn ab und atmete die Nachtluft ein.
„Alter, wir haben es geschafft. Das Med können wir von unserer Liste streichen. Wollen wir nicht langsam nach unten? Elijah und Jacob stehen sich sicher schon die Beine in den Bauch.“ Maurice, mein bester Kumpel seit Kindheitstagen, pirschte sich zu mir an die kleine Mauer heran, die das Dach umgab. Dicht an der Kante zu stehen war für ihn immer die größte Herausforderung. Die schmale Grenze zwischen dem sicheren Stand und dem freien Fall, ein beinahe unwirkliches Gefühl. Als stünde man an der Schwelle zwischen Leben und Tod.
Schon als Kinder waren wir von unseren Eltern in teure Boulder-Summercamps nach Milwaukee geschickt worden. In jedem von uns steckten mindestens zehn Jahre Klettererfahrung. Wobei ich davon überzeugt war, dass unsere Eltern uns den Sommer über nur hatten abschieben wollen. Das Klettern war nur eine Ausrede gewesen. Tja, das hatten sie jetzt davon.
„Lass uns wieder zurück. Ich habe keinen Bock von der Security erwischt zu werden“, drängte Maurice erneut.
Nicht, dass das für uns von Belang gewesen wäre, denn meine Eltern holten mich aus jeder Misere raus. Mit einem Griff in die Portokasse. Als Sohn des Geschäftsführerehepaars einer Sportwagenfabrik genoss ich solche Vorzüge. Auch wenn eine Vorstrafe nicht so geil für die geplante Karriere wäre. Der Übernahme der hauseigenen Firma. Es juckte mich nicht.
Die Krankenhausflure waren sicher mit Kameras gespickt. Wir würden sowieso auffliegen, falls das nicht schon längst geschehen war. Das würde ein nettes Filmchen geben. Ich riss mich von den flackernden Lichtern der Stadt los, die beinahe den Sternenhimmel zu berühren schienen.
„Alles klar. Aber wir klettern, okay?“
Maurices Miene verfinsterte sich. „Wir sind schon ewig hier oben, Pax. Lass uns das Treppenhaus nehmen!“
Ich fuhr mir durchs Haar. Maurices Vernunft würde mir irgendwann noch den letzten Nerv rauben. Das war schon damals in den Camps so gewesen.
„Komm schon! Wir haben uns geschworen, den Rückweg immer save anzugehen“, erinnerte er mich an den Pakt, den wir geschlossen hatten, als wir uns die Rooftop-Challenge ausgedacht hatten. Niemals den Rückweg unnötig riskant gestalten, es sei denn wir stünden auf dem Lake Point Tower, dem höchsten Wolkenkratzer am Lake. Von dort wollte ich unbedingt mit einem Seil wieder nach unten klettern. Bis meine Muskeln brannten und der Schmerz Beweis war, dass ich es geschafft hatte.
Genau das war mein Ziel, für das ich hart trainierte.
„Also gut. Dann das Treppenhaus.“
Dieser verdammte Pakt! Aber okay. Immerhin hatte ich gerade auch einen ordentlichen Schluck Whiskey getrunken, um meinen Sieg zu feiern.
Wir gingen zu einer Metalltür. Erfahrungsgemäß waren die Türen zum Dach nicht verschlossen. Keine Ahnung, was sich die Menschen dabei dachten. Vermutlich, dass keiner so verrückt wäre, aufs Dach zu klettern. Oder sie nutzten das Dach heimlich als Ort zum Knutschen, Rauchen … was auch immer.
Wir schlichen das dämmrige Treppenhaus hinab bis in den fünften Stock. Dort standen Elijah und Jacob Schmiere.
Ich öffnete die Tür in den Krankenhausflur und roch Sterillium. Hastig schlüpften wir hindurch.
„Achtung, Schwestern im Anmarsch!“ Elijah sprintete los und bog um die nächste Ecke.
Ich hörte Schritte und drehte mich um. Fuck! Ich musste schnellstmöglich hier weg. Aber wohin?
Als ich ebenfalls lossprinten wollte, merkte ich, dass Maurice schon abgehauen war. Wer auch immer hinter uns war – er kam näher.
Mein Herz klopfte wild. Ich wollte nicht im Streifenwagen abtransportiert werden, das war zu billig. Das wäre an meinen Stolz gegangen. Ich wollte unbemerkt aus dem Krankenhaus verschwinden und mich den Rest der Nacht an dem Kitzel ergötzen.
Ohne nachzudenken, drückte ich die Türklinke hinter mir herunter, öffnete leise die Tür und schlüpfte in das Krankenzimmer. Wer auch immer da lag – hoffentlich war er so zugedröhnt mit Pillen, dass er mich nicht bemerkte.
Schnapsidee, Paxton. Ehrlich!
Ich schloss leise die Tür, und mein Blick schnellte zum Krankenbett mit der hellblau gestreiften Bettwäsche.
Mit angezogenen Knien saß da eine junge Frau und starrte mich aus schreckgeweiteten grünen Augen an. In ihrer Nase steckte ein Schlauch. Die feinen Lippen hatte sie geöffnet, und die braunen Haare waren kurz. Sie war jung. In meinem Alter. Scheiße!
Ich versuchte, meinen Atem zu beruhigen. Doch mein Brustkorb wollte platzen. Ich musste was tun. Irgendwas!
Wortlos legte ich den Zeigefinger auf die Lippen.
Ihr Anblick schockierte mich. Eine so junge Frau litt an …? Tja, an was denn? Wenn ich es richtig mitbekommen hatte, war das hier die Onkologie. Also musste sie Krebs haben. Fuck!
Sie war hübsch. Blass, aber hübsch. Ihre helle Haut wies leichte Spuren von hellbraunen Sommersprossen auf.
Mein Herz klopfte. Sie durfte jetzt nicht losschreien.
Herrgott, diese scheiß Nervosität ließ mich nicht klar denken. Irgendwas musste ich sagen.
„Ganz ruhig, okay!“
In ihren grünen Augen zeigte sich Skepsis.
Ich trat vorsichtig näher. Weg vom Fenster zum Flur, an dem ich Schatten vorbeihuschen sah. Dabei ließ ich ihre angespannten Gesichtszüge nicht aus den Augen. Es war ein Balanceakt. Sie musste nur noch einige Minuten durchhalten, dann würde ich verschwinden. Das würde sie doch, oder?
Das stetige Fiepen der Geräte und das Gurgeln des Sauerstoffgerätes durchschnitten die Stille. In was für eine Scheiße war ich hier denn reingeraten? Suchend sah ich mich um.
„Sie werden dich sowieso finden“, sagte sie mit einem heiseren Touch in der Stimme.
„Nein“, wisperte ich und betrachtete das metallene Bettgestell. „Nicht, wenn du mich da drunter kriechen lässt.“
„Was?“, entfuhr es ihr.
„Ich will mich unter deinem Bett verstecken“, presste ich bemüht hervor. Der Druck in meinem Nacken pochte. „Die Schwestern werden sicher jedes Zimmer kontrollieren. Ich hau sofort ab, wenn die Luft rein ist.“
„Aha.“ Sie verschränkte die Arme. „Bist du ein Einbrecher? Dann schnappen sie dich zurecht.“
Mist! Sie war von der Sorte Ehrgefühl. Wobei es ja stimmte: Es wäre nur fair, wenn ich geschnappt werden würde. Vielleicht wollte sie mich melden? Was hatte ich mir nur dabei gedacht, mich in einem Krankenzimmer zu verstecken?
„Hör mal, ich tue dir nichts, okay? Meine Kumpels und ich wollten nur ein bisschen Spaß haben. Damit ich nicht erwischt werde, verstecke ich mich jetzt unter deinem Bett, ja?“
„Das ist keine gute Idee.“
„Und warum nicht?“
„Schon mal daran gedacht, wie hoch das Krankenbett steht? Man sieht alles darunter, sobald das Licht angeht.“
Tja. Da hatte sie wohl recht. Ich kam mir ziemlich dämlich vor. Und jetzt? Sollte es doch zum Streifenwagen-Abgang kommen, durfte ich die Jungs beim nächsten Partyabend aushalten. Außerdem würde die Story schneller die Runde machen als meine Affären. Nichts, was mein Ego akzeptieren würde. Das würde meine Rolle als Anführer schmälern.
„Ich kann dir den Schrank empfehlen.“ Sie wies mit zitterndem Finger auf den abgenutzten Holzschrank. Sie hatte Angst. Oder fror. Oder beides?
„Danke.“ Ich nickte und trat zum Schrank. Öffnete die Tür und zwängte mich zwischen einen Bademantel und eine Jacke. Dann zog ich die knarzende Tür zu. Blumiger Duft drang in meine Nase.
Mein Atem rasselte nicht mehr, und mein Herzschlag verlangsamte sich, obwohl ich fast nervöser war als vorhin mit den Jungs.
Ich musste der Frau vertrauen, mehr noch, ich war abhängig davon, ob siemir vertraute oder nicht. Ein seltsames Gefühl, denn zumeist war Vertrauen bei mir keine Kategorie. Ich hatte Geld und damit auch Leute. Die natürlich machten, was ich wollte. Außer Maurice. Er war freiwillig mein Freund. Trotzdem wollte ich nicht abhängig sein. Schon gar nicht von einer Fremden. Oder irgendwem. Meinen Eltern zum Beispiel.
„Was willst du überhaupt im Krankenhaus? Geht man nicht in einen Club, um Spaß zu haben?“
Ich hörte das Bettzeug rascheln. Sie würde mich doch nicht einschließen, oder?
„Wir suchen nicht diese Art von Spaß.“
„Wenn du ein Vergewaltiger bist, dann schreie ich augenblicklich los.“ Die Drohung in ihrer Stimme war nicht zu überhören. Sie müsste nur auf den Knopf drücken, und schon wären wir mindestens zu dritt. Ausgeliefert von einer Kranken. Damit wäre mein Ruf im Eimer.
„Sehe ich aus wie ein Vergewaltiger?“ Ich rümpfte die Nase. Hallo? Ich war kein Typ, der Angst einjagte. Respekt schon eher. Oder Mitleid, manchmal?
Okay, meine trainierten Oberarme spannten im Shirt und mein stechender Blick war irritierend. Aber deswegen brachte ich nicht gleich jemanden um.
„Einem Vergewaltiger sieht man ja nicht an, dass er zu so einer schrecklichen Tat fähig ist.“
„Ich bin kein Vergewaltiger, kein Mörder, kein Serienkiller und habe auch keinen Raubüberfall geplant“, entfuhr es mir lautstark. Blöde Kuh!
Die Tür wurde aufgerissen. Durch den Spalt der Holztüren blendete Licht.
„Alles okay hier drin, Laila?“, hörte ich eine atemlose weibliche Stimme.
Oh oh!
Kapitel 3
– Laila –
Ich blickte direkt in Helens besorgte Miene. Ihr Brustkorb hob und senkte sich schnell, während mein Herz einen Marathon lief. Die Sauerstoffstöße aus meinem Schlauch reichten nicht annähernd aus, mir Luft zu verschaffen. Ein Japsen entfuhr mir, als ich um Luft heischte. Mein Herzschlag rauschte in den Ohren.
Bumm. Bumm bumm bumm. Bumm.
Da war ein fremder Typ in meinem Kleiderschrank. Ich hatte keinen Schimmer, ob er die Wahrheit sagte oder ich einen Kriminellen schützte. Was war nur los mit mir?
Ich öffnete den Mund, um zusätzlich Luft einzusaugen. Der einsetzende Schwindel bewog mich dazu, die Augen zu schließen.
Mist! Ich sollte den Typ auffliegen lassen, dann war er nicht mehr mein Problem, sondern das der Polizei.
„Laila?“ Helen griff nach dem Schlauch und überprüfte das Display des Pulsoxymeters, das zu piepen begann. Sie erhöhte die Luftzufuhr.
Puff. Der Stoß kribbelte in meiner Nase. Mit der einströmenden Luft entspannte sich mein Brustkorb, und das Brennen der Lunge ebbte ab. Das Piepen stoppte.
„Danke“, krächzte ich, das Brummen in meinem Kopf ignorierend.
Helen musterte den Ausschlag meiner Pulslinie kritisch. Das Gefühl, dass in meiner Brust ein Rennwagen bretterte, war nicht neu.
„Dein Puls ist zu hoch. Hundertzwanzig.“ Ihr Blick huschte besorgt durch das Zimmer. Hoffentlich bemerkte sie meinen neuen Schrankbewohner nicht.
„Es geht schon“, presste ich hervor und atmete den Sauerstoff tief ein. Mit der beruhigten Atmung sollte sich auch der Puls beruhigen.
„Was war da eben auf dem Flur los?“ Ich sollte sie ablenken.
Helen krauste die Stirn. „Da hat sich ein Kerl herumgetrieben. Schwester Lory war ihm dicht auf den Fersen. Ich schätze, sie hat ihn geschnappt, die Gute.“
Schwester Lory war eine feurige Südländerin mittleren Alters, die mit ihrem Temperament jeden Oberarzt überrollen konnte. Ich grinste innerlich bei der Vorstellung, wie sie den Komplizen meines Schrankbesuchers verfolgte und stellte. „Er war nicht allein, ich habe zwei weitere Kerle gesehen. Aber auf der Orthopädie habe ich sie verloren. Na, die Security ist informiert. Die werden sie schon kriegen.“
„Hoffentlich“, gab ich zu bedenken und sah, wie der Ausschlag der Pirouetten meiner Herzlinie schrumpfte.
„Ach, du glaubst gar nicht, was ich schon alles erlebt habe.“ Helen setzte sich brummend auf die Bettkante. „Vorletztes Jahr, als der Winter so eisig war, fanden wir in den Lagerräumen Obdachlose. Wir nahmen sie auf und verfrachteten sie in den Eingangsbereich mit warmen Decken und Tee. Es gab schon Kleinkriminelle, die sich am Medikamentenschrank vergreifen wollten. Das meiste spielt sich unten ab. Hier auf Station ist es selten, dass nachts jemand Ungebetenes hindurchmarschiert. Wahrscheinlich war der Auflauf auf dem Flur eben jung, betrunken und dumm.“ Sie zuckte mit den Schultern.
Ich kam mir Helen gegenüber ein bisschen wie eine Verräterin vor, auf der anderen Seite war es aufregend, den Typ zu decken, obwohl ich nichts über ihn wusste. Außerdem war er meine Chance auf eine spannende Nacht. Darauf, endlich mal wieder mit jemandem zu quatschen, jemandem, der nicht krank war. Und noch dazu meine Altersklasse. Ausliefern konnte ich ihn noch immer, wenn er mir unheimlich wurde. Ein Knopfdruck genügte. Ich musste verrückt sein …
„Es gibt doch Kameras hier, oder?“, vergewisserte ich mich, weil mir ein ungebetener Gast dann doch reichte. Am Ende war das hier so ein Bandending, wie es in Chicago manchmal üblich war.
„Ja klar, überall. Mach dir keine Sorgen, Süße. Die Typen sind sicher längst geschnappt.“ Sie rutschte von der Matratze. „Ich checke jetzt die anderen Zimmer. Falls du noch einen Schlaftee benötigst, melde dich, ja?“
„Danke, Helen.“
Als sie die Tür hinter sich schloss, schnellte mein Blick zum Schrank. Es fühlte sich fast so an, als würde ich einen Kerl in einem Club kennenlernen. Zumindest war es diese Art von Aufregung, die in mir kribbelte. Nur dieser kleine Funken Ungewissheit, ob er nicht doch ein Krimineller war, mahnte mich zur Achtsamkeit.
„Du kannst rauskommen. Sie ist weg“, murmelte ich.
Die Schranktür öffnete sich einen Spalt, und der Typ stolperte wenig galant zwischen meinen Kleidern hervor. „Von dem Weichspüler wird man ja high.“ Mit zusammengekniffenen Augen schloss er die Schranktür. Dann lehnte er sich an das Holz. Musterte mich unverhohlen. Erst jetzt fiel mir auf, dass er eine schwarze Lederjacke trug und einen Flachmann in der Hand hielt. Jepp, er würde durchaus als Krimineller durchgehen mit dieser verruchten Ausstrahlung. Ich schluckte. Immerhin hatte ich ihm geholfen. Das sollte mich schützen.
„Wildrose“, sagte ich. „Ich mag den Duft. Er erinnert mich an unseren Garten. Er ist voller Rosen.“
Was würde ich dafür geben, noch einmal durchlaufen zu können. Mit den Fingerkuppen die zarten Knospen zu berühren und die blühende Pracht zu sehen. Die Bienen zu beobachten, wie sie um die Blüten tänzelten.
Unser Stadthaus in Chicago stand zwar auf einem kleinen Grundstück, aber der Garten war paradiesisch. Meine Mutter pflegte ihn mit Hingabe. Insbesondere die Rosenhecken.
Wie gerne würde ich den Sommer außerhalb dieses Zimmers erleben.
„Davon abgesehen, ich finde ein Danke wäre angebracht.“ Mein Blick klebte an seinem markanten Gesicht.
Er legte den Kopf schief und fuhr mit der Hand über sein Kinn. Die Wangen wurden von dunklem Bartschatten überzogen.
„Danke, Laila.“
Ich spürte einen Schauer über meinen Rücken laufen. Er muss meinen Namen aufgeschnappt haben.
„Sie haben deinen Kumpel vermutlich erwischt.“ Ich wollte ihn noch nicht abhauen lassen, wollte mehr über ihn erfahren. Obwohl seine Miene im Halbdunkel noch finsterer war, hatte ich keine Angst.
„Tja, Pech.“ Er setzte den Flachmann an die Lippen. Es gluckste.
„Wow. Das muss ja eine echte Freundschaft sein.“
Er brummte nur.
„Ihr seid sowieso von den Kameras aufgezeichnet worden.“
„Was hält dich dann davon ab, den Rufknopf für die Schwester zu drücken und mich zu verpfeifen? Wenn wir sowieso auffliegen?“ Sein undurchsichtiger Blick musterte mich interessiert.
„Keine Ahnung. Vermutlich der Weichspüler in Kombination mit den Medikamenten.“ Ich schürzte die Lippen. Seine Unerschrockenheit überraschte mich. Meistens wurde ich milde behandelt, als würde ich bei jedem schroffen Wort umknicken wie ein Grashalm. Ihm war das offensichtlich nicht aufgefallen. Oder er hatte es nicht kapiert?
„Muss scheiße sein.“ Er trat ans Bettende.
Der Duft von Sandelholz und Whiskey strömte zu mir. Gepaart mit Leder, das bei jeder seiner Bewegungen leise knarzte.
„Ich habe es mir nicht ausgesucht“, erwiderte ich schnippisch. „Also? Was bringt einen Typ wie dich dazu, nachts Spaß im Krankenhaus zu suchen?“
Ganz sicher redete ich mit ihm nicht über meine akute lymphatische Leukämie oder kaute meine Krankengeschichte durch.
„Vermutlich derselbe Adrenalinkick, der dich dazu gebracht hat, mich nicht zu verpfeifen.“
„Also reine Neugier? Ist dein Leben nicht spannend genug?“
Er zuckte mit den Schultern. „Manchmal braucht es eben einen kleinen Peak.“
„Aha.“ Ich verschränkte die Arme, unser Gespräch hatte ich mir anders vorgestellt. Er vertraute mir genauso wenig wie ich ihm. „Weil du unbedingt nachts mal Krebskranke anstarren wolltest, oder was genau verstehst du unter Spaß?“
„Keine Ahnung.“ Er fuhr sich durch das braune Haar. „Wir wollten halt etwas Aufregendes erleben. Aufs Dach klettern, so was halt.“
„Auf das Dach der Klinik?“, fragte ich ungläubig.
„Jepp. Roofing, schon mal davon gehört? Ein irre geiles Gefühl, wenn man es geschafft hat.“ In seinem Blick glomm erschreckend viel Selbstbewusstsein.
War ja klar …
„Ungesichertes Fassadenklettern ist doch viel zu gefährlich.“ Ein reizvoller Gedanke, denn vor der Leukämie trieb ich mich nur zu gerne in Chicagos Kletterhallen herum. Aber ich würde es niemals ohne Absicherung wagen, wenn beim Aufprall auf dem Asphalt der sichere Tod wartete.
„Mir geht es auch nicht um Sicherheit, sondern um die Freiheit. Die Macht mich über das Leben selbst zu stellen.“
„Aha“, kommentierte ich. „Und das Risiko abzustürzen? Das blendest du komplett aus?“ Ich konnte es nicht fassen, wie ein gesunder Mensch mit seinem Leben spielte, als würde es ein zweites auf Reserve geben.
„Das ist der Kick.“ Er grinste.
Ich schüttelte den Kopf. Es war mir unbegreiflich.
„Wohin gehst du jetzt? Ich meine, wie willst du hier rauskommen? Der Eingang wird sicher bewacht.“
Es würde dort unten vor Security-Leuten wimmeln. Nicht, dass das mein Problem wäre.
„Schaust du zu viel Criminal Minds oder so?“ Seine Mundwinkel schnellten nach oben.
„Nein. Mich würde nur interessieren, wie ausgereift dein Fluchtplan ist.“ Idiot! Ich hasste Krimiserien, denn ich wollte mich freiwillig nicht mit noch mehr Elend umgeben. Liebeskomödien oder Fantasy-Serien waren mir lieber. Eben etwas, das mir die schönen Seiten des Lebens aufzeigte. Die lebenswerten.
„Es gibt keinen Fluchtplan. Zumindest nicht spontan.“ Seine Hand umfasste die Stange am Ende meines Bettes, und er schloss die Augen.
„Du wirst warten müssen. Entweder darauf, geschnappt zu werden, weil dich deine Kumpels verpfeifen. Oder darauf, dass die Polizei abzieht.“
Ich verschränkte die Arme vor der Brust, während er auf die Blaulichter, die sich in der Fensterscheibe spiegelten, starrte. Sein Kiefer mahlte. Was hielt ihn denn noch auf? „Du hast ein paar Probleme und läufst vor ihnen davon, stimmt’s?“
Ich kannte den verschlossenen Ausdruck auf seinem Gesicht. Den trugen die Leute immer dann, wenn die Ärzte schlechte Neuigkeiten zu verkünden hatten. Ich hatte ihn oft genug auf den Zügen meiner Eltern gesehen. Wie er sie altern ließ …
Er setzte den Flachmann an die Lippen. Der Schnaps gluckste.
„Hat die nicht jeder? Das Leben ist kein Happyland.“
Die Miene meines nächtlichen Besuchers war undurchdringlich. Glatt, wie ein weißes Blatt Papier. Nur in seinen Augen brannte etwas, als er sich zu mir drehte. Verwundbarkeit.
Wie ein Bindeglied schwang sie zwischen uns. Ich kannte dieses Gefühl, das direkt in der Magengegend einschlug und dort wütete. Einen großen Felsbrocken hinterließ, den man nicht mehr abtragen konnte. Mein Steinbrocken hieß Leukämie.
Er blinzelte und wandte sich hastig ab.
Nein, Happyland war weit weg. Unerreichbar?
„Weglaufen ist keine Lösung. Irgendwann holt dich der Mist doch wieder ein.“
Ich stellte mich der Leukämie. Bisher war kein Hindernis groß genug für mich gewesen. Durch meinen Ehrgeiz und Disziplin hatte ich mir im angefangenen Schuljahr Bestnoten erarbeitet. Ich wollte ein Stipendium für die University of Chicago.
Aber das hier war eine andere Nummer. Zum ersten Mal in meinem Leben zweifelte ich daran, ob die Hürde nicht doch zu hoch war.
Er tigerte vor dem Fenster auf und ab. „Ich muss hier raus.“
Eine unsinnige Idee reifte in mir heran. Eine, von der ich selbst profitieren konnte.
„Ich kann dich zum hinteren Treppenhaus bringen, wenn du willst.“
Er stoppte. Ich schob die Bettdecke beiseite und schlüpfte in meine Slipper. Zog den Cardigan über, der über der Stuhllehne hing. Ja, ich wollte Nachtluft schnuppern. Ich schloss Engel an mein mobiles Sauerstoffgerät an und steckte es in einen Rucksack, den ich rasch schulterte.
Der Geruch von kaltem Rauch streifte mich, als ich mich ihm näherte. Seine Pupillen weiteten sich. Mit einer Hand griff er nach dem Fenstersims. Ich roch den Whisky.
„Die Cops warten vor dem Krankenhaus. Das hintere Treppenhaus führt zu einem kleinen geschützten Innenhof. Von da aus kannst du vermutlich ungesehen verschwinden.“
Er holte tief Luft und machte einen Schritt zurück. In seinem Blick flackerte Unsicherheit. „Warum willst du mir helfen?“
„Weil wir dein Problem leicht beheben können und ich mal wieder ein Erfolgserlebnis brauche.“
Wenn ich es die Treppen runter schaffen würde, dann auch wieder hinauf. Einen Blick auf den Sternenhimmel werfen und zufriedener ins Bett schlüpfen als die letzten Tage. Das wäre es wert.
Er fuhr sich über den Bartschatten. „Okay.“
„Glaub mir, wenn man fast ein halbes Jahr im Krankenhaus verbringt und auf eine Knochenmarkspende wartet, kommt man vor Langeweile fast um.“ Ich klang zynischer als beabsichtigt und hörte, wie er scharf einatmete, während ich den Cardigan vor der Brust enger zog. Schnell ging ich zur Jalousie und schob vorsichtig zwei Lamellen auseinander. Ich wollte sein Mitleid nicht.
„Keine Menschenseele.“ Ich ließ die Lamellen zuschnappen und wandte mich zu ihm. Sein Blick war verklärt.
Ich schluckte. Verdrängte, dass er jetzt sicherlich daran dachte, wie meine ungewisse Zukunft aussah. Ob ich einen Retter in Aussicht hatte oder nicht.
Hatte ich nicht. Doch ich klammerte mich daran, dass die Ärzte morgen positive Nachrichten vom Knochenmarkregister mitbrachten, ein Spender mit meiner Blutgruppe aufgetaucht war.
Mein Leben weiterging.
Geregelt.
Ohne Leukämie.
Aber davon brauchte er nichts wissen.
„Wollen wir?“ Ich legte die Hand auf die Türklinke.
Sein Blick klärte sich, und er nickte knapp.
„Dann los.“
Kapitel 4
– Paxton –
Ich fixierte im Gehen ihren kurzen rotbraunen Haarschopf. Sie ging langsam, und doch wippte er mit jedem Schritt ein wenig. Dieses Mädchen machte mich unsicher, ihre Hilfsbereitschaft war sicher ungewöhnlich, oder?
Sie sollte mir egal sein. Ich wollte nur ungesehen hier raus.
Trotzdem hatte ich noch nie eine Gleichaltrige mit Krebs getroffen. Das Wissen schockierte mich, mehr als ihr Anblick. Natürlich war sie blass und dünn, aber trotzdem wirkte sie stärker, als man bei ihrem Zustand vermuten würde.
Aber was wusste ich vom Kampf, den sie führte? Davon, wie es sich anfühlen musste, von einer Spende abhängig zu sein?
Der Flur vor mir endete in einer Linkskurve.
Ich nahm einen tiefen Atemzug.
Sie stoppte.
„Wow.“ Ich stützte mich an der Wand ab. „Nicht so schnell, Mädchen.“
Aus ihren grünen Augen sah sie mich gebieterisch an, während ihr Zeigefinger auf die Lippen wanderte. Das leise Surren ihres Gerätes rauschte in meinem Ohr.
Dumpfe Schritte klangen im Flur.
Ich presste die Lippen aufeinander.
Leises Gemurmel verschmolz mit einem Rattern.
Scheiße. Nicht schon wieder.
Es kam näher. Ich schloss die Augen.
Fuck! Ich würde auffliegen. Oder wollte sie das etwa?
Ich stolperte, als sie mich am Arm zog und spürte wenige Sekunden später etwas Hartes im Rücken.
„Pscht!“, zischte sie, und unter ihren geweiteten Augen lagen bläuliche Schatten. Über ihre Schulter sah ich vollgestopfte Regale mit … Schwesternkitteln? Und irgendwelchem folierten Zeug.
„Das war knapp.“ Ihre Stimme bebte.
„Allerdings“, sagte ich atemlos.
Verdammt. Das Mädchen hatte mir den Arsch gerettet. Ich könnte mich bedanken, aber dann würde ich womöglich in ihrer Schuld stehen. Und das wollte ich ganz sicher nicht.
Mit was sollte ich sie begleichen?
Sie trat zur Tür und lauschte. Winkte mich heran und öffnete sie einen Spalt.
„Okay“, flüsterte sie. „Nur noch da runter, dann hast du es geschafft.“ Sie klang atemlos, trotz Sauerstoffgerät.
Ohne ein weiteres Wort ließ ich sie hinter mir, lief die Treppen runter und hastete ins Freie. Da war nur mein Echo.
Endlich!
Unbemerkt streifte ich die dichten Büsche, die hin und wieder von einer Parkbank getrennt wurden.
Die frische Nachtluft belebte meine Lunge. Verdrängte den Nebel in meinem Kopf.
Als die Lichtkegel aus den Krankenhausfenstern, die sich auf dem Weg abzeichneten, kleiner wurden, wandte ich mich um.
Schmal und vom Schatten grau erkannte ich ihre Silhouette in der Tür.
Ich überließ sie ihrem Schicksal. Schüttelte den Gedanken an sie ab. Trank einen Schluck des karamellfarbenen Alkohols aus meinem Flachmann.
Ein Krankenwagen zog an mir vorbei. Die Sirene röhrte, und das Blaulicht brach durch das Nachtblau.
Ich joggte aus dem Innenhof geradewegs zu meinen eigenen scheiß Problemen.
Laila
Meine Lunge brannte, und ein stechender Schmerz durchfuhr bei jedem Atemzug meinen Oberkörper. Trotzdem fühlte es sich an wie ein Stück Freiheit, den Sauerstoff nicht nur aus Engel zu atmen. Die Nachtluft strömte in meinen Mund und hinterließ einen frischen Geschmack auf meiner Zunge. Es war mir egal, dass meine angegriffenen Schleimhäute dadurch noch trockener wurden. Nachtluft war herrlich.
Ich blickte meinem nächtlichen Besucher hinterher. Ein Krankenwagen schoss an ihm vorbei, ohne anzuhalten. In was für ein Leben er wohl joggte?
Ich wäre ihm gern gefolgt. Für eine unvergessliche Nacht. Doch die Türschwelle war meine magische Grenze, die ich nicht übertreten durfte. Nicht ohne Begleitung, nicht mit Lungenentzündung. Da draußen lauerten Risiken für eine Leuko wie mich.
Ich blickte in den klaren Sternenhimmel und schickte meinen Wunsch nach Besserung hinauf.
Dann genoss ich noch einmal die laue Nachtluft und wandte mich ab. Schloss vorsichtig die Tür und lehnte mich an. Ob ich den Aufzug nehmen sollte? Das Brennen in meinem Brustkorb war inzwischen stetig, nicht mehr wie eine Welle.
Bei dem Anblick der Stufen wurden meine Beine schwer. Der Abstieg war anstrengend gewesen, und der Atemschmerz zog sich bis in die Flanken. Ich zögerte.
Ein Stockwerk, dachte ich. Nur ein Stockwerk wollte ich zu Fuß schaffen.
Ich setzte den Fuß auf die Treppenkante und zog mich am Geländer nach oben. Achtete gleichzeitig darauf, beim Abdrücken auszuatmen. Ein Tipp von Helen, die hauptsächlich mit Beatmungspatienten arbeitete.
Mit dieser Gedankenstütze zählte ich zehn Stufen, bis ich die Luftzufuhr über Engel erhöhte. Wie das brannte …
Die restlichen zwanzig wollte ich auch noch schaffen. Nach dem regelmäßigen Luftstoß in meiner Nase drückte ich mich wieder ausatmend von der nächsten Stufe ab.
Dreißig Treppen zählte ich, bis ich mit brennender Lunge an der Glastür zur Orthopädie stand. Ich keuchte, aber das Glücksgefühl vermischte sich mit der Sehnsucht nach dem Bett.
Ich hatte es geschafft!
Aber es war verdammt mühsam gewesen.
Ich vermisste meine alte Fitness, denn ich liebte Bewegung. Das Inlineskaten durch Chicagos belebte Straßen, oder das Joggen im Hyde Park hatten in meinen Wochenplan gehört wie die Apfelschnitze am Morgen. Ich hatte gesund gelebt.
Und jetzt waren es ein paar Stufen, die meine Beine vor eine Prüfung stellten.
Mit einem Schubs stieß ich die Tür zur Station auf und glitt unbemerkt in den Gang zum kleinen Aufzug, der mich nach oben ans Ende der Onkologie-Station bringen würde.
Wenn ich Glück hatte, blieb ich unbemerkt. Ich drückte auf den edelstahlfarbenen Rufknopf. Ein sanftes Pling später stand ich im Aufzug.
Nervöses Herzklopfen gesellte sich zum stechenden Schmerz in meiner Brust. Trotzdem war ich unglaublich stolz auf die dreißig Stufen.
Surrend transportierte mich der Aufzug nach oben, und ich betete, dass ich nicht direkt der Assistenzärztin McPears in die Arme rannte, die heute Nachtschicht hatte.
Ich hatte wieder Glück und schlich geduckt durch den Gang. Erleichtert schlüpfte ich in mein Zimmer und bugsierte mit schweren Händen mein Sauerstoffgerät in seine Halterung.
Ich war hundemüde.
Die weiche Bettdecke zog ich mir bis ans Kinn und dachte an die funkelnden Sterne. Vielleicht würde ich es wieder tun und das Treppensteigen trainieren.
Ganz heimlich.
Paxton
Gott verdammt! Ich schlug die Augen auf und presste den Handballen an die Stirn, um die Schmerzen wegzudrücken. Zwecklos. Stöhnend setzte ich mich auf. Durch die Jalousien meines Poolhauses brach sich das Sonnenlicht.
Ich schob die Decke weg. Ein Blick auf die Uhr bestätigte, dass ich das Frühstück mit meinen Eltern verpasst hatte. Das tat mir nicht unbedingt leid, denn damit verpasste ich auch den Vortrag über meine Rolle als Versagersohn. Ich checkte die Nachrichten auf meinem Handy und las, dass Maurice sich über Elijahs und Jacobs Festnahme amüsierte. Sicher waren die beiden Deppen schon wieder unterwegs. Vielleicht hatten meine Eltern von der Rooftop-Aktion ja auch gar nichts mitbekommen.
Ich gähnte und tappte ins Bad. Scheiße, warum hatte das Hausmädchen nicht längst mal frische Handtücher gebracht? Ich nahm eins von den gebrauchten, die lieblos auf einem Haufen in der Ecke lagen.
Vielleicht würde ich die Jungs auf eine Xbox-Session einladen. Ganz ohne Alk, um weitere Rooftop-Ziele zu besprechen. Ich hatte Feuer gefangen.
Ich öffnete den Hahn der Luxus-Edition-Regenbrause. Das Wasser prickelte auf der Haut und tat gut. Ich schloss die Augen. Wie es wohl dem Mädchen ging?
Es musste sich verdammt beschissen anfühlen, zu wissen, dass das eigene Leben von den Zellen eines Unbekannten abhing.
Es fühlte sich aber auch verdammt beschissen an, gar kein richtiges eigenes Leben zu haben.
Ich schüttelte den Kopf, trat aus der Dusche und trocknete mich mit einem kleinen Handtuch ab. Laila war nicht mein Problem.
Ich warf das Handtuch zu den anderen und zog mir Jeans und Shirt über. Dann ging ich über die Terrasse ins Haupthaus.