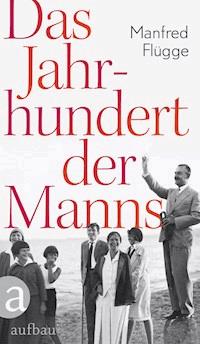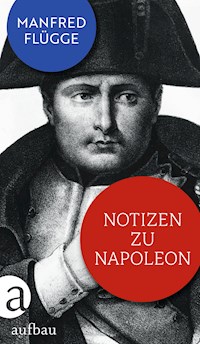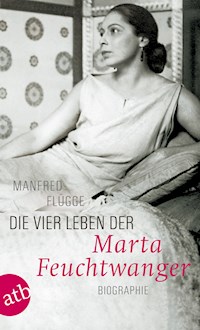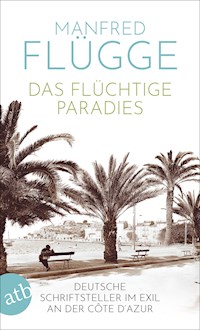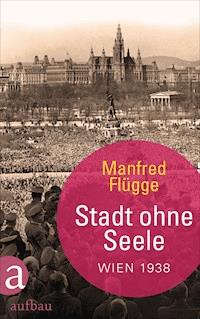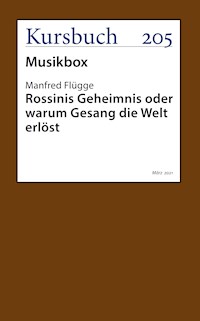
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kursbuch Kulturstiftung gGmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Er war ein Superstar seiner Zeit. Giachino Rossini komponierte, dirigierte und konzertierte in den Großstädten Europas. Umjubelt von Kritikern und Bewunderern. Der Schriftsteller Manfred Flügge rekonstruiert Person, Werk und Zeitläufte von damals. Unglaublich, wie aktuell Rossini heute noch ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 69
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Manfred FlüggeRossinis Geheimnis oder warum Gesang die Welt erlöst
Der Autor
Impressum
Manfred FlüggeRossinis Geheimnis oder warum Gesang die Welt erlöst
Schaut, was das Auge einer Frau zu leisten vermag oder alleine eine singende Stimme! …Singe, wer nicht reden kann! …
Nicht wir erfinden die Musik, sie ist schon da, nichts entgeht ihr, man muss sich nur dreingewöhnen! Wir müssen uns nur hineinversenken bis über die Ohren.
Anstatt uns den Dingen zu widersetzen, brauchen wir uns nur geschickt in sie einzubooten auf ihrem seligen Seegang!
Paul Claudel, Der seidene Schuh
Rossini, divino Maestro, Helios von Italien, der du deine klingenden Strahlen über die Welt verbreitest! Verzeih meinen armen Landsleuten, die dich lästern auf Schreibpapier und auf Löschpapier! Ich aber erfreue mich deiner goldenen Töne, deiner melodischen Lichter, deiner funkelnden Schmetterlingsträume, die mich so lieblich umgaukeln, und mir das Herz küssen, wie mit Lippen der Grazien! Divino Maestro, verzeih meinen armen Landsleuten, die deine Tiefe nicht sehen, weil du sie mit Rosen bedeckst, und denen du nicht gedankenschwer und gründlich genug bist, weil du so leicht flatterst, so gottbeflügelt! – Freilich, um die heutige italienische Musik zu lieben und durch die Liebe zu verstehn, muß man das Volk selbst vor Augen haben, seinen Himmel, seinen Charakter, seine Mienen, seine Leiden, seine Freuden, kurz seine ganze Geschichte. …
Dem armen geknechteten Italien ist ja das Sprechen verboten, und es darf nur durch Musik die Gefühle seines Herzens kundgeben. All sein Groll gegen fremde Herrschaft, seine Begeisterung für die Freiheit, sein Wahnsinn über das Gefühl der Ohnmacht, seine Wehmut bei der Erinnerung an vergangene Herrlichkeit, dabei sein leises Hoffen, sein Lauschen, sein Lechzen nach Hülfe, alles dieses verkappt sich in jene Melodien, die von grotesker Lebenstrunkenheit zu elegischer Weichheit herabgleiten.
Heinrich Heine
Welche Mutter möchte schon ihren einzigen Sohn kastrieren lassen? Wem würde sie damit einen Gefallen tun? Und wozu soll die schmerzliche und riskante Operation gut sein? Um stimmlich ein Knabe zu bleiben, um weder Knabe noch Mann zu sein, sondern ein Frauenersatz? Um nichts zu sein als eine körperlose Stimme?
Aber soll die Stimme den Körper leugnen? Ist sie nicht das, was den Körper über sich selbst hinaus erhebt, ohne ihn zu leugnen oder gar zu opfern? Stimme ist der Klang des Körpers, ist eine reine Gegenwartskunst. Daher ihre Intensität, daher ihre Flüchtigkeit. Die geschulte Stimme hat ihre Vorgeschichte und ihre Vorbereitung, eine Nachgeschichte hat sie nur in der Erinnerung (oder auf fixierenden Medien); ihre Intensität aber erreicht sie nur im erfüllten Augenblick, im Nu der Mystiker, dem absoluten Augenblick, der sein Gegenteil beschwört: die Ewigkeit – aber vor teilnehmenden Ohrenzeugen.
Der Kastrat war ein Missverständnis, eine Folge von absurden Gesetzen im Vatikanstaat, nach denen Frauen nicht öffentlich singen durften, war eine Idee perverser Kardinäle, wie vielleicht die Oper als Kunstgattung insgesamt. In dieser Kunst allerdings, gerade im Gesang, gerade auf der Bühne, ist die Sache mit männlich und weiblich nicht so eindeutig, wie es scheint. Und aus dieser Uneindeutigkeit, ja latenten Verwechslung und Vermischung stammt der unheimliche, phantomatische und fantastische Reiz des Operngesangs. Und dieser Reiz und damit vielleicht das Wesen der Oper lässt sich bei niemand besser nachempfinden und ausloten als bei dem scheinbar so arglosen und leichtfertigen Gioachino Rossini.
Seine Mutter hat ihn nicht kastrieren lassen, ernst gemeintem Rat zum Trotz; ihr Sohn hat es ihr gedankt. Auch zu unserem Glück. Gioachino Rossini blieb ein Mann und musste später die Folgen tragen, dass er nicht nur der Muse Erato gehuldigt hatte, sondern auch der Göttin Venus. Er diente auf seine Weise den schönen Stimmen dieser Welt. Kinder hatte er allerdings keine. Die einzigen Geschöpfe, um die er die Welt vermehrte, leben als Gestalten auf den Bühnen der ganzen Welt.
Über Rossini kursieren unendlich viele Anekdoten. Die Anekdoten haben ihn populär gemacht, aber sie haben sein Bild als Mensch und als Komponist verzerrt. Nein, er war kein Koch und Rezepterfinder – das Tournedos Rossini (kleine Stückchen Rinderfilet mit einer Scheibe Gänsestopfleber) wurde erfunden vom Pariser Küchenchef Casimir Moisson, bei dem Rossini in seinen späten Jahren Stammgast war, aber er war sehr wohl ein kulinarischer Genießer und Kenner; nein, er hat nicht mit dem Komponieren aufgehört; er hat nach langem Kampf mit allerlei Krankheiten eine Verwandlung erlebt und ein zweites Leben als Komponist jenseits der Oper gehabt. Und nein, er war kein unpolitischer, sorgloser Spaßmacher, ein schludriger Faulpelz, der im Bett liegend komponierte und zu faul war, ein heruntergefallenes Notenblatt aufzuheben, und stattdessen ein neues Stück komponierte. Sein einziger Fehler war, dass er die Leute über ihn und seine Werke reden und schreiben ließ, niemals reagierte oder widersprach, sondern höchstens über alles lachte.
Er wusste, was er wert war. Er lernte alle Freuden und alle Schmerzen kennen: schnellen Ruhm und großen Reichtum, Liebe und Anerkennung, aber auch schwere körperliche und seelische Leiden. Er hatte eine grundlegende Intuition, die seine besten Opern beseelt und auch seine anderen Kompositionen; man muss diese Momente nur aufzuspüren wissen. Sie entsprangen seinem Gemüt, seinem Charakter, seinem Verhältnis zur Welt. Bei ihm wird alles leicht und schwerelos, aber keineswegs seicht und substanzlos, und vor allem ist es auf Zusammenklang angelegt, auf Harmonie und Versöhnung, auf Vertrauen in das Menschenmögliche. Rossini schenkt uns eine musikalische Utopie.
Wahr aber ist, dass er an einem 29. Februar geboren wurde, im Schaltjahr 1792. So konnte der Sohn des Stadttrompeters von Pesaro nur ein Schalk werden. In der Geburtsurkunde steht GIOVACCHINO ANTONIO ROSSINI, er selbst schrieb seinen Vornamen GIOACHINO.
Verlängert man die Linie Mailand–Bologna mit dem Lineal von Nordwest nach Südost, am nördlichen Teil des Apenningebirgszugs entlang, so gelangt man zu der Küstenstadt Pesaro, südlich von Rimini und nahe bei San Marino. Ende des 18. Jahrhunderts gehörte der Ort zum Vatikanstaat. Von provinzieller Ruhe konnte keine Rede sein: Von Frankreich ausgehend betrafen Revolution und Kriege bald Pesaro, wo sich Anfang 1797 auch Napoleon kurz blicken ließ, der größte Kunsträuber aller Zeiten. Die französischen Besatzer plünderten die Kunstschätze des Landes, sie reglementierten nicht nur die Machtverhältnisse, zunächst mittels der Cisalpinischen Republik, später als Königreich Italien; sie regulierten auch das Theater- und Opernleben. Das ist in Frankreich immer schon eine Sache gewesen, welche die Herrscher persönlich beschäftigt hat, spätestens seit Richelieu die Kulturpolitik als Mittel der Gesellschaftspolitik etabliert hatte, was Ludwig XIV. zur großen Staatskunst entwickelte.
Für Madame Rossini waren die französischen Eingriffe beruflich von Vorteil: Die Besatzer schafften die Vorschriften des Kirchenstaates ab, welche Frauen das Auftreten auf öffentlichen Bühnen untersagt hatten. Rossinis Mutter konnte nun eine Laufbahn als Sängerin beginnen. Dabei hatte sie gar keine stimmliche Ausbildung genossen, Noten lesen konnte sie auch nicht. Und so hat sie sich ihrem Sohn eingeprägt: Mama auf der Bühne als Sängerin brillierend, öffentlich gefeiert und doch für ihn ungreifbar, selbst wenn er in den Kulissen stand, was der Bube gerne tat.
Sehr unstet war das Leben von Rossinis Eltern. Sie wechselten die Orte, je nachdem, wo sich gerade Arbeit fand, und sie übten auch andere als musikalische Tätigkeiten aus. Als sie heirateten, war Anna Guidarini im fünften Monat schwanger. Der Papa, Giuseppe Antonio Rossini, war Hornist und Trompeter in der banda von Pesaro, der Städtischen Musikkapelle. Beide Eltern beherrschten mehrere Instrumente. Musik war bei den Rossinis eine Familienangelegenheit, von allem Anfang an.
1798 schlossen sich die Eltern einer wandernden Operntruppe an. Während dieser Zeit lebte Gioachino bei seiner Großmutter Lucia Guidarini, ging zur Schule, lernte schon einige Instrumente. Mit sechs Jahren spielte er Triangel in der Städtischen Kapelle. Musik als Beruf und Lebensform hat er von klein auf gekannt. Die kindliche Freude daran und die Identifikation mit den (oft abwesenden) Eltern sind ihm erhalten geblieben. 1799 verließen die französischen Truppen die Stadt Pesaro; der Vater wurde als Anhänger der importierten Revolution in Haft genommen. Zu seinen Untaten gehörten: die Komposition einer republikanischen Hymne; die Mitwirkung in einer politischen Pantomime; der Kauf von rotem, weißem und blauem Stoff zum Nähen einer Trikolore; überdies die Befreiung der jüdischen Mitbürger aus dem Getto von Pesaro. Sage niemand, diese Musikerfamilie sei unpolitisch gewesen!