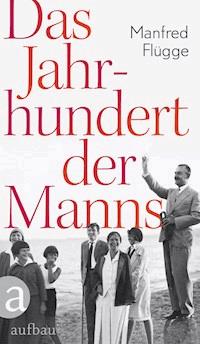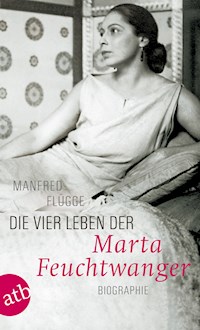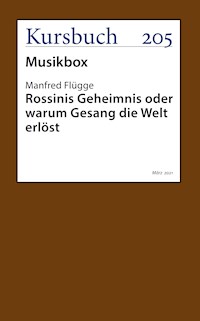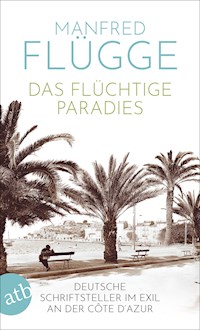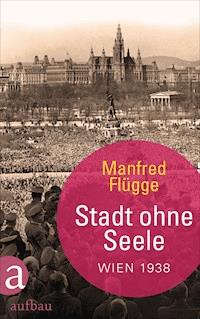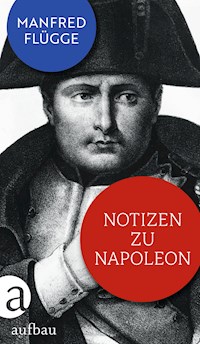
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Feldherr, Machtmensch und Reformer – ein Blick auf Napoleon 200 Jahre nach seinem Tod.
Mit seinem Tod wurde Napoleon endgültig zur Legende. Doch der Mythos gehörte schon immer zu ihm. Er selbst wirkte an seiner Entstehung mit, und dies nicht erst in der Zeit der Verbannung. Seit Julius Cäsar verstand kein Feldherr so gut, wie wichtig das eigene Bild in der Öffentlichkeit für das Erreichen politischer Ziele ist. Mit Gespür für die großen Linien wie die bezeichnenden Details erfasst Manfred Flügge in seinem Essay das Wesentliche dieses widersprüchlichen Lebens am Übergang zweier Epochen – und zeigt, wie in Napoleon Person und Mythos untrennbar miteinander verschmelzen.
„Ob man will oder nicht – man ist hingerissen und überwältigt von seinem Charakter und seiner Laufbahn.“ Lord Byron
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Er löste die Ehe mit seiner geliebten Joséphine, da sie ihm keine Kinder gebären konnte, er aber eine Dynastie gründen wollte. Er schlug einen royalistischen Aufstand nieder, verfolgte später aber erbarmungslos alle Jakobiner. Und er ließ sich als Kommandeur abbilden, dem das Wohl seiner Soldaten am Herzen lag, zwang sie aber auf Gewaltmärsche, bei denen er keine Rücksicht auf ihre Kräfte nahm – Napoleon gehört zu den widersprüchlichsten, rätselhaftesten Gestalten der Geschichte. Der Blick auf sein Leben scheint dabei häufig durch die Legende verdeckt zu werden, die ihn umgibt. In seinem souverän erzählten Essay zeigt Manfred Flügge diese ungreifbare Gestalt in ihrer ganzen Komplexität – und gibt uns einen Eindruck von der Wucht, die der Mensch wie der Mythos Napoleon entwickelte.
Über Manfred Flügge
Manfred Flügge, geboren 1946, studierte Romanistik und Geschichte in Münster und Lille. Von 1976 bis 1988 war er Dozent an der Freien Universität Berlin. Heute lebt er als freier Autor und Übersetzer in Berlin. 2014 erhielt er den „Literaturpreis Hommage à la France der Stiftung Brigitte Schubert-Oustry“ und in Cognac den Prix Jean Monnet du Dialogue Européen. Im Aufbau Verlag sind seine Bücher „Die vier Leben der Marta Feuchtwanger“, „Das Jahrhundert der Manns“, "Stadt ohne Seele. Wien 1938", „Das flüchtige Paradies. Deutsche Schriftsteller im Exil an der Côte d’Azur“ und „Stéphane Hessel – ein glücklicher Rebell“ lieferbar.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Manfred Flügge
Notizen zu Napoleon
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Motto
Einleitung
Der Clan
Inseln waren sein Schicksal
Kriegskunst
Der Politiker
Staatskult
Der Sturz
Frauen
L’Aiglon
Legende
Der Sieg über die Erinnerung
Kritische Sicht auf Napoleon
Bildteil
Danksagung
Zeitleiste
Literaturauswahl
Abbildungsverzeichnis
Impressum
Für Christa
»Meine Arbeitskraft kennt keine Grenzen.«
Napoleon Bonaparte
»Der Name Napoleon Bonaparte wird immer bis an die Enden der Welt widerhallen, und das Echo Frankreichs wird ihn wiederholen.«
Letizia Ramolino, Napoleons Mutter, 1815
»Beglücken wollte er die Welt, und er verschaffte ihr Plage.«
Joseph Roth, Die hundert Tage. Napoleons letzte Schlacht
Einleitung
Am 3. Juli 1821 trafen im englischen Hafen Portsmouth zwei Schiffe ein, die am 7. Mai von Sankt Helena, einer isolierten Insel im südlichen Atlantik, abgefahren waren. Sie überbrachten die Mitteilung, dass am Abend des 5. Mai der ehemalige Kaiser der Franzosen, Napoleon, der dort seit 1815 interniert war, gestorben sei. Von England aus verbreitete sich die Information rasch über ganz Europa. Am französischen Hof kommentierte Außenminister Charles-Maurice de Talleyrand, der dem Kaiser oft gedient, ihn aber auch oft hintergangen und nach dessen Sturz König Ludwig XVIII. auf den Thron verholfen hatte: »Das ist kein Ereignis, das ist nur irgendeine Nachricht.«
So betont desinteressiert, wie dieser Satz klang, bekundete er doch nur umso deutlicher, dass er gelogen war. Eine Gestalt wie Napoleon Bonaparte hätte sich niemand ausdenken können, auch nicht in seiner Zeit. Dass jemand sowohl ein begabter Feldherr als auch der Umgestalter seiner Gesellschaft sein kann, klingt zunächst unwahrscheinlich, ebenso, dass er zugleich ein zutiefst literaturaffiner Mensch war, ein eifriger Leser und Autor, der später selber zu einer literarischen Gestalt wurde, die viele Autoren in ganz Europa inspiriert hat. Und doch war seine Existenz sehr real, mit Folgen bis in die Gegenwart.
Mit seinem Tod wurde Napoleon endgültig zur Legende, so sehr, dass gewitzte Autoren in England wie in Deutschland die Realität Napoleons anzweifelten, als hätte er nur in der Phantasie existiert. Die Legende hatte immer schon zu Napoleon gehört, er hatte selbst an ihrer Entstehung mitgewirkt. Seit Julius Cäsar hatte kein Feldherr so gut verstanden, wie wichtig für höhere politische Ziele das eigene Bild in der Öffentlichkeit ist. Mit seinen hochrangigen und begabten Helfern kann man Napoleon als Erfinder der politischen Propaganda im modernen Sinn bezeichnen. Ein Buchtitel wie Napoleon ohne Legende wäre unmöglich, etwas Wesentliches würde fehlen. Die Legende gehörte zu seinem Wirken, war stets Teil seines Handelns und eine Form der Machtentfaltung.
Mit der Macht Napoleons war es seit seiner Deportation nach Sankt Helena im Juli 1815 vorbei, der Mythos hingegen entfaltete nach seinem Tod 1821 seine ganze Wirksamkeit. Im französischen Volk sorgte die Nachricht von seinem Ableben für eine große Erschütterung. Bei einigen labilen Gemütern löste es den Wunsch oder die Vorstellung aus, dass sie selbst Napoleon seien, dass er in ihnen weiterlebe. Später traten einige falsche Napoleons im Lande auf, von denen manche in Anstalten für Geisteskranke landeten.
Bei Napoleon bekommt man es mit unerquicklichen Themen zu tun: Alleinherrschaft, manipulierte Referenden, Zensur (er verbot alle Zeitungen, über die er keine Kontrolle hatte) und gelenkte Propaganda, Kriegslüsternheit und Kunstraub, politische Verbrechen, dazu Schlachten, deren schiere Opferzahlen an Schlachten des Ersten Weltkriegs heranreichten, und das bei einer prozentual viel kleineren Bevölkerungszahl.
Von Napoleon müsste man daher so erzählen wie Klaus Mann von Alexander dem Großen – als der Geschichte eines phantastischen Sohnes, der seinen prosaisch realen Vater übertrifft, eben weil er den Bezirk des Mythischen erreicht, aber anders als Klaus Mann ohne Identifikation mit der Figur: Napoleon schuf einen Absolutismus der eigenen Person, der für Nachahmer mental gefährlich wurde, besonders schauerlich im Fall des russischen Historikers Oleg Sokolow in Sankt Petersburg, der sich als Napoleon gebärdete und in historischen Uniformen auftrat und 2012 zum bestialischen Mörder einer seiner Studentinnen wurde.
Der Name Napoleon löst immer noch Urteile und Vorurteile aus, deren man sich möglichst enthalten sollte, will man zu einer historisch gerechten Darstellung gelangen. Erstaunlicherweise fand ausgerechnet einer von seinen wichtigsten Gegenspielern, der österreichische Außenminister Fürst Clemens von Metternich, zu einer Einschätzung des französischen Kaisers, der jegliche Dämonisierung fremd war. Napoleon habe zwei Gesichter gehabt, schrieb der Fürst: »Als Privatperson war er umgänglich und nachgiebig, ohne gut oder schlecht zu sein. In seiner Eigenschaft als Staatsmann ließ er keinerlei Gefühl zu; seine Entscheidungen traf er weder aus Zuneigung, noch aus Hass. Er vernichtete oder entfernte seine Feinde, ohne sich dabei nach etwas anderem zu richten als der Notwendigkeit oder dem Vorteil, sich ihrer zu entledigen. War dieses Ziel erreicht, vergaß er sie und verfolgte sie nicht weiter.«
Dieser nüchterne Blick auf Napoleon hat sich in Frankreich selbst nicht durchsetzen können. Dort ist er bis heute Inbegriff eigener Größe und Gloire; in Umfragen wurde er immer wieder zur bedeutendsten Gestalt der französischen Geschichte gewählt. Doch auch außerhalb seiner Heimat und unter Historikern treibt seine Gestalt noch viele um. »Es fällt mir schwer«, so schrieb sein jüngster Biograf Adam Zamoyski 2018, »jemandem Genialität zu attestieren, der trotz all seiner vielen Triumphe die schlimmste (und ganz und gar selbstverschuldete) Niederlage der Kriegsgeschichte verantwortete und aus eigenem Antrieb das große Unternehmen zerstörte, das er und andere unter großen Mühen auf den Weg gebracht hatten.«
Der Clan
Dass bei Napoleons Mutter die Wehen unerwartet früh einsetzten, sodass sie es kaum aus der Messe, die sie täglich besuchte, nach Hause schaffte und mit ihrem zweiten Sohn auf einem Teppich niederkam – zufällig ein Teppich mit Darstellungen antiker Heldengestalten –, ist wohl nur eine schöne Geschichte, zumal es im Elternhaus gar keine Teppiche gab, aber um seinen Platz in der Geschichte war Napoleon stets besorgt; es war ihm ein großes Anliegen, Herr seines Bildes zu bleiben, weshalb er sich von vornherein um das kümmerte, was von ihm in der Öffentlichkeit berichtet wurde, von den ersten Schlachten an bis zu seiner zweiten Verbannung auf Sankt Helena, aus der er nicht lebend zurückkehrte.
Immerhin lenkt diese Geschichte, wenngleich anders als beabsichtigt, den Blick auf seine Herkunft, seine Familie, oder genauer: seinen Clan. Der Name Buenaparte ist zuerst im italienischen Ligurien des siebzehnten Jahrhunderts belegt, von wo einige Familienmitglieder auf die Insel Korsika übergesiedelt sind, als diese ein päpstliches Lehen an Genua war. Die Genueser verkauften die Insel am 15. Mai 1768 an Frankreich. Ein Jahr früher geboren, wäre Napoleon italienischer Bürger gewesen.
Sein Vater, der Jurist Carlo (später: Charles) di Buenaparte, kämpfte unter dem korsischen Nationalhelden Pasquale Paoli für die Unabhängigkeit der Insel, folgte diesem nach dessen Niederlage 1769 aber nicht ins englische Exil, sondern arrangierte sich mit dem später zum Gouverneur von Korsika ernannten Grafen Louis Charles de Marbeuf, der allen Kämpfern Freiheit und Amnestie sowie Respektierung der korsischen Identität versprach. Fünf Jahre zuvor hatte Buenaparte Letizia Ramolino geheiratet, da war er gerade neunzehn und sie noch nicht einmal vierzehn Jahre alt. Letizias Vorfahren stammten ebenfalls vom italienischen Festland, sie waren Adlige in der Lombardei gewesen, doch lebte die Familie zum Zeitpunkt ihrer Heirat schon seit gut zweihundertfünfzig Jahren auf Korsika. Letizias Vater befehligte zeitweise die Garnison von Ajaccio und wurde Generalinspekteur der Straßen und Brücken auf Korsika. Nach seinem Tod heiratete ihre Mutter den Schweizer Offizier Franz Faesch. Letizia brachte dreizehn Kinder zur Welt; die ersten beiden starben bei der Geburt. Ihren im Januar 1768 erstgeborenen Sohn nannten Charles und Letizia Giuseppe (Joseph). Den zweiten Sohn, geboren am 15. August 1769, nannten sie nach einem im Kampf um Korsikas Unabhängigkeit gefallenen Onkel Napoleone (korsisch: Nabulione).
Napoleons Vater beendete sein Rechtsstudium in Pisa mit einer Promotion; unter dem Namen Charles-Marie de Buenaparte leistete er in Ajaccio den Eid als französischer Rechtsanwalt. Da er gern in Samt und Seide auftrat, bekam er den Spitznamen »Buenaparte il magnifico« (der Prächtige). Seiner Umtriebigkeit und Letizias Charme sowie der Intervention von Marbeuf verdankte Charles im September 1771 die französische Adelsanerkennung mitsamt den damit verbundenen Privilegien wie Steuererleichterungen und im Jahr 1772 einen Sitz im Rat der zwölf Edlen, dem Standesparlament und Selbstverwaltungsorgan Korsikas. Der verwitwete Marbeuf unterstützte die Familie jahrelang und ernannte Charles Buenaparte 1778 zum Standesvertreter des Adels in den Generalständen, die der französische König nach Versailles einberufen hatte.
Dort wurde er von Ludwig XVI. empfangen und konnte ihm sowie der Königin Marie-Antoinette von den ökonomischen Problemen Korsikas berichten. Er führte aus, wie wichtig für die wirtschaftliche Zukunft der Insel die Anpflanzung von Maulbeerbäumen sei, die man zur Zucht von Seidenraupen brauchte. Sein Plädoyer war so überzeugend, dass er königliche Subventionen für seine eigene Pflanzung erhielt. Die erste Paris-Reise seines Zweitgeborenen Napoleon diente der Bemühung um eine Fortsetzung der königlichen Förderung für diese Plantagen. Die Familie lebte vor allem von landwirtschaftlichen Einkünften, da das Gehalt des Vaters als Richter nicht genügte. Charles Buenaparte führte die Kartoffel auf der heimischen Insel ein, übernahm sich aber finanziell bei der Trockenlegung von salzigen Sumpfgebieten.
Marbeuf vermittelte den Kindern der Buenapartes auch königliche Stipendien auf dem Festland. Charles richtete die größte Privatbibliothek auf Korsika ein, sodass seine Kinder mit Büchern groß wurden. Der älteste Sohn Joseph sollte ursprünglich Geistlicher werden, wurde aber Jurist wie sein Vater. 1784 erkrankte Charles in Paris und wurde vom Leibarzt der Königin untersucht. Ein Jahr später verschlechterte sich sein Zustand; auf Anraten der Ärzte begab er sich nach Montpellier, wo er im Februar 1785 an Magenkrebs verstarb und begraben wurde. Bei ihm war nur sein Sohn Joseph.
Noch im Exil auf Sankt Helena beteuerte Napoleon, wie gut die Ehe seiner Eltern gewesen war. Seine Mutter nannte er eine tatkräftige und couragierte Frau. Als sie mit ihm schwanger gewesen sei und der Unabhängigkeitskampf mit den Franzosen getobt habe, sei sie über ein Schlachtfeld geritten und habe ihr Pferd durch einen reißenden Fluss gelenkt. Mag dies auch zu den vielen Geschichten gehören, mit denen Napoleon nicht zuletzt seine eigene Person in einem glänzenderen Licht erscheinen lassen wollte, so handelte es sich bei Letizia ohne Zweifel um eine ungewöhnlich selbstbewusste Frau. Den Stolz darüber, dass ihre Kinder historische Persönlichkeiten wurden und bald die Throne halb Europas zu besetzen schienen, drückte sie später kess und korsisch so aus: Ich bin die Frau, die den meisten künftigen Königen und Königinnen den Hintern versohlt hat.
Napoleon, das ist somit nicht nur die Geschichte vom Aufstieg eines republikanischen Generals provinziell-korsischer Herkunft zum französischen Kaiser und (letztlich gescheitertem) Begründer einer vierten Dynastie – was bemerkenswert genug ist; Napoleon ist auch der zentrale Punkt in der Geschichte eines Clans, dessen Vorfahren zunächst in die Toskana und später auf eine wilde, legendenselige Insel verschlagen wurden, deren Landschaft und deren Düfte alle Sinne gefangen nehmen, und dessen Nachfahren teilweise im sehr realen und zugleich mythischen Amerika lebten, was seinerseits eine Folge des Napoleonmythos war. Elizabeth Patterson, die erste Frau von Napoleons jüngstem Bruder Jérôme, erlebte eine böse Überraschung, als sie im April 1820 über Amsterdam nach Frankreich reisen wollte. Der französische Botschafter in Holland verweigerte ihr und ihrem Sohn Jérôme Napoléon die Reiseerlaubnis mit der Begründung, dieser sehe dem Kaiser zu ähnlich, was zu Ärgernissen in Frankreich führen könne.
Elizabeth kehrte daher mit ihrem Sohn nach einigen Jahren in Großbritannien in die USA zurück, wo ihr Enkel Charles Joseph Bonaparte Marine- und später Justizminister unter Präsident Theodore Roosevelt wurde, den er seit seinem Jurastudium in Harvard kannte. Er bewies sein Organisationstalent, als er 1908 eine Behörde schuf, die Steuerunterschlagungen aufdecken sollte und aus der das spätere FBI entstand. Der letzte Prominente der amerikanischen Napoleoniden, der 1878 geborene Jérôme Charles Bonaparte-Patterson, ein Urenkel von Napoleons Bruder Jérôme, starb im Jahr 1945, als er bei einem Spaziergang im Central Park in New York über die Hundeleine seiner Frau stolperte und dabei so unglücklich fiel, dass er sich das Genick brach.
In den USA, wo sich die Familien- und Ahnenforschung großer Beliebtheit erfreut, ist aus der Suche nach amerikanischen Nachfahren der Bonapartes längst ein lukrativer Geschäftszweig geworden. Die Firma iGenea untersuchte seit 2010 die DNA von siebenundvierzig bezeugten Nachfahren der Bonapartes. Allen Personen, die sich für Nachfahren hielten, bot man an, ihre DNA daraufhin zu überprüfen. Auf diesem Wege konnten einige Nachfahren ermittelt werden, eine Person wurde sogar als Erbprinz anerkannt.
Inseln waren sein Schicksal
Das südliche Licht und die wilde Schönheit Korsikas, vor allem der besondere Duft der dichten Buschlandschaft, der Macchia, haben Napoleon geprägt, aber bedeutsamer als sein Außenseitertum und seine Fremdheit auf dem Festland ist die Tatsache, dass er durch Erziehung und Ausbildung zum Franzosen wurde und sich bald von den korsischen Verstrickungen löste, von Clankämpfen und Rivalitäten, die auch seine Familie betrafen. Lediglich in diesem Clancharakter seiner Familie zeigte sich das korsische Erbe, er musste Rücksicht nehmen auf die Ansprüche und Wünsche seiner zahlreichen Brüder und Schwestern, andererseits bediente er sich seiner Geschwister als Instrumente seiner Machtpolitik. Sein Ehrgeiz war zu groß für die heimische Insel. Einzig das französische Mutterland konnte ihm Perspektiven bieten. Allerdings war ihm selbst die besuchsweise Rückkehr nach Korsika später ohnehin verwehrt. Zum letzten Mal hielt sich Napoleon im Oktober 1799 dort auf, auf der Rückfahrt von der Ägyptenexpedition. Bald darauf war das Befahren des Mittelmeers zu gefährlich für ihn, denn es wurde von den Engländern kontrolliert.