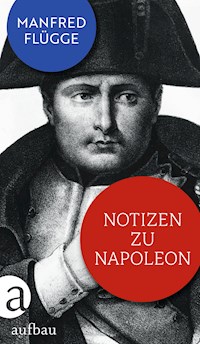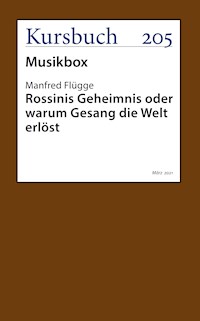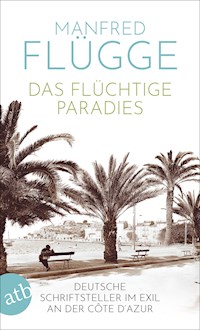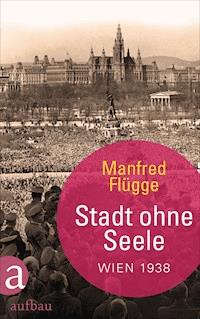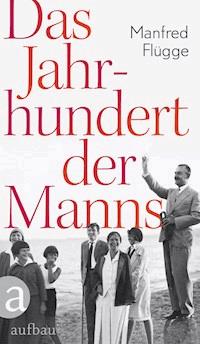
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
„Es ist doch eine wirklich erlauchte Versammlung, aber einen Knacks hat jeder.“ Thomas Mann an Klaus Mann, 1942. Manfred Flügge schildert die Familiengeschichte der Manns, wobei er auch auf die Familienzweige der Dohms und der Pringsheims eingeht. Das politische Denken und Handeln sowie die wichtigsten literarischen Werke der Manns stellt er in engem Zusammenhang mit Zeit- und Lebensgeschichte dar. Indem Thomas Mann an einer Humanisierung des Mythos arbeitete, wurden er und die Seinen selber zu einem Monument der deutschen Kulturgeschichte. Über Konflikte und Missverständnisse hinweg hat Deutschland aus dem Wirken der Manns vielfachen Nutzen gezogen. Wie zwischen dem Erscheinen der ersten Romane der Brüder Mann im Jahr 1901 bis zur Ausstrahlung der Fernsehserie "Die Manns" im Jahr 2001 mit dieser produktiven und provozierenden Familie umgegangen wurde, das besagte stets auch etwas über den Zustand des Landes. "Die Manns", das ist eine Glücksgeschichte, die aus lauter kleinen Tragödien besteht. Von Lübeck bis Venedig, von München bis Los Angeles, von Capri bis Halifax, von Nidden bis Paraty reichen die Schicksalswege der Mitglieder dieser besonderen Familie, deren Erlebnisse ein Jahrhundert beleuchten und deren Texte alle Themen ihrer Zeit berührt haben. Das Buch des ausgewiesenen Biographen Manfred Flügge entwickelt ein mehr als hundert Jahre umspannendes Panorama der legendären Literatenfamilie. Diese erste Familienbiographie der Manns ermöglicht ein neues Verständnis der geistigen, politischen und kulturellen Entwicklung Deutschlands bis heute. „Ich glaube, dass es in Deutschland im 20. Jahrhundert keine bedeutendere, originellere und interessantere Familie gegeben hat als die Manns.“ Marcel Reich-Ranicki. »Die Lektüre dieser konzisen und gut informierten Gesamtbiographie lohnt sich.« Sigrid Löffler.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Informationen zum Buch
»Ich glaube, dass es in Deutschland im 20. Jahrhundert keine bedeutendere, originellere und interessantere Familie gegeben hat als die Manns.« Marcel Reich-Ranicki
Das Buch des ausgewiesenen Biographen Manfred Flügge entwickelt ein mehr als hundert Jahre umspannendes Panorama der legendären Literatenfamilie.
Diese erste Familienbiographie der Manns ermöglicht ein neues Verständnis der geistigen, politischen und kulturellen Entwicklung Deutschlands bis heute.
»Es ist doch eine wirklich erlauchte Versammlung, aber einen Knacks hat jeder.« Thomas Mann an Klaus Mann, 1942
»Die Manns«, das ist eine Glücksgeschichte, die aus lauter kleinen Tragödien besteht. Von Lübeck bis Venedig, von München bis Los Angeles, von Capri bis Halifax, von Nidden bis Paraty reichen die Schicksalswege der Mitglieder dieser besonderen Familie, deren Erlebnisse ein Jahrhundert beleuchten und deren Texte alle Themen ihrer Zeit berührt haben.
Manfred Flügge schildert die Familiengeschichte der Manns, wobei er auch auf die Familienzweige der Dohms und der Pringsheims eingeht. Das politische Denken und Handeln sowie die wichtigsten literarischen Werke der Manns stellt er in engem Zusammenhang mit Zeit- und Lebensgeschichte dar. Indem Thomas Mann an einer Humanisierung des Mythos arbeitete, wurden er und die Seinen selber zu einem Monument der deutschen Kulturgeschichte.
Über Konflikte und Missverständnisse hinweg hat Deutschland aus dem Wirken der Manns vielfachen Nutzen gezogen. Wie zwischen dem Erscheinen der ersten Romane der Brüder Mann im Jahr 1901 bis zur Ausstrahlung der Fernsehserie »Die Manns« im Jahr 2001 mit dieser produktiven und provozierenden Familie umgegangen wurde, das besagte stets auch etwas über den Zustand des Landes.
Manfred Flügge
Das Jahrhundert der Manns
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Manns
Herkunft
Kaisers neue Bühne
Symbolismus und Satire
Damen und Dramen
Die Tragödie von Carla Mann
Ironie und Schicksal
Werkwanderung
Jüdische Schicksale
Pringsheims
Katzenzungen, edelbitter
Göttliche Jünglinge
Bruderzwist im Hause Mann
Falsche Zwillinge, echte Komplizen
Die Erfahrung des Exils
Meisterlichkeit als Lebensform
Verehrende Frauen
Unmögliche Heimkehr
Bruder Viktor
Die liebe Schweiz
Der Erwählte
Die Verfemte
Verlorenes Spiel
Einsamkeit und Skepsis
Vaters Element
Novellenverbrechen
Das Glück der Manns
Hinweise
Danksagung
Personenregister
Über Manfred Flügge
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Will es denn das Schicksal, daß unsere Existenz symbolisch wird, so haben wir uns diesem Schicksal zu stellen.
Thomas Mann, Paulskirche 1949
Man kennt meine Herkunft aus dem Roman meines Bruders.
Heinrich Mann, 1944
Wir alle waren bestimmt, Weltkinder zu sein.
Monika Mann
Es ist doch eine wirklich erlauchte Versammlung, aber einen Knacks hat jeder.
Thomas Mann an Klaus Mann, 1942
Für Mahmud Haddadi (Teheran),
der die Werke von Heinrich Mann und Thomas Mann
ins Persische übersetzt
Manns
Vorsicht ist geboten bei allen Personen namens Mann.
Ordnungsamt Lübeck, Dezember 1936
Im Sommer 1997 reiste Frido Mann zum ersten Mal nach Nidden, einem kleinen Ort auf der Kurischen Nehrung. Oberhalb des Ostseestrandes stand noch immer das geräumige Sommerhaus seiner Großeltern. Bei einem Abstecher von Königsberg aus hatten sie den Ort im Jahr 1929 entdeckt und beschlossen, dort ein Feriendomizil zu errichten. Als das braungestrichene Holzhaus mit Strohdach und blauen Fensterläden im Sommer 1930 bezogen wurde, kam es zu einem Auflauf wie bei einem Volksfest. Die Einheimischen feierten den zum Nobelpreisträger avancierten Autor und seine Angehörigen. Auch in den beiden folgenden Jahren verbrachten die Manns hier ausgedehnte Ferien, dann beendete das Exil diese Phase. In wechselndem Besitz überdauerte das Gebäude die Jahrzehnte und Regime, ehe es im souveränen Litauen restauriert und als Thomas-Mann-Kulturzentrum eingeweiht werden konnte.
Frido Mann ist mehrmals wiedergekommen und konnte erleben, wie sich an diesem Ort auf der schmalen Landzunge zwischen Meer und Haff die Epochen überlagern und alle noch spürbar sind. 1997 reiste er auch in den brasilianischen Küstenort Paraty, wo seine Urgroßmutter Julia da Silva-Bruhns geboren wurde, die Mutter von Heinrich und Thomas Mann. Von Nidden bis Paraty, von Lübeck bis Venedig, von München bis Los Angeles, von Capri bis Halifax reichen die Schicksalswege der Mitglieder dieser besonderen Familie, deren Erlebnisse ein Jahrhundert beleuchtet und deren Werke alle Themen ihrer Zeit berührt haben.
»Die Manns kommen!« Dieser Schreckensruf tönte Thomas Mann entgegen, als er eines Tages in der Nähe seines Münchner Hauses mit seinem Hund spazieren ging. Ein paar Kinder flüchteten… vor seinem eigenen Nachwuchs. »Die Mannkinder«, wie man auch sagte, ärgerten ihre Nachbarschaft mit Telefonterror, Ladendiebstählen und anderen bösen Streichen (vielleicht weil im Haus des Vaters immer Ruhe herrschen musste). Kadidja Wedekind erinnerte sich: »Zuweilen, wenn wir so am Isarufer hinpilgerten, begegneten wir vor einer eleganten Villa einigen finster blickenden, etwas verwahrlosten Kindern, und wir erfuhren, daß dies ›Thomas Manns‹ seien.«
Der Roman, der den Grundstein für den Mythos der Familie Mann bildete, trägt in seinem Titel keinen bestimmten Artikel: Buddenbrooks. Im Deutschen werden Personennamen ohne Artikel gebraucht. Für Vornamen gelten regional geprägte Eigenheiten, mal mit, mal ohne Artikel. Wer die Sippschaft meint, sollte also sagen: Bei Manns wurde Weihnachten seit Generationen groß gefeiert. Und doch heißt es längst überall Die Manns, als handle es sich um eine Firma, ein Unternehmen, ein Markenzeichen. Dabei schwingt etwas Abschätziges mit, im Sinne von »diese Manns«, mit denen es, wie man ja wisse, etwas Besonderes auf sich habe.
Auf ihrer Weltreise von 1927 traten Klaus und Erika Mann als »die literarischen Mann-Zwillinge« auf, als Angehörige eines Kollektivs wie Kinder aus einer berühmten Zirkusfamilie. Vielleicht hatte sie Rudolf Grossmanns bebilderter Artikel »Die Romanzwillinge. Thomas und Heinrich Mann« auf diese Idee gebracht, der am 9.Februar1926 im Berliner Tageblatt erschienen war. Die Pluralform bezog sich ursprünglich auf das schreibende Brüderpaar mit seinen Unterschieden in Schreib- und Lebensstil, im Denken und öffentlichen Auftreten. Im November1918 wurden in München Postkarten mit den beiden Türmen der Frauenkirche gedruckt, deren Kuppeln jeweils die Köpfe der beiden Romanciers darstellten: »Feindliche Brüder?« Links der schmunzelnde Heinrich über einer roten Fahne, rechts Thomas, missmutig hinüberschielend und von lästigen Krähen umschwärmt.
Schon als junger Autor war Klaus Mann Gegenstand von Karikaturen. Th. Th. Heine zeichnete ihn 1925 im Simplicissimus mit einem Manuskript in der Hand, hinter seinem Vater stehend: »Du weißt doch, Papa, Genies haben niemals geniale Söhne, also bist du kein Genie.« Egon Friedrich Maria Aders illustrierte seinen Artikel »Die Dichterdynastie Mann«, der 1927 in der Essener Wochenschau erschien, mit eigenen Zeichnungen: »Heinrich: Aristokrat und Grandseigneur in Gang und Haltung, Manieren und Kleidung, nicht aber im Zuschnitt der Lebensführung, der Behausung und der Repräsentation«. Thomas skizzierte er flau, glatt, konturlos; im Text hieß es, man würde ihn nie für einen Dichter halten, gleichwohl umgebe ihn ein besonderer Glanz im Gegensatz zu Heinrich. »Klaus Mann, der älteste Sohn von Thomas, auch bereits als Dichter bekannt, ist ein sehr begabter Junge, jedenfalls besser als seine allzu scharfen Kritiker.« Klaus wurde im Halbprofil gezeichnet, mit stark betonter Nase.
Im Mai1929 veröffentlichten die Leipziger Neuesten Nachrichten folgende Karikatur: »Die Familie Mann, Heinrich, Thomas, Klaus und Erika, marschieren unter dem Ruf ›Selbst ist der Mann‹ geschlossen in Weimar ein, um dort ihren eigenen Dichtertag abzuhalten.« Auf der Zeichnung paradieren sie etwas unpassend im Stechschritt, Klaus trägt kurze Hosen. Als Kollektiv tauchten die schreibenden Manns 1930 in Ottomar Starkes Kleinem Literaturbilderbogen auf, einer gezeichneten Kolumne, die regelmäßig in der Zeitschrift Literarische Welt erschien. Die Porträts von Heinrich und Thomas Mann wurden mit Lorbeerkränzen verziert, der ovale Bilderrahmen für Klaus Mann blieb leer (»Klaus noch nicht«).
Ganz beiläufig erhielt der Begriff den bestimmten Artikel in einer kleinen Parodie mit dem Titel »Literatur= Conference. The Th.& H.Mann Family« im Berliner Tageblatt vom 1.Januar 1931. Paul Nikolaus, damals der bekannteste Conférencier der Hauptstadt, ließ für die Neujahrsausgabe der Zeitung einige Dichter wie auf einer Kabarettbühne auftreten. Zu dieser Konferenz erschienen »vier Mann«, nämlich Heinrich, Thomas, Erika und Klaus. Hier ist die Rede davon, »dass die Manns Lübecker sind« und dass die Kinder Klaus und Erika »literarisch erblich belastet« seien. In der NS-Presse wurden die Manns kollektiv verhöhnt, wobei Heinrich Mann der Lieblingsfeind war und mit antisemitischen Klischees verunziert wurde. Nach dem Januar1933 nahmen die bösartigen Karikaturen zu. Auch auf ihre Exilorte am Mittelmeer wurde dabei angespielt.
Nach 1945 dauerte es lange, ehe die Manns öffentlich wieder als Kollektiv wahrgenommen wurden. Walter Arthur Berendsohn publizierte 1973 eine Sammlung von Aufsätzen und Besprechungen unter dem Titel Thomas Mann und die Seinen; Marcel Reich-Ranicki brachte 1987 eine Essay-Sammlung unter demselben Titel heraus. Schon lange vor Heinrich Breloers TV-Dokumentarspiel aus dem Jahr 2001 finden sich viele Belege für die Formel Die Manns.
Die beiden ältesten Söhne eines Lübecker Kaufmanns und dessen musisch begabter Frau wenden sich zu Beginn der 1890er Jahre vom Getreidehandel ab, dem ihre Vorfahren Ansehen und Wohlstand verdankten. Nach einer familiären Katastrophe – Tod des Vaters, Untergang der Firma– und nach zehn Jahren des Suchens, Irrens, Reifens verleihen beide Brüder ab etwa 1900 ihrem Namen Glanz und Klang auf dem Feld der Literatur. Sie selbst wie auch die folgende Generation sind von einer besonderen Aura umgeben, doch ist ihr Prestige mit menschlichen Dramen und massiven Anfeindungen erkauft. Die Lebensgeschichten der einzelnen Mitglieder der literarischen Dynastie beschäftigen die Öffentlichkeit noch Jahrzehnte nach dem Tod der Gründerfiguren, machen sie als Familienverband zu einem »Monument« der deutschen, ja der europäischen Kulturgeschichte, mitsamt einer amerikanischen Phase.
»[…] es ist ja alles schon so oft erzählt worden, Süßes und Herbes, von Hoffnung und Resignation, Stolz und Ehrgeiz, Neid, Liebe und Wollust, Spott und Verzweiflung«, diese Worte aus einer Erzählung des jungen Golo Mann gelten längst für »die Manns« insgesamt. Es fehlt nur noch ein Gesellschaftsspiel: Nenne mir deinen Lieblings-Mann! Gemeint ist: Wer aus der Generationenfolge der Manns und ihrem Umfeld ist deine Lieblingsgestalt? Dabei sollten die Pringsheims, die Vorfahren von Katia Mann, einbezogen werden, denn durch sie wird die Familiengeschichte um einen jüdischen Schicksalskomplex erweitert. Dieses Ranking-Spiel könnte Anlass zu ernsten und heiteren Vergleichen sein und dabei helfen, uns bewusst zu machen, was wir an den Manns haben: eine große Saga voller Glanz und Glorie, voller Widersprüche und Leid, voller Irrtümer und Sonderwege, voller Errungenschaften und Gedächtnisorte, kurzum: einen Königsweg zum Verstehen von Gesellschaft und Geschichte in Deutschland, von Deutschlands Position in der Welt und einen Spiegel, in dem wir manche Züge und Neigungen der Deutschen besser erkennen können.
Der Aufstieg zum Mythos eines Landes wurde durch die Magie der Literatur bewirkt, aber auch durch nachhaltige Engagements in öffentlichen Angelegenheiten zwischen dem Kaiserreich und der Zeit der deutschen Teilung, über die NS-Zeit, das Exil und beide Weltkriege hinweg. Begründer der neuen Dynastie war Heinrich Mann, der als erster eine literarische Existenz wählte. Der jüngere Bruder Thomas folgte seinem Beispiel und erlangte höchsten Ruhm. Doch erst durch das eigenständige künstlerische und politische Auftreten der »Kinder der Manns« wurde der kulturelle Clan zu einem generationenübergreifenden Gebilde, das an die griechische Mythologie erinnert.
Schon als Kind hatte Thomas Mann gerne »Zeus« gespielt. Zu einer Art Göttervater geworden, versammelte er um sich und seine Gattin eine muntere Schar von Nebengöttinnen und -göttern, Halbgöttern, zu Göttern geadelten Helden und Heldinnen, Gefährtinnen und Gefährten, Geliebten, Hausfreunden und Haustieren und natürlich auch von hartnäckigen Gegenspielern und Todfeinden. Zu allen gehören ihre Kose- und Spitznamen, ihre bezeichnenden Anekdoten, fröhlich gemischt aus Dichtung und Halbwahrheit, von Forschern humorlos entwirrt. Was immer sie taten oder was ihnen zustieß– es war nur eine Spielart der Kernidentität, eines geschlossenen Seelenkosmos, der von den beiden Zentralgestalten zusammengehalten wurde. Manns also, oder »in Gottes Namen denn«: Die Manns.
Herkunft
Dies ist eine kleine, alte Handelsstadt, mancher verlässt sie nie.
Heinrich Mann, Eine Liebesgeschichte, 1936
Lübeck war einst die mächtigste Hansestadt und nach Köln die zweitgrößte Stadt im Alten Reich. Im 12.Jahrhundert zwischen zwei Flussarmen auf einer länglichen Anhöhe gegründet, erhielt die Stadt 1226 die Reichsfreiheit, die bis in die Neuzeit verteidigt wurde. Ihre Selbstverwaltung bestand auch nach 1866 innerhalb des Norddeutschen Bundes; 1871 trat sie dem geeinten Reich als eigenständiges Land bei. Erst unter dem NS-Regime verlor Lübeck im Jahr 1937 seinen Status. Damit entfiel die bis dahin erhaltene lübecksche Staatsangehörigkeit, die auch in den Pässen der Manns vermerkt gewesen war. Nach 1945 wurde die Stadt dem Land Schleswig-Holstein zugeordnet.
Lübeck war ein in sich geschlossenes Kunstwerk mit seiner Insellage, seinen Stadttoren, seinen bedeutenden Kirchen, seinem Rathaus, den engen, langen Straßen, den Gassen, Hinterhöfen und Gängen. Etwa100 große Familien bestimmten das politische Leben. Als Stoff und Schauplatz der Literatur war die Stadt erst noch zu entdecken. Ehrgeizige Kaufleute hatte sie immer schon angezogen.
Im Jahr 1775 war ein Johann Siegmund Mann als vierzehnjähriger Kaufmannslehrling von Rostock nach Lübeck gekommen. Schon von dessen mecklenburgischen Vorfahren hatte es geheißen, sie hätten »sich sehr gut gestanden«.1790 wurde in Lübeck die Firma »Johann Siegmund Mann, Commissions- und Speditionsgeschäfte« gegründet. Der Patron heiratete eine gebürtige Hamburgerin, war als Kaufmann erfolgreich und starb 1848 nach einem Schlaganfall. Er hinterließ nicht nur eine angesehene Firma, sondern auch die Tradition, auf den letzten leeren Seiten einer Bibel in knapper Form die Fakten der Familiengeschichte schriftlich festzuhalten oder sie in Broschüren zu erzählen.
Sein Sohn, ebenfalls Johann Siegmund Mann mit Namen, geboren 1797, führte die Firma zu hoher Blüte und konnte das Firmenvermögen verzwanzigfachen. Aus seiner ersten Ehe mit Emilie Wunderlich hatte Johann Siegmund der Jüngere fünf Kinder. Fünf Jahre nach dem Tod von Emilie heiratete er 1837 in zweiter Ehe Elisabeth Marty, eine wesentlich jüngere Frau, deren Vorfahren aus der Schweiz zugewandert waren; auch aus dieser Ehe gingen fünf Kinder hervor. Von seinem Schwiegervater Marty übernahm Johann Siegmund Titel und Amt des »Königlich Niederländischen Konsuls«. Im November1841 erwarb er von Verwandten seiner Frau das Haus in der Mengstraße4, das nachmalige »Buddenbrookhaus«. Im Frühjahr 1842 wurde es zum Firmensitz und zur Familienresidenz. Seit 1848 saß er in der Bürgerschaft von Lübeck. Johann Siegmund starb 1863 an Lungentuberkulose.
Der älteste Sohn aus der zweiten Ehe, Thomas Johann Heinrich, Rufname Heinrich, wurde 1840 geboren und begann 1855 eine Lehre in der väterlichen Firma. Die erwünschte Auslandserfahrung sammelte er in London und in Amsterdam. Als sein Vater dem Tode nahe war, kehrte der Junior nach Lübeck zurück und übernahm mit 23Jahren die Leitung der Firma »Johann Siegmund Mann, Getreidehandlung, Kommissions- und Speditionsgeschäfte«, wie sie inzwischen hieß. Zudem erbte er den Titel eines niederländischen Konsuls.
1869 heiratete der neue Firmenchef. Seine elf Jahre jüngere Braut, die ihn an Körpergröße deutlich überragte, hieß Julia da Silva-Bruhns. Ihr Vater, der Kaufmann Johann Ludwig Hermann Bruhns, stammte aus einer Lübecker Familie, war aber nach Brasilien ausgewandert, wo er die Tochter einer einheimischen Kreolin und eines Portugiesen heiratete, der in vierter Generation in Brasilien lebte. Julia wurde 1851 als viertes von fünf Kindern geboren und erhielt den Rufnamen Dodo. Ihre Mutter starb mit 28Jahren bei der Geburt des sechsten Kindes. Die achtjährige Julia wurde von ihrem Vater nach Lübeck gebracht und dem Mädchenpensionat von Therese Bousset vor den Toren der Stadt anvertraut. Der Vater kehrte zunächst nach Brasilien zurück, lebte aber später bis zu seinem Tod im Jahr 1893 mit einer neuen Gefährtin bei Kassel. Als Julia siebzehn war, lernte sie auf einem Ball ihren künftigen Mann kennen. Nach der Heirat zog das junge Ehepaar nicht in das Haus Mengstraße4; dort blieb jedoch vorerst der Firmensitz. Im Februar 1877 wurde Thomas Johann Heinrich Mann zum Senator auf Lebenszeit gewählt, ein Höhepunkt in der Familiengeschichte. Unter den 14Mitgliedern der Stadtregierung war er ab 1885 für Steuerwesen und Wirtschaft zuständig.
Das junge Ehepaar Mann wohnte zunächst zur Miete in einer Etagenwohnung im Haus Breite Straße54, in dem am 27.März 1871 der erste Sohn geboren wurde, Luiz Heinrich Mann. 1872 erwarb die Familie ein eigenes Haus, Breite Straße38, an der Ecke zur Beckergrube. Dort kamen Heinrich Manns Geschwister zur Welt: am 6.Juni1875 der Bruder Paul Thomas; am 23.August 1877 die erste Schwester Julia Elisabeth Therese, Rufname Lula; am 23.September1881 die zweite Schwester, Carla Augusta Olga Maria, Rufname Carla.
Als am 12.April1890 ein weiterer Sohn geboren wurde, Carl Viktor, bewohnten die Manns das repräsentative Gebäude, das Senator Mann 1883 auf dem Grundstück Beckergrube52 hatte errichten lassen. Von stabilen Wohnverhältnissen, wie sie die Bezugnahme auf den imaginären Fixpunkt des »Buddenbrookhauses« suggeriert, konnte kaum die Rede sein.
Auf den 21.Mai1890 fiel das einhundertjährige Jubiläum der Firma Mann. Wenige Wochen später wurde beim Senator Blasenkrebs festgestellt, eine Operation war unvermeidlich. Am 30.Juni1891 setzte der Firmenchef sein Testament auf. Und er verkaufte das Haus seiner Eltern in der Mengstraße. Der Senator starb am 13.Oktober1891 mit 51Jahren; mit einem langen Trauerzug zum Friedhof vor dem Burgtor im Norden der Stadt erwies Lübeck ihm die letzte Ehre. Alsbald kursierten Gerüchte über den fragwürdigen Lebenswandel der Witwe; der Hauptpastor der Marienkirche brachte das Schmähwort von der »verrotteten Familie« in Umlauf. Aber was den einen als Niedergang vorkommt, ist für andere der Ausgangspunkt eines neuen Lebens.
Senator Mann war in dem Bewusstsein gestorben, dass mit ihm eine Tradition erlosch und seiner Witwe sowie den fünf Kindern schwere Zeiten bevorstünden. Der eingesetzte Testamentsvollstrecker erwies sich als unfähig und unzuverlässig. Die Liquidation der Firma ergab lediglich 400000Mark, die Hälfte der erhofften Summe. Die monatlichen Zinsen für die Mutter betrugen 600Mark, für die beiden ältesten Söhne je 180Mark– aber erst nach deren Volljährigkeit auszuzahlen. Der zuständige Vormundschaftsrichter hieß übrigens Leverkuehn.
Nach dem Tod ihres Gatten war Julia Manns Leben von einem zwanghaften Umzugstrieb geprägt. Ihr Sohn Viktor sprach von »krankhafter Unstetheit«. Zunächst zog sie mit den Kindern aus dem großen Stadthaus in eine Villa vor dem Burgtor (Roeckstraße7). Im Sommer 1893 verließ sie Lübeck, wo sie nie recht heimisch geworden war, und zog von der Trave an die Isar; aber auch in Bayern fand sie keine Ruhe. Ihren Kindern jedoch bot die Kunststadt München neue Perspektiven.
Kaisers neue Bühne
In Heinrich Manns Geburtsjahr 1871 hatte für Deutschland eine neue Epoche begonnen. Bismarck und der greise Kaiser Wilhelm I. hatten mit dem geeinten Deutschland einen neuen politischen Akteur auf dem europäischen Kontinent platziert, dessen Gleichgewicht dadurch aus der Balance kam. Auch dank der Reparationszahlungen aus dem unterlegenen Frankreich setzte in den Gründerjahren ein Aufschwung ohnegleichen ein, eine gewaltige Modernisierung von Infrastruktur, Bildungswesen, Technik.
In Frankreich war mit dem Krieg von 1870/71 das zweite Kaiserreich zu Ende gegangen; in einem Prozess, der sich über mehrere Jahre hinzog, setzte sich danach die Republik als Staatsform durch. Sie war das Neue in der französischen Geschichte, aber sie nannte sich »die Dritte Republik«, wodurch eine Bezugnahme auf das Jahr 1792 sowie auf das Jahr 1848 gegeben war. Durch ein republikanisches Bildungswesen wurde sie tief im allgemeinen Bewusstsein verankert.
Die Bilanz des deutschen Kaiserreichs war auf den ersten Blick positiv. Unbestreitbar waren der wirtschaftliche Aufschwung und der langsam wachsende Wohlstand; hinzu kamen Formen sozialer Absicherung wie in keinem vergleichbaren Land der Welt. Vor 1914 gehörte Deutschland zu den drei führenden Industrienationen, nach den USA und Großbritannien, aber vor Frankreich. Es vollzogen sich ein kolossaler Bevölkerungszuwachs sowie eine enorme Binnenwanderung in die neuen Zentren der Industrie. Die autoritäre Regierungsform stieß sich an den Gegebenheiten, die für die moderne Gesellschaft unabdingbar waren: freie Wirtschaft, offene Gesellschaft, Universalismus der Werte. Der Reichstag symbolisierte ein uneingelöstes Versprechen, eine künftige Gegenmacht, deren Bedeutung im Laufe der Jahre allerdings zunahm.
Das Bismarck-Reich schien die historisch endgültige Form Deutschlands geworden zu sein und war dann doch nur eine relativ kurze Etappe in der langen und konfliktreichen Nationenbildung. Es war mächtig: industriell, wissenschaftlich, technisch, militärisch. Doch es konnte seinen Frieden nicht finden, nach innen nicht und nicht nach außen. Und es schuf auch keine wirkliche Einheit im Innern: Es wurden stets »Reichsfeinde« ausgemacht oder notfalls erfunden. Die halbabsolutistische Struktur war ein Anachronismus, das feudalaristokratische Machtzentrum stand in krassem Widerspruch zur stürmischen Entwicklung von Industrie und Technik; das Wachstum von Arbeiterschaft, Städten und Massengesellschaft trieb die alten Mächte in die Enge. Es war ein reiner Machtstaat ohne übergreifende Idee und ohne grundlegende Werte, mit der Obsession von Sicherheit und Stabilität, in Wahrheit stets virtuell im Krieg mit allen liegend, sich auf den nächsten Waffengang vorbereitend. Die innere Leere wurde mit Getöse und Getue überdeckt, mit dem stillosen Schauspiel hohler Macht.
Ab 1888 begann eine neue Ära, deren Beginn mit der Thronbesteigung Wilhelms II. zusammenfiel. Die archaischen Formen und Ideologien, die aus dem Alten Reich überlebt hatten, stießen auf die Gegebenheiten der entfesselten Moderne. Die Deutschen wie ihr Kaiser schwankten zwischen Selbstüberschätzung und Minderwertigkeitsgefühl.
Kaiser Wilhelm II. war der Hauptdarsteller dieses Reiches. Niemand verkörperte Ansprüche und Schwächen, Triumphgeheul und Jammer des Zweiten Deutschen Kaiserreichs umfassender und überzeugender als dieser Staatsschauspieler. Er interpretierte eine Vielzahl von Rollen in immer neuen Kostümen, vom Heerführer bis zum Familienpatriarchen, vom Kunstdiktator bis zum Herrenreiter, vom Edelmann bis zum Arbeiterversteher, vom Judenfreund bis zum Antisemiten. Er beherrschte das Genre der Hetzrede ebenso wie die huldvolle Hinwendung zu seinen Untertanen. Und doch hatte dieser Reisekaiser einen heimlichen Makel, ein brüchiges Selbstbewusstsein, und vieles an seinem Imponiergehabe war nur Kompensation.
Die Binnenseite der politischen Widersprüche war die allgemeine Nervosität. Sie war eine Signatur der modernen Zeiten schlechthin, fand aber im Wilhelminischen Deutschland ihren greifbarsten Ausdruck. Leben und Werk des jungen Heinrich Mann ergäben schönes Anschauungsmaterial für das »Zeitalter der Nervosität«. Dies meinte die Reizbarkeit im »ruhelosen Reich« als eine der Wurzeln der Katastrophe von 1914, wobei es unwichtig ist, ob es sich um ein Phantasma oder um medizinische Realität handelte.
»Raste nie, doch haste nie, sonst haste die Neurasthenie«, reimte der Volksmund. Den Begriff Neurasthenie hatte der New Yorker Nervenarzt George M.Beard 1880 eingeführt. Diese Nervenschwäche, ein Grenzzustand zwischen Krankheit und Gesundheit, wurde als charakteristisches Leiden verstanden und galt als Grund, sich in spezielle Kuren zu begeben. Die Rede davon verbarg allerlei Unaussprechliches, nicht zuletzt Probleme mit der Sexualität. Aus solchen zeittypischen Vorstellungen von Nervenschwäche und neu zu gewinnender Energie wird verständlich, warum beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs so viele Kur-Begriffe benutzt wurden bis hin zu Formulierungen wie »Stahlbad«.
Im Neuen Reich kam der Stadt Lübeck nur noch eine marginale Bedeutung zu; sie verkörperte eher die Vergangenheit, gemessen an der rasanten Entwicklung des geeinten Landes; Hamburg hatte der Stadt endgültig den Rang abgelaufen. Eine Sonderstellung nahm Berlin ein als stetig wachsende Hauptstadt und als zweitwichtigste Industrieregion nach dem Ruhrgebiet. München bildete den maximalen Kontrast dazu, auch wenn es hier einiges an Industrie gab. Unter dem Prinzregenten Luitpold wurde es zur Stadt der künstlerischen Freiheit (wozu es seine intolerante katholische Vorgeschichte nicht prädestiniert hatte). Jenseits von München gab es nur noch Paris, das viele Münchner Künstler anzog.
Denn die Intelligentia des neuen Reiches begab sich gerne an die Seine. Das besiegte Frankreich hatte das siegreiche Deutschland übertrumpft– in künstlerischer Hinsicht. Vorreiter einer Hinwendung nach Frankreich, ohne dass die Tradition der Italienreise verloren ging, war Friedrich Nietzsche, der befand, dass man den deutschen Geist zugunsten der deutschen Einheit geopfert hatte. Alle großen Namen in Malerei, Journalismus, Literatur, Theater, von Max Liebermann und Rainer Maria Rilke, Stefan George, Frank Wedekind bis Franz Hessel, Erich Mühsam, Wilhelm Herzog, Paula Modersohn-Becker, Annette Kolb und viele andere, verbrachten Lehrjahre in Paris. In dieser beeindruckenden Liste fehlen nur die Brüder Mann. Gleichwohl spielte das Bild von Frankreich zwischen ihnen eine wesentliche Rolle.
In seinem erfolgreichen Roman Prinz Kuckuck (1907) hat Otto Julius Bierbaum alle gesellschaftlichen, menschlichen und moralischen Widersprüche des Wilhelminischen Reiches veranschaulicht, das er als »Hurrasien« verspottete. Dieses sprachmächtige und erotisch freizügige Kunstwerk war auch eine wichtige Anregung für die Schriftstellerbrüder Mann. Deren Laufbahn begann zu einer Zeit, als Kunst und Künstler in Deutschland ideologisch überhöht wurden und sich die materiellen Voraussetzungen durch einen Aufschwung im Verlagswesen erheblich verbesserten.
Der Bereich der Kunst hatte im Verlauf des 19.Jahrhunderts eine erstaunliche Ausweitung erfahren. Maler, Dichter, Komponisten gewannen einerseits an kreativer Freiheit und an technischen Möglichkeiten, sahen sich andererseits politischen Kontrollen und ökonomischem Druck ausgesetzt. Die Kunstszene wurde vielfältiger und internationaler; europäische Musiker reisten durch alle Länder des Kontinents und gelegentlich in die Neue Welt; Romane wurden übersetzt, Gemälde wurden international gehandelt; ästhetische Entwicklungen in einem Land hatten Auswirkungen auf andere Länder. Museen, Galerien, Salons, Akademien, Kultusministerien stützten die Geltung der Künste. Die rapiden Fortschritte der Drucktechnik und anderer Verfahren zur Vervielfältigung bewirkten Neugründungen von Presseorganen und Verlagen und steigerten die Nachfrage nach Texten.
Mit den neuen Techniken und ihren vielfältigen Möglichkeiten wuchs ein buntes Künstlervölkchen heran: Maler, Zeichner, Romanciers, Liederdichter, Dramatiker, Kabarettisten, Kritiker, Journalisten, Fotografen. Es entstand eine sozial ungesicherte und ungebundene Zwischenschicht: die Boheme. Am anderen Ende der Skala standen Maler- und Dichterfürsten, die zu nationalen Ikonen wurden. Kunst- und Buchhandel sowie das Pressewesen entwickelten sich zu neuen Erwerbszweigen und gesellschaftlichen Instanzen.
Seit 1887 galten für Bücher feste Ladenpreise; der Buchmarkt hatte sich erheblich ausgeweitet. Im Deutschen Reich erschienen im Jahr 1909 insgesamt 31000Titel, in Frankreich etwa nur 11000. Ausländische Romane wurden in Deutschland billiger verkauft, gefertigt von schlecht bezahlten Feierabend-Übersetzern. Rechtsabkommen über Grenzen hinweg gab es nur selten und wurden nicht immer respektiert.
Eine Serie von Verlagsgründungen sorgte für neue Formen und Dimensionen des literarischen Lebens, so durch Samuel Fischer (Berlin, 1886), Eugen Diederichs (Florenz, 1896), Albert Langen (1893, erst Paris, dann München), Georg Müller (München, 1903), Reinhard Piper (München, 1904). Der Verlag Die Insel, aus der gleichnamigen Zeitschrift hervorgegangen, wurde 1899 in München gegründet und ab 1906 in Leipzig von Anton Kippenberg geleitet; 1910 begann Ernst Rowohlt in Leipzig, zog aber bald nach Berlin; 1913 gründete Kurt Wolff einen Verlag in Leipzig (mit den Lektoren Kurt Pinthus und Franz Werfel). Kleinformatige Bücher (als Reiselektüre in der Eisenbahn) spielten eine besondere Rolle, so Langens »Kleine Bibliothek« (seit 1897) mit dem Einheitspreis 1Mark (dort erschienen die Novellen von Heinrich Mann). Ähnliches versuchte die »Collection Fischer« (in der Thomas Mann mit Erzählungen debütierte).
In Malerei, Bildhauerei und Literatur, in Musik, Theater und Mode beanspruchten die Frauen ihren Platz, nicht länger als geduldete Ausnahmen, sondern als gleichberechtigte kreative Persönlichkeiten. Ihr Zugang zu den entsprechenden Institutionen wurde von dominanten Männern und gängigen kulturellen Zuschreibungen behindert. Als neue Akteure im kulturellen Feld wirkten seit Beginn des 19.Jahrhunderts jüdische Künstler, ein Zeichen ihrer fortschreitenden gesellschaftlichen Integration.
Alle Tendenzen der Kunstideologie des 19.Jahrhunderts kulminierten in einer Person, einem Werk und an einem Ort: in Richard Wagner und dem Festspielhaus in Bayreuth. In Wagners Idee vom Gesamtkunstwerk flossen verschiedene ästhetische Formen zusammen; ergänzt und überhöht wurde dies ab 1876 durch einen Ort, an den man pilgern konnte, um weihevollen Aufführungen beizuwohnen. Die Kräfte des Imaginären in neue Mythen und neue integrale Formen eingebunden zu haben, die Aufführung als soziales und beinahe sakrales Ereignis, das eigene Werk zum kulturgeschichtlichen Faktum überhöht zu haben, das war Wagners Leistung. Eben diese Entwicklung führte zum Abfall seines einstigen Bewunderers Friedrich Nietzsche. Nietzsches Wagnerkritik (Der Fall Wagner) wiederum wurde zum ästhetischen Schlüsseltext für Thomas Mann. Durch Nietzsche vermittelt, entwickelte Thomas Mann ein lebenslanges Misstrauen gegen Wagner als »Dichter« und als Effekthascher– und versuchte doch, dessen Selbstbewusstsein und Werkkult nachzuahmen. Richard Wagner vereinte mehrere Künstlermythen: als Dichter, als Musiker, als Politiker, als Held einer abenteuerlichen Lebensgeschichte.
Brennpunkt der Entwicklung von Kunstpraxis und Kunsttheorie um 1900 war München. Hier erschien 1890 das folgenreiche Buch von Julius Langbehn Rembrandt als Erzieher. Darin wurde der Kunst eine erzieherische Aufgabe zugewiesen, jedoch beschränkt auf das eigene Volk. Der Künstler galt als eine Art Führer, welchen man den Spezialisten des wissenschaftlich-technischen Zeitalters, aber auch demokratischen Politikern entgegensetzte. Diese heroische Auffassung von Künstlertum passte in das Weltbild der Völkischen und ihrer Vorstellung von einer Wiedererstarkung des Deutschtums. Die Künstlerideologie geriet hier zum nationalpädagogischen Projekt, bewusst gegen die Moderne gesetzt.
Symbolismus und Satire
Du träumtest Leben, und du lebtest Mythen.
Heinrich Mann, Jugendgedicht
Apart sein war alles. Er suchte das Abseitige und Marginale, um sich zu unterscheiden, um aufzufallen. Mit 15Jahren schrieb er eine kleine Erzählung mit dem Titel Apart, die kurzgefasste Lebensgeschichte eines Snobs und Exzentrikers aus Paris. Dieser ist mit dem Leben fertig, bevor er es kennen gelernt hat, schaut gelangweilt und amüsiert auf das Treiben der anderen hinab. Noch seinen Tod inszeniert der blasierte Dandy als theatralische Provokation. In seinem Verhalten, seinen politischen Ansichten, in seinem Liebesleben wie in seinem Schreiben suchte der junge Heinrich Mann das Ausgefallene. Das Lebenswerk des Vaters fortzusetzen war nicht apart genug.
Vergeblich hatte Senator Mann versucht, seinen ältesten Sohn für die Familienfirma und den Kaufmannsberuf zu gewinnen. Auch eine Reise zu Verwandten nach Sankt Petersburg konnte den 13-Jährigen nicht für den Fernhandel begeistern. Schon als Schüler schickte Heinrich Gedichte und Erzählungen an Zeitungen und Zeitschriften. In der Schule, dem Katharineum in der Königstraße, fand er kaum Anregungen. Nach der Obersekunda verließ er die Schule und begann im Oktober1889 eine Buchhandelslehre in Dresden. Die Arbeit empfand er als stumpfsinnig, genoss aber das kulturelle Leben der sächsischen Hauptstadt. Er las Heine, Fontane und bald auch Nietzsche. Seine Zukunft sah er vage als »Verleger –Redakteur– Schriftsteller«. Als die Zeitschrift Gesellschaft im Herbst 1890 ein Gedicht von ihm abdruckte, nannte er dies seinen ersten Schritt in die Öffentlichkeit. Im Herbst 1890 entstand die autobiographische Novelle Haltlos über einen jungen Mann aus gutem Hause, der im Buchhandel arbeitet und eine Affäre mit einer Verkäuferin hat. Erlebnisse oder Wünsche verwandelte er in Literatur– das war sein Weg.
Im August1891 trat er als Volontär in den Verlag von Samuel Fischer in Berlin ein. Um die neue Situation zu begutachten, führte der Vater ein Gespräch mit dem Chef des Hauses. Aus Heinrichs Sicht war das (unbezahlte) Volontariat nur Mittel zum Zweck: »Hauptsache Berlin«. In seinen Erinnerungen schreibt Heinrich Mann, der Vater habe seine literarischen Pläne auf dem Totenbett gebilligt, aber als der Senator starb, hielt sich der älteste Sohn noch in der Hauptstadt auf. Immer wieder hat Heinrich Mann kleine Geschichten erfunden, um das Bild seines Lebens auszuschmücken. Der Vater hatte in seinem Testament vom 30.Juni1891 ausdrücklich gewünscht, seine Frau möge den »Neigungen meines ältesten Sohnes zu einer so genannten literarischen Tätigkeit« entgegentreten. Nach dem Tod des Vaters musste Heinrich keine Rücksicht mehr nehmen, er sprach von seiner »Freilassung« und gab sich seinem ungezügelten Bummelantenleben hin. Ein kurzes Zwischenspiel als Gasthörer an der Berliner Friedrich-Wilhelm-Universität war eher ein mondäner Zeitvertreib. Sein Wissen bezog er aus den Feuilletons, wie er seinem einstigen Mitschüler Ludwig Ewers gegenüber zugab.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!