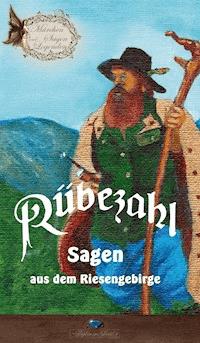
Rübezahl E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Saphir im Stahl
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Märchen, Sagen und Legenden
- Sprache: Deutsch
Rübezahl Wer kennt ihn nicht, den Herrn der Berge? So sind diese Sagen den Lesern sicherlich bekannt. Das Taschenbuch ist der Nachdruck eines Sagenbuches aus dem Jahr 1900. Die Frakturschrift wurde wortwörtlich abgeschrieben. Daher entbehren die Geschichten jedweder deutschen Rechtschreibreform. Auch die Sprache ist etwas anders, als die, die heute verwendet wird. Damit ist dieses Buch eine Besonderheit, weil sie die Kultur von vor einhundert Jahren bewahrt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Taschenbuch 008 RübezahlErste Auflage 01.03.2014
© Saphir im StahlVerlag Erik SchreiberAn der Laut 1464404 Bickenbachwww.saphir-im-stahl.de
Titelbild: Manfred HussZeichnung: Oskar Theurer
Vertrieb bookwire
ISBN: 978-3-943948-21-9eISBN: 978-3-943948-22-6
Herausgeber Erik Schreiber
MärchenRübezahl
Vorwort
Die Geschichten um Rübezahl, den Berggeist des Riesengebirges, werden immer wieder gern aufgelegt. In der Reihe „Märchen, Sagen und Legenden“ nahm ich mich als Herausgeber dieses Themas an. Der Hintergrund ist schon eine eigene Geschichte für sich.
Im Jahr 2012, zur Buchmesse in Leipzig, besuchte ich in Hohenossig das Gasthäuschen. Dort fand ich im Regal im Gastraum das Buch Rübezahl. Der gebrochene Umschlag und der abgerissene Buchrücken machten das Buch nicht sehr ansehnlich. Aufgeblättert fehlten die Angaben des Verlages und die meisten Farbtafeln waren entfernt. Nur ein paar Schwarzweisszeichnungen lockerten den Text auf. Geschrieben war das Buch in alter deutscher Fraktur und entsprechend in der damaligen Sprache, die sich von der heutigen doch unterscheidet. Ich schätze den Druck des Buches etwa auf das Jahr 1902. Bereits 2012 hatte ich vor, das Buch Rübezahl in der Rubrik Historisches nachzudrucken, doch andere Projekte und technische Schwierigkeiten hielten mich davon ab.
Jetzt ist das Buch als Taschenbuch erschienen, in der neu geschaffenen Reihe „Märchen, Sagen und Legenden“. Neben Wolfsmärchen, Märchenprinzessinnen und Gnome, Wichtel Heinzelmännchen ist Rübezahl der vierte Band der Reihe. Mir ist es wichtig, alte Märchen und Sagen für die Nachwelt zu erhalten. Bei Rübezahl hat es mir die antiquierte Sprache angetan, die Wort für Wort, ohne Veränderung so übernommen wurde.
Das bedeutet für den Leser den Verzicht auf die zur Zeit gültige Rechtschreibung, sowie eine mitunter andere Bedeutung von Begriffen, wie wir sie heute kennen.
Es gibt noch eine Anmerkung.
Im 7. Kapitel ist die Rede von Kundschaft. Hierunter versteht man das Gesellenzeugnis oder auch andere Empfehlungen, die dem Wandergesellen mitgegeben wurden.
Und nun wünsche ich ein angenehmes Lesevergnügen.
Erik Schreiber
Bickenbach 06.01.2014
Unter der Erde
Eine Erzählung als Einleitung zu den folgenden Kapiteln.
Wer schon einmal das Riesengebirge besuchte, mit seinen himmelanstrebenden Bergen, seinen klaren Bächen, seinen rieselnden Quellen und seinen heilspendenden Brunnen, der hat auch wohl erfahren, daß dort ein betriebsames Völkchen zu Hause ist. Nicht nur Weber sind es, die dort von früh bis spät fleißig die Hände rühren, um für Weib und Kind herbeizuschaffen, was für des Leibes Notdurft erforderlich ist, und die für geringen Lohn bis spät in die Nacht hinein arbeiten, glücklich, wenn ihnen ihr Fleiß nur soviel einträgt, um sie vor Hunger zu schützen. Nein, auch der Bergbau blüht im Riesengebirge, denn die hohen, stolzen Bergriesen hüten in ihrem Inneren gar reiche Schätze, Kohlen und edle Erze, die den Menschen unentbehrlich sind und ihnen außerdem reichen Gewinn eintragen. Seit grauen Zeiten sind denn auch viele Tausende von fleißigen Menschen damit beschäftigt, den Bergen ihre Schätze abzuringen, und so sind die Bergleute oder Bergknappen, wie man diese fleissigen Leute nennt, im Riesengebirge eine liebe, altgewohnte Erscheinung. Nun müßt ihr aber wissen, daß der Beruf eines Bergmannes gar schwierig und gefahrvoll ist, denn der Bergmann muß jahraus, jahrein unter der Erde arbeiten, um derselben ihre Schätze zu entreißen: Kohle, Silber, Eisen und so weiter, und dabei ist er stets Gefahren ausgesetzt, denn die Berggeister sehen nicht immer geduldig zu, wie man sie ihres Eigentums beraubt; oft wehren sie sich dagegen und suchen die Eindringlinge zu vertreiben. Dann schicken sie plötzlich giftige Gase, welche die armen Bergleute bei der Arbeit überfallen und ihnen die Besinnung rauben, so daß sie in der Grube elend sterben müssen. Dann sprechen die Menschen wohl von einem Grubenunglück, von explodierten Gasen, Wassereinbrüchen und so weiter, während das Volk und mit ihm die Poesie an dem Glauben festhalten, daß eigentlich nur die „Berggeister“ im Kampf um ihr gutes Recht den Schaden angerichtet haben.
Dennoch ist dem Bergmann sein Beruf wert, und er würde ihn um keinen Preis mit einem anderen tauschen. Denn während er unter der Erde, abgeschlossen von allem Lebenden, die Spitzhacke und den Hammer führt und den blinkenden und glitzernden Adern beim Schein der Grubenlampe ihre Reichtümer entlockt, geht er seinen Gedanken nach, sieht auch wohl manches, was uns, die wir auf der Oberfläche der Erde leben, stets ein Geheimnis bleiben wird. Der Bergmann macht auch wohl die Bekanntschaft von „Berggeistern“, aber er spricht dann nicht von seinen vornehmen Bekannten, weil er weiß, daß die Berggeister die Ruhmredigkeit nicht leiden mögen und er ich die gute Freundschaft doch nicht verderben möchte. Wenn er aber dann alt geworden ist und es mit der Arbeit nicht mehr gehen will, so daß er die Spitzhacke und den Hammer beiseite legen muß, um im Sorgenstuhl von der schweren von der schweren Lebensarbeit auszuruhen, dann erinnert er sich wohl an all die Geschichten, die er unter der Erde erlebte, auch an solche, die er von anderen vernommen hat, und gern erzählt er dann denen, die es hören wollen, von feinen Erlebnissen, von den Sagen und Märchen.
Ein solcher Bergmann war auch der alte Hurtig, der in der Gegend von Waldenburg zu Hause, und nachdem er wohl fünfzig Jahre in dem Schacht tätig gewesen war, sich nun von der Arbeit ausruhte. Seine alten Knochen waren im Laufe der Zeit mürbe geworden, und seine wackeren beiden Söhne folgten seit Jahren dem Beispiel des Vaters und waren in der Grube tätig, während ihre Frauen daheim nach dem Rechten sahen, auf die Kinder achteten, aber auch den alten Vater pflegten, der ruhig im Sorgenstuhl saß und sein Pfeifchen rauchte. Wenn dann aber die Enkelkinder sich um den Großvater scharten und jedes ihm gern alles zu willen tat, da war es dem alten Hurtig oft, als müsse er sich für soviel Liebe auch dankbar zeigen. Weil er nun aber wußte, daß Kinder gern Geschichten hören, so erzählte er ihnen gar vieles, was eigentlich nur Großväter ihren Enkelkindern erzählen können, da es sich aus dem Mund des Großvaters am besten anhört. So erzählte denn „Großvater Hurtig“ den Kindern viel anmutige Geschichten, darunter auch manche von Rübezahl, dem „Herrn der Berge“, und die Kinder konnten gar nicht genug davon hören. Da ich ihn nun glaubte, daß meinen jungen Freunden die Geschichten von Rübezahl ebenso gefallen dürften, habe ich die besten gesammelt und biete sie ihnen zur Kurzweil dar.
Erste Kapitel.
Der Geist des Riesengebirges
In uralten Zeiten hauste im Riesengebirge ein Erdgeist von gar gewaltiger Macht, wie sie nur eben Geistern zu Gebote steht. Zwar hatte noch kein Bewohner des Gebirges den mächtigen Geist gesehen, doch wußten alle von seiner Existenz. Ja, einige alte Leute wollten ihn sogar auf einsamen Wegen im Gebirge gesehen haben, aber sie fanden wenig Glauben mit solchen Erzählungen, denn da einer die äußere Erscheinung des Erdgeistes immer anders beschrieb als der andere, so fand eben keiner Glauben.
Dennoch existierte der Geist. Er war aber kein Erdgeist, sondern ein Berggeist, der sich nur in seiner unterirdischen Behausung im Gebirge wohl fühlte, denn hier war er der eigentliche Herrscher auf vielen Meilen in der Runde, Tausende von Nixen und Gnomen waren ihm untertan und befolgten seine Befehle, und mit so königlicher Macht ausgestattet, konnte sich der Berggeist wohl behaglich fühlen in seinem Reiche, denn sein Anweisungen zu geben, wie sie es anzustellen hätten, daß alles in dem unterirdischen Reiche auch seinen richtigen Gang ging.
Das war nun freilich nicht so leicht; denn da war gar vieles zu beobachten und zu regeln. Zunächst mußten die Bergadern täglich nachgesehen werden, welche die Kohle und Erze und sonst edles Gestein als Silber und Gold enthielten, damit sie den fleißigen Bergleuten auch den Lohn für ihre saure Arbeit sicherten. Dann wieder mußten die Gärten gut instand gehalten werden, damit oben im Gebirge die wunderbaren Heilkräuter nicht ausgingen, und schließlich mußten die Gnomen auch fleißig das Feuer schüren, denn nur so konnten die sprudelnden Heilquellen warm erhalten werden, die sich im Gebirge ergossen und zu denen alljährlich im Sommer viele Tausende von Kranken von weither pilgerten, um Genesung für ihre Leiden zu finden. Dann mußten wieder andere Quellen mit dem nötigen Salz versehen werden oder mit bitteren Kräutern, damit sie den Kranken die stärkende Arznei ersetzten.
Kurz, der Berggeist hatte vollauf zu tun, wenn alles in seinem Reich ordnungsmäßig zugehen sollte, ob er gleich nur zu kommandieren nötig hatte. So kam es denn, daß er sich um das Getriebe auf der Erdoberfläche wenig kümmerte, denn was gingen ihn denn auch die Wesen an, die sich oben über ihm in dem Gebirge tummelten, und die doch nur ein so kurzes Dasein hatten, daß es für einen Berggeist und noch dazu für einen, der auf guten Ruf hielt, gar nicht lohnte, sich mit ihnen abzugeben.
Nur aus Neugier verließ er wohl ab und zu sein Reich, um einen kleinen Abstecher auf die Erdoberfläche zu machen, wenn er aber dann das Treiben der Menschen sah, wenn er beobachtete, wie sie, einer auf den anderen neidisch, sich gegenseitig mit List und Tücke verfolgten, Freundschaft heuchelten, während sie doch Feindschaft im Busen nährten, dann war er immer froh, wenn er von solch einem Ausflug wieder in das Innere seiner Berge zurückgekehrt war.
Doch ganz ohne Nachteil sollten die Besuche, die der Berggeist der Oberfläche der Erde abzustatten pflegte, für ihn nicht bleiben. „Böse Beispiele verderben gute Sitten.“ Dieses Sprichwort sollte sich auch an dem Berggeist erfüllen. Durch seinen, wenngleich nur seltenen Rückkehr mit den Menschen, hatte er zuletzt, ohne daß er es selbst ahnte, viele Eigenschaften der Menschen angenommen, die sich mit dem Wesen eines rechtschaffenen Berggeistes gar nicht vertrugen. Indem er es bald dem einen, bald dem anderen Menschen gleichtun wollte, nahm er auch dessen Charakter an, und so war er denn bald eitel, bald bescheiden, bald gutmütig, bald hart und unbarmherzig, so daß er eigentlich einer Wetterfahne glich.
Darunter hatten denn wieder die Gnomen schwer zu leiden, die ihrem Herrn nichts recht machen konnten. Bald hatten sie das Gestein und Erz nicht ordentlich abgeteilt, bald das Feuer für die warmen Quellen nicht gut genug geschürt, bald wieder die balsamischen, heilkräftigen Kräuter nicht gut gemischt, kurz, immer gab es Neues, worüber ihr Herr, der Berggeist, in Zorn geriet und sie rüffelte.
Wenn er sich dann ordentlich ausgetobt hat, begab er sich meist auf die Erdoberfläche, um sich die Zeit zu vertreiben, denn so oft er auch bei den Menschen erscheinen mochte, immer fand er des Neuen gar viel, immer Leute, die er vorher nie gesehen hatte, immer Dörfer, die plötzlich neu erstanden waren.
Das war aber ganz natürlich, denn des Menschen Erdenwallen währt nur kurze Zeit, während der Berggeist, da er ewig lebte, keine Zeit kannte, für ihn glichen hundert Jahre einer Minute, tausend Jahre zehn Minuten unserer Zeitrechnung. In tausend Jahren aber gehen gar gewaltige Veränderungen vor, und so war es kein Wunder, daß der Berggeist bei jedem Besuch auf der Erdoberfläche auch stets alles vollkommen verändert fand; selbst die Menschen, die nach Tracht, oft sogar der Sprache nach von denen verschieden waren, die er an der gleichen Stelle vorher gesehen hatte.
Das aber war es, was den Berggeist reizte, seinen Besuch oft zu wiederholen, denn wenn er auch ein Geist war, liebte er doch die Abwechslung. Obgleich er im Grunde genommen die Menschen nicht besonders liebgewonnen hatte, hegte er doch schon lange den Wunsch, einmal unter ihnen zu leben, um sie genauer kennen zu lernen, denn da er als Geist die Macht hatte, überall einzudringen, sich auch jede Gestalt zu geben, wollte er die Menschen einmal im Umgange genau studieren, nicht nach dem Schein, sondern nach dem Sein urteilen, um ihnen nicht unrecht zu tun.
Zweites Kapitel.
Wie der Berggeist sich zuerst als Knecht, dann als Schäfer und darauf als Diener bei einem Richter verdingt, aber überall nur schlechten Dank für seine Mühe erntet.
Kaum hatte der Berggeist diesen Entschluß gefaßt, als er sich auch auf die Erdoberfläche begab, um sein Vorhaben auszuführen. Das Glück war ihm günstig, denn kaum hatte er die Oberwelt betreten, als er auch ein großes Dorf erblickte, an einer Stelle, wo bei seinem letzten Besuche noch ein mächtiger Wald seine Baumriesen ausgebreitet hatte. Schmucke Bauerngehöfte, von saftigen Wiesen umgeben, zeugten von der Wohlhabenheit ihrer Besitzer, und ein der derselben stand eben am Scheunentor und beobachtete behaglich schmunzelnd, wie die Knechte und Mägde die goldene Ernte einfuhren.
„Wirst es einmal mit diesem versuchen,“ dachte der Berggeist, während er sich in einen Knecht verwandelte und im nächsten Augenblick nach höflichen Gruß den Bauer um einen Dienst ansprach. Der Bauer ließ seine Blicke mit schlichtem Wohlgefallen auf dem stattlichen Knecht ruhen, der etwas Tüchtiges zu leisten versprach; bald waren beide über den Lohn einig und der Berggeist zog bei dem Bauer als Knecht ein.
Der Bauer konnte sich zu dem neuen Knecht wohl gratulieren, denn kein anderer Knecht im Dorfe konnte auch nur den zehnten Teil von dem schaffen, was der neue Knecht leistete. Jeder im Dorfe beneidete den Bauer um einen so guten Knecht. Der Bauer aber tat, als merke er nichts davon, ja er entließ noch zwei andere Knechte, so daß der neue Knecht nun die Arbeit für drei zu verrichten hatte. Das schien aber den außerordentlich fleißigen Knecht gar nicht anzustrengen, denn spielend verrichtete er die Arbeiten, alles ging ihm leicht von der Hand, und es war, als ob ein Segen auf allem ruhte, was er verrichtete.
Das war aber seinem Herrn sehr recht, denn nun durfte er selbst faulenzen und konnte sich am Tage in der Scheune umhertreiben und die Zeit beim Spiel vergeuden, weil er ja wußte, daß die Arbeit daheim doch verrichtet und der Acker zu seiner Zufriedenheit bestellt wurde. Da er aber den ganzen Tag nur damit zubrachte, sein Geld zu verprassen, so kam es daß er seinem braven Knecht nicht einmal den sauer verdienten Lohn zahlen konnte.
Das war nun dem Knecht nicht recht, der deshalb den Dienst verließ und gerade keinen guten Begriff von der Dankbarkeit der Menschen aus dieser ersten Stelle mitnahm. Aber da er die Menschen doch nicht gern nach einem einzigen beurteilen wollte, so beschloß er noch einen anderen Dienst anzunehmen, wozu sich ihm auch bald Gelegenheit bot.
Der Nachbar des Bauern, bei dem der Berggeist eben so böse Erfahrungen gemacht hatte, suchte um diese Zeit gerade einen Hirten für seine Scharfherde. Flugs bot sich der Berggeist für diesen Dienst an, und da er als fleißig und ehrlich bekannt war, wurde er auch sogleich angenommen. Wieder versah der Berggeist als Hirt sein Amt mit Umsicht und Treue, und es war, als ob auch in dem neuen Dienst ein Segen auf allem ruhte, was er unternahm. Die Herde, die ihm anvertraut war, gedieh unter seinen Händen. Er wußte die besten Stellen im Gebirge aufzufinden, die die saftigsten Kräuter boten, so daß die Schafe nicht nur gediehen, sondern auch die beste und feinste Wolle versprachen. Seitdem der Berggeist die Schafe hütete, stürzte keines mehr im Gebirge ab, auch wurde kein Schaf von einem Wolfe zerrissen, was vordem nur zu oft vorgekommen war.
Da glaubte denn der Knecht, sein Herr würde sich dankbar zeigen für die treuen Dienste, die er ihm leistete. Doch das war weit gefehlt. Der Bauer war wohl mit seinem neuen Hirten sehr zufrieden, aber er ließ sich das nicht merken, weil er gern am Lohn feilschen wollte. Er war nämlich ein Geizhals, einer von den Menschen, die nie genug haben, sondern nur immer darauf bedacht sind, einen Gulden zum anderen zu fügen, um sich an dem angesammelten Reichtum zu erfreuen. Deshalb sann er nur darauf, wie er den treuen Hirten um seinen Lohn betrügen konnte. Da er keinen Grund dafür fand, so stahl er eines Tages den besten Widder aus der Schafherde und zog den Wert desselben dem Hirten von seinem kümmerlichen Lohn ab.
Da war der Berggeist sehr zornig, denn er hatte nun bereits zum zweiten Male eine gar böse Erfahrung mit den Menschen gemacht, so daß er begann, die Menschen insgesamt für schlecht und treulos zu halten. Doch er mochte nicht zu schnell urteilen, deshalb sagte er sich:
„Bisher hast du nur die Bauern auf dem Dorfe kennen gelernt, die doch eigentlich ganz ohne Unterweisung in Tugenden aufwachsen, vielleicht sind die Menschen in den Städten besser geartet. Ich werde es einmal mit ihnen versuchen.“
Das Glück war ihm günstig, denn kaum hatte er diesen Vorsatz gefaßt, als er auch hörte, daß der Richter in Hirschberg einen Polizeigehilfen suchte. Flugs meldete er sich für diesen Posten. Da er von großer, kräftiger Gestalt war, so daß man schon glauben konnte, daß er den Dieben, Räubern und Wegelagerern Furcht einflößen würde, nahm ihn der Richter sofort an, setzte ihn in das neue Amt ein, daß der Berggeist nun mit Pflichttreue und Gewissenhaftigkeit versah, so daß das Diebesgesindel bald aus der Gegend verschwand, da ihm die Bekanntschaft mit dem Galgen doch zu bedenklich schien.
Damit war aber dem Richter gar nicht gedient, denn er hatte oft genug mit den Dieben gemeinsame Sache gemacht, die Beute mit ihnen geteilt und sie, wenn sie erwischt wurden, laufen lassen. Dadurch hatte er seinen Sold derart aufgebessert, daß er mit der Zeit ein wohlhabender Mann geworden war. Diese Einnahmequelle wurde ihm aber nun durch den Rechtssinn des neuen Polizeidieners sehr zu seinem Schaden geschmälert, weshalb er demselben wenig Dank wußte.
Das merkte der Berggeist denn auch nur zu bald, er sah, daß der Richter käuflich war und das Recht beugte, wenn er dadurch Vorteil für sich erzeugen konnte, und deshalb gab er dienst als Polizeidiener auf, verließ die Stadt und nahm sich vor, gar nicht mehr mit den Menschen in Berührung zu kommen, die er für schlechte Geschöpfe hielt. Ja, als er auf seinem Wege, hoch vom Gebirge aus, die Blicke über die Welt schweifen ließ, die blühenden Gefilde, Berg und Tal überschaute, die blumigen Wiesen und klarsprudelnden Quellen, da mochte er gar nicht begreifen, daß eine so schöne Welt einem so verderbten, treulosen Geschlecht wie den Menschen zu eigen gegeben worden war, mit denen er noch eben so böse Erfahrungen gemacht hatte. Uebellaunig ob dieser bösen Erfahrungen, wollte er sich in sein unterirdisches Reich zurückziehen, um dasselbe nie wieder zu verlassen, als ihn plötzlich ein ganz sonderbares Abenteuer aufhielt und in seinem Entschluß wankend machte.
Drittes Kapitel.
Wie der Berggeist die reizende Tochter des Herzogs von Schlesien erblickt, in Liebe zu der wunderholden Prinzessin entbrennt und sie in sein unterirdisches Reich entführt.
Als der Berggeist eben von Menschenhaß erfüllt, in sein Reich zurückkehren wollte, stand er plötzlich wie geblendet vor einem Bild, wie er es ähnlich noch nie erschaut hatte, und das ganz dazu geschaffen war, ihn wieder mit der Oberwelt auszusöhnen; denn der Anblick, der sich ihm bot, war so entzückend, so berauschen, daß er sich nicht davon zu trennen vermochte, und ein süß-sehnendes Gefühl in seinen Herzen einzog, wie er es bis dahin nie gekannt hatte, so daß er immer und immer wieder das bezaubernde Bild betrachten mußte.
Um diese Zeit regierte in Schlesien ein stolzer Herzog, dem ein großer Teil des Landes Untertan war. Der Herzog hatte ein mächtiges Heer, besaß viele Städte und Schlösser, wie auch unermeßliche Schätze; der herrlichste Schatz aber war ihm in seinem einzigen Kinde, der lieblichen Prinzessin Emma beschieden, die von so seltener, bezaubernder Schönheit war, daß es fast schien, als wäre sie ein Engel, direkt vom Himmel herniedergestiegen, um die Menschen durch ihren Anblick zu entzücken.
Wie alltäglich nahm die liebreizende Prinzessin in einem silberklaren Bach ein Bad, während ihre Gespielinnen sich in heiteren, unschuldsvollen Scherzen in der Nähe des Baches fröhlich tummelten, um die holde Gebieterin zu erheitern. Wie nun der Berggeist die liebliche Prinzessin erblickte, da war es ihm, als ob er sich nie wieder von ihr trennen könne. Und dennoch mußte er sich mit Schmerz gestehen, daß die liebreizende Jungfrau nie sein werden könne, da ihm ja jede menschliche Eigenschaft abging.
Weil er aber fürchtete, dass die wunderholde Prinzessin könnte durch seinen Anblick aus dem Bache verscheucht und er so um den bezaubernden Anblick gebracht werden, verwandelte er sich in einen Raben, flog auf einen Baum und gedachte nun unbemerkt das liebliche Mädchen zu beobachten. Aber er hatte eines nicht bedacht. Mit der Verwandlung hatte er nicht nur seine äußere Gestalt verändert, sondern auch die natürlichen Eigenschaften eines Raben angenommen, wie die diesem Vogel angeborenen Triebe. So empfand er denn auch wie ein Rabe, und eine Waldmaus hatte für ihn mehr Reiz als die liebreizende Prinzessin.
Kaum hatte er diese Entdeckung gemacht, als er auch einen Ausweg aus der Verlegenheit fand, indem er die menschliche Gestalt annahm und sich in einen selten schönen Jüngling verwandelte, der sicher das Wohlgefallen der lieblichen Prinzessin erregen würde.
Kaum hatte der Berggeist diese Verwandlung vorgenommen, als auch in seinem inneren Wesen eine menschliche Umwandlung sich vollzog, er fühlte plötzlich wie ein Jüngling und fand sich von dem Liebreiz der holden Prinzessin derart angezogen, daß er nur einzig daran dachte, wie er die liebliche Maid in seinen Besitz bekommen könne, um sie nie mehr von sich zu lassen. Unwiderstehlich zog es ihn zu dem Bach, in welchem die Prinzessin ihre elfenartige Gestalt in anmutsvollen Windungen untertauchen ließ, während die silberhellen Wellen die zierliche Jungfrau umspielten. Gern wäre er aus seinem Versteck gesprungen, um die Prinzessin zu überraschen und die Wehrlose mit hinunter zu nehmen in sein Reich. Doch die Scheu davor, durch solches Gebaren die Gunst des lieblichen Wesens zu verlieren, noch bevor er sie gewonnen hatte, hielt ihn davon ab.
So beschloß er denn, sich in Geduld zu fassen und sich vorläufig mit dem Anblick der wunderschönen Prinzessin zu begnügen, bis es ihm gelingen würde, sie in seine Netze zu ziehen. Aus diesem Grunde fand er sich täglich in der Nähe des Waldbaches ein, in dem die Prinzessin zu baden pflegte. Doch viele Tage mußte er vergeblich in seinem Versteck lauern, ohne das liebliche Mädchen zu erblicken.
Während Prinzessin Emma sonst täglich in dem klaren Waldbach ein Bad zu nehmen pflegte, hatte sie, einer Mädchenlaune folgend, durch mehrere Tage auf diese Erfrischung verzichtet, und so war es erklärlich, daß der Berggeist nach dem Anblick des liebreizenden Herzogskindes sich sehnend, fast irdischen Schmerz empfand.
Endlich an einem schwülen Tage eilte Emma in Begleitung ihrer Gespielinnen wieder zu dem Waldbach, um im Bade Kühlung zu suchen. Wie erstaunte sie aber, als sie die Verwandlung wahrnahm, die seit ihrem letzten Besuch mit dem Waldbach und seiner nächsten Umgebung vorgegangen war. Alles hatte wie durch einen Zauber eine andere Gestalt angenommen. Die Felsen, inmitten deren sich der Waldbach befand, waren mit dem kostbarsten Marmor und Alabaster verkleidet, die Wasser, welche sonst mit tobendem Geräusch sich in den Waldbach ergossen, rauschten nun mit sanftem Murmeln dem kostbaren Marmorbassin zu, und in der Mitte des Waldbaches stieg eine Fontäne auf, deren feine duftspendende Strahlen in allen Farben des Regenbogens spielten und so ein reizvolles, immer wechselndes Bild zeigten.
Dazu bot die Umgebung des Waldbaches so ein wunderbar duftiges Bild, daß der Beschauer davon schier berauscht wurde. Auf den noch vor wenigen Tagen fast kahlen Abhängen wuchsen Rosenhecken, welche die Gegend umher mit süßem, berauschenden Duft erfüllten: Veilchen, Nelken, Jasmin schienen darin zu wetteifern, die Umgebung des Baches mit Wohlgeruch zu durchdringen, während ganze Beete von Vergißmeinnicht dem trunkenen Auge einen lieblichen Halt boten.
Zu beiden Seiten des Waldbachs sah man in prächtige Grotten, welche von Bergkristall gebildet, einen wunderbaren Anblick boten, farbenprächtig, funkelnd und schimmernd, wie die Prinzessin und ihre Gespielinnen es bisher nie ähnlich gesehen hatten; dazu war auch für leibliche Erfrischungen gesorgt, denn in den Nischen, welche sich in den Grotten befanden, standen auf zierlichen Tischchen von Kristall die leckersten und seltensten Erfrischungen bereit und luden zum Genusse ein.
Wie von einem Zauber gebannt, stand die liebliche Prinzessin beim Anblick dieser Pracht, die fast überwältigend wirkte. Sie wußte nicht ob sie wache, oder ob nicht ein neckischer Traum ihr all die tausend wunderbaren Dinge vorspielte, die sie zum ersten Male an einer Stelle erblickte, die sie doch noch vor wenigen Tagen aufgesucht hatte, ohne irgendeine Veränderung wahrzunehmen. Auch ihre Gespielinnen waren über das wunder, das sich hier vollzogen hatte, fast sprachlos vor Erstaunen. Die Prinzessin aber zögerte lange, bevor sie sich dazu entschließen konnte, in das prachtvolle Marmorbassin hinabzusteigen; beim Anblick all der Wunderdinge mußte sie unwillkürlich an einen Zauber denken, der seinen Spuk mit ihr trieb.
Doch jung und unschuldig, wie sie war, reinen Herzens und frei von sündiger Schuld, hatte sie bald jede Furcht besiegt. Nicht wenig trug auch dazu die Neugier bei. Sie wollte alles das, was sie hier fand, genau betrachten, sich an dem reichen Duft der herrlichen Blumen erquicken, wohl auch von den seltenen, zum Genuß einladenden Früchten kosten, die in den Nischen auf den Kristalltischchen verlockend grüßten.
Auch ihre Gespielinnen waren dieser Ansicht, und so erlaubte sich denn die kleine anmutsvolle Gesellschaft mit Behagen an den Genüssen, welche ihr hier so unerwartet geboten wurden. Nun aber gelüstete es die Prinzessin, wie sonst im Waldbach, in dem kostbaren Marmorbassin zu baden. Deshalb gebot sie einigen Dienerinnen, darüber zu wachen, daß sie nicht überrascht werde; dann entkleidete sie sich ihrer Gewänder und betrat das Bassin, dessen klares Wasser so einladend wirkte.
Doch, o schrecken! Kaum hatte die liebliche Prinzessin die Mitte des Bassins erreicht, als der saubere Kies unter ihren Füßen zu wanken begann und sie mit Blitzesschnelle tiefer und tiefer in den Boden sank, so schnell, daß ihre Dienerinnen, die zu Tode erschreckt herbeieilten, sie nicht mehr retten konnten; denn ehe sie ihre anmutsvolle Gebieterin erreicht hatten, war diese bereits ihren Blicken entschwunden, völlig in den Boden des trügerischen Bassins versunken.
Nur eine ihrer Gespielinnen, Brinhild, wollte der Prinzessin nacheilen, um sie zu retten oder ihr Geschick zu teilen. Beherzt stürzte sie sich in die Flut; doch sonderbar, dasselbe Wasser, welches der Prinzessin den Untergang gebracht, hatte für Brinhild keinerlei Gefahr, und zu Tode betrübt, daß sie das Schicksal ihrer lieblichen Herrin nicht teilen durfte, verließ sie das Bassin ohne daß ihr irgend etwas Böses widerfahren war.
Vergebens warteten die entsetzten Dienerinnen durch Stunden darauf, daß ihre Gebieterin, wie sie durch Zauber verschwunden war, auch wieder auf der Oberfläche des Wassers erscheinen würde, doch als alles Warten vergeblich war, und sie sich endlich schweren Herzens in den Gedanken fügen mußten, daß die liebliche Prinzessin in dem trügerischen Wasser den Tod gefunden habe, da gingen sie, um dem Herzog, ihren Vater, das traurige Ereignis zu melden.
Der Herzog war über den Verlust seiner lieblichen Tochter in tiefer Betrübnis, er weinte und jammerte laut; doch all sein Schmerz konnte ihn das holde Kind nicht wieder zurückbringen. Doch er wollte sich wenigstens davon überzeugen, wo und auf welche Art sein armes Kind den Tod gefunden hatte, deshalb begab er sich selbst zu dem Waldbach, um das beschriebene Wunder mit eigenen Augen zu sehen.
Wie erstaunte der Herzog aber, als er an den Waldbach kam und keine Spur von den Wunderdingen wahrnahm, von der Pracht, welche die Dienerinnen ihm in so berückender Weise beschrieben hatten. Weder ein Marmorbassin, noch eine Grotte, weder Rosengehege, noch Jasminlauben waren zu entdecken. Dennoch mochte der Herzog nicht daran glauben, daß die Dienerinnen ihn belogen hätten, denn der Schmerz, den sie um den Verlust der geliebten Herrin zur Schau trugen, war zu ungekünstelt, zu aufrichtig.
So mußte sich denn der Herzog in den Gedanken finden, daß Thor oder Wotan oder sonst einer der Götter bei dieser wunderbaren Begebenheit die Hand im Spiel gehabt habe. Freilich konnte ihn eine solche Ueberzeugung nicht über den Verlust seines lieblichen Kindes trösten, doch suchte er beim Spiel und auf der Jagd, wie durch mancherlei andere Zerstreuungen Trost für seinen Schmerz.
Viertes Kapitel.
Wie Prinzessin Emma sich in dem unterirdischen Schlosse das Berggeistes wohl befindet, wie dessen Liebe zu der schönen Prinzessin mit jedem Tage wäschst, wie diese aber plötzlich eine verzehrende Sehnsucht danach verspürt, ihren Verlobten, den Fürsten Ratibor, wiederzusehen und deshalb darüber sinnt, ein Mittel zu finden, um wieder mit ihm vereinigt zu werden.
Als sich die Prinzessin von dem Schreck über ihren Sturz in die Tiefe – der eigentlich kein Sturz, sondern ein sanftes Hinabgleiten war – erholt hat, fand sie sich auf einem Sofa von weichen, kostbaren, mit Goldbrokat durchwirkten Stoffen, in einem rotseidenen Gewand, mit einem Gürtel aus himmelblauer Farbe.
Vor ihr auf den Knien aber lag ein selten schöner, vornehmer Jüngling, der ihr in berückenden Worten von seiner Liebe sprach und sie um ihre Gegenliebe anflehte. Darauf berichtete er ihr von seinem Stand, von seiner Herkunft und von den unterirdischen Staaten, die er beherrschte, wie auch von den großen Reichtümern, die er besaß. Damit sie sich von der Wahrheit seiner Worte überzeugen sollte, führte er sie durch alle Zimmer des Schlosses, in dem sie sich befanden, und von denen eines immer mit größerer Pracht ausgestattet war als das andere.
An dem Schloß befand sich ein Lustgarten, von einer Pracht, wie sie kein Gärtner auf Erden hätte erfinden, geschweige denn hervorzaubern können. In den Obstbäumen wiegten sich herrliche, mit Gold gesprenkelte Früchte und vieltausendstimmig erscholl der Chor jubilierender Vögel, deren Gefieder in der seltensten Farbenpracht schimmerte. Glücklich wandelte das Paar in den lauschigen Gängen des Lustparkes, beschienen von dem traulichen Licht des Mondes, der sich durch die dichtbelaubten Grotten stahl.
Der Berggeist lauschte mit Entzücken den Worten des liebreizenden Mädchens, die ihm wie Musik erklangen und sein Herz mit einer Seligkeit schwellten, wie er sie bis dahin nie empfunden hatte, jener Wonne, die eben nur den Sterblichen beschieden ist, als ein Abglanz der himmlischen Freuden, die ihrer einst in einem besseren Jenseits harren.
Während aber der Berggeist an ihren Lippen hing und jedes ihrer Worte begierig einsog, wurde die Prinzessin bald trübe gestimmt; es war, als ob sie die Pracht um sich her vollkommen unbeachtet ließ, keinen Sinn habe für die duftenden Blumen, die rauschenden Fontänen, den Sang der Vögel, bestimmt, das Herz jedes Menschen zu erfreuen. Es war, als ob sie in einer anderen, fremden Welt lebte, in der sie mit ihren Gedanken hing, während sie an der Seite des Berggeistes dahinschritt.
Diese trübe Stimmung konnte dem Berggeist nicht verborgen bleiben und er sann über den Grund derselben nach. Bald hatte er diesen Grund gefunden, der darin bestand, daß die Prinzessin von allem, was sie bisher umgeben hatte, von allen an denen ihr Herz in Liebe hing, getrennt war.
Kaum aber hatte er die Ursache ihres Trübsinns entdeckt, als er ein Mittel fand, dem Uebel abzuhelfen. Er ging hinaus ins Feld, zog aus dem Acker ein Dutzend Rüben, legte dieselben in einen zierlichen Korb und brachte sie der Prinzessin.
„Holde Prinzessin,“ sprach er, „schon seit lange habe ich Deine Schwermut entdeckt und über den Grund derselben nachgedacht. Da fand ich denn, daß meine Liebe Dich nicht entschädigen kann für die Gespielinnen, an deren Umgang Du gewöhnt bist, für die Freuden der Geselligkeit, die Du hier entbehren mußt, und für welche alle Pracht, die Dich hier umgibt, keinen Ersatz bietet.
Doch werde wieder heiteren Sinns, denn Du sollst alles wiederfinden, was Du auf der Oberwelt zurückgelassen hast.“
Bei diesen Worten übergab er der Prinzessin den zierlichen Korb mit den Rüben und zugleich einen ebenso zierlichen Stab aus Elfenbein.
„Schönstes, engelhaftes Mädchen!“ sprach er dabei. „In diesem Korbe befinden sich zwölf Rüben und diese werden Dich für alles, was Du verloren hast, entschädigen, Dir geben, wonach Dein Herz sich sehnt. Sobald Du eine der Rüben mit dem Stabe berührst, wird sie Leben erhalten und sich in diejenige Person verwandeln, die Du zu sehen begehrst. Auf diese Art wirst Du nicht mehr den Schmerz der Einsamkeit empfinden.“
Nachdem er so geredet hatte, verließ er den Garten, und Emma befand sich allein.
Nun drängte es sie, zu erproben, ob auch der Zauberstab wirklich seine Wirkung tun würde. Sie berührte deshalb eine Rübe mit demselben und gedachte dabei ihrer liebsten und treuesten Freundin Brinhild.
„Brinhild, erscheine!“ rief sie deshalb, und Wunder! Im nächsten Augenblick stand Brinhild vor ihr, umhalste sie und erdrückte sie fast mit ihren Küssen.
Das war eine Freude des Wiedersehens, so groß, so unbeschreiblich, daß die Prinzessin darüber tatsächlich vergaß, daß sie es in der wiedergefundenen Freundin nur mit einem Phantom zu tun hatte und daß doch eigentlich ein Trugbild vor ihr stand. Sie gab sich voll dem Genuß der Freundschaft hin, indem sie Brunhild alles erzählte, was sie seit der Stunde, in der sie auf so sonderbare Weise plötzlich verschwunden war, erlebt hatte.
Da gab es nun vielerlei zu erzählen, so daß Emma kein Ende fand, da sich immer wieder andere Neuigkeiten ihr aufdrängten, die sie der Freundin mitteilen mußte. Und Brinhild folgte den Erzählungen der Prinzessin mit der größten Aufmerksamkeit und Hingebung, genau so, wie sie es früher getan hatte. Wie jauchzte sie vor Entzücken, als Emma sie in den wundervollen Palast umherführte, und ihr all die tausend Herrlichkeiten zeigte, von deren Existenz Brinhild bis dahin keine Ahnung gehabt hatte. Als aber die Prinzessin die Freundin in ihre eigenen Gemächer führte, da wollten die Ausrufe des Staunens und Entzückens bei Brinhild kein Ende nehmen.
Aber das war auch begreiflich, denn so kostbare Gewänder, so seltenen Schmuck hatte Brinhild noch nie gesehen, und sie klatschte vor Freuden in die Hände und konnte sich gar nicht genug daran tun, immer aufs neue das Glück der Prinzessin zu loben. So geschah es, daß Emma unter den beglückenden Einfluß so treuer, lang entbehrter Freundschaft ihre frühere muntere Laune wiederbekam und sich wirklich glücklich fühlte. Nun wollte sie aber auch das Glück ganz genießen, deshalb berührte sie noch neun der Rüben mit dem Zauberstabe, verlieh ihnen Leben und hatte nun ihre zehn Gespielinnen beisammen, so daß sie sich nicht mehr einsam fühlen konnte.
Zwei Rüben waren aber übrig geblieben, doch als sie darüber sann, was sie mit denselben beginnen sollte, kam sie auch bald auf die richtige Idee. Sie verwandelte die eine in eine zierliche Cyperkatze, welche sie früher besessen hatte, die andere in einen kleinen, drolligen Schoßhund, an dem ihr Herz in der Erinnerung hing. Nachdem nun alle ihre Dienerinnen und Gespielinnen beisammen waren, richtete Emma ihren Haushalt wieder wie vordem ein, jede erhielt ihre dienstlichen Verrichtungen vorgeschrieben, und es herrschte Friede, Freude und Eintracht unter den Glücklichen, die sich wiedergefunden hatten.





























