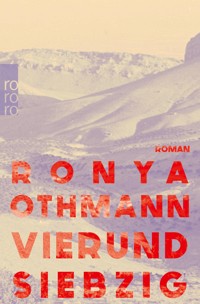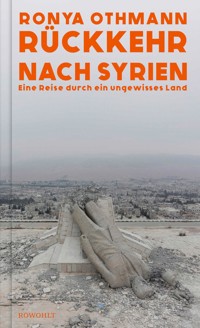
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine erhellende Reisereportage, die teilnehmende Beobachtung eines historischen Umbruchsmoments. «Assad ist weg. Das Regime ist gefallen. Das Regime, vor dem mein Vater – ein staatenloser jesidischer Kurde – 1980 aus Syrien floh. Ich kenne das Land von Besuchen bei meinen Großeltern in meiner Kindheit. Ein Land, in dem an jeder Ecke das Porträt des Diktators und seines Vaters hing, ein Land, über das eine Familie herrschte wie ein Mafia-Clan. 54 Jahre lang.» Wenige Wochen nach dem Sturz Assads ist Ronya Othmann mit ihrem Vater nach Syrien gereist: auf den Spuren der jüngsten Ereignisse, durch ein Land, das sich selbst fremd geworden zu sein scheint. Und überall hat sie mit Menschen, gleich, welcher Zugehörigkeit, gesprochen – Menschen, die zwischen Angst und Hoffnung wieder an eine Zukunft glauben wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ronya Othmann
Rückkehr nach Syrien
Eine Reise durch ein ungewisses Land
Essay
Über dieses Buch
«Das könnte das neue Syrien sein.» Eine erhellende Reisereportage, die persönliche Erkundung eines historischen Umbruchmoments.
«Assad ist weg. Das Regime ist gefallen. Das Regime, vor dem mein Vater – ein staatenloser jesidischer Kurde – 1980 aus Syrien floh. Ich kenne das Land von Besuchen bei meinen Großeltern in meiner Kindheit. Ein Land, in dem an jeder Ecke das Porträt des Diktators und seines Vaters hing, ein Land, über das eine Familie herrschte wie ein Mafia-Clan. 54 Jahre lang.»
Wenige Wochen nach dem Sturz Assads ist Ronya Othmann mit ihrem Vater nach Syrien gereist: auf den Spuren der jüngsten Ereignisse, durch ein Land, das sich selbst fremd geworden zu sein scheint. Und überall hat sie mit Menschen, gleich welcher Zugehörigkeit, gesprochen – Menschen, die zwischen Angst und Hoffnung wieder an eine Zukunft glauben wollen.
Vita
Ronya Othmann, als Tochter einer deutschen Mutter und eines kurdisch-êzîdischen Vaters 1993 in München geboren, schreibt Lyrik, Prosa und Essays und arbeitet als Journalistin. Für ihr Schreiben wurde sie viele Male ausgezeichnet, u. a. mit dem Lyrik-Preis des Open Mike, dem MDR-Literaturpreis und dem Caroline-Schlegel-Förderpreis für Essayistik. Für Die Sommer, ihren ersten Roman, bekam sie 2020 den Mara-Cassens-Preis zugesprochen, für den Lyrikband die verbrechen (2021) den Orphil-Debütpreis, den Förderpreis des Horst-Bienek-Preises und den Horst Bingel-Preis 2022. Vierundsiebzig, ihr zweiter Roman, wurde für den Deutschen Buchpreis nominiert und mit dem Düsseldorfer Literaturpreis, dem Preis der SWR-Bestenliste 2024 sowie dem Erich-Loest-Preis 2025 ausgezeichnet.
Impressum
Auszüge dieses Texts erschienen vorab in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
Anmerkung zur Transkription fremdsprachiger Namen und Begriffe: Nach Möglichkeit wurde die in deutschsprachigen Medien geläufige Schreibweise verwendet, in einzelnen Fällen aber die vorgezogen, die am häufigsten zu finden ist.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Cover- und Innenabbildung Johanna-Maria Fritz
ISBN 978-3-644-02003-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Im Dezember 2024 werden in Syrien Schlösser aufgebrochen, Türen aufgestemmt. Die Gefängnistore sind geöffnet, die Gefangenen treten ans Licht.
Überall dort, wo sich Assads Armee zurückgezogen hat, strömen die Gefangenen aus den Zellen. Diejenigen, die nicht ermordet wurden, die Folter, Hunger und Krankheiten überlebt haben, Menschen mit fahlen, ausgezehrten Gesichtern. Manche haben seit Jahren kein Tageslicht gesehen, können kaum gehen; manche haben ihren Namen vergessen, wissen nicht mehr, woher sie kommen, und noch weniger: wohin.
Seit einigen Tagen bin ich wieder am Handy. Ich wache auf, ich esse, arbeite unkonzentriert, ich lese die Nachrichten.
Ich rufe meinen Vater an. Mein Vater steht morgens auf, liest die Nachrichten, geht arbeiten, sitzt vor dem Fernseher.
Assad ist weg.
Ich sage: Hast du das gesehen, das Bild von dem Mann – ein libanesischer Christ –, der vor vierzig Jahren aus dem Libanon nach Syrien verschleppt wurde? Hast du das gesehen, das Bild von dem syrischen Piloten, der sich 1982 geweigert hatte, Hama zu bombardieren? Jetzt ist er wiederaufgetaucht. Niemand wusste, dass er noch lebt.
Andere leben nicht mehr. Schätzungsweise 150000 Menschen wurden allein seit 2011 in Assads Syrien festgenommen und verschwanden.[1] Nun, nachdem das Regime gefallen ist, eilen die Menschen in die Gefängnisse, um nach ihren Angehörigen zu suchen oder zumindest etwas über deren Verbleib zu erfahren.
Auf dem Weg zum Saidnaya-Gefängnis bei Damaskus bildet sich Stau. Die Menschen stehen in den Büros der Gefängniswärter, durchsuchen Akten. Das Assad-Regime war bekannt für seine akribische Bürokratie. Alles wurde festgehalten, vermerkt, dokumentiert, auch um sich gegenüber Vorgesetzten abzusichern. So sind auch «Caesars» Fotos im Auftrag des Regimes entstanden – Fotos von Leichen, ausgemergelt, mit Spuren schwerster Folter, Schusswunden –, bevor sie, heimlich auf einen USB-Stick kopiert, nach draußen geschmuggelt wurden.
Man wird diese und ähnliche Dokumente nun tonnenweise finden. Wie viele Regalmeter sind 54 Jahre Assad-Diktatur? Und wer wird sie nun sichern? All die Beweise für Verbrechen, Kollaboration, Bespitzelung. Beweise, die in Prozessen unverzichtbar sein werden. Wenn es sie denn überhaupt geben wird, denke ich, die Gerichtsverfahren, die Rechtsstaatlichkeit.
Aber die Frage stellt sich noch nicht. In Saidnaya graben sie noch nach geheimen unterirdischen Zellen. Sie bohren, brechen Wände auf. Sie untersuchen Eingänge, Ausgänge, Lüftungsschächte, Abwassersysteme, elektrische Leitungen, Kabel von Überwachungskameras. Auch zwei Spürhunde sind an der Suche beteiligt. Irgendwann wird gemeldet, solche Zellen gebe es nicht. Alle Gefangenen seien befreit.
Ich telefoniere mit meinem Vater. Mein Vater sagt, hast du das Video gesehen, wie sie den Frauentrakt öffnen?
Das Kind, ja, das habe ich gesehen, höchstens drei Jahre alt.
Unzählige Frauen sind in den Gefängnissen vergewaltigt worden. Sie haben Kinder geboren, Kinder, die noch nie einen Baum gesehen haben, einen Vogel oder eine Katze. Wir wussten davon, die Welt wusste davon. Seit Jahrzehnten war bekannt, was sich in den syrischen Gefängnissen abspielte. Menschenrechtsorganisationen hatten darüber berichtet, Überlebende Zeugnis abgelegt. Der Schriftsteller Mustafa Khalifa hatte in seinem Roman Das Schneckenhaus davon erzählt.
Trotzdem wurde Assad Anfang der Nullerjahre auch im Westen hofiert. Und trotzdem, selbst nach Jahren des Krieges, nach Bombardierungen, Aushungern der Städte, nach Giftgasangriffen, ließ sich im Westen wieder eine – wenn auch vorsichtige – Annäherung an das Regime beobachten. Erst im Sommer 2024 hatte Italien seine Botschaft in Damaskus wiedereröffnet. Und im selben Sommer kündigte Bundesinnenministerin Nancy Faeser Abschiebungen nach Syrien an. Die Arabische Liga hatte Assad schon 2023 wieder aufgenommen, nachdem sie ihn dreizehn Jahre zuvor wegen seines brutalen Vorgehens gegen die protestierende Bevölkerung ausgeschlossen hatten.
Man schien sich mit Assad arrangieren zu wollen, sei es, um Flüchtlinge loszuwerden oder das Captagon-Problem in den Griff zu bekommen. Syrien hatte sich zu einem Narco-Staat entwickelt. Um die leeren Staatskassen zu füllen, war das Regime ins Drogengeschäft eingestiegen. Syrisches Captagon flutete die gesamte Region.
Und nun ist dieses Regime gefallen. Das Regime, vor dem mein Vater – ein staatenloser jesidischer Kurde – 1980 aus Syrien floh.
Mein Vater war Kommunist. Als er als Schüler einmal einer Parade für den Diktator fernblieb, wurde er vom Unterricht ausgeschlossen. Als er studieren wollte, bekam er keine Zulassung. Stattdessen setzte ihn der Geheimdienst unter Druck.
Einmal gab es eine Hausdurchsuchung. Meine Familie hatte verbotenerweise Weinstöcke gepflanzt. Bei dieser Hausdurchsuchung waren kurdische Bücher gefunden worden. Außerdem eine Liste, mit den Namen derer, die Geld gespendet hatten für die Demokratische Partei Kurdistan. Die Liste hatte mein Onkel angefertigt, der dort für die Finanzen zuständig war.
Mein Großvater und mein Onkel wurden festgenommen. Meine Familie verpachtete ihre Felder und verdingte sich bei der Baumwollernte, um sie aus dem Gefängnis freizukaufen.
Es war nicht das erste Mal, dass sie festgenommen wurden. Ein paar Jahre zuvor hatte sich das ganze Dorf zur Wehr gesetzt, weil man ihnen im Rahmen des Projekts «Arabischer Gürtel» das Land wegnehmen und sie in die Wüste umsiedeln wollte. Sicherheitskräfte waren im Dorf eingefallen, hatten die Dorfbewohner verprügelt und die Männer und Jugendlichen verhaftet.
Ich selbst kenne das Land von Besuchen bei meinen Großeltern in den Sommerferien. Ein Land, in dem an jeder Ecke das Porträt des Diktators und seines Vaters hing: in jedem Klassenzimmer, jeder Beamtenstube, an den Rückspiegeln in den Taxis. Ein Land, über das die Diktatoren-Familie herrschte wie ein Mafia-Clan.
2011 war ein Jahr der Hoffnung. Überall im Land gingen die Menschen auf die Straße. Sie riefen «Freiheit», «Syrien ist eins» und «Das Volk will den Sturz des Regimes».
Wir beobachteten die Ereignisse vor dem Fernseher, in den sozialen Medien, in Kontakt mit unseren Verwandten. Ich erinnere mich an Fotos, die mein Onkel uns von den Demonstrationen schickte.
Nur: Das Regime stürzte nicht. Es schlug die Proteste nieder mit brutalster Gewalt. Assad verkündete eine Amnestie für politische Gefangene, ließ allerdings nur Islamisten aus den Gefängnissen frei. Mithilfe des russischen Militärs wurden Städte bombardiert. Unterstützung am Boden kam vonseiten der Hisbollah und Iran. Dschihadistische Gruppen breiteten sich aus. Sie gingen gegen die säkulare Opposition vor und auch gegen das Regime.
Als religiöse Minderheit war meine Familie in Gefahr. 2014 flohen meine Großmutter, mein Onkel, seine Frau und ihre Kinder nach Deutschland. Der Großteil meiner Verwandten versuchte, Syrien zu verlassen, nachdem der sogenannte Islamische Staat Teile des Landes wie auch des Irak besetzt hatte.
Am 3. August 2014 fiel der IS im nordirakischen Shingal[2] ein und verübte an der jesidischen Bevölkerung einen Genozid, der allen Hoffnungen ein Ende setzte.
2019 wurde das IS-Kalifat zerschlagen, allen voran von den mit den USA verbündeten Kurden, die in Nordostsyrien eine Selbstverwaltung etablieren konnten. Die IS-Familien hat man in den Gefangenenlagern Roj und Al-Hol untergebracht, besonders gefährliche IS-Anhänger sind in den Hochsicherheitstrakten der Gefängnisse inhaftiert. Doch es blieb fragil. Seit Jahren steht die Region unter Beschuss. Mehrmals marschierte die türkische Armee ein, vertrieb Kurden und Jesiden, herrschte dort brutal, mithilfe islamistischer Söldner. Die Region Idlib wurde von der dschihadistischen HTS[3]-Miliz kontrolliert. Den Rest des Landes kontrollierte das Assad-Regime, eine Herrschaft, die oft als «Friedhofsruhe» bezeichnet wurde.
Es ist ein unmögliches Unterfangen, denke ich, dreizehn Jahre Krieg in ein paar Sätzen zu fassen. Etwas nachzuzeichnen, das man nur aus der Ferne beobachtet hat.
Im Sommer 2023 waren die Bewohner von Suwaida im Süden Syriens – mehrheitlich Drusen – auf die Straße gegangen. Ihr Protest war säkular und richtete sich gegen das Regime. Mein Vater schickte mir Videos. Die Protestierenden wirkten entschlossen. Sie sagten: «Es gibt kein Zurück mehr. Wir haben unsere Entscheidung getroffen. Es kann nur Freiheit geben und sonst nichts.»
Ich wagte dennoch nicht zu hoffen.
Und dann, im Dezember 2024, fällt das Regime. Nicht nur durch die Hand der Islamisten, aber auch. Die neuen Machthaber tragen Bärte. Al-Dscholani hält seine Siegesrede nicht auf einem öffentlichen Platz, im Parlament oder Park, sondern in einer Moschee. Und er ruft damit Erinnerungen wach an die Rede Al-Baghdadis in der Großen Moschee von Mossul 2014.
Hast du das gesehen, fragt mein Vater.
Ja, habe ich. Al-Dscholani spricht von der «Ummah», der Gemeinschaft der Muslime, vom «Blut der Märtyrer», von den «Brüdern». Und endet mit: «Takbir – Allahu Akbar.»
Ich sage zu meinem Vater: Wenn er von der Ummah spricht, sind wir nicht vorgesehen.
Er habe dieses Land vor zwanzig Jahren verlassen, sagt Al-Dscholani. Sein Herz habe sich nach diesem Moment gesehnt.
Was ist mit den Minderheiten, frage ich. Werden auch sie zurückkehren können oder werden sie fliehen?
Sie fliehen schon jetzt. 200000 Kurden und andere Minderheiten, unter ihnen auch Flüchtlinge aus Afrin, fliehen in die selbstverwalteten Gebiete. Zwei Jesiden, lese ich, wurden von Islamisten erschossen, einer von HTS, der andere von der SNA[4].
Ich sehe ein Video, das Islamisten zeigt, die im Duty-free-Shop im Flughafen Aleppo Wodka-, Whisky- und Weinflaschen zerschmettern.
In den deutschen Medien lese ich von «Rebellen», auch auf deutschen Straßen wird gejubelt.
Mein Vater und ich gehen nicht auf die Straßen, wir jubeln nicht, obwohl wir den Sturz des Regimes immer ersehnt haben. Wir haben Angst. SNA-Milizen, türkische Proxys, greifen die kurdischen Gebiete an, auch das türkische Militär bombardiert weiter unablässig. Im türkischen Fernsehen ist ein SNA-Kämpfer zu sehen mit IS-Patch am Arm. Es kursieren Videos von verschleppten SDF[5]-Kämpferinnen auf der Ladefläche eines Pick-ups.
Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, kündigt Gespräche an. US-Außenminister Antony Blinken reist in die Türkei. Wird nun dort über die Zukunft Syriens entschieden, frage ich mich.
Israel bombardiert Militärstützpunkte, Waffenlager, Chemiewaffenbestände, die das Assad-Regime hinterlassen hat. Waffen, die nun nicht den Islamisten in die Hände fallen.
Ich lese Relativierungen seitens deutscher Nahost-Expertinnen, lese, die «Rebellen» gäben sich gemäßigt. Lese, die Islamisten seien besser als Assad. Die Grausamkeit des Assad-Regimes habe gar die des IS übertroffen.
Ich bin fassungslos. Hat man den Genozid an den Jesiden vergessen und all die anderen Verbrechen? Oder sind die Minderheiten zu vernachlässigen? Stören sie gar das Bild?
Dabei haben auch sie sich gegen die Diktatur aufgelehnt, saßen in Assads Folterknästen, wurden ermordet. Jahrelang hat es mich empört, wenn die Assad-Diktatur bagatellisiert, als bessere Alternative zu den Islamisten verharmlost wurde. Ging es nicht um Freiheit, Demokratie und Menschenwürde?
Seit Tagen bin ich am Handy. Ich lese die Nachrichten, die Videos, versuche zu sortieren, verifizieren.
An der Wand eines Krankenhauses in Damaskus: Fotos der nach der Befreiung des Saidnaya-Gefängnisses geborgenen Leichen. Menschen stehen davor und suchen ihre Angehörigen. Menschen suchen auch auf Listen, die auf Facebook geteilt werden.
Der Krieg ist noch nicht zu Ende. Ich lese, das US-Militär habe dutzende Angriffe gegen IS-Stellungen geflogen. Wird Trump seine Truppen abziehen? Und was wird dann passieren? Ich denke an die Kurden, deren Zukunft ungewiss ist, an die Gefangenen, die aus den Gefängnissen strömen, an Flüchtlinge, die nach Hause zurückkehren. Was ist das für ein Land, das sie erwartet? Der Diktator ist weg, aber ist Syrien nun frei?
Am 25. Dezember 2024 machen mein Vater und ich uns auf den Weg nach Syrien. Wir hatten die Nachrichten verfolgt, uns mit Freunden, Verwandten und Bekannten besprochen, wir hatten gezögert und dann doch Flüge gebucht. Wer weiß, wie es in drei Monaten sein wird, hatte mein Vater gesagt. Und ich sagte: Wenn wir jetzt nicht fahren, werden wir vielleicht nie mehr fahren.
Das Land befindet sich im Umbruch. Ich wollte es mit eigenen Augen sehen.
Wir fliegen ins jordanische Amman, nach Syrien gibt es noch immer keine Flüge. Von Amman aus machen wir uns früh am Morgen auf den Weg nach Norden, Richtung Syrien.
An der jordanisch-syrischen Grenze staut sich der Verkehr. Autos, Pick-ups, die einen ganzen Hausrat geladen haben: Matratzen, Kisten, Decken. Syrer, die nach Syrien zurückkehren. Seit Tagen nur Syrer, hatte auch der Grenzbeamte am Flughafen in Amman gesagt.
Auch wir stehen in der Schlange, mein Vater und ich.
Nachdem Assad gestürzt worden war und die HTS die Macht in Damaskus übernommen hatte, hatten die Jordanier den Grenzübergang geschlossen. Jetzt ist er wieder geöffnet.
Plötzlich höre ich meinen Namen. Ich drehe mich um und sehe Sirwan Berko, einen Bekannten vom kurdischen Radiosender Arta FM. Auch er kehrt nun nach Jahrzehnten zum ersten Mal nach Damaskus zurück. Wir verabreden uns für später.
Ob wir Syrer seien, fragen die jordanischen Beamten und geben uns unsere deutschen Pässe zurück. Hier würden nämlich nur Syrer durchgelassen.
Nein, Syrer sind wir nicht. Aber mein Vater, ein staatenloser jesidischer Kurde aus dem Gouvernement Hasaka, hat eine syrische Geburtsurkunde, und die legt er vor.
Nach einigem Hin und Her, von dem einen Schalter zum anderen bis in das Büro des Grenzbeamten – die Staatenlosigkeit vieler Kurden aus Dschasira ist den jordanischen Beamten durchaus ein Begriff –, winkt man uns durch.
Auf der syrischen Seite steigen wir in einen klapprigen Bus und fahren zum Grenzposten.
Vor dem Gebäude stehen Männer mit zotteligem Haar, langen Bärten, ausrasierter Oberlippe. Sie tragen Messer und Kalaschnikows. Manche von ihnen sind vermummt.
Im Gebäude kontrollieren jedoch noch die Beamten des alten Apparats die Pässe – blau uniformierte Männer mit Schnurrbärten und pomadisiertem Haar. Nur das Bild des Diktators ist abgehängt. Es hängt auch nicht mehr am Torbogen über der Straße. Die Betonleitplanken am Straßenrand sind frisch gestrichen: grün, weiß, schwarz, mit den drei roten Sternen auf weißem Grund. Es ist die Flagge des neuen Syriens und des alten, die von 1932 bis 1958 und noch einmal 1961 bis zum Putsch der Baath-Partei 1963 syrische Staatsflagge war.
Wir passieren ein Schild «Syrian Arab Republic Welcomes You».
Ob sie auch diesen Namen ändern werden? Schließlich stammt der Zusatz «arab» von den Baathisten. Wird «arab» nun durch «islamic» ersetzt werden, der arabische Nationalismus durch den Islamismus?
Sowenig die Bevölkerung in Syrien je eine homogen arabische war, denke ich, so wenig ist sie eine islamische.
Wir fahren durch das Gouvernement Daraa, wo die Proteste gegen das Regime 2011 ihren Anfang nahmen. Jugendliche hatten «Du bist dran, Doktor» und «Nieder mit dem Präsidenten» an eine Schulhofmauer gesprayt. Sie wurden verhaftet und gefoltert. Die Menschen gingen auf die Straße. Von Daraa breiteten sich die Proteste über das ganze Land aus. Das Regime antwortete mit brutalster Gewalt.
Wir fahren vorbei an zerstörten Häusern, Mauern mit Einschusslöchern.
2015 zerbombt, sagt unser Fahrer, ein Druse aus Damaskus.
Eine Zeit lang war Daraa selbstverwaltet. Einige Mitglieder der Freien Syrischen Armee[1] waren dann zum IS übergelaufen. 2018 wurde das Gebiet von der syrischen Armee zurückerobert.
Wir folgen der M5 nach Norden. Wir passieren Kleinstädte, Felder und Dörfer. Die Straße, eine der wichtigsten Autobahnen Syriens, ist marode, der Asphalt aufgeraut, brüchig. Wir sehen unpassierbare Brücken, überall direkte oder indirekte Spuren des Krieges.
Wir passieren ein Stromkraftwerk, das der Frau von Assad gehörte, Militärbasen, verlassene Checkpoints, von der syrischen Armee zurückgelassene Panzer.
An einem Supermarkt halten wir, um einen Kaffee zu trinken. Die Regale sind voll. Aber kaum jemand kann sich etwas leisten. Schätzungsweise neunzig Prozent der Syrer leben unterhalb der Armutsgrenze. Ein durchschnittlicher Angestellter im öffentlichen Dienst verdient nur in etwa 24 Euro im Monat. Und das Geld ist nichts mehr wert.
Meine Eltern hatten zu Hause noch syrische Lira von unserem letzten Besuch im Dorf meiner Großeltern, die haben wir mitgenommen. Es war nicht viel Geld, aber jetzt reicht es nicht einmal für eine Flasche Wasser. Hat man für einen Euro im Jahr 2009 noch 65 syrische Lira bekommen, sind es jetzt 14000. Die Menschen bezahlen nicht mehr mit einzelnen Scheinen und Münzen, sondern mit ganzen Packen von Scheinen, die von Gummibändern zusammengehalten werden.
Wenig später erreichen wir Damaskus, die Hauptstadt.
Dort, sagt der Fahrer und zeigt auf ein mehrstöckiges Gebäude, das «Far Falestin». Auch bekannt als Zweigstelle 235, war es eines der zahlreichen Foltergefängnisse der Assad-Geheimdienste. Einige der Toten, die «Caesar» fotografierte, stammten von dort.
Jetzt hängt von der Balkonbrüstung eine riesige grün-weiß-schwarze Flagge. Ein Teil des Gebäudes ist ausgebrannt.
Wir fahren nach Duweila, ein christliches Viertel. Das Hotel, in dem wir übernachten, ist direkt neben der Mar-Elias-Kirche. Ein Christbaum steht in der Lobby des Hotels. Daneben eine beleuchtete Krippe. Es ist der 26. Dezember.
Wir haben gerade unsere Taschen abgelegt, da schreibt Sirwan, in der Lobby des Hotel Sham finde gleich eine Konferenz zur Zukunft der Kurden in Syrien statt.
Wir machen uns also auf den Weg.
Im Hotel Sham treffen wir nicht nur Sirwan wieder, sondern auch Aziz, einen Freund, den ich noch aus dem Studium in Leipzig kenne. Auch er ist nun, da das Regime gestürzt ist, zurückgekehrt. Um die NGO, für die er arbeitet, offiziell in Damaskus anzumelden, aber auch um seine Wohnung zurückzubekommen, die der syrische Geheimdienst beschlagnahmt hatte.
Ebenfalls auf der Konferenz treffen wir Cano, einen Freund meines Vaters seit Kindertagen. Sie sind im selben Dorf aufgewachsen, Cano ist ebenfalls Jeside, aber aus der Sheikh-Kaste, und wie mein Vater hat er Syrien als junger Mann verlassen. Auch er ist nach Jahrzehnten das erste Mal wieder in Damaskus.
Die Konferenz beginnt feierlich. Vor wenigen Wochen wären die hier Versammelten für die Durchführung so einer Veranstaltung noch im Gefängnis gelandet. Der Eröffnungsredner, Khorshid Deli, beginnt mit einer Anekdote: Als junger Mann, erzählt er, kam er von Qamischlo nach Damaskus zum Studieren. Eine Kommilitonin fragte ihn: Khorshid, was ist das für ein Name?
Ein kurdischer Name, entgegnete er.
Die Kommilitonin fragte: Was ist das, kurdisch?
Schätzungsweise zehn Prozent der Menschen in Syrien sind Kurden, nach den Alawiten stellen sie die zweitgrößte Minderheit im Land. Sie leben vor allem im Nordosten, in einem Gebiet, das in Syrien als Dschasira bekannt ist und von vielen Kurden Rojava, der Westen, genannt wird. Auch in Damaskus und Aleppo gibt es kurdische Viertel. Und es gab sie schon, lange bevor es einen syrischen Staat gab.
1962, im Zuge der Volkszählung von Hasaka, wurde bis zu 150000 Kurden in Dschasira die Staatsbürgerschaft entzogen. «Rettet das Arabertum in Dschasira», «Bekämpft die kurdische Bedrohung», hieß es. Vor 2011 stellten die Kurden eine der größten Gruppen in den syrischen Gefängnissen.
Die nunmehr Staatenlosen wurden in zwei Gruppen eingeteilt, in adschanib, Ausländer, und maktumin, die Versteckten, denen man vorwarf, sich illegal in Syrien aufzuhalten. Maktumin erhielten in den meisten Fällen nicht einmal eine Geburtsurkunde. Als Staatenlose durften sie nicht studieren, nicht in staatlichen Unternehmen arbeiten, nicht heiraten, hatten keinen Zugang zu kostenloser medizinischer Versorgung, konnten keine vergünstigten Grundnahrungsmittel erhalten und auch keinen Reisepass beantragen. Auch meine Familie war davon betroffen. Meine Großeltern blieben deswegen bis zu ihrem Tod vor dem Gesetz unverheiratet.
Bei der Entziehung der syrischen Staatsbürgerschaft war man willkürlich vorgegangen. So kam es in kurdischen Familien vor, dass der eine Bruder staatenlos war, während der andere seine Staatsbürgerschaft behalten durfte. Mit den Jahren war die Zahl der Staatenlosen jedoch immer weiter angewachsen, denn die Staatenlosigkeit wurde weitervererbt, vom Vater zu den Kindern, von den Kindern zu den Enkelkindern.
Doch das war beileibe nicht die einzige antikurdische Maßnahme. Die Baath-Partei, die ja der Ideologie des arabischen Nationalismus folgte, kam am 8. März 1963 durch einen Militärputsch an die Macht. Muhammad Talib Hilal, der Chef der Sicherheitskräfte in Hasaka, verfasste schon wenige Monate später einen Bericht, in dem er die «kurdische Frage» als «Tumor» beschrieb, der den Körper der Arabischen Nation befallen habe und sich auf ihm ausbreite. Man müsse die Kurden als Feind betrachten. Es gebe keinen Unterschied zwischen ihnen und Israel. Die Kurden, schrieb er, hätten keine Geschichte, keine Sprache, keinen ethnischen Ursprung, sie seien Bergmenschen, unzivilisiert und anfällig für Gewalt. Er schlug eine Reihe von Maßnahmen vor, unter anderem ihnen Bildung vorzuenthalten, Arbeitsplätze zu verweigern und Araber in ihrer Region anzusiedeln.
1965 wurde das «Projekt Arabischer Gürtel» entwickelt. Auf einem 15 Kilometer breiten Streifen entlang der türkischen Grenze auf einer Länge von 280 Kilometern sollten arabische «Modelldörfer» errichtet werden. Die Kurden, die dort an dem Grenzstreifen lebten, wurden dafür ins Landesinnere zwangsumgesiedelt, mit dem Ziel, die demographische Zusammensetzung der Region zu verändern und die Kurden in Syrien von den Kurden auf der anderen Seite der Grenze zu trennen.
Nicht selten waren die Kurden in Syrien und jene in der Türkei durch verwandtschaftliche Beziehungen miteinander verbunden. So war es auch in meiner Familie, die älteste Schwester meiner Großmutter lebte in einem Dorf auf der anderen Seite der Grenze.
Diese Grenze war ein Produkt des 1916 geschlossenen Sykes-Picot-Abkommens und führte mitten durch mehrheitlich kurdisches Siedlungsgebiet. Anfang der 1970er Jahre begann man mit der Verwirklichung des Projekts. Offiziell hieß es damals schon nicht mehr «Arabischer Gürtel», sondern «Plan zur Errichtung Modellstaatlicher Farmen im Gouvernement Dschasira».
Auch die Familie meines Vaters war davon betroffen, ihr Dorf befand sich nämlich genau dort, auf diesem Streifen an der Grenze. Sie lebten von der Landwirtschaft und vom Tier-, Tabak- und Tee-Handel, den sie quer über die Minenfelder bis in die Türkei trieben. Für das Regime waren sie keine Händler, sondern Schmuggler.
Die Zwangsumsiedlungen und Enteignungen waren eine Bedrohung für ihre Lebensgrundlage. Im Austausch für das fruchtbare Ackerland an der Grenze hatte man ihnen Land in der Wüste versprochen. Also beschlossen die Menschen im Dorf, sich zur Wehr zu setzen. Was blieb ihnen anderes übrig? Mit Traktoren errichteten sie eine Blockade. Als Regierungsbeamte aus der Stadt kamen, ließen sie sie nicht passieren. Ein paar Tage später fiel das Militär im Dorf ein. Sie nahmen die Männer mit. Auch mein Onkel und mein Großvater wurden damals verhaftet. Sie kamen einige Wochen später auf Kaution wieder frei. Syrien befand sich gerade im Sechstagekrieg mit Israel. Offenbar wollte man weitere Aufstände im Land vermeiden.
2004 kam es dann doch zu einem größeren Aufstand. Ich kann mich noch gut daran erinnern, weil es das erste Mal war, dass wir im Sommer nicht meine Großeltern besuchten. Alles hatte mit einem Fußballspiel begonnen. Eine kurdische Mannschaft aus Qamischlo sollte dort gegen eine arabische aus Deir ez-Zor antreten, die als regimenah galt. Die Fans der Mannschaft aus Deir ez-Zor waren ohne die üblichen Sicherheitskontrollen ins Stadion gelangt, sie durften sich direkt neben dem kurdischen Fanblock positionieren und begannen – da hatte das Spiel noch nicht mal angefangen –, die gegnerischen Fans mit Flaschen und Steinen zu bewerfen.
In der Stadt sprach sich bald herum, dass es im Stadion zu Ausschreitungen gekommen war, und immer mehr Menschen machten sich auf den Weg. Sicherheitskräfte gaben erste Schüsse ab, sie trieben aber nicht die Provokateure aus dem Stadion, sondern die kurdischen Fans der heimischen Mannschaft. Vor dem Stadion schossen sie mit scharfer Munition in die Menge.
Neun Menschen starben an diesem Tag.
Am nächsten Tag sollten die Toten beerdigt werden. Zehntausend Menschen hatten sich zu einem friedlichen Trauerzug versammelt. Als einige Teilnehmer jedoch Parolen für den amerikanischen Präsidenten George W. Bush anstimmten, dessen Truppen gerade im Nachbarland Irak den Diktator Saddam Hussein gefangen genommen hatten, kurdische Flaggen hissten und eine Statue von Hafez Al-Assad mit Steinen bewarfen, schossen Bewaffnete in Zivil in die Menge. Schwerverletzte Kurden wurden daran gehindert, sich im Krankenhaus behandeln zu lassen.
In den Tagen und Wochen darauf kam es zu einer großen Verhaftungswelle in der Region. Jegliche Proteste wurden von Sicherheitskräften brutal niedergeschlagen. Unsere Familie war in großer Sorge. Im Dorf blieb es zwar ruhig, aber überall gab es Ausgangssperren und Straßenkontrollen. Wenige Jahre später reagierte das Regime auf dieselbe Weise: mit Schüssen in eine unbewaffnete Menge, dem Verwehren von medizinischer Versorgung und Massenverhaftungen.
Im Windschatten der Proteste 2011 und des darauf folgenden Krieges haben die Kurden im Nordosten des Landes eine Selbstverwaltung etabliert, die zunächst die Kantone Afrin, Kobane und Dschasira umfasste und sich später, nach dem Sieg über den IS, bis nach Rakka und Deir ez-Zor ausgedehnt hat. Sie steht heute durch die Türkei und die dschihadistische SNA unter Beschuss. Auch hält die türkische Armee weiterhin kurdische Gebiete in Syrien besetzt.
Der Krieg ist hier noch nicht vorbei.
Nach der Konferenz gehen Cano, mein Vater und ich zwei Straßen weiter zu Al-Kamal. Das Restaurant gibt es immer noch. Mein Vater hatte in den Schulferien dort in der Küche gearbeitet, Geschirr gespült, Bestellungen durchgereicht.
Das Lokal ist recht gut gefüllt, aber wir finden einen Platz in der Mitte, von dem aus wir einen guten Blick auf das Geschehen um uns herum haben, auf die Familien und Freundesgruppen, die sich hier zum Abendessen verabredet haben, ebenso wie ein paar weitere Teilnehmer der Konferenz.
Wir bestellen Mutabal (Auberginenpaste), Muhammara (Paprika-Walnusscreme), Essiggemüse, Brot und Huhn mit Reis. Auch die Speisekarte hat sich nicht groß verändert. Wir sind erleichtert, die Stimmung ist gelöst, fast ausgelassen.
Dann betritt eine Gruppe Männer in Tarnfleck das Lokal, Dschihadisten, auf den ersten Blick als solche zu erkennen, aber keine Syrer, vielleicht Usbeken, Tadschiken, Tschetschenen?
Sie setzen sich an einen der Tische am Rand.
Der Betrieb geht weiter. Ich sehe immer wieder verstohlen zu ihnen hinüber und frage mich, zu welcher Gruppe sie gehören. HTS, vermutlich. Aber HTS besteht aus unterschiedlichen Milizen. Viele der Dschihadisten haben im Laufe der letzten Jahre ihre Loyalitäten gewechselt, unterschiedlichen Führern die Treue geschworen. Waren Mitglied bei Al-Qaida, Al-Nusra, IS, ehe sie zu HTS wechselten. Wobei jede dieser Gruppen sich schwerste Verbrechen hat zuschulden kommen lassen.
Womöglich waren die Männer, die hier im Restaurant Al-Kamal zwei Tische weiter auf ihre Bestellung warten, auch am Genozid an den Jesiden beteiligt. Womöglich haben sie Menschen verschleppt, enthauptet, gesteinigt, Kinder rekrutiert.
Die Menschen um uns herum plaudern, essen und rauchen, als wäre nichts weiter. Und dann denke ich daran, dass diese Menschen die letzten sechzig Jahre in einer Diktatur verbracht haben, in einem totalitären Regime, die letzten dreizehn im Bürgerkrieg. Und so versuche auch ich, nicht allzu auffällig hinüberzusehen.
Wir essen auf, trinken noch einen Tee, bezahlen und machen uns auf den Weg zum Suk. Mittlerweile ist es dunkel geworden, aber die Straßen sind immer noch voll.
Überall gibt es die alt-neuen syrischen Flaggen zu kaufen. Ladeninhaber sind gerade dabei, die Jalousien vor ihren Geschäften in den neuen Farben zu übermalen. In einem Eisladen laufen Naschids, Lobgesänge auf Gott und den Propheten. Das ist neu. Ebenso die handbeschriebenen Banner, über die Gasse gespannt, darauf Huldigungen an Al-Dscholani und seine Kämpfer.
Früher haben sie Assad gehuldigt, sagt Cano, jetzt ist es Al-Dscholani.
Am nächsten Morgen gibt es kein warmes Wasser im Hotel. Im Frühstücksraum sind wir die einzigen Gäste. Früher, erzählt uns eine Hotelmitarbeiterin, eine Christin aus Maalula, sei das anders gewesen.
Und heute, fragen wir.
Sie zögert. Sie habe Angst, sagt sie. Noch sei es ruhig. Aber niemand wisse, wie es sich entwickelt.
2013 waren Kämpfer von Al-Nusra in Maalula eingedrungen. Sie ermordeten Zivilisten und verschleppten dreizehn Nonnen, die erst vier Monate später wieder freikamen.
Die Hotelmitarbeiterin sagt: Machen wir uns nichts vor. Wir wissen doch, wer diese Leute sind, die jetzt Damaskus kontrollieren. Wir wissen, woher sie kommen.
In einem Geschäft gegenüber der Kirche kaufen wir SIM