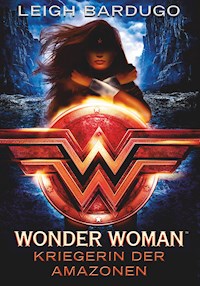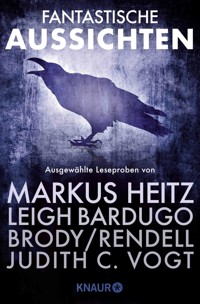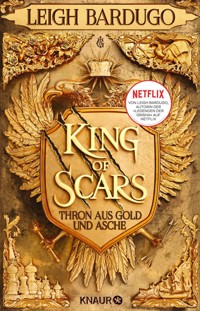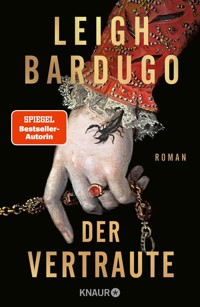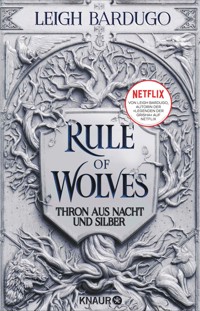
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die King-of-Scars-Dilogie
- Sprache: Deutsch
Ein König, der mit seinem Dämon ringt Eine Sturmhexe, deren schlimmster Feind zurückgekehrt ist Eine Spionin, deren Wunsch nach Rache alles zu vernichten droht Nach dem atemraubenden Cliffhanger in »King of Scars. Thron aus Gold und Asche « erzählt SPIEGEL-Bestseller-Autorin Leigh Bardugo im 2. Teil der Fantasy-Reihe »King of Scars«, wie es mit Nikolai Lantsov, der Grisha Nina Zenik und Zoya Nazyalensky weitergeht. »Rule of Wolves« ist dabei zugleich das spektakuläre Finale der Grishaverse-Saga. Der schicksalhafte Kampf um den Zarenthron von Ravka steuert unaufhaltsam auf eine Entscheidung zu: Wird ein Krieg, den niemand gewinnen kann, eine ganze Welt in Asche versinken lassen? Während der junge König Nikolai Lantsov – auch mithilfe des Monsters in seinem Inneren – alles versucht, um Ravka vor dem Schlimmsten zu bewahren, hadert Zoya Nazyalensky, die Sturmhexe, mit ihrem Schicksal: Nach allem, was sie im Krieg bereits verloren hat, verlangt nun die Pflicht von ihr, dass sie ihre Kräfte nutzt, um die Waffe zu werden, die ihr Land braucht. Koste es, was es wolle … Zur selben Zeit riskiert die Grisha Nina Zenik als Spionin im feindlichen Fjerda mehr als nur ihr Leben: Ihr unbändiger Wunsch nach Rache könnte Ravkas Schicksal endgültig besiegeln – und Nina die Chance nehmen, ihr trauerndes Herz zu heilen … »Rule of Wolves« ist der zweite Teil der Fantasy-Dilogie »Thron aus Gold und Asche« von Bestseller-Autorin Leigh Bardugo nach »King of Scars«. Wie schon die Grisha-Trilogie und die Krähen-Dulogie, begeistert dieses Fantasy-Abenteuer mit Dialogwitz, düsterer Magie und facettenreichen Charakteren. Die Grisha-Trilogie ist in folgender Reihenfolge erschienen: - »Goldene Flammen« - »Eisige Wellen« - »Lodernde Schwingen« Die Krähen-Dilogie ist in folgender Reihenfolge erschienen: - »Das Lied der Krähen« - »Das Gold der Krähen« Noch mehr Geschichten aus der Grisha-Welt: - »Die Sprache der Dornen« (illustrierte Märchen aus der Welt der Grisha) - »Die Leben der Heiligen« (illustrierte Heiligen-Legenden aus der Welt der Grisha) - »Demon in the Wood. Schatten der Vergangenheit« (Graphic Novel zur Vorgeschichte des Dunklen)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 821
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Leigh Bardugo
Rule of Wolves
Thron aus Nacht und Silber
Aus dem amerikanischen Englisch von Michelle Gyo
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Der schicksalhafte Kampf um den Zarenthron von Ravka steuert unaufhaltsam auf eine Entscheidung zu: Wird ein Krieg, den niemand gewinnen kann, eine ganz Welt in Asche versinken lassen? Während der junge König Nikolai Lantsov – auch mithilfe des Monsters in seinem Inneren – alles versucht, um Ravka vor dem Schlimmsten zu bewahren, sieht sich die Sturmhexe Zoya gezwungen, selbst zu einer Waffe zu werden. Und die Grisha Nina Zenik riskiert als Spionin mehr als nur ihr Leben: Ihr unbändiger Wunsch nach Rache könnte Ravkas Schicksal endgültig besiegeln – und Nina die Chance nehmen, ihr trauerndes Herz zu heilen ...
Inhaltsübersicht
Widmung
Karte
Die Grisha
Dämonenherrscher
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Der Ursprung der Welt
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
Danksagung
Für EDA, der mir half, meinen Platz bei den Wölfen zu finden.
Die Grisha
Soldaten der Zweiten Armee
Meister der Kleinen Künste
Orden der Lebenden und der Toten
Entherzer
Heiler
Orden der Beschwörer
Stürmer
Inferni
Fluter
Orden der Fabrikatoren
Durasten
Alkemi
Dämonenherrscher
1
Königin Makhi
Makhi Kir-Taban, Himmelsgeborene, war eine Königin, die einer langen Reihe von Königinnen entstammte.
Und alle waren Närrinnen, dachte sie. Ihr Puls beschleunigte sich, während sie die Einladung in ihrer Hand las. Wären sie keine Närrinnen gewesen, wäre ich jetzt nicht in dieser verzwickten Lage.
Zorn zeigte sich nicht in ihrem Gesicht. Das Blut schoss ihr nicht in die glatten Wangen. Sie war eine Königin, und sie benahm sich wie eine – gerader Rücken, aufrechte Haltung, ruhige Miene. Ihre Finger zitterten nicht, obschon sich jeder Muskel in ihrem Körper danach sehnte, das elegant beschriebene Papier zu Staub zu zermalmen.
Zar Nikolai Lantsov, Großherzog von Udova, alleiniger Herrscher der großen Nation Ravka, und Prinzessin Ehri Kir-Taban, Tochter des Himmels, Ätherischste der Taban-Folge, würden sich freuen, Königin Makhi Kir-Taban zu den Hochzeitsfeierlichkeiten in der Zarenkapelle zu Os Alta empfangen zu dürfen.
Die Hochzeit fand in einem Monat statt. Genug Zeit für Makhis Diener, die angemessenen Gewänder und Juwelen einzupacken, ihre königliche Gefolgschaft zusammenzustellen, ihr Aufgebot der Tavgharad einsatzbereit zu machen, die Elitesoldatinnen, die ihre Familie schützten, seit die erste Königin von Taban den Thron bestiegen hatte. Jede Menge Zeit, um die Reise über Land oder in dem neuen luxuriösen Luftschiff zurückzulegen, das ihre Ingenieure konstruiert hatten.
Jede Menge Zeit für eine schlaue Königin, einen Krieg anzufangen.
Doch in diesem Moment musste Makhi für die Minister funktionieren, die in der Ratskammer vor ihr standen. Ihre Mutter war erst einen Monat zuvor gestorben. Die Krone hätte an Makhis Großmutter zurückgegeben werden können, aber Leyti Kir-Taban war fast achtzig und hatte genug von den Mühen, eine Nation zu führen. Sie wollte nur noch ihre Rosen schneiden und sich mit einer Reihe äußerst gut aussehender Liebhaber vergnügen, und so hatte sie Makhi ihren Segen gegeben und sich aufs Land zurückgezogen. Makhi war nur wenige Tage nach der Beisetzung ihrer Mutter gekrönt worden. Ihre Herrschaft war zwar frisch, doch sie würde dafür sorgen, dass sie lange andauerte. Sie würde ein Zeitalter des Wohlstands und Imperiums für ihr Volk einleiten – und das erforderte die Unterstützung der königlichen Minister, die mit erwartungsvollen Mienen zu ihr aufblickten.
»Ich sehe keine persönliche Nachricht von Ehri«, sagte sie und lehnte sich auf dem Thron zurück. Sie legte die Einladung in den Schoß und erlaubte es sich, die Augenbrauen zu verziehen. »Das ist bedenklich.«
»Wir sollten uns freuen«, sagte Minister Nagh. Er trug den dunkelgrünen und mit Messingknöpfen versehenen Mantel des Bürokratenstands – wie alle Minister, an deren Aufschlägen die gekreuzten Schlüssel der Shu steckten. Sie sahen aus wie ein Wald strenger Bäume. »Ist das nicht das Ergebnis, auf das wir hofften? Eine Hochzeit, um die Allianz zwischen unseren Nationen zu besiegeln?«
Das Ergebnis, auf das ihr hofftet. Ginge es nach euch, würden wir uns für immer hinter unseren Bergen verstecken.
»Ja«, sagte sie mit einem Lächeln. »Aus diesem Grund setzten wir unsere kostbare Prinzessin Ehri in einem so wilden Land aufs Spiel. Dennoch, sie hätte uns selbst eine Botschaft schreiben sollen, ein Zeichen, dass alles in Ordnung ist.«
Ministerin Zihun räusperte sich. »Ihre Himmlischste Hoheit, Ehri ist vielleicht nicht wirklich glücklich darüber, sondern hat sich nur gefügt. Sie hatte nie ein öffentliches Leben gewollt, ganz zu schweigen von einem Leben, das sie von dem einzigen Zuhause wegführt, das sie je kannte.«
»Wir sind Taban. Wir wollen, was unser Land braucht.«
Die Ministerin neigte respektvoll den Kopf. »Natürlich, Eure Majestät. Sollen wir unsere Antwort verfassen?«
»Das werde ich selbst übernehmen«, erwiderte die Königin. »Als ein Zeichen des Respekts. Wir beginnen diese neue Partnerschaft besser auf dem richtigen Fuß.«
»Sehr gut, Eure Majestät«, sagte Nagh, als hätte Makhi einen besonders gekonnten Knicks vollführt.
Irgendwie setzte Makhi die Zustimmung des Ministers sogar noch mehr zu als seine Ablehnung.
Sie erhob sich, und wie eins traten die Minister einen Schritt zurück, befolgten das Protokoll. Sie stieg von ihrem Thron herab, und ihre Tavgharad-Wächterinnen schlossen hinter ihr auf, während sie den langen Flur hinab zu den Gemächern der Königin hinabschritt. Die seidene Schleppe ihres Gewands glitt seufzend über den Marmorboden, es klang so verdrießlich wie einer ihrer Berater. Makhi wusste genau, wie viele Schritte es von der Ratskammer bis in die Zurückgezogenheit ihrer Zimmer waren. Diesen Gang hatte sie unzählige Male mit ihrer Mutter unternommen und davor mit ihrer Großmutter. Jetzt zählte sie herunter – sechsundfünfzig, fünfundfünfzig – und versuchte, ihren Frust fallen zu lassen und klar zu denken.
Sie spürte Minister Yerwei hinter sich, obwohl das Geräusch seiner Tritte in den Pantoffeln vom rhythmisch-dumpfen Aufprall der Stiefel ihrer Tavgharad übertönt wurde. Es war, als würde man von einem Geist verfolgt. Würde sie ihren Wächterinnen befehlen, ihm die Kehle durchzuschneiden, so würden sie es ohne Zögern tun. Und würde man sie daraufhin wegen Mordes vor Gericht stellen, was in Shu Han sogar bei Königinnen möglich war, so würden sie dann gegen sie aussagen.
Sie erreichten das Heiligtum der Königin, und Makhi schritt unter dem vergoldeten Bogen hindurch und betrat einen kleinen Empfangsraum aus blassgrünem Marmor. Sie winkte den dort wartenden Dienern ab und wandte sich an die Tavgharad. »Stört mich nicht«, wies sie sie an.
Yerwei folgte ihr durch den Raum, dann in das Musikzimmer und bis in den großen Salon, in dem Makhi einst auf dem Schoß ihrer Mutter gesessen und den Geschichten der ersten Taban-Königinnen gelauscht hatte – Kriegerinnen, die in Begleitung ihres Gefolges aus zahmen Falken von den höchsten Bergen der Sikurzoi herabgestiegen waren, um über die Shu zu herrschen. Taban yenok-yun nannte man sie. Der Sturm, der blieb.
Diese Königinnen hatten den Palast erbaut, der immer noch ein Wunderwerk der Technik und Schönheit war. Er gehörte zur Taban-Dynastie. Er gehörte zum Volk. Und für diesen kurzen Augenblick – nur ein paar maßvolle Schritte im Marsch der Taban-Linie – gehörte er Makhi. Sie spürte, wie sich ihre Stimmung hob, als sie den Hof der Goldflügel betraten. Es war ein Saal voll goldenem Licht und fließendem Wasser und mit einer Terrasse, deren schmale, sich wiederholende Bögen die getrimmten Hecken und plätschernden Brunnen der königlichen Anlagen darunter rahmten, hinter denen die Pflaumenplantagen von Ahmrat Jen zu erkennen waren, deren Bäume wie ein Regiment aus Soldatinnen in ordentlichen Reihen standen. In Ravka war Winter, aber hier in Shu Han, in diesem gesegneten Land, schien die Sonne noch warm.
Makhi schritt hinaus auf die Terrasse. Es war einer der wenigen Orte, an denen sie sich sicher genug fühlte, zu reden, fern der neugierigen Blicke und wissbegierigen Ohren der Diener und Spione. Ein grüner Glastisch war gedeckt mit Karaffen voll Wein und Wasser und einem Teller mit spät gereiften Feigen. Im Garten unten sah sie ihre Nichte Akeni, die mit einem der Gärtnerjungen spielte. Empfing Makhi keine Töchter von einem ihrer Gemahle, so hatte sie beschlossen, dass Akeni eines Tages die Krone erben würde. Sie war nicht die Älteste unter den Taban-Mädchen, aber trotz ihrer erst acht Jahre deutlich die Klügste. Eine Überraschung, bedachte man, dass ihre Mutter die Tiefe eines flachen Tellers besaß.
»Tante Makhi!«, rief Akeni von unten herauf. »Wir haben ein Vogelnest gefunden!«
Der Gärtnerjunge sprach nicht und sah die Königin auch nicht direkt an, sondern stand stumm neben seiner Spielkameradin, den Blick auf die abgenutzten Sandalen gerichtet.
»Du darfst die Eier nicht berühren«, rief Makhi zu ihnen hinab. »Ansehen, aber nicht anfassen.«
»Das mach ich nicht. Möchtest du Blumen?«
»Bring mir eine gelbe Pflaume.«
»Aber die sind sauer!«
»Bring mir eine, und ich erzähle dir eine Geschichte.« Sie sah zu, wie die Kinder auf die Südmauer des Gartens zurannten. Die Frucht hing hoch oben in den Bäumen, und es würde Zeit und Einfallsreichtum erfordern, sie zu erreichen.
»Sie ist ein gutes Kind«, sagte Yerwei hinter ihr. »Vielleicht etwas zu fügsam, um eine gute Königin abzugeben.«
Makhi ignorierte ihn.
»Prinzessin Ehri lebt«, sagte er.
Sie nahm die Karaffe und schleuderte sie hinab auf die Pflastersteine.
Sie riss die Vorhänge von den Fenstern und zerfetzte sie mit den Fingernägeln.
Sie vergrub das Gesicht in den Seidenkissen und schrie.
Sie tat nichts davon.
Stattdessen warf sie die Einladung auf den Tisch und nahm die schwere Krone vom Kopf. Sie war aus reinem Platin, dicht mit Smaragden besetzt, und ihr schmerzte immer der Nacken von ihr. Sie legte sie neben die Feigen und goss sich ein Glas Wein ein. Diener hätten sich um diese Bedürfnisse kümmern sollen, aber die wollte sie gerade nicht in ihrer Nähe haben.
Yerwei glitt auf den Balkon und bediente sich, ohne zu fragen, am Wein. »Eure Schwester sollte nicht am Leben sein.«
Prinzessin Ehri Kir-Taban, Liebling des Volks, ihm die Höchste – aus Gründen, die Makhi nie hatte begreifen können. Sie war nicht weise oder wunderschön oder interessant. Sie konnte nur albern lächeln und Khatuur spielen. Und trotzdem betete man sie an.
Ehri sollte tot sein. Was war schiefgegangen? Makhi hatte ihre Pläne sorgfältig gefasst. Sie hätten dazu führen sollen, dass sowohl Zar Nikolai als auch Prinzessin Ehri tot waren – und man Fjerda die Attentate anlastete. Unter dem Vorwand, den Mord an ihrer geliebten Schwester zu rächen, wäre sie in ein zarenloses, führerloses Land einmarschiert, hätte seine Grisha für das Khergud-Programm eingefordert und Ravka als Stützpunkt für einen Krieg gegen die Fjerdan benutzt.
Sie hatte ihre Agentin gut gewählt: Mayu Kir-Kaat war Mitglied von Prinzessin Ehris Tavgharad. Sie war jung, eine talentierte Kämpferin und Schwertfrau, und vor allem war sie verwundbar. Ihr Zwillingsbruder war aus seiner Militäreinheit verschwunden, und seiner Familie hatte man mitgeteilt, dass der junge Mann im Einsatz gefallen wäre. Doch Mayu hatte die Wahrheit erraten: Er war auserwählt worden, ein Khergud zu werden, eingesetzt im Programm des Eisernen Herzens, das ihn stärker und tödlicher machen würde, jedoch nicht vollständig menschlich. Mayu hatte darum gefleht, man möge ihn freilassen, bevor seine Verwandlung vollzogen würde, und in den Dienst als einfacher Soldat zurückschicken.
Königin Makhi kannte den Prozess der Erschaffung eines Khergud – wie Grisha-Stahl mit den Knochen verschmolzen oder mechanische Flügel am Rücken befestigt wurden – es war schmerzhaft. Es gab jedoch auch Gerede, dass der Prozess noch etwas bewirkte: dass die Soldaten, die in das Programm geholt wurden, auf schreckliche Weise verändert daraus hervorgingen, dass die Khergud einen wesentlichen Teil ihres Selbst durch die Verwandlung verloren, als würde der Schmerz einen Teil dessen verbrennen, was sie menschlich machte. Und natürlich wollte Mayu Kir-Kaat das nicht für ihren Bruder. Sie waren Zwillinge, Kebben. Es gab kein engeres Band. Mayu würde ihr eigenes Leben nehmen und das Leben eines Zaren, um ihn zu retten.
Königin Makhi stellte ihren Wein ab und goss sich ein Glas Wasser ein. Sie brauchte einen klaren Kopf für das, was noch kam. Ihr Kindermädchen hatte ihr einmal gesagt, dass sie ein Zwilling hätte sein sollen, dass ihr Bruder tot auf die Welt gekommen war. »Du hast seine Stärke verschlungen«, hatte sie geflüstert, und bereits damals hatte Makhi gewusst, dass sie eines Tages eine Königin sein würde. Was hätte geschehen können, wäre ihr Bruder geboren worden? Wer hätte Makhi sein können?
Jetzt änderte es nichts.
Ravkas Zar war immer noch sehr lebendig.
Und ihre Schwester ebenso.
Es war übel. Aber Königin Makhi konnte nicht sicher wissen, wie übel. Hatte Nikolai Lantsov von dem Komplott gegen ihn erfahren? Hatte Mayu die Nerven verloren und Prinzessin Ehri den wahren Plan verraten? Nein. Das konnte nicht sein. Sie weigerte sich, das zu glauben. Dafür war das Band der Kebben zu stark.
»Diese Einladung wirkt wie eine Falle«, sagte sie.
»Das sind die meisten Ehen.«
»Verschone mich mit deinem Humor, Yerwei. Falls Zar Nikolai weiß …«
»Was kann er beweisen?«
»Ehri könnte viel erzählen. Je nachdem, was sie weiß.«
»Eure Schwester ist eine sanfte Seele. Sie würde nie glauben, dass Ihr eines solchen Betrugs fähig seid, und sie würde gewiss nie gegen Euch reden.«
Makhi schlug nach der Einladung. »Dann erkläre das hier!«
»Vielleicht hat sie sich verliebt. Ich hörte, dass der Zar sehr charmant sei.«
»Das ist absurd.«
Prinzessin Ehri hatte Mayus Platz in der Tavgharad eingenommen. Mayu hatte sich als Prinzessin Ehri verkleidet. Mayus Aufgabe war es, sich Zar Nikolai zu nähern, ihn zu ermorden und sich dann selbst das Leben zu nehmen. Was Prinzessin Ehri anging, wäre das alles. Aber bei der Invasion, die darauf folgen würde, würden unweigerlich Leben verloren, und die Tavgharad hatte den Befehl, dafür zu sorgen, dass Ehri eines der Opfer würde. Sie waren Ehris Haushalt zugewiesen worden, befolgten aber einzig die Befehle der Königin. Makhis Minister würden niemals von dem Plan erfahren, den sie eingefädelt hatte. Was war also schiefgegangen?
»Ihr müsst dieser Hochzeit beiwohnen«, dozierte Yerwei. »All Eure Minister werden das erwarten. Dies ist die Verwirklichung ihrer Pläne für den Frieden. Sie denken, Ihr müsstet höchst erfreut sein.«
»Schien ich für deinen Geschmack nicht erfreut genug?«
»Ihr wart, wie Ihr immer seid, eine perfekte Königin. Nur ich sah die Anzeichen.«
»Männer, die zu viel sehen, haben die Angewohnheit, die Augen zu verlieren.«
»Und Königinnen, die zu wenig Vertrauen haben, haben die Angewohnheit, ihren Thron zu verlieren.«
Abrupt wandte Makhi den Kopf. »Was meinst du damit?«
Nur Yerwei kannte die Wahrheit – und nicht nur die Einzelheiten ihres Plans, den Zaren von Ravka zu töten und ihre eigene Schwester. Er hatte ihrer Mutter und ihrer Großmutter als Leibarzt gedient. Er war Zeuge an ihrer Mutter Totenbett gewesen, als Königin Keyen Kir-Taban, Himmelsgeborene, Ehri statt Makhi als ihre Erbin erwählt hatte. Es war das Recht einer Taban-Königin, ihre Nachfolgerin auszuwählen, aber es war fast immer die älteste Tochter. So war es seit Hunderten von Jahren. Makhi war dazu bestimmt, Königin zu werden. Sie war dafür geboren, dazu aufgezogen. Sie war so stark wie ein Mitglied der Tavgharad, eine erfahrene Pferdefrau, eine brillante Strategin, so listig wie eine Spinne. Und doch. Ihre Mutter hatte Ehri gewählt. Die weiche, süße, liebste Ehri, die von den Menschen angebetet wurde.
»Versprich es mir«, hatte ihre Mutter gesagt. »Versprich mir, dass du meinen Wünschen folgst. Schwöre es bei den Sechs Soldatinnen.«
»Ich verspreche es«, hatte Makhi geflüstert.
Yerwei hatte all das mit angehört. Er stand als Berater am längsten im Dienst ihrer Mutter, war so alt, dass Makhi keine Ahnung hatte, wie viele Jahre er schon auf dieser Erde war. Er schien nie zu altern. Sie hatte zu ihm gesehen, die wässrigen Augen in dem runzligen Gesicht, hatte sich gefragt, ob er ihrer Mutter von dem Werk erzählt hatte, das sie gemeinsam verfolgten, den geheimen Experimenten, der Geburt des Khergud-Programms. All das würde enden, käme Ehri auf den Thron.
»Aber Ehri möchte nicht herrschen …«, hatte Makhi angesetzt.
»Nur, weil sie immer davon ausging, dass du herrschen würdest.«
Makhi hatte die Hand ihrer Mutter in ihre genommen. »Aber das sollte ich. Ich habe gelernt. Ich bin ausgebildet.«
»Und doch hat keine Lektion dich je Güte gelehrt. Kein Tutor lehrte dich je Gnade. Dein Herz hungert nach Krieg, und ich weiß nicht, warum.«
»Es ist das Herz des Falken«, hatte Makhi stolz geantwortet. »Das Herz der Han.«
»Es ist der Wille des Falken. Das ist etwas anderes. Schwöre mir, dass du dies tun wirst. Du bist eine Taban. Wir wollen, was das Land braucht, und diese Nation braucht Ehri.«
Makhi hatte nicht geweint oder dagegengehalten; sie hatte nur ihr Versprechen gegeben.
Dann hatte ihre Mutter ihren letzten Atemzug getan. Makhi hatte ihre Gebete an die Sechs Soldatinnen gesprochen, hatte Kerzen für die gefallenen Taban-Königinnen entzündet. Sie hatte ihr Haar geordnet und war mit den Händen über die Seide ihrer Gewänder gefahren. Sie würde bald Blau tragen müssen, die Farbe der Trauer. Und sie hatte so viel zu betrauern – den Verlust ihrer Mutter, den Verlust ihrer Krone.
»Werdet Ihr es Ehri sagen, oder soll ich?«, hatte sie Yerwei gefragt.
»Ihr was sagen?«
»Meine Mutter …«
»Ich habe nichts gehört. Ich bin froh, dass sie friedlich von uns ging.«
So war der Pakt über dem erkaltenden Leib ihrer Mutter geschlossen worden. Und so war eine neue Königin gemacht worden.
Jetzt stützte Makhi die Arme auf die Balkonbrüstung und atmete die Düfte des Gartens ein – Jasmin, süße Orangen. Sie lauschte dem Gelächter ihrer Nichte und des Gärtnerjungen. Als sie die Krone ihrer Schwester an sich genommen hatte, hatte sie nicht begriffen, wie wenig es lösen würde, dass sie für immer mit der gütigen, ahnungslosen Ehri wetteifern würde. Nur eine Sache würde dieses Leid beenden.
»Ich werde zusehen, wie meine Schwester heiratet. Aber zuerst muss ich eine Botschaft senden.«
Yerwei trat näher. »Was ist Eure Absicht? Ihr wisst, dass Eure Minister die Botschaft lesen werden, selbst wenn sie versiegelt ist.«
»Ich bin keine Närrin.«
»Man kann närrisch sein, ohne eine Närrin zu sein. Wenn …«
Yerwei verstummte ohne Vorwarnung.
»Was ist?«, fragte Makhi und folgte seinem Blick.
Ein Schatten bewegte sich über die Pflaumengärten hinter der Palastmauer. Makhi sah auf, erwartete, ein Luftschiff zu sehen, aber der Himmel war klar. Der Schatten wuchs immer weiter, breitete sich aus wie ein Fleck, raste auf sie zu. Die Bäume, die er berührte, stürzten, ihre Zweige wurden schwarz, dann verschwanden sie, hinterließen nichts als graue Erde und ein Rauchwölkchen.
»Was ist das?«, keuchte Yerwei.
»Akeni!«, schrie die Königin. »Akeni, runter von dem Baum! Komm sofort da weg!«
»Ich pflücke Pflaumen!«, rief das Mädchen lachend.
»Sofort, habe ich gesagt!«
Akeni konnte nicht über die Mauern blicken, sah die schwarze Todeswelle nicht, die geräuschlos herankam.
»Wächter!«, schrie die Königin. »Helft ihr!«
Doch es war zu spät. Der Schatten glitt über die Palastmauer, färbte die goldenen Steine schwarz und ging über dem Pflaumenbaum nieder. Es war, als wäre ein dunkler Vorhang über Akeni und den Gärtnerjungen herabgefallen, der ihr Gelächter zum Verstummen brachte.
»Nein!«, schrie Makhi.
»Meine Königin«, drängte Yerwei. »Ihr müsst hier weg.«
Doch der Pesthauch hatte innegehalten, direkt am Rand des Brunnens, klar wie die Wasserlinie bei Flut am Strand. Alles, was er berührt hatte, lag grau und zerstört. Alles darüber hinaus war prächtig und grün und lebendig.
»Akeni«, flüsterte die Königin mit einem Schluchzen.
Nur der Wind antwortete, wehte vom Garten heran, vertrieb die letzten dünnen Rauchschwaden. Nichts blieb als der süße Duft nach Blumen, fröhlich und unwissend, ihre Gesichter der Sonne zugewandt.
2
Nina
Nina schmeckte die salzige Luft auf der Zunge, ließ die Geräusche des Marktplatzes über sich hinwegspülen – die Rufe der Verkäufer, die ihre Waren feilboten, die Möwen im Hafen von Djerholm, die Schreie der Seeleute an Bord ihrer Schiffe. Sie sah hinauf zu dem Kliff, auf dem das Eistribunal über allem aufragte, die hohen weißen Mauern glänzend hell wie freiliegende Knochen, und sie unterdrückte ein Schaudern. Es war gut, draußen zu sein, fern der abgeschiedenen Räumlichkeiten der Weißen Insel, aber sie fühlte sich, als würde das uralte Gebäude sie beobachten, als hörte sie es flüstern: Ich weiß, was du bist. Du gehörst hier nicht her.
»Sei so lieb und halt den Rand«, murmelte sie.
»Hm?«, fragte Hanne, die mit ihr über den Kai lief.
»Nichts«, antwortete Nina hastig.
Mit leblosen Gebäuden zu reden war kein gutes Zeichen. Sie war zu lange eingepfercht gewesen, nicht nur im Eistribunal, sondern in Mila Jandersdats Körper, ihr Gesicht und ihre Gestalt so verändert, dass sie ihre wahre Identität verbargen. Nina warf noch einen bösen Blick zum Eistribunal. Seinen Mauern sagte man nach, undurchdringlich zu sein, noch nie von einer angreifenden Armee gebrochen. Doch ihre Freunde hatten das ganz prima hinbekommen. Sie hatten ein Loch in diese prächtigen Mauern gesprengt mit einem von Fjerdas höchsteigenen Panzern. Und nun? War Nina eher wie eine Maus – eine große, blonde Maus in zu schweren Röcken –, die an den Grundfesten des Eistribunals nagte.
Sie blieb beim Stand eines Wollhändlers stehen, dessen Regale mit den traditionellen Westen und Schals vollgestopft waren, die man zu Vinetkälla trug. Trotz bester Absichten hatte Djerholm Nina auf den ersten Blick bezaubert. Es war ordentlich, wie es nur eine Stadt der Fjerdan sein konnte, Häuser und Läden pink und blau und gelb gestrichen, die Gebäude behaglich am Wasser und eng aneinandergedrängt, als wollten sie sich gegenseitig wärmen. Die meisten Städte, die Nina gesehen hatte – wie viele waren es gewesen? Wie viele Sprachen hatte sie in ihnen gesprochen? –, waren um einen zentralen Platz oder eine Hauptstraße herum erbaut, Djerholm jedoch nicht. Djerholms Lebensnerv war das Salzwasser, und sein Markt war der See zugewandt, verlief über den Kai, auf dem man in Läden und auf Wagen und an Ständen frischen Fisch, getrocknetes Fleisch und um heiße Eisen geschlungenes, über Kohlen gebackenes und danach mit Zucker bestäubtes Gebäck feilbot. Die Steinhallen des Eistribunals waren gebieterisch und kalt, aber hier herrschte Durcheinander und Leben.
Wohin Nina auch blickte, waren Erinnerungen an Djel, seine geheiligten Eschenzweige verwoben zu Knoten und Herzen in Vorbereitung auf die Winterfeste von Vinetkälla. In Ravka bereitete man sich jetzt auf das Fest des Sankt Nikolai vor. Und auf Krieg. Dieses Wissen lastete jede Nacht schwer auf ihrer Brust, wenn sie sich zum Schlafen hinlegte, und jeden Tag, wenn sie aufstand, schlang es sich um ihre Kehle und nahm ihr den Atem. Ihre Leute waren in Gefahr, und sie wusste nicht, wie sie ihnen helfen sollte. Stattdessen durchstöberte sie knubblige Hüte und Schals hinter den feindlichen Linien.
Hanne stand neben ihr, eingewickelt in einen distelfarbenen Mantel, der ihre gelbbraune Haut trotz des bedeckten Himmels leuchten ließ, eine elegante Strickkappe über dem geschorenen Haar, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sosehr Nina die Enge des Eistribunals hasste, Hanne litt noch mehr. Sie musste laufen können, reiten; sie brauchte den frischen Geruch von Schnee und Kiefern und den Trost der Wälder. Sie war bereitwillig mit Nina zum Eistribunal gekommen, aber es stand außer Frage, dass die langen Tage der höflichen Konversationen über öden Mahlzeiten ihren Tribut gefordert hatten. Sogar dieses kleine bisschen Freiheit – ein Ausflug zum Markt mit Eltern und Wächtern im Schlepp – reichte aus, um wieder Farbe in ihre Wangen und ein Glänzen in ihre Augen zu bringen.
»Mila! Hanne!«, rief Ylva. »Geht nicht zu weit weg.«
Hanne verdrehte die Augen und nahm ein blaues Wollknäuel vom Karren des Händlers. »Als wären wir Kinder.«
Nina warf einen Blick zurück. Hannes Eltern, Jarl und Ylva Brum, folgten ihnen in wenigen Metern Entfernung – beide waren groß und mager, Ylva in warmer brauner Wolle und rotem Fuchspelz, Brum in der schwarzen Uniform, die Nina mit Abscheu erfüllte und deren Ärmel der silberne Wolf der Drüskelle zierte. Zwei junge Hexenjäger folgten ihnen, die Gesichter glatt rasiert, das goldene Haar lang. Erst wenn sie ihre Ausbildung abgeschlossen und die Worte Djels an Hringkälla gehört hatten, würde es ihnen erlaubt sein, sich den Bart wachsen zu lassen. Und dann würden sie munter in die Welt hinausziehen und Grisha ermorden.
»Papa, sie bauen da etwas auf für ein Schauspiel«, sagte Hanne und deutete den Kai hinab, wo eine behelfsmäßige Bühne errichtet worden war. »Können wir zusehen?«
Brum runzelte ein wenig die Stirn. »Das ist nicht so eine Kerch-Truppe, oder? Mit diesen Masken und unzüchtigen Scherzen?«
Wenn sie das doch nur mal wäre, dachte Nina düster. Sie sehnte sich nach den wilden Straßen Ketterdams. Sie hätte hundert der derben, lärmenden Aufführungen der Komedie Brute den fünf ellenlangen Akten der Fjerdan-Oper vorgezogen, die sie am vergangenen Abend hatte durchstehen müssen. Hanne hatte Nina immer wieder in die Seite gepikt, damit sie nicht einnickte.
»Du fängst an zu schnarchen«, hatte Hanne geflüstert, der Tränen über die Wangen gelaufen waren bei dem Versuch, nicht zu lachen.
Als Ylva das rote Gesicht und die nassen Augen ihrer Tochter sah, hatte sie Hannes Knie getätschelt. »Es ist wirklich ein bewegendes Stück, nicht wahr?«
Hanne hatte nur noch nicken und Ninas Hand drücken können.
»Oh, Jarl«, sagte Ylva jetzt zu ihrem Ehemann. »Ich bin sicher, es wird voll und ganz bekömmlich sein.«
»Na gut.« Brum gab nach, und sie liefen hinüber zu der Bühne, ließen den enttäuschten Wollverkäufer hinter sich zurück. »Doch ihr wäret überrascht von der Wandlung, die dieser Ort durchgemacht hat. Korruption. Ketzerei. Mitten in unserer Hauptstadt. Seht ihr das?« Er deutete auf eine ausgebrannte Ladenfront, an der sie vorbeikamen. Es sah aus, als wäre es einmal ein Metzgerladen gewesen, aber jetzt waren die Fenster zerbrochen und die Mauern von Ruß geschwärzt.
»Erst vor zwei Nächten wurde dieser Laden geplündert. Man fand einen Altar für diese angebliche Sonnenheilige und einen für … wie ist noch ihr Name? Linnea vom Wasser?«
»Leoni«, korrigierte Hanne ihn leise.
Nina hatte von der Plünderung durch ihre Kontakte in der Hringsa gehört, einem Spionagenetzwerk, das sich der Befreiung der Grisha in Fjerda widmete. Man hatte die Metzgerwaren auf die Straßen geworfen, die Schränke und Regale herausgerissen, und darunter waren verborgene Relikte zum Vorschein gekommen – ein Fingerknochen von der Sonnenheiligen, eine Ikone, laienhaft bemalt, die deutlich die wunderschöne Leoni mit ihren aufgedrehten Zöpfen zeigte, die Arme erhoben, um Gift aus einem Fluss zu ziehen und eine Stadt zu retten.
»Es ist schlimmer als einfach nur die Verehrung der Heiligen«, fuhr Brum fort und stach mit dem Finger in die Luft, als hätte es ihn persönlich beleidigt. »Sie behaupten, die Grisha seien die bevorzugten Kinder Djels. Dass ihre Mächte eigentlich ein Zeichen seines Segens seien.«
Diese Worte ließen Ninas Herz schmerzen. Matthias hatte das gesagt. Bevor er starb. Ihre Freundschaft mit Hanne hatte geholfen, diese Wunde zu heilen. Diese Mission, diese Bestimmung hatte geholfen, aber der Schmerz war immer noch da, und sie nahm an, dass er auch bleiben würde. Man hatte ihm sein Leben gestohlen, und Matthias hatte nie die Chance gehabt, seine eigene Bestimmung zu finden. Ich verdiente es, meine Liebste. Ich habe dich beschützt. Bis zum Ende.
Nina schluckte den Kloß herunter, der sich in ihrem Hals gebildet hatte, und zwang sich zu sagen: »Hanne, sollen wir Honigwasser kaufen?« Sie hätte Wein vorgezogen, vielleicht sogar etwas Stärkeres, aber den Frauen der Fjerdan war Alkohol nicht erlaubt, und ganz gewiss nicht in der Öffentlichkeit.
Der Honigwasserverkäufer lächelte sie an, und sein Kiefer sackte herunter, als er Brums Uniform erblickte. »Kommandant Brum!«, sagte er. »Heiße Getränke für Ihre Familie? Um Euch an diesem kühlen Tag zu stärken?«
Der Mann war breitschultrig und stiernackig, mit einem langen, rotblonden Schnauzer. Auf seine Handgelenke waren Wellenkreise tätowiert, die einen früheren Seemann ausweisen konnten. Oder mehr.
Nina verspürte eine seltsame Verdopplung, als sie zusah, wie Jarl Brum die Hand des Händlers schüttelte. Vor fast zwei Jahren, nur ein paar Meter von dieser Stelle entfernt, hatte sie diesen Mann bekämpft. Sie hatte dem Drüskelle-Kommandanten in ihrem wahren Ich gegenübergestanden, als Nina Zenik, die Droge Jurda Parem stark in ihrem Blut. Diese Droge hatte es ihr erlaubt, es mit Hunderten von Soldaten aufzunehmen, hatte sie unverwundbar für Kugeln gemacht, und sie hatte ihre Grisha-Gabe für immer verändert, hatte ihr die Macht über die Toten verliehen statt über die Lebenden. An diesem Tag hatte sie Brums Leben verschont, doch sie hatte seinen Skalp genommen. Nina war die Ursache für seinen kahlen Schädel und die Narbe, die über den Haaransatz im Nacken verlief wie der fette pinke Schwanz einer Ratte.
Matthias hatte um Gnade gebeten – für seine Leute, für den Mann, der ihm ein zweiter Vater gewesen war. Nina war immer noch nicht sicher, ob sie das Richtige getan hatte, als sie ihm das gewährt hatte. Hätte sie Brum getötet, hätte sie Hanne nie kennengelernt. Sie wäre vielleicht nie zurückgekommen nach Fjerda. Matthias wäre vielleicht immer noch am Leben. Dachte sie zu viel über die Vergangenheit nach, so verlor sie sich darin, in all den Dingen, die vielleicht hätten sein können. Und das konnte sie sich nicht leisten. Trotz des falschen Namens, den sie trug, und des falschen Gesichts, das sie dank Genyas geschickten Bildens aufgesetzt hatte, war Nina eine Grisha, eine Soldatin der Zweiten Armee und eine Spionin Ravkas.
Also pass auf, Zenik, schalt sie sich.
Brum versuchte, den Honigwasserhändler zu bezahlen, aber der Mann weigerte sich, seine Münze anzunehmen. »Ein Geschenk zu Vinetkälla, Kommandant. Mögen Eure Nächte kurz und Euer Becher immer voll sein.«
Eine fröhliche Tonfolge von Flöten und Trommeln erklang von der Bühne und gab das Signal für den Beginn der Aufführung. Der Vorhang hob sich, enthüllte ein gemalte Klippenspitze und einen Miniaturmarktplatz darunter. Die Menge brach in begeisterten Applaus aus. Sie blickten auf Djerholm, genau die Stadt, in der sie jetzt standen, und ein Banner, auf dem stand: DIE GESCHICHTE DES EISTRIBUNALS.
»Siehst du, Jarl«, sagte Ylva. »Keine lüsternen Scherze. Eine anständige, patriotische Erzählung.«
Brum schien abgelenkt, er sah auf seine Taschenuhr. Worauf wartest du?, fragte sich Nina. Die diplomatischen Gespräche zwischen Fjerda und Ravka waren immer noch im Gange, und Fjerda hatte noch keinen Krieg erklärt. Doch Nina war sich sicher, dass ein Kampf unvermeidlich war. Brum würde sich nicht mit weniger zufriedengeben. Sie hatte das bisschen Wissen weitergegeben, das sie hatte in Erfahrung bringen können, wenn sie an Türen und bei Abendessen gelauscht hatte. Es war nicht genug.
Becken krachten, und die Geschichte von Egmond, dem Wunderkind, das schon klein herausragende Burgen und prächtige Gebäude entworfen und erbaut hatte, begann. Die Akrobaten zogen an langen Seidensträngen und erschufen so ein gewaltiges Herrenhaus aus grauen Spitzen und glitzernden Bögen. Das Publikum klatschte begeistert, aber ein Schauspieler mit hochmütigem Gesicht – ein Adliger, der für sein fantastisches neues Heim nicht zahlen wollte – verfluchte Egmond, und der gut aussehende junge Architekt wurde in Ketten gelegt und in die alte Festung geschleppt, die früher einmal auf der Spitze der Klippe über dem Hafen gestanden hatte.
Die Szene wechselte und zeigte nun Egmond in seiner Zelle, während ein großer Sturm mit donnernden Trommeln herankam. Blaue Seide kräuselte sich in Kaskaden über die Bühne, verkörperte die Flut, die die Festung mit dem König und der Königin von Fjerda darin verschlang.
Verdeckt zu arbeiten war nicht einfach nur eine Frage dessen, eine Sprache zu meistern oder ein paar örtliche Gewohnheiten zu erlernen, und so kannte Nina auch die Mythen und Legenden aus Fjerda sehr gut. Dies hier war der Teil der Geschichte, wo Egmond seine Hand auf die Wurzel eines Baums legen sollte, die seine Zellenmauer durchbrochen hatte, um dann mit Djels Hilfe die Kraft der heiligen Esche zu nutzen, um die Mauern der Festung zu stärken und so den König und die Königin zu retten und das Fundament für das mächtige Eistribunal zu legen.
Doch stattdessen traten drei Gestalten auf die Bühne – eine Frau, eingehüllt in rote Papierrosen, ein junges Mädchen mit einer weißen Perücke mit Geweihstangen um den Hals und eine Frau mit schwarzem Haar in einem blauen Gewand.
»Was ist das?«, knurrte Brum.
Das Keuchen des Publikums sagte alles: Sankta Lizabeta von den Rosen, die Sonnenheilige Alina Starkov und – eine wirklich hübsche Note, wenn Nina das mal so sagen durfte – die Sturmhexe Zoya Nazyalensky kamen ins Spiel.
Die Heiligen legten Egmond die Hände auf die Schultern, dann an die Mauern des Gefängnisses, und die verdrehten Stoffbahnen, die Djels Esche darstellen sollten, weiteten und entrollten sich wie Wurzeln, die sich durch die Erde schoben.
»Schluss damit«, sagte Brum laut, und seine Stimme trug über die Menge hinweg. Er klang recht ruhig, doch Nina hörte die Schärfe in seiner Stimme, als er jetzt nach vorn ging. Die beiden Drüskelle folgten, griffen bereits nach den Keulen und Peitschen an ihren Gürteln. »Das Wetter schlägt um. Das Stück kann später weitergehen.«
»Lass sie in Ruhe!«, rief ein Mann aus der Menge.
Ein Kind begann zu weinen.
»Ist das Teil des Stücks?«, fragte verwirrt eine Frau.
»Wir sollten gehen«, sagte Ylva und versuchte, Hanne und Nina davonzuscheuchen.
Doch die Menge war zu dicht um sie herum, drängte auf die Bühne zu.
»Ihr geht jetzt auseinander«, sagte Brum nachdrücklich. »Sonst werdet ihr festgenommen und mit einem Bußgeld belegt.«
Plötzlich erklang Donner – echter Donner, nicht die blechernen Trommeln der Schausteller. Dunkle Wolken kamen so rasch über den Hafen heran, dass es schien, als würde sich die Dämmerung herabsenken. Die See war plötzlich lebendig, das Wasser hatte Schaumkronen, rollte in Wellen heran, die die Schiffsmasten zum Schwanken brachten.
»Djel ist wütend«, sagte jemand aus der Menge.
»Die Heiligen sind wütend«, rief ein anderer.
»Ihr geht jetzt!«, sagte Brum, rief es über das Grollen des heraufziehenden Sturms hinweg.
»Seht!«, schrie eine Stimme.
Vom Hafen her raste eine Welle auf sie zu, ragte höher und immer höher auf. Statt an der Seemauer zu brechen, übersprang sie den Kai. Sie dräute über der Menge, eine Mauer aus brodelndem Wasser. Die Menschen schrien. Die Welle schien sich in der Luft zu drehen, dann krachte sie auf den Kai herab – direkt auf Brum und seine Soldaten, sodass sie in dem Ansturm des Wassers auf den Pflastersteinen zu Boden gingen.
Die Menge keuchte, dann brach sie in Gelächter aus.
»Jarl!«, rief Ylva und versuchte, zu ihm zu gelangen.
Hanne hielt sie zurück. »Bleib hier, Mama. Er wird nicht wollen, dass man ihn für schwach hält.«
»Sankta Zoya!«, rief jemand. »Sie brachte den Sturm!«
Ein paar Leute in der Menge gingen auf die Knie.
»Die Heiligen!«, sagte eine andere Stimme. »Sie sehen, und sie beschützen die Gläubigen.«
Die See war in Aufruhr, und die Wellen schienen zu tanzen.
Brum rappelte sich auf, das Gesicht rot, die Kleider vom Seewasser durchweicht. »Steht auf«, fauchte er, riss seine jungen Soldaten hoch. Dann war er in der Menge, zerrte die Bußfertigen an ihren Hemdkragen hoch. »Hoch mit euch, oder ich nehme euch alle wegen Aufwiegelung und Ketzerei fest!«
»Glaubt ihr, wir sind zu weit gegangen?«, flüsterte Hanne, schob ihre Hand in Ninas und drückte sie.
»Nicht weit genug«, murmelte Nina.
Weil die Aufführung und selbst die Welle nur eine Ablenkung waren. Das Stück war vom Netzwerk der Hringsa aufgeführt worden. Die Welle hatte freundlicherweise ein Fluter beigesteuert, der in einem der Boote im Hafen versteckt war. Während Jarl Brum und seine Männer in der Menge wüteten, winkte der Honigwasserhändler, der in eine Gasse gehuscht war, als das Stück begann, kurz mit der Hand und teilte so die Wolken.
Sonnenlicht strömte hinab auf den Metzgerladen, der vor ein paar Nächten geplündert worden war. Die Mauer schien zuerst leer, doch dann entkorkte der Händler eine Flasche, die Nina ihm in den Karren geschoben hatte. Er pustete eine Wolke aus Ammoniak auf die Farbe, und eine Botschaft erschien wie durch Magie auf der Ladenfront: Linholmenn fe Djel ner werre peje.
Die Kinder Djels sind unter euch.
Es war ein billiger Taschenspielertrick, einen, den sie und die anderen Waisen genutzt hatten, um einander geheime Botschaften zukommen zu lassen. Doch wie Nina nicht vor allzu langer Zeit in Ketterdam gelernt hatte, ging es bei einem guten Trick im Grunde um ein Spektakel. Um sich herum sah sie die Menschen Djerholms, die auf die Botschaft gafften, die die Ladenfront zierte, und auf die See deuteten, die sich jetzt beruhigt hatte, auf die Wolken, die wieder an ihren Platz zurückrollten, während der Honigwasserverkäufer sich beiläufig die Hände abwischte und an seinen Stand zurückkehrte.
Würde es etwas bewirken? Nina wusste es nicht, aber kleine Wunder wie dieses waren in ganz Fjerda aufgetaucht. In Hjar war ein beschädigtes Fischerboot schon fast untergegangen, als die Bucht zufror, sodass die Seeleute sicher zurück ans Ufer laufen konnten, ihr Fang unversehrt. Am nächsten Morgen war ein Wandbild von Sankt Vladimirs heiligem Leuchtturm auf der Kirchenmauer aufgetaucht.
In Felsted hatte ein Apfelgarten volle Früchte trotz der Kälte getragen, als hätte Sankt Feliks eine wärmende Hand auf die Bäume gelegt. Die Zweige waren mit Eschenzweigen geschmückt gewesen, hatte man festgestellt – ein Symbol für Djels Segen.
In Kjerek war die halbe Stadt an den Feuerpocken erkrankt, ein fast sicheres Todesurteil. Doch am Morgen, nachdem ein Bauer eine Vision von Sankta Anastasia gehabt hatte, die mit einem Kranz aus Eschenzweigen über der Stadtquelle schwebte, waren die Bewohner ohne die Krankheit erwacht, die Haut von den Schwären befreit und das Fieber verschwunden.
Wunder um Wunder war von der Hringsa und den Spionen der Zweiten Armee geschaffen worden. Fluter hatten die Bucht einfrieren lassen, allerdings nachdem sie auch den Sturm gerufen hatten, der das Fischerboot zerstörte. Stürmer hatten den frühen Frost in Felsted gebracht, aber Sonnenkrieger hatten die Bäume aufblühen lassen. Und während die Agenten der Hringsa die Feuerpocken nicht beschworen hatten, hatten sie doch dafür gesorgt, dass Korporalki die Opfer heilten. Was die Vision von Anastasia betraf, so war es erstaunlich, was ein wenig Theaterbeleuchtung und eine rote Perücke bewirken konnten.
Dann war da noch der seltsame Pesthauch, der nördlich von Djerholm zugeschlagen hatte. Nina wusste nicht, woher er gekommen war, ein natürliches Phänomen oder die Arbeit eines Einzelgängers der Hringsa. Aber sie wusste, dass es Gerüchte gab, es sei das Werk des Sternenlosen Heiligen gewesen, eine Strafe für die religiösen Plünderungen und die Festnahmen durch Brums Männer.
Zu Anfang hatte Nina bezweifelt, dass ihre Wunder überhaupt irgendeinen Unterschied machten, hatte gefürchtet, dass ihre Bemühungen wenig mehr als kindische Streiche wären, die zu nichts führen würden. Doch die Tatsache, dass Brum mehr und mehr Ressourcen darauf verwendete, die Anbetung der Heiligen auszumerzen, gab ihr Hoffnung.
Brum stampfte zurück zu ihnen, das Gesicht eine Maske des Zorns. Es war schwer, ihn allzu ernst zu nehmen, wo er bis auf die Knochen durchweicht war und es aussah, als könnte ein Fisch aus einem seiner Stiefel hüpfen. Trotzdem hielt Nina den Kopf gesenkt, den Blick abgewandt und die Miene ausdruckslos. Brum war jetzt gefährlich, eine Mine, die nur darauf wartete, in die Luft zu gehen. Es war eine Sache, gehasst oder konfrontiert zu werden, aber eine ganz andere, ausgelacht zu werden. Doch genau das wollte Nina; Fjerda sollte aufhören, Brum und seine Drüskelle als Männer zu sehen, die man fürchtete, und sie stattdessen als das begreifen, was sie waren: verängstigte Tyrannen, die Hohn verdienten und keine Schmeicheleien.
»Ich bringe meine Familie zurück ins Eistribunal«, murmelte er seinen Soldaten zu. »Bringt die Namen in Erfahrung. Von allen Schauspielern, von jedem, der auf dem Marktplatz war.«
»Aber die Menge …«
Brums blaue Augen verengten sich. »Namen. Das hier stinkt nach Hringsa. Wenn es Grisha auf meinen Straßen gibt, in meiner Hauptstadt, finde ich das heraus.«
Es gibt Grisha in deinem Haus, dachte Nina schadenfroh.
»Werd nicht zu großspurig«, murmelte Hanne.
»Zu spät.«
Sie bestiegen die geräumige Kutsche. Der König und die Königin hatten Brum eines dieser lärmenden Gefährte geschenkt, das keine Pferde erforderte, doch Ylva zog eine Kutsche vor, die keinen schwarzen Rauch ausspie und bei der es weniger wahrscheinlich war, dass sie auf dem steilen Anstieg zum Eistribunal kaputt ging.
»Jarl«, fing Ylva an, als sie es sich in den Samtsitzen gemütlich gemacht hatten. »Was schadet es? Je mehr du auf dieses Theater eingehst, desto mehr ermutigt es sie.«
Nina rechnete damit, dass Brum explodierte, aber er schwieg lange, starrte aus dem Fenster auf die graue See unter ihnen.
Als er wieder sprach, war seine Stimme gemessen, seine Wut gezügelt. »Ich hätte mein Temperament im Zaum halten sollen.« Er streckte die Hand aus und umschloss Ylvas.
Nina sah die Wirkung, die diese kleine Geste auf Hanne hatte, den besorgten, schuldbewussten Blick, der ihre Augen trübte. Für Nina war es leicht, Brum zu hassen, ihn bloß als Bösewicht zu sehen, der zerstört werden musste. Aber er war Hannes Vater, und in solchen Augenblicken, wenn er freundlich war, verständig und sanft, schien er weniger wie ein Monster als ein Mann, der sein Bestes für sein Land gab.
»Aber es geht hier nicht um ein paar Leute, die Ärger auf dem Marktplatz machen«, fuhr Brum erschöpft fort. »Fangen die Menschen an, unsere Feinde als Heilige anzusehen …«
»Es gibt Heilige der Fjerdan«, sagte Hanne, beinahe hoffnungsvoll.
»Aber es sind keine Grisha.«
Nina biss sich auf die Zunge. Vielleicht waren sie welche, vielleicht auch nicht. Sënj Egmond, der große Architekt, hatte zu Djel gebetet, um das Eistribunal gegen den Sturm zu befestigen, so sagte man. Aber es gab andere Geschichten, die behaupteten, dass er zu den Heiligen gebetet habe. Und es gab die, die glaubten, dass Egmonds Wunder nichts mit göttlichem Eingreifen zu tun hatten, dass sie einfach das Ergebnis seiner Grisha-Fähigkeiten waren, dass er ein talentierter Fabrikator war, der Metall und Stein seinem Willen nach manipulieren konnte.
»Die Heiligen der Fjerdan waren heilige Männer«, sagte Brum. »Sie wurden von Djel begünstigt, nicht … diese Dämonen. Aber es ist noch mehr als das. Hast du die dritte Heilige erkannt, die da auf der Bühne herumgeschlendert ist? Das war Zoya Nazyalensky, Befehlshaberin der Zweiten Armee. An dieser Frau ist nichts heilig oder natürlich.«
»Eine Frau dient als Befehlshaberin?«, fragte Hanne unschuldig.
»Wenn man eine solche Kreatur Frau nennen kann. Sie ist alles, was abstoßend und widerwärtig ist. Die Grisha sind Ravka. Fjerdan beten diese falschen Heiligen an … Sie geben ihre Gefolgschaft an eine fremde Macht, an eine Macht, mit der wir im Krieg stehen werden. Diese neue Religion ist eine größere Bedrohung, als es jeder Schlachtfeldsieg sein könnte. Wenn wir das Volk verlieren, verlieren wir den Kampf, bevor er überhaupt beginnt.«
Wenn ich meinen Job richtig mache, dachte Nina.
Sie musste hoffen, dass das gemeine Volk der Fjerdan Grisha nicht mehr hasste, als es die eigenen Söhne und Töchter liebte, dass die meisten von ihnen jemanden kannten, der verschwunden war – einen Freund, eine Nachbarin, sogar Verwandte. Eine Frau, die bereit war, Existenz und Familie zurückzulassen aus Angst davor, dass man ihre Macht entdeckte. Ein Junge, den man in der Nacht von zu Hause wegholte und der sich dann Folter und Tod durch die Hände von Brums Hexenjägern ausgesetzt sah. Vielleicht konnte Nina mit ihren kleinen Wundern Fjerda etwas geben, um sich zu sammeln, einen Grund, um den Hass und die Angst infrage zu stellen, die so lange Brums Waffen gewesen waren.
»Die Anwesenheit des Asketen unterminiert alles, für das wir gearbeitet haben«, fuhr Brum fort. »Wie kann ich unsere Städte und Dörfer von fremdem Einfluss säubern, wenn da ein Ketzer mitten im Herzen unserer Regierung ist? Wir sehen wie die schlimmsten Heuchler aus, und er hat Spione in jeder Nische.«
Ylva erschauderte. »Er hat eine so entnervende Art an sich.«
»Das ist nur Schau. Der Bart. Die dunklen Gewänder. Es gefällt ihm, die Damen mit seinen merkwürdigen Äußerungen und seinem Herumgeschleiche zu verängstigen, aber er ist kaum mehr als ein krächzender Vogel. Und wir brauchen ihn, wenn wir Demidov auf den Thron schaffen wollen. Der Rückhalt des Priesters wird für Ravka von Bedeutung sein.«
»Er riecht nach Friedhof«, sagte Hanne.
»Das ist nur Räucherwerk.« Brum trommelte mit den Fingern auf die Fensterbank. »Es ist schwierig zu sagen, was der Mann wirklich glaubt. Er sagt, dass der König von Ravka von Dämonen besessen ist, dass Vadik Demidov von den Heiligen selbst gesalbt wurde, um zu regieren.«
»Wo kam Demidov überhaupt her?«, fragte Nina. »Ich hoffe so sehr, dass wir ihn kennenlernen werden.«
»Wir beschützen ihn für den Fall, dass es einem Attentäter aus Ravka in den Sinn kommt, gegen ihn zu ziehen.«
Sehr schade.
»Ist er wirklich ein Lantsov?«, fragte sie weiter.
»Er hat mehr Anrecht auf die Krone als dieser Bastard Nikolai.«
Die Kutsche kam mit einem Ruck zum Stehen, und sie stiegen aus, doch bevor Ninas Füße auch nur den Kiespfad berührten, rannte ein Soldat zu Brum, ein gefaltetes Papier in der Hand. Nina erhaschte einen Blick auf das königliche Siegel – silbernes Wachs und der gekrönte Grimjer-Wolf.
Brum erbrach das Siegel und las die Botschaft, und als er aufsah, sackte Ninas Magen herab. Trotz seiner nassen Kleider und der Demütigung, die er im Hafen erlitten hatte, strahlte er.
»Es ist an der Zeit«, sagte er.
Nina sah, wie Ylva reumütig lächelte. »Dann wirst du uns verlassen. Und ich werde jede Nacht mit Angst in meinem Herzen warten.«
»Es gibt nichts zu befürchten«, sagte Brum und steckte das Papier in die Manteltasche. »Sie können es nicht mit uns aufnehmen. Unser Augenblick ist endlich gekommen.«
Er hatte recht. Die Fjerdan hatten Panzer. Sie hatten nach Parem süchtige Grisha-Gefangene. Der Sieg war gewiss. Besonders, wenn Ravka ohne Verbündete dastand. Ich sollte da sein. Ich gehöre in diesen Kampf.
»Wirst du weit reisen?«, fragte Nina.
»Keineswegs«, sagte Brum. »Mila, du siehst so verängstigt aus! Hast du so wenig Glauben in mich?«
Nina zwang sich zu einem Lächeln. »Nein, Sir. Ich fürchte nur um Eure Sicherheit, so wie wir alle. Hier«, sagte sie. »Lasst mich Euren Mantel nehmen, damit alle hineingehen und sich wärmen können. Ihr solltet jeden Moment zusammen als Familie nutzen, bevor Kommandant Brum geht.«
»Was für ein Segen du doch bist, Mila«, sagte Ylva liebevoll.
Nina nahm ihren Mantel und Hannes und Brums, und ihre Hand schob sich bereits unauffällig in die Tasche, in die er die Botschaft gesteckt hatte.
Der Krieg kam.
Sie musste eine Botschaft an ihren Zaren senden.
3
Nikolai
Nikolai versuchte, sein nervöses Reittier zu beruhigen, indem er seinen Widerrist tätschelte. Sein Stallknecht hatte angedeutet, dass es für einen Herrscher unangemessen wäre, auf einem Pferd namens Pointe auszureiten, aber Nikolai hatte eine Schwäche für das scheckige Pony mit den krummen Ohren. Es war nicht das schönste Pferd in den königlichen Ställen, aber es konnte meilenweit laufen, ohne zu ermüden, und es besaß das ruhige Gemüt eines Felsbrockens. Normalerweise. Gerade jetzt konnte es kaum stillhalten, seine Hufe tänzelten nach rechts und links, und es zog an den Zügeln. Pointe mochte diesen Ort nicht, und Nikolai konnte es ihm nicht verdenken.
»Sag mir, dass ich nicht das sehe, was ich sehe«, sagte er mit wenig Hoffnung im Herzen.
»Was glaubst du, was du da siehst?«, fragte Tamar.
»Massenvernichtung. Sicherer Untergang.«
»Nicht ganz sicher«, erwiderte Zoya.
Nikolai warf ihr einen scharfen Blick zu. Sie hatte das schwarze Haar mit einem dunkelblauen Band zurückgebunden. Das war äußerst praktisch, aber es hatte die unglückliche Wirkung auf ihn, dass er es daraus lösen wollte. »Erkenne ich da so etwas wie Optimismus bei meiner pessimistischsten Befehlshaberin?«
»Wahrscheinlicher Untergang«, korrigierte Zoya und zog sanft an den Zügeln ihrer weißen Stute. Alle Pferde hier waren nervös.
Die Dämmerung kroch über Yaryenosh, badete die Dächer der Stadt und die Straßen in rosigem Licht. Auf den Weiden dahinter sah Nikolai eine Herde Ponys mit struppigem Winterfell, die in der Kälte mit den Hufen stampften. Es wäre eine malerische Szenerie gewesen, eine verträumte Landschaft für einen Maler von Gäulen, der sie an einen reichen Kaufmann mit einem Übermaß an Geld und einem Mangel an Geschmack verkaufte – wenn da nicht die tote, aschene Erde gewesen wäre, die die Landschaft wie ein Fleck aus verschütteter Tinte zierte. Der Pesthauch erstreckte sich von den Koppeln des Pferdehofs in der Ferne bis an die Grenzen der Stadt unten.
»Zwei Meilen?«, vermutete Nikolai und versuchte, das Ausmaß der Zerstörung zu erfassen.
»Mindestens«, sagte Tolya und spähte durch ein ausfaltbares Fernrohr. »Vielleicht drei.«
»Doppelt so groß wie bei dem Vorfall in Balakirev.«
»Es wird schlimmer«, sagte Tamar.
»Das können wir noch nicht sagen«, widersprach Tolya. Wie seine Schwester trug er eine olivgrüne Uniform, und die gewaltigen bronzefarbenen Arme waren trotz der Winterkälte bloß, um seine Sonnentätowierungen zur Schau zu stellen. »Das ist nicht unbedingt ein Muster.«
Tamar schnaubte. »Das hier ist Ravka. Es wird immer schlimmer.«
»Es ist ein Muster.« Zoyas Blick aus den blauen Augen schweifte über den Horizont. »Doch ist es sein Muster?«
»Ist das überhaupt möglich?«, fragte Tolya. »Wir hatten ihn in der Sonnenzelle eingesperrt, seit er … zurückkam.«
Zurückkam. Das Wort hatte etwas Malerisches an sich. Als hätte der Dunkle einfach nur einen Urlaub auf der Wandernden Insel gemacht, hätte verfallene Schlösser gezeichnet, die einheimischen Eintöpfe probiert. Und wäre nicht wieder ins Leben zurückgeholt worden von einem uralten Ritual, das von einem blutdürstigen Heiligen mit einer Vorliebe für Bienen inszeniert worden war.
»Ich versuche, unseren illustren Gefangenen nicht zu unterschätzen«, sagte Nikolai. »Und was möglich ist …« Nun, das Wort hatte seine Bedeutung verloren. Er war Heiligen begegnet, hatte ihre Zerstörung mit angesehen, war selbst beinahe gestorben und Wirt eines Dämons geworden. Er hatte einen längst verstorbenen Mann wiederauferstehen sehen, und er war sich ziemlich sicher, dass der Geist eines uralten Drachen in der Frau lauerte, die neben ihm ritt. Wäre möglich ein Fluss, so war dieser längst über die Ufer getreten und zur Flut geworden.
»Seht«, sagte Tolya. »Rauch.«
»Und Reiter«, fügte Tamar hinzu. »Scheint Ärger zu geben.«
Am Rand der Stadt, in deren Nähe der Pesthauch zugeschlagen hatte, sah Nikolai eine Versammlung von Männern zu Pferd. Wütende Stimmen wurden vom Wind herangetragen.
»Das da sind Suli-Wagen«, sagte Zoya, die Worte hart und abgehackt.
Ein Schuss erklang.
Sie warfen einander flüchtige Blicke zu, dann preschten sie den Hügel hinab auf das Tal zu.
Zwei Gruppen standen im Schatten einer großen Zeder, kaum ein paar Schritte von der Stelle entfernt, an der der Pesthauch dem Land das Leben ausgesaugt hatte. Sie befanden sich am Rande eines Suli-Lagers, und Nikolai sah, dass die Wagen nicht nur zu reiner Bequemlichkeit positioniert worden waren, sondern zur Verteidigung. Es war kein Kind in Sichtweite. Sie waren auf einen möglichen Angriff vorbereitet gewesen. Vielleicht, weil sie immer bereit sein mussten. Die alten Gesetze, die den Grundbesitz und das Reisen der Suli beschnitt, waren sogar noch vor der Zeit seines Vaters aufgehoben worden, aber die Vorurteile waren schwerer aus den Büchern zu streichen. Und es wurde immer schlimmer, wenn schwere Zeiten kamen. Der Mob – es gab kein anderes Wort dafür, das stellten ihre Gewehre und die fiebrig blickenden Augen klar –, der den Suli gegenübertrat, bezeugte das.
»Waffen runter!«, schrie Nikolai, noch während sie herangaloppierten. Doch nur ein paar Menschen wandten sich zu ihm um.
Tolya sprengte weiter voran und drängte sein gewaltiges Schlachtross zwischen die beiden Gruppen. »Im Namen des Zaren, legt die Waffen nieder!«, brüllte er. Er sah aus wie ein zum Leben erwachter Kriegerheiliger aus einem Buch.
»Sehr beeindruckend«, sagte Nikolai.
»Angeber«, sagte Tamar.
»Sei nicht so kleinlich. So groß zu sein wie eine Eiche sollte Vorteile mit sich bringen.«
Sowohl die Stadtbewohner als auch die Suli machten einen Schritt zurück, mit offenen Mündern angesichts eines riesigen, uniformierten Shu mit den tätowierten Armen in ihrer Mitte. Nikolai erkannte Kyril Mirov, den ortsansässigen Statthalter. Er hatte gutes Geld verdient mit dem Handel von Salzkabeljau und der Herstellung der neuen Transportfahrzeuge, die rasch Kutschen und Karren ersetzten. Er hatte kein adliges Blut in sich, aber jede Menge Ambition. Er wollte ernst genommen werden als Anführer, und das bedeutete, dass er das Gefühl hatte, etwas beweisen zu müssen. Immer besorgniserregend.
Nikolai ergriff die Gelegenheit, die Tolya ihm verschafft hatte. »Guten Morgen«, sagte er fröhlich. »Versammeln wir uns hier alle zu einem frühen Frühstück?«
Die Städter verfielen in tiefe Verbeugungen. Die Suli nicht. Sie erkannten keinen König an.
»Eure Hoheit«, sagte Mirov. Er war hager und hatte Hängewangen, die aussahen wie geschmolzenes Wachs. »Ich hatte ja keine Ahnung, dass Ihr in der Gegend seid. Ich wäre hinausgeritten, Euch zu begrüßen.«
»Was geht hier vor sich?«, fragte Nikolai ruhig und bannte die Anschuldigung aus seiner Stimme.
»Seht, was sie mit unseren Feldern angestellt haben!«, rief einer von Mirovs Männern. »Was sie der Stadt angetan haben! Zehn Häuser haben sich aufgelöst wie Rauch. Zwei Familien tot, und Gavosh der Weber auch.«
Sich aufgelöst wie Rauch. Die gleichen Berichte hatten sie aus anderen Gebieten Ravkas erhalten: ein Pesthauch, der aus dem Nichts zuschlug, eine Schattenflut, die Städte, Ackerland, Häfen einhüllte und alles, was sie berührte, auflöste, und das alles so unzeremoniell wie eine Kerze, die einfach mit einem letzten Flackern erlosch. In seinem Kielwasser hinterließ der Pesthauch Felder und Wälder bar jeden Lebens. Kilyklava, nannte man es, wie er gehört hatte – Vampir, nach einer Sagengestalt.
»Das erklärt nicht, warum ihr die Waffen gezogen habt«, sagte Nikolai milde. »Hier ist etwas Schreckliches geschehen. Aber das ist nicht das Werk der Suli.«
»Ihr Lager wurde verschont«, sagte Mirov, und Nikolai gefiel der gewichtige Ton gar nicht. Es war eine Sache, einen schnappenden Hund zu beruhigen, aber eine andere, mit einem Mann vernünftig zu reden, der sich einen hübsch ordentlichen Schützengraben gebuddelt und ihn verstärkt hatte. »Dieses … Ding, dieses Grauen, schlug nur wenige Tage nach ihrer Ankunft auf unserem Land zu.«
»Euer Land«, sagte ein Suli, der in der Mitte der Gruppe stand. »Es gab Suli in jedem Land diesseits der Wahren See, bevor sie auch nur Namen hatten.«
»Und was habt ihr hier gebaut?«, fragte ein Metzger in einer schmutzigen Schürze. »Nichts. Das hier sind unsere Heime, unsere Geschäfte, unsere Weiden und unser Vieh.«
»Es ist ein verfluchtes Volk«, sagte Mirov, als führte er eine Tatsache an – wie den Niederschlag des letzten Jahres oder den Weizenpreis. »Das weiß jeder.«
»Mir gefällt es gar nicht, wenn man mich von einer Feier ausschließt«, sagte Nikolai, »aber so etwas ist mir nicht bekannt, und dieser Pesthauch hat auch anderswo zugeschlagen. Es ist ein Naturphänomen, eines, das meine Materialki untersuchen und für das sie eine Lösung finden werden.« Eine ungestüme Mischung aus Lügen und Optimismus, doch ein wenig Übertreibung hatte noch niemandem geschadet.
»Sie dringen unbefugt in Graf Nerenskis Land ein.«
Nikolai legte sich den Mantel der lantsovschen Autorität um. »Ich bin Ravkas Zar. Der Graf hält diese Ländereien nach meinem Belieben. Ich sage, dass diese Leute hier willkommen sind und unter meinem Schutz stehen.«
»Sagt der Bastard«, grummelte der Metzger.
Schweigen sank herab.
Zoya ballte die Fäuste, und Donner grollte über die Felder.
Doch Nikolai hob die Hand. Das war kein Krieg, den sie mit Gewalt gewinnen würden.
»Würdest du das wiederholen?«, fragte er.
Die Wangen des Metzgers waren rot, die Stirn gerunzelt. Der Mann mochte glatt mit Herzversagen umkippen, wenn ihn seine Ignoranz nicht zuerst umbrachte. »Ich sagte, Ihr seid ein Bastard und passt nicht auf dieses schicke Pferd.«
»Hast du das gehört, Pointe? Er hat dich schick genannt.« Nikolai wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Metzger zu. »Du sagst, ich bin ein Bastard. Warum? Weil unsere Feinde das machen?«
Ein angespanntes Murmeln lief durch die Menge. Füße schabten über den Boden. Aber niemand sprach. Gut.
»Nennt ihr jetzt Fjerda euren Meister?« Seine Stimme erhob sich über die versammelten Städter, über die Suli. »Werdet ihr lernen, ihre Sprache zu sprechen? Werdet ihr vor ihrem reinblütigen Königspaar knien, wenn ihre Panzer Ravkas Grenzen überrollen?«
»Nein!«, schrie Mirov. Er spuckte aus. »Niemals!«
Einer geschafft.
»Fjerda hat eure Waffen mit Lügen über meine Abstammung geladen. Sie hoffen, dass ihr eure Waffen gegen mich richtet, gegen eure Landsleute, die selbst jetzt an euren Grenzen wachen, bereit, dieses Land zu verteidigen. Sie hoffen, dass ihr das blutige Werk des Kriegs für sie erledigt.«
Natürlich war Nikolai hier der Lügner. Aber Könige taten, was sie wollten; Bastarde taten, was sie mussten.
»Ich bin kein Verräter«, fauchte der Metzger.
»Du klingst aber mal sicher wie einer«, sagte Mirov.
Der Metzger warf sich in die Brust. »Ich habe für das Achtzehnte Regiment gekämpft, und das wird mein Sohn auch.«
»Ich wette, du hast viele Fjerdan in die Flucht geschlagen«, sagte Nikolai.
»Verdammt richtig, das hab ich«, sagte der Metzger.
Doch der Mann hinter ihm war weniger überzeugt. »Ich möchte nicht, dass meine Kinder in einem weiteren Krieg kämpfen. Schickt diese Hexen vor.«
Jetzt ließ Zoya Blitze durch die Luft um sie herum knistern. »Die Grisha führen den Sturm, und ich fange mir die erste Kugel ein, wenn es sein muss.«
Mirovs Männer traten einen Schritt zurück.
»Ich sollte euch danken«, sagte Nikolai mit einem Lächeln. »Wenn Zoya es sich in den Kopf setzt, heroisch zu sein, dann kann sie sehr beängstigend sein.«
»Das würde ich mal so sagen«, quietschte der Metzger.
»Menschen sind hier gestorben«, sagte Mirov und versuchte, etwas Autorität zurückzugewinnen. »Dafür muss sich jemand verantworten …«
»Wer verantwortet sich für die Dürre?«, fragte Zoya. Ihre Stimme durchschnitt die Luft wie eine gut geschliffene Klinge. »Für Erdbeben? Für Wirbelstürme? Sind wir so? Kreaturen, die beim ersten Anzeichen von Ärger heulen? Oder sind wir Ravkan – praktisch, modern, nicht länger die Gefangenen des Aberglaubens?«
Einige der Stadtbewohner blickten aufgebracht drein, aber andere wirkten richtiggehend gescholten. In einem anderen Leben hätte Zoya eine schreckenerregende Gouvernante abgegeben – mit geradem Rücken, saurer Miene und voll und ganz in der Lage, jeden Anwesenden dazu zu bringen, sich vor Angst in die Hose zu machen. Aber eine Suli starrte Zoya an, ihre Miene grüblerisch, und seine Befehlshaberin, auf die man normalerweise zählen konnte, dass sie jedem unverschämten Blick mit einem finsteren Blick begegnete, so mächtig, dass er Wälder versengen konnte, bekam es entweder nicht mit oder ignorierte sie vorsätzlich.
»Khaj pa ve«, sagte die Frau. »Khaj pa ve.«
Nikolai war zwar neugierig, aber es gab Dringenderes, um das er sich kümmern musste. »Ich weiß, das ist wenig Trost, aber wir sollten besprechen, welche Hilfe die Krone anbieten kann, um euch für euer verlorenes Land und die Häuser zu entschädigen. Ich werde …«
»Ich spreche mit dem Statthalter«, sagte Zoya knapp.
Nikolai hatte geplant, selbst mit Mirov zu reden, da das Interesse des Mannes an Status ihn empfänglich machen könnte für die Aufmerksamkeit des Zaren. Aber Zoya lenkte ihre Stute bereits auf ihn zu.
»Sei charmant«, flüsterte er ihr warnend zu.
Sie warf ihm ein warmherziges Lächeln zu und blinzelte. »Das werde ich.«
»Das war ja sehr überzeugend.«
Das Lächeln verschwand augenblicklich. »Ich hab Jahre zusehen müssen, wie du in ganz Ravka herumschmeichelst. Ich habe ein paar Kniffe gelernt.«
»Ich schmeichle nicht herum.«
»Gelegentlich schmeichelst du herum«, sagte Tolya.
»Ja«, räumte Nikolai ein. »Aber es ist gewinnend.«
Er beobachtete, wie Zoya von ihrem Pferd rutschte und Mirov wegführte. Der Mann sah ziemlich verblüfft aus, eine häufige Nebenwirkung von Zoyas Schönheit und dem allgemein mörderischen Auftreten. Vielleicht gab es doch etwas, das noch berauschender war für Mirov als sein Status.
Zoya hatte jedoch keinen Vorteil bei Mirov genutzt. Sie war davongerannt. Sie hatte nicht gewollt, dass die Suli sich ihr gegenüberstellte, und das sah seiner Befehlshaberin nicht ähnlich. Zumindest bisher nicht. Seit sie Juris verloren hatte, seit ihrem Kampf auf der Schattenflur, hatte sich Zoya verändert. Es war, als würde er sie aus der Ferne betrachten, als hätte sie sich einen Schritt von jedem und allem entfernt. Und doch war sie so scharfsichtig wie immer, ihre Rüstung saß, eine Frau, die durch die Welt ging mit Präzision und Eleganz, und wenig Zeit für Gnade.
Er wandte seine Aufmerksamkeit der Suli zu. »Für eure Sicherheit mag es besser sein, wenn ihr heute Abend weiterzieht.«
Ihr Anführer sträubte sich. »Was immer dieser Schrecken ist, wir hatten nichts damit zu tun.«
»Das weiß ich, aber wenn die Nacht hereinbricht, herrschen vielleicht keine kühleren Köpfe mehr vor.«
»Sieht so der Schutz von Ravkas Zar aus? Ein Befehl, in die Schatten zu fliehen?«
»Das ist kein Befehl, das ist ein Vorschlag. Ich kann bewaffnete Männer hier stationieren, die euer Lager verteidigen, aber ich denke nicht, dass ihr deren Anwesenheit willkommen heißen würdet.«
»Damit hättet Ihr recht.«
Nikolai wollte diese Menschen nicht ohne einen Unterschlupf zurücklassen. »Wenn ihr möchtet, kann ich Gräfin Gretsina eine Botschaft schicken, dass sie euch ihre Felder öffnen soll.«
»Sie würde Suli auf ihren Ländereien willkommen heißen?«