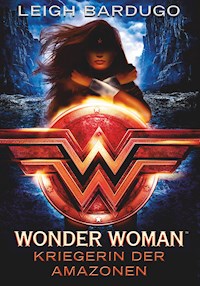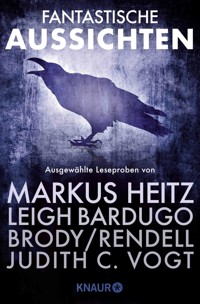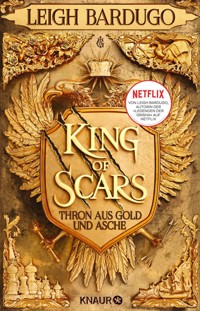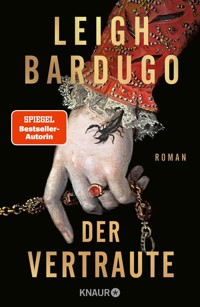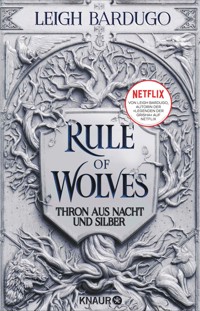9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Legenden der Grisha
- Sprache: Deutsch
Das Finale der Grisha-Trilogie von Fantasy-Bestseller-Autorin Leigh Bardugo Tief unter der Erde versteckt sich Alina vor dem Dunklen, der nun endgültig die Macht in Ravka übernommen hat. Um sie hat sich ein Kult gebildet, der sie als Sonnenkriegerinverehrt – doch in den Höhlen kann Alina ihre Kräfte nicht anrufen. Und die einst mächtige Armee der Grisha ist fast vollständig zerschlagen. Alinas letzte Hoffnung gilt nun den magischen Kräften des legendären Feuervogels – und der winzigen Chance, dass ein geächteter Prinz noch leben könnte. Gemeinsam mit Mal macht sich Alina auf die Suche. Doch der Preis für die uralte Magie des Feuervogels könnte alles zerstören, wofür sie so lange gekämpft haben. Nicht nur Fans der Fantasy-Bestseller »Das Lied der Krähen« und »Das Gold der Krähen« werden von Leigh Bardugos Grisha-Trilogie begeistert sein: Zwischen Abenteuer, Märchen und zarter Romance ist die Welt der Grisha mit ihrem ausgeklügelten Magie-System und den lebendigen, facettenreichen Charakteren ein absolutes Highlight der Fantasy. Entdecke das gesamte GrishaVerse Die Grisha-Trilogie ist in folgender Reihenfolge erschienen: - »Goldene Flammen« - »Eisige Wellen« - »Lodernde Schwingen« Die Krähen-Dilogie ist in folgender Reihenfolge erschienen: - »Das Lied der Krähen« - »Das Gold der Krähen« Die Thron aus Nacht und Silber-Dilogie besteht aus - King of Scars - Rule of Wolves Noch mehr Geschichten aus der Grisha-Welt: - »Die Sprache der Dornen« (illustrierte Märchen aus der Welt der Grisha) - »Die Leben der Heiligen« (illustrierte Heiligen-Legenden aus der Welt der Grisha) - »Demon in the Wood. Schatten der Vergangenheit« (Graphic Novel zur Vorgeschichte des Dunklen)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Sammlungen
Ähnliche
Leigh Bardugo
Lodernde Schwingen
Roman
Aus dem Englischen von Henning Ahrens
Knaur e-books
Über dieses Buch
Tief unter der Erde erholt sich Alina von ihrem verlorenen Kampf gegen den Dunklen, der nun endgültig die Macht über Ravka an sich gerissen hat. In den Höhlen hat sich ein Kult versammelt, der sie als Sonnenheilige verehrt – doch dort kann Alina ihre Kräfte nicht anrufen. Und die einst mächtige Armee der Grisha ist fast vollständig zerschlagen.
Alinas letzte Hoffnung gilt nun den magischen Kräften des legendären Feuervogels – und der winzigen Chance, dass ein geächteter Prinz noch leben könnte. Gemeinsam mit Mal macht sich Alina auf die Suche. Doch der Preis für die uralte Magie des Feuervogels könnte alles zerstören, wofür sie so lange gekämpft haben.
Inhaltsübersicht
Für meinen Vater, Harve.
Manche unserer Helden schaffen es nicht ganz.
Die Grisha
Soldaten der Zweiten Armee
Meister der Kleinen Künste
Orden der Lebenden und der Toten
Entherzer
Heiler
Orden der Beschwörer
Stürmer
Inferni
Fluter
Orden der Fabrikatoren
Durasten
Alkemi
davor
Das Ungeheuer hieß Izumrud, und manche sagten, es habe die Gänge unterhalb von Ravka geschaffen. Von einem unersättlichen Hunger getrieben, habe dieser gewaltige Wurm Schlick und Gestein verschlungen, sich immer tiefer gebohrt, bis er zu weit vorgedrungen sei und sich am Ende in der Finsternis verirrt habe.
Das war nur eine Legende, aber die Menschen in der Weißen Kathedrale mieden trotzdem alle Gänge, die zu weit von den großen Grotten entfernt waren. Im halbdunklen Gewirr der Gänge hallten sonderbare Geräusche – manchmal ein Stöhnen, manchmal ein rätselhaftes Rumpeln. Die Totenstille wurde von leisem Zischen gestört, das vielleicht nichts weiter zu bedeuten hatte, vielleicht aber auch von einem langen Körper stammte, der sich auf Beutejagd durch nahe Gänge schlängelte. In solchen Augenblicken glaubte man gern, dass Izumrud, der gewaltige Wurm, noch lebte, dass er darauf wartete, von dem Ruf der Helden geweckt zu werden, und davon träumte, ein Kind zu fressen, das arglos in sein Maul spazierte. Denn ein solches Ungeheuer stirbt nicht; es ruht nur.
Als er noch zu dem Mädchen durfte, erzählte der Junge diese Legende und alle anderen Geschichten, die er aufschnappte. Er saß neben ihrem Bett und versuchte, sie zu füttern, lauschte ihrem pfeifenden, gequälten Atem und erzählte ihr die Geschichte eines Flusses, der von einem Fluter gezähmt und darauf abgerichtet wurde, auf der Suche nach einer Zaubermünze durch Gesteinsschichten zu tauchen. Er erzählte ihr im Flüsterton von dem armen, verfluchten Pelyekin, der tausend Jahre die magische Spitzhacke schwang und so unzählige Gänge und Grotten schuf, ein einsames Geschöpf, das auf der Suche nach Zerstreuung Gold und Edelsteine anhäufte, mit denen er nichts anzufangen wusste.
Und dann, eines Morgens, standen bewaffnete Männer vor der Tür des Mädchens. Als der Junge nicht weichen wollte, wurde er in Ketten fortgeschafft. Friede bringe nur der Glaube, ermahnte ihn der Priester, und sein Leben hänge vom Gehorsam ab.
Das einsame Mädchen, in eine Zelle gesperrt, in der es nur seinen Herzschlag und das Geräusch fallender Wassertropfen hörte, war überzeugt, dass die Geschichte von Izumrud der Wahrheit entsprach. Sie war mit Haut und Haaren verschlungen worden, und im hallenden Alabasterbauch der Weißen Kathedrale verblieb nur die Heilige.
Die Heilige erwachte täglich vom Klang ihres Namens, den die Gläubigen sangen. Täglich schwollen die Ränge ihres Heeres durch die Hoffnungslosen und Hungrigen weiter an, durch verwundete Soldaten und Kinder, zu jung, um Waffen führen zu können. Der Priester predigte den Gläubigen, dass das Mädchen eines Tages Zarin werde, und sie glaubten ihm. Sie wunderten sich jedoch über ihren sonderbar verwahrlosten Hofstaat: die scharfzüngige Stürmerin mit den pechschwarzen Haaren, die Verstümmelte mit dem schwarzen Gebetstuch und den grausigen Narben, der blasse Gelehrte, der sich mit seinen Büchern und rätselhaften Geräten verkroch. Das war der klägliche Rest der Zweiten Armee – und keine passende Gesellschaft für eine Heilige.
Wenige wussten, wie schlimm es um sie stand. Die Macht, mit der sie gesegnet gewesen war, ob göttlichen Ursprungs oder nicht, war verloren – oder nicht mehr greifbar. Man sorgte dafür, dass ihre Anhänger sie nicht von Nahem sahen, damit ihnen nicht auffiel, dass ihre Augen dunkle Höhlen waren und dass ihr Atem in angsterfüllten Stößen kam. Sie schleppte sich dahin, denn ihre Knochen waren brüchig wie Treibholz, ein kränkliches Mädchen, auf dem alle Hoffnungen ruhten.
Oben regierte der neue Zar mit seinem Schattenheer und forderte die Auslieferung seiner Sonnenkriegerin. Er versuchte es abwechselnd mit Zuckerbrot und Peitsche, aber die Antwort bestand jedes Mal in einer Provokation – ausgeführt von einem Gesetzlosen, den man Prinz der Lüfte nannte. Er schlug an der Nordgrenze zu, bombardierte die Nachschublinien und zwang den Fürsten der Schatten, den Handel anzukurbeln und Fahrten durch die Schattenflur anzuordnen. Diese unternahm man auf gut Glück, mehr oder weniger gut geschützt von Inferni, die die Ungeheuer durch ihre Flammen abwehrten. Manche hielten seinen Gegenspieler für einen Prinzen aus dem Geschlecht der Lantsov. Andere hielten ihn für einen Fjerdan-Rebellen, der sich weigerte, in den Reihen der Hexen zu kämpfen. Aber alle stimmten darin überein, dass er eine mächtige Gabe besitzen musste.
Die Heilige rüttelte an den Stäben ihres unterirdischen Käfigs. Dies war ihr Krieg, und sie wollte ihre Freiheit haben, um ihn führen zu können. Der Priester gab nicht nach.
Doch er hatte vergessen, dass sie in Keramzin, vor ihrer Zeit als Grisha und als Heilige, ein Geist gewesen war. Gemeinsam mit dem Jungen hatte sie Geheimnisse gehortet wie Pelyekin seine Schätze. Beide wussten, wie man sich in Diebe und Phantome verwandelte, wie man seine Stärken verbarg und seine Streiche vertuschte. Wie die Lehrer auf dem Anwesen des Herzogs bildete sich auch der Priester ein, das Mädchen genau zu kennen und beurteilen zu können, wozu sie imstande war.
Er sollte sich irren.
Denn ihm entging die Geheimsprache, mit der die beiden sich verständigten, und er unterschätzte die Entschlossenheit des Jungen. Er merkte nicht, dass das Mädchen nach einer Weile nicht mehr unter ihrer Schwäche litt, sondern diese nur noch vortäuschte.
1
Ich stand mit ausgebreiteten Armen auf einem Balkon, den man aus dem Gestein gehauen hatte, und versuchte, eine möglichst gute Vorstellung zu geben. Ich zitterte, denn meine Kefta war nur Flickwerk. Sie bestand aus Resten des Gewands, das ich bei meiner Flucht aus dem Palast getragen hatte, und aus dem Stoff eines hässlichen Vorhangs, der angeblich aus einem ehemaligen Theater in der Nähe von Sala stammte. Die Glasperlen, mit denen der Saum meiner Kefta geschmückt war, kamen auch aus jenem Theater und hatten zu den Kronleuchtern gehört. Die Stickereien auf den Ärmelaufschlägen lösten sich bereits langsam auf. David und Genya hatten sich große Mühe gegeben, aber hier, unter der Erde, waren die Mittel begrenzt. Aus der Entfernung funktionierte es trotzdem. Das Gewand funkelte golden und erweckte so den Eindruck, dass ich das Licht aufrufen würde, und ein heller Schein tanzte über die verzückten Gesichter meiner Anhänger, die weit unter mir standen. Aus der Nähe betrachtet, waren es nur lose Fäden und falscher Glanz. Und das passte zu mir, der fadenscheinigen Heiligen.
Die Stimme des Asketen dröhnte in der Weißen Kathedrale. Die Menschen schwankten mit geschlossenen Augen hin und her wie Mohnblumen im Wind, ihre gereckten Arme glichen bleichen Stängeln. Ich vollführte eine einstudierte Abfolge von Gesten und Schritten, damit David und der Inferni, der ihm morgens half, von ihrem Versteck in der Kammer oberhalb des Balkons meinen Bewegungen folgen konnten. Ich verabscheute diesen morgendlichen Mummenschanz, aber der Priester hielt ihn für unverzichtbar.
»Es ist Euer Geschenk an Euer Volk, Sankta Alina«, sagte er. »Ihr schenkt ihm Hoffnung.«
In Wahrheit war es nur eine Illusion, ein schwacher Abglanz meiner früheren Macht. Das goldene Funkeln verdankte ich Inferni-Flammen, reflektiert durch eine Spiegelschüssel, die David aus Glasresten gebaut hatte. Sie ähnelte jenen, mit denen wir den Angriff der Horden des Dunklen während der Schlacht um Os Alta hatten zurückschlagen wollen. Vergeblich, denn wir waren überrumpelt worden, und weder meine Macht noch unsere Pläne, weder Davids Genialität noch Nikolais Erfindungsreichtum hatten dem Gemetzel ein Ende setzen können. Seither hatte ich keinen einzigen Sonnenstrahl mehr aufrufen können. Zum Glück hatten die allermeisten Schäfchen in der Herde des Asketen nie erlebt, welche Macht ihre Heilige in Wahrheit entfalten konnte, und deshalb würde die Täuschung wohl vorerst ausreichen.
Der Asket beendete seine Predigt. Das war das Zeichen. Der Inferni sorgte dafür, dass ich in strahlendes Licht getaucht wurde. Es zuckte und sprang wie wild hin und her und erlosch, sobald ich die Arme senkte. Ich ahnte, wer heute als Inferni Dienst tat, und sah grimmig zur Kammer auf. Harshaw. Er ließ sich jedes Mal hinreißen. Drei Inferni waren der Schlacht um den Kleinen Palast entkommen. Eine war kurz darauf an ihren Verletzungen gestorben, und von den beiden Übrigen war Harshaw der Mächtigere, aber auch der Unberechenbarere.
Ich verließ den Balkon, um dem Asketen so rasch wie möglich zu entfliehen, aber mein Fuß knickte um, und ich stolperte. Der Priester griff nach meinem Arm, um mich zu stützen.
»Seid vorsichtig, Alina Starkov. Ihr müsst Euch in Acht nehmen, damit Euch nichts geschieht.«
»Danke.« Ich hätte mich am liebsten losgerissen, um dem Gestank nach aufgewühlter Erde und Weihrauch zu entkommen, den er überall verströmte.
»Ihr fühlt Euch heute unwohl.«
»Ich bin bloß ungeschickt.« Wir wussten beide, dass ich log. Ich war zwar kräftiger als bei meiner Ankunft in der Weißen Kathedrale – meine Knochenbrüche waren verheilt, und ich behielt das Essen bei mir –, aber ich war immer noch angeschlagen, hatte ständig Schmerzen und fühlte mich schlapp.
»Dann solltet Ihr Euch ausruhen.«
Ich knirschte mit den Zähnen. Noch ein Tag in dem Kerker, der sich meine Kammer nannte. Ich schluckte die Frustration hinunter und lächelte schwach. Ich wusste, was er sehen wollte.
»Mir ist so kalt«, sagte ich. »Ein bisschen Zeit im Kessel würde mir guttun.« Das stimmte sogar. In der Weißen Kathedrale war der Kessel, wie man die Küche nannte, der einzige Ort, an dem es nicht so feucht war. Zu dieser Stunde würde wenigstens ein Feuer brennen, weil man das Frühstück zubereitete. Die große, runde Grotte wäre vom Duft nach frischem Brot und süßem Brei aus Trockenerbsen und Milchpulver erfüllt. Diese Vorräte wurden von Verbündeten auf der Oberfläche geliefert und von den Pilgern eingelagert.
Ich zitterte noch einmal demonstrativ, aber die Antwort des Priesters bestand nur in einem unverbindlichen »Hmm«.
Da bemerkte ich Bewegungen unten in der Grotte: frisch eingetroffene Pilger. Ich kam nicht umhin, sie mit einem strategischen Auge zu mustern. Einige trugen Uniformen, die sie als Fahnenflüchtige der Ersten Armee auswiesen. Sie wirkten jung und kräftig.
»Keine Veteranen?«, fragte ich. »Keine Witwen?«
»Der Weg unter die Erde ist beschwerlich«, antwortete der Asket.
»Viele sind zu alt oder zu schwach und bleiben lieber in ihrem gemütlichen Zuhause.«
Ich hielt das für unwahrscheinlich. Die Pilger kamen auf Krücken und Stöcken, egal wie alt oder wie krank. Sogar Sterbende wollten vor ihrem Tod noch einen Blick auf Sankta Alina werfen. Ich sah mich wachsam um und erblickte die Priestergardisten, die unter dem Torbogen Wache hielten. Diese bärtigen, schwer bewaffneten Männer waren Mönche, gelehrte Priester wie der Asket, und die Einzigen, die unter der Erde Waffen tragen durften. Oben traten sie als Torhüter auf, sortierten Spione und Ungläubige aus und gewährten jenen Schutz, die sie für würdig hielten. In letzter Zeit waren weniger Pilger eingetroffen, und jene, die kamen, wirkten eher forsch als fromm. Der Asket wollte nicht nur hungrige Mäuler stopfen, nein, er brauchte auch Männer, die ihm als Soldaten dienen konnten.
»Ich könnte die Kranken und Alten besuchen.« Ich ahnte zwar, dass er ablehnen würde, aber diese Geste wurde von mir erwartet.
»Eine Heilige sollte sich nicht wie eine Ratte in ihrem Loch verkriechen, sondern bei ihrem Volk sein.«
Der Asket lächelte – dieses gütige, gnädige Lächeln entzückte die Pilger, ich fand es jedoch widerlich. »Viele Tiere verbergen sich während unruhiger Zeiten unter der Erde. So überleben sie«, sprach er. »Wenn die Narren ihre Kämpfe ausgefochten haben, sind es die Ratten, die Stadt und Land beherrschen.«
Und sich an den Toten mästen, dachte ich erschaudernd. Als könnte er meine Gedanken lesen, legte er mir eine Hand auf die Schulter. Mit ihren langen, bleichen Fingern sah sie aus wie eine wächserne Spinne. Falls diese Geste tröstlich gemeint war, erfüllte sie ihren Zweck nicht.
»Geduld, Alina Starkov. Wir werden uns erheben. Aber erst, wenn die Zeit dafür gekommen ist.«
Geduld. Das war sein gebetsmühlenartig wiederholtes Rezept. Ich widerstand dem Drang, mein Handgelenk zu berühren, die leere Stelle, an der ich die Knochen des Feuervogels hätte tragen sollen. Ich besaß die Schuppen der Meeresgeißel und den Halsreif aus Hirschhorn, aber das letzte Teil von Morozovas Puzzle fehlte. Der dritte Kräftemehrer wäre längst in unserem Besitz, wenn der Asket unsere Suche unterstützt oder uns an die Oberfläche gelassen hätte. Doch er wollte dies nur unter bestimmten Bedingungen erlauben.
»Mir ist kalt«, wiederholte ich, um meine Gereiztheit zu verbergen. »Ich will in die Küche.«
Er runzelte die Stirn. »Es gefällt mir nicht, dass Ihr dort mit diesem Mädchen zusammenhockt …«
Im Hintergrund tuschelten die Priestergardisten, und ein Wort drang an meine Ohren. Razrusha’ya. Ich schlug die Hand des Asketen weg und ging direkt auf die Männer zu. Sie nahmen Haltung an. Sie trugen Braun, wie alle ihre Brüder, dazu das goldene Sonnensymbol, das auch das Gewand des Asketen schmückte. Mein Symbol. Doch sie sahen mir nie ins Gesicht und wechselten auch kein Wort mit mir oder den anderen geflüchteten Grisha. Stattdessen standen sie immer stumm an den Wänden und folgten mir überallhin wie bärtige, Gewehre schwingende Geister.
»Diese Bezeichnung ist tabu«, sagte ich. Sie blickten so starr geradeaus, als wäre ich unsichtbar. »Sie heißt Genya Safin, und ohne sie wäre ich immer noch die Gefangene des Dunklen.« Keine Reaktion. Aber ich merkte, wie sie bei dem bloßen Klang des Namens erstarrten. Bis an die Zähne bewaffnete Männer, die sich vor einem entstellten Mädchen fürchteten. Abergläubische Idioten.
»Friede, Sankta Alina«, sagte der Asket, packte mich am Ellbogen und führte mich durch den Gang in sein Audienzzimmer. Man hatte eine Rose in das silbern geäderte Gestein der Decke gehauen und die Wände mit Heiligen bemalt, ein jeder mit goldenem Heiligenschein. Das konnte nur das Werk von Fabrikatoren sein, denn gewöhnliche Pigmente hielten der Kälte und Feuchtigkeit in der Weißen Kathedrale nicht lange stand. Der Priester setzte sich auf einen niedrigen Holzstuhl und bat mich mit einer Geste, ebenfalls Platz zu nehmen. Ich versuchte, meine Erleichterung zu verbergen, als ich auf den Stuhl sank. Sogar zu langes Stehen ermüdete mich.
Er musterte meine gelbliche Haut und die dunklen Ringe unter meinen Augen. »Kann Genya nicht etwas mehr für Euch tun?«
Der Kampf gegen den Dunklen war jetzt über zwei Monate her, doch ich hatte mich noch nicht vollständig erholt. In meinem eingefallenen Gesicht stachen die Wangenknochen zornig hervor, und meine schlohweißen Haare waren so fein, dass sie wie Spinnweben in der Luft zu schweben schienen. Es hatte mich viel Zeit und Mühe gekostet, dem Asketen die Erlaubnis abzuringen, mich von Genya in der Küche behandeln zu lassen. Er hatte in erster Linie eingewilligt, weil ich ihm versprochen hatte, dass sie mich durch ihre Künste vorzeigbarer machen würde. Das war seit vielen Wochen mein erster Kontakt mit einer anderen Grisha. Ich hatte jeden Moment genossen, jede noch so kleine Neuigkeit.
»Sie gibt ihr Bestes«, sagte ich.
Der Priester seufzte. »Nun, wir müssen uns wohl alle in Geduld fassen. Mit der Zeit werdet Ihr genesen. Wenn Ihr glaubt. Wenn Ihr betet.«
Wut flammte in mir auf. Er wusste verdammt gut, dass ich nur durch eines wieder gesund werden würde, nämlich durch den Gebrauch meiner Macht, aber dazu hätte ich an die Oberfläche zurückkehren müssen.
»Wenn Ihr mir einen kurzen Ausflug an die Oberfläche gestatten würdet …«
»Ihr seid zu wertvoll für uns, Sankta Alina, und das Risiko wäre zu hoch.« Er zuckte entschuldigend mit den Schultern. »Da Ihr nicht auf Euch achtgebt, muss ich es tun.«
Ich schwieg. Wir spielten dieses Spiel, seit man mich hierhergebracht hatte. Der Asket hatte viel für mich getan. Ohne ihn hätte kein Einziger meiner Grisha den Kampf gegen die Ungeheuer des Dunklen überlebt. Er hatte uns eine sichere Zuflucht unter der Erde geboten. Trotzdem empfand ich die Weiße Kathedrale in immer stärkerem Maße als Gefängnis.
Er legte die Fingerspitzen beider Hände aneinander. »Nach so vielen Monaten vertraut Ihr mir noch immer nicht?«
»Doch«, log ich. »Natürlich vertraue ich Euch.«
»Aber Ihr wollt Euch nicht helfen lassen. Alles wäre anders, wenn der Feuervogel in unseren Händen wäre.«
»David studiert Morozovas Aufzeichnungen. Ich bin überzeugt, dass sie die Antwort enthalten.«
Der Asket betrachtete mich bohrend aus seinen schwarzen Augen. Er argwöhnte, dass ich wusste, wo der Feuervogel zu finden war – Morozovas dritter Kräftemehrer und der Schlüssel zur Entfesselung der einzigen Macht, die imstande wäre, den Dunklen zu besiegen und die Schattenflur zu vernichten. Und er hatte recht. Jedenfalls hoffte ich das. Unser einziger Hinweis verbarg sich in meinen spärlichen Kindheitserinnerungen. Ich klammerte mich an die Hoffnung, dass die staubigen Ruinen von Dva Stolba mehr waren, als sie zu sein schienen. Doch ob ich mich nun irrte oder nicht – der mögliche Aufenthaltsort des Feuervogels war ein Geheimnis, das ich nicht preisgeben wollte. Ich war unter der Erde isoliert und nahezu machtlos und wurde auf Schritt und Tritt von der Priestergarde verfolgt. Wie konnte ich da den letzten Trumpf aus der Hand geben, den ich noch besaß?
»Ich will nur Euer Bestes, Alina Starkov. Und das Eurer Freunde. So wenige bleiben Euch. Wenn ihnen etwas zustoßen sollte …«
Ich vergaß, nett und freundlich zu sein, und fauchte: »Ihr werdet ihnen nichts tun.«
Der Blick des Asketen war etwas zu herausfordernd, wie ich fand.
»Ich meine doch nur, dass hier, unter der Erde, leicht ein Unfall passieren kann. Ich weiß, wie tief Euch jeder Verlust schmerzen würde, und Ihr seid ja noch so schwach.« Bei dem letzten Wort entblößte er sein Zahnfleisch. Es war so schwarz wie das eines Wolfs.
Wieder überkam mich die Wut. Seit meinem allerersten Tag in der Weißen Kathedrale saß mir eine Bedrohung im Nacken, die für eine ständige und erstickende Angst sorgte. Der Asket erinnerte mich bei jeder Gelegenheit daran, wie verwundbar ich war. Ohne nachzudenken, schnippte ich mit meinen in den Ärmeln verborgenen Fingern. Schatten sprangen an den Wänden hinauf.
Der Asket zuckte auf seinem Stuhl zusammen. Ich sah ihn stirnrunzelnd an und spielte die Verwirrte. »Was habt Ihr?«, fragte ich.
Er räusperte sich und ließ den Blick nach rechts und nach links huschen. »Nichts … gar nichts«, stotterte er.
Ich ließ die Schatten nach unten gleiten. Die Benommenheit, die dieser Trick in mir auslöste, wurde durch seine Reaktion mehr als wettgemacht. Aber das war auch schon alles. Ich konnte nur die Schatten springen und tanzen lassen. Es war ein klägliches Echo der Macht des Dunklen, das nach dem Kampf, der uns beide fast das Leben gekostet hätte, immer noch in mir nachhallte. Ich hatte es entdeckt, als ich verzweifelt versucht hatte, das Licht aufzurufen. Vergeblich hatte ich mich bemüht, die Schatten zu etwas auszubauen, das ich als Waffe einsetzen konnte. Nun empfand ich sie nur noch als Strafe, als Abklatsch einer größeren Macht, der mich, die Heilige der Taschenspielertricks, verhöhnte.
Der Asket rang immer noch um Fassung. »Ihr geht ins Archiv«, sagte er entschieden und stand auf. »Dort könnt Ihr Euch in aller Ruhe Eurem Studium widmen und nachdenken. Das wird Euch guttun.«
Ich unterdrückte ein Stöhnen. Das war eine echte Strafe – Stunden mit dem sinnlosen Versuch zu verbringen, in alten religiösen Texten Hinweise auf Morozova zu finden. Ganz zu schweigen davon, dass das Archiv feucht und ungemütlich war und nur so von Priestergardisten wimmelte. »Ich begleite Euch«, fügte er hinzu. Auch das noch.
»Und der Kessel?«, fragte ich und versuchte, die Verzweiflung aus meiner Stimme zu verbannen.
»Später. Razru… Genya wird warten«, sagte er, als ich ihm in den Gang folgte. »Und warum immer die Küche? Ihr könntet Euch auch hier mit Genya treffen. Ganz ungestört.«
Ich warf den beiden Gardisten, die uns dicht auf den Fersen waren, einen Blick zu. Ganz ungestört? Das war lächerlich. Aber die Vorstellung, nicht mehr in den Kessel zu dürfen, war entsetzlich. Vielleicht würde man den großen Rauchfang heute länger als nur wenige Sekunden öffnen. Das war eine schwache Hoffnung, aber die einzige, die ich hatte.
»Ich bin lieber in der Küche«, sagte ich. »Dort ist es warm.« Ich schenkte ihm mein demütigstes Lächeln und fügte mit zitternder Unterlippe hinzu: »Sie erinnert mich an mein Zuhause.«
Diese Vorstellung fand er herrlich: eine vor dem Herd in die Asche gekauerte Magd. Noch eine Illusion, ein weiteres Kapitel für sein Heiligenbuch.
»Nun gut«, sagte er schließlich.
Wir brauchten lange, um vom Balkon nach unten zu gelangen. In der Weißen Kathedrale, der gewaltigen, zentralen Grotte mit den Alabasterwänden, denen sie ihren Namen verdankte, fand morgens und abends der Gottesdienst statt. Aber sie war weit mehr – ein weitverzweigtes Netzwerk von Gängen und Höhlen, eine unterirdische Stadt. Ich hasste jeden Quadratzentimeter. Ich hasste die Nässe, die aus den Wänden rann, von den Decken tropfte und auf meiner Haut Perlen bildete. Die Kälte, die man niemals abschütteln konnte. Die Giftpilze und Nachtschattengewächse, die in Rissen und Spalten gediehen. Ich hasste es, wie man hier die Zeit maß: anhand von Morgenmesse, Nachmittagsgebet und Abendmesse, anhand von Tagen, an denen man bestimmter Heiliger gedachte, ganz fastete oder nur halb. Am schlimmsten fand ich allerdings das Gefühl, eine kleine, bleiche Ratte zu sein, deren kraftlose Krallen gegen die Wände meines Irrgartens nichts ausrichten konnten.
Der Asket führte mich durch die nördlich des Zentrums gelegenen Grotten, in denen die Soldat Sol gedrillt wurden. Menschen wichen an die Felswände zurück oder reckten die Arme nach meinem goldenen Gewand, als wir an ihnen vorbeigingen. Wir schritten langsam und würdevoll – zwangsläufig, denn schnelleres Gehen hätte mich ermüdet. Die Herde des Asketen wusste, dass ich krank war, und betete für meine Gesundheit, aber er befürchtete, dass eine Panik ausbrechen würde, falls man merkte, wie angeschlagen – und zutiefst menschlich – ich tatsächlich war.
Die Soldat Sol hatten bei unserem Eintreffen schon mit dem Drill begonnen. Sie waren die heiligen Krieger des Asketen, Sonnenkämpfer, denen die Strahlensonne auf Arme und Gesicht tätowiert worden war. Viele waren Fahnenflüchtige aus der Ersten Armee, andere dagegen einfach nur jung, draufgängerisch und todesmutig. Sie hatten mir unter schwersten Verlusten geholfen, aus dem Kleinen Palast zu entkommen. Doch ob heilig oder nicht, mit den Nichevo’ya des Dunklen konnten sie es nicht aufnehmen. Aber da dieser auch Soldaten und Grisha zur Verfügung hatte, übten sich die Soldat Sol weiter im Kampf.
Sie übten nicht mit echten Waffen, sondern mit Holzsäbeln und Gewehren, die Kugeln aus Wachs verschossen. Die Soldat Sol, eine ganz eigene Sorte von Pilgern, hatten sich dem Kult der Sonnenheiligen angeschlossen, weil sie sich davon gesellschaftliche Veränderungen versprachen. Viele waren jung und brachten dem Asketen und den althergebrachten Ritualen der Kirche eine tiefe Skepsis entgegen. Seit meiner Ankunft wurden sie von dem Asketen an einer noch kürzeren Leine gehalten. Er brauchte sie, traute ihnen aber nicht ganz. Das Gefühl kannte ich.
Am Rand stehende Priestergardisten wachten mit Argusaugen über alles, was sich tat. Ihre Kugeln waren echt und genauso die Klingen ihrer Säbel.
Eine Gruppe sah Mal und Stigg bei einem Übungskampf zu. Stigg war einer der beiden überlebenden Inferni. Er hatte einen Stiernacken, blonde Haare und keinen Funken Humor – ein waschechter Fjerdan.
Mal wich einer Flammensichel aus. Die nächste versengte sein Hemd, und die Zuschauer keuchten auf. Ich glaubte, er würde zurückweichen, doch stattdessen griff er an. Er tat einen Satz, rollte sich über den Boden, was die Flammen erstickte, und riss Stigg von den Beinen. Im nächsten Moment drückte er den Inferni mit dem Gesicht auf die Erde und packte ihn bei den Handgelenken, um einen erneuten Angriff zu verhindern.
Die zuschauenden Soldaten pfiffen und klatschten beifällig.
Zoya warf ihre glänzenden schwarzen Haare zurück. »Gut gemacht, Stigg. Jetzt bist du verschnürt wie ein Braten und reif für den Ofen.« Mal brachte sie mit einem Blick zum Schweigen. »Ablenken, entwaffnen, unschädlich machen«, sagte er. »Der Trick besteht darin, nicht in Panik zu geraten.« Er stand auf und half Stigg auf die Beine.
»Alles in Ordnung?«
Stigg zog eine verärgerte Grimasse, nickte aber und ging zu einer neuen Übungspartnerin, einer hübschen und jungen Soldatin.
»Na los, Stigg«, sagte das Mädchen mit einem breiten Grinsen.
»Ich springe auch nicht so hart mit dir um.«
Ihr Gesicht kam mir bekannt vor, aber ich brauchte eine Weile, um sie einzuordnen – Ruby. Mal und ich waren mit ihr in Poliznaya ausgebildet worden. Wir waren im gleichen Regiment gewesen. Ich hatte sie als kichernd und fröhlich in Erinnerung, als eines dieser glücklichen, koketten Mädchen, die mir stets das Gefühl gegeben hatten, ein hoffnungsloser Fall zu sein. Sie lächelte immer noch viel und trug auch noch ihren langen blonden Zopf. Aber ich spürte sogar von Weitem, dass sie eine Wachsamkeit ausstrahlte, wie sie nur der Krieg mit sich brachte. Auf ihre rechte Wange war die Strahlensonne tätowiert worden. Sonderbar, dass ich von einem Mädchen, das mir früher in der Kantine gegenübergesessen hatte, nun für eine göttliche Erscheinung gehalten wurde.
Der Asket oder seine Gardisten führten mich selten auf diesem Weg zu den Archiven. Was war heute anders? Hatte er mich hergebracht, damit ich den kläglichen Rest meiner Armee sah und mich an den Preis meines Fehlers erinnerte? Wollte er mir zeigen, wie wenige Verbündete mir geblieben waren?
Ich sah zu, wie Mal Paare aus Sonnenkämpfern und Grisha bildete. Da waren die Stürmer: Zoya, Nadia und ihr Bruder Adrik. Gemeinsam mit Stigg und Harshaw waren sie meine letzten Ätheralki. Harshaw war nicht zu sehen. Er hatte sich vermutlich wieder ins Bett gelegt, nachdem er während der Morgenmesse die Flammen für mich aufgerufen hatte.
Was die Korporalki betraf, so waren Tamar und Tolya, ihr riesiger Zwillingsbruder, die einzigen Entherzer auf dem Übungsplatz. Ich verdankte ihnen mein Leben, trotzdem war ich vor ihnen auf der Hut. Sie standen dem Asketen nahe, der sie mit der Ausbildung der Soldat Sol betraut hatte, und sie hatten mich im Kleinen Palast monatelang belogen. Ich wurde nicht schlau aus ihnen. Vertrauen war ein Luxus, den ich mir eigentlich nicht leisten konnte.
Alle übrigen Soldaten mussten noch auf ihren Kampf warten, denn es gab zu wenige Grisha. Genya und David blieben lieber für sich allein und kämpften ohnehin ungern. Maxim war ein Heiler und zog es vor, seine Künste im Hospital auszuüben, obwohl die meisten Anhänger des Asketen den Grisha nicht genug Vertrauen schenkten, um sich von ihnen helfen zu lassen. Sergei war ein mächtiger Entherzer, galt in seelischer Hinsicht aber immer noch als so labil, dass man darauf verzichtete, ihn als Lehrer einzusetzen. Während des Überraschungsangriffs des Dunklen war er mitten im Kampfgetümmel gewesen und hatte mit ansehen müssen, wie das Mädchen, das er liebte, von Ungeheuern zerrissen worden war. Unseren einzigen anderen Entherzer hatten wir irgendwo zwischen dem Kleinem Palast und der Kapelle an die Nichevo’ya verloren.
Alles deine Schuld, sagte eine Stimme in meinem Kopf. Weil du versagt hast.
Der Asket riss mich aus meinen trübseligen Gedanken. »Der Junge maßt sich zu viel an.«
Ich folgte seinem Blick. Er beobachtete Mal, der zwischen den Soldaten umherlief, mit ihnen sprach oder sie auf Fehler hinwies. »Er unterstützt sie beim Üben«, sagte ich.
»Er gibt ihnen Befehle. Oretsev!«, rief der Priester und winkte ihn zu sich. Ich spannte mich an, als Mal näher kam. Seit er aus meiner Kammer verbannt worden war, hatte ich ihn kaum noch zu Gesicht bekommen. Von meinen selten gestatteten Treffen mit Genya abgesehen, isolierte mich der Asket von jedem, der als mein Verbündeter infrage kam.
Mal wirkte verändert. Er trug die bäuerlich grobe Kleidung, die im Kleinen Palast seine Uniform gewesen war, aber durch die lange Zeit unter der Erde war er schmaler und so blass geworden, dass die Narbe auf seinem Kiefer hervorstach.
Er blieb vor uns stehen und verneigte sich. Wir waren einander so nahe wie seit Monaten nicht mehr.
»Du bist hier nicht der Befehlshaber«, sagte der Asket. »Tolya und Tamar stehen im Rang über dir.«
Mal nickte. »Das stimmt.«
»Und warum leitest du die Übungen?«
»Ich leite nichts«, erwiderte er. »Ich kann ihnen etwas beibringen. Und sie können etwas von mir lernen.«
Wie wahr, dachte ich verbittert. Mal war sehr gut im Kampf gegen Grisha geworden. Ich hatte vor Augen, wie er in den Ställen des Kleinen Palasts blutend und mit gebrochenen Rippen über einem Stürmer gestanden und verächtlich und herausfordernd auf ihn geblickt hatte. Noch eine Erinnerung, auf die ich gut verzichten konnte.
»Warum hat man diese Rekruten nicht gezeichnet?«, fragte der Asket und zeigte auf eine Gruppe, die hinten in der Grotte mit Holzsäbeln übte. Keiner von ihnen sah älter aus als zwölf.
»Weil sie noch Kinder sind«, antwortete Mal mit eisiger Stimme.
»Es war ihre freie Entscheidung. Willst du verhindern, dass sie ihre Treue zu unserem Anliegen beweisen?«
»Ich will verhindern, dass sie später etwas bereuen.«
»Das steht in niemandes Macht.«
An Mals Unterkiefer zuckte ein Muskel. »Falls wir unterliegen sollten, wären sie durch die Tätowierungen als Sonnenkämpfer gebrandmarkt. Sie könnten sich ebenso gut freiwillig vor ein Erschießungskommando stellen.«
»Bist du deshalb selbst nicht tätowiert? Weil dein Glaube an unseren Sieg so schwach ist?«
Mal sah zu mir, dann wieder zum Asketen. »Mein Glaube gilt den Heiligen«, antwortete er ruhig. »Und nicht Männern, die Kinder in den Tod schicken.«
Der Priester verengte die Augen.
»Mal hat recht«, warf ich ein. »Lasst sie nicht tätowieren.« Der Asket sah mich aus seinen ausdruckslosen schwarzen Augen an.
»Bitte«, sagte ich leise, »mir zu Gefallen.«
Ich wusste, wie sehr er diesen Tonfall mochte – warmherzig, sanft und einlullend.
»So ein weiches Herz«, sagte er und schnalzte mit der Zunge. Doch er war erfreut, das konnte ich spüren. Ich hatte mich zwar gegen seine Wünsche ausgesprochen, aber der Rolle entsprochen, die er mir zudachte: die mütterliche Heilige und Trösterin der Herzen. Ich bohrte meine Fingernägel in die Handfläche.
»Ist das nicht Ruby?«, fragte ich, um das Thema zu wechseln und den Asketen von Mal abzulenken.
»Sie ist vor einigen Wochen gekommen«, sagte Mal. »Sie ist gut – war bei der Infanterie.« Mir selbst zum Trotz verspürte ich den winzigsten Anflug von Neid.
»Stigg sieht nicht gerade froh aus«, sagte ich und nickte zu dem Inferni, der seine Wut angesichts der Niederlage an Ruby auszulassen schien. Sie gab sich größte Mühe, war ihm aber nicht gewachsen.
»Er verliert nicht gern.«
»Du bist bestimmt nicht einmal ins Schwitzen gekommen.«
»Nein«, sagte er. »Leider nicht.«
»Warum leider?«, fragte der Asket.
Mals Blick glitt ganz kurz zu mir. »Durch Niederlagen lernt man mehr.« Er zuckte mit den Schultern. »Zum Glück gibt es Tolya. Er kann mir noch den Arsch versohlen.«
»Achte auf deine Wortwahl«, fauchte der Asket.
Mal beachtete ihn nicht. Dann pfiff er plötzlich auf zwei Fingern. »Ruby! Deine Deckung ist offen!«
Zu spät. Ihr Zopf fing Feuer. Ein junger Soldat kam angerannt und kippte einen Eimer Wasser über ihr aus.
Ich zuckte zusammen. »Pass auf, dass sie nicht zu knusprig geraten.«
Mal verneigte sich. »Moi Soverenyi.« Dann trabte er zurück zur Truppe.
Diese Anrede. Hier schwang nicht mehr der Groll darin mit, den er in Os Alta hineingelegt hatte, aber ich empfand sie immer noch als Schlag in die Magengrube.
»So darf er Euch nicht anreden«, beschwerte sich der Asket.
»Und warum nicht?«
»Das war die Anrede des Dunklen. Sie ist unpassend für eine Heilige.«
»Wie sollte er mich sonst anreden?«
»Er sollte Euch gar nicht direkt anreden.«
Ich seufzte. »Wenn er wieder ein Anliegen hat, werde ich ihn bitten, mir einen Brief zu schreiben.«
Der Asket spitzte die Lippen. »Ihr seid gereizt. Ich denke, eine zusätzliche Stunde in der Stille des Archivs wird Euch guttun.«
Er schalt mich wie ein überdrehtes Kind, das dringend zu Bett musste. Ich zwang mich, an den versprochenen Aufenthalt in der Küche zu denken, und rang mir ein Lächeln ab. »Ihr habt gewiss recht.« Ablenken, entwaffnen, unschädlich machen.
Als wir in den Gang einbogen, der zum Archiv führte, blickte ich noch einmal über die Schulter. Zoya hatte einen Soldaten auf den Rücken geworfen und ließ ihn mit lässigen Drehungen ihres Handgelenks wie eine Schildkröte auf dem Boden kreisen. Ruby redete mit lebhafter Miene und strahlendem Lächeln auf Mal ein, aber er sah zu mir. Im Zwielicht der Grotte strahlten seine Augen so blau wie das Herz einer Flamme.
Ich wandte mich ab und folgte dem Asketen, beschleunigte meine Schritte und versuchte, weniger pfeifend zu atmen. Ich dachte an Rubys Lächeln und ihren angesengten Zopf. Ein nettes Mädchen. Ein normales Mädchen. Genau, was Mal brauchte. Ich wusste nicht, ob er schon mit einer anderen zusammen war, aber früher oder später würde es passieren. Und irgendwann wäre ich anständig genug, um ihm viel Glück zu wünschen. Nur noch nicht heute.
Wir begegneten David, der ebenfalls zum Archiv unterwegs war. Er sah wie üblich aus wie eine Vogelscheuche – zerzauste Haare, mit Tinte bekleckste Ärmel. Er hatte ein Glas mit heißem Tee in der Hand, aus seiner Tasche ragte eine geröstete Brotscheibe.
Sein Blick zuckte vom Asketen zu den Priestergardisten.
»Mehr Salbe?«, fragte er.
Bei diesem Wort verzog der Asket den Mund. David rührte die Salbe für Genya an. Sie unterstützte ihre eigenen Bemühungen, die schlimmsten Narben zu verdecken, aber von den Nichevo’ya geschlagene Wunden verheilten nie ganz.
»Sankta Alina möchte den Vormittag ihren Studien widmen«, verkündete der Asket feierlich.
David deutete ein Schulterzucken an und huschte durch die Tür.
»Aber nachher gehst du in die Küche, oder?«
»In zwei Stunden schicke ich Gardisten, die Euch dorthin eskortieren«, sagte der Asket. »Genya Safin wird Euch erwarten.« Er musterte mein eingefallenes Gesicht. »Sorgt dafür, dass sie sich mehr Mühe gibt.«
Er verneigte sich tief und verschwand durch den Gang. Als ich mich im Raum umsah, seufzte ich niedergeschlagen. Eigentlich hätte ich mich im Archiv pudelwohl fühlen müssen, denn hier roch es nach Tinte und Papier, und man hörte das unablässige Kratzen der Federkiele. Aber es war auch der Rückzugsort der Priestergardisten – ein schwach erhelltes Labyrinth aus Säulen und Bögen, die man aus dem weißen Gestein gehauen hatte. Der stille David wäre fast explodiert, als er die kleinen, überwölbten Nischen voller uralter Manuskripte und Bücher zum ersten Mal gesehen hatte, denn die Seiten waren schwarz von Schimmel, die Rücken aufgequollen. Die Höhlen waren so feucht, dass sich Pfützen auf dem Boden bildeten. »Hier … hier lagert ihr Morozovas Aufzeichnungen?«, hatte er mit fast überschnappender Stimme geschrien. »Das ist ein Sumpf.«
Inzwischen verbrachte er seine Tage und fast alle Nächte im Archiv, brütete über Morozovas Schriften und trug Notizen und Skizzen in eine eigene Kladde ein. Wie fast alle Grisha hatte auch er geglaubt, dass Morozovas Aufzeichnungen nach der Erschaffung der Schattenflur zerstört worden waren. Doch der Dunkle hätte einen solchen Schatz niemals vernichtet. Er hatte die Aufzeichnungen versteckt, und obwohl ich dem Asketen bisher keine direkte Antwort hatte entlocken können, ging ich davon aus, dass er sie im Kleinen Palast entdeckt und nach der erzwungenen Flucht des Dunklen aus Ravka an sich gebracht hatte.
Ich sackte gegenüber von David auf einen Stuhl. Er hatte Tisch und Stuhl in die trockenste Höhle getragen. In einem der Regale lagerte er zusätzliches Öl für seine Lampen und die Kräuter und Fette für Genyas Salbe. Sonst war er meist mit Formeln oder Tüfteleien beschäftigt und sah stundenlang nicht auf, aber heute schien ihm die nötige Ruhe zu fehlen. Er hantierte nervös mit den Tinten und fummelte an der Taschenuhr herum, die auf dem Tisch lag.
Ich blätterte lustlos in einem der Bücher mit den Aufzeichnungen. Inzwischen hasste ich schon ihren Anblick, denn ihr Inhalt war nutzlos, verwirrend und vor allen Dingen unvollständig. Morozova legte seine Theorien zu den Kräftemehrern dar, schilderte seine Jagd auf den Hirsch und die zwei Jahre, die er auf der Suche nach der Meeresgeißel auf einem Walfänger verbracht hatte, erläuterte seine Hypothesen bezüglich des Feuervogels, und dann … nichts. Entweder fehlten Teile der Aufzeichnungen, oder Morozova hatte sein Werk nicht vollendet.
Der Gedanke, den Feuervogel zu finden und mir seine Macht zunutze zu machen, war einschüchternd. Aber der Gedanke, dass er vielleicht gar nicht existierte und dass ich den Dunklen ein weiteres Mal ohne ihn würde bekämpfen müssen, war unerträglich, und ich verdrängte ihn immer so rasch wie möglich.
Ich zwang mich, die Seiten umzublättern. Ich hatte nur Davids Taschenuhr, um nach der Zeit zu schauen. Ich wusste nicht, wo er sie entdeckt und wie er sie in Gang gebracht hatte und ob die von ihm eingestellte Zeit stimmte, aber ich starrte sie an, als könnte ich den Minutenzeiger durch meinen Blick dazu bringen, sich schneller zu drehen.
Priestergardisten kamen und gingen, beugten sich über ihre Texte oder behielten uns im Auge. Eigentlich sollten sie Manuskripte mit Zeichnungen versehen und heilige Schriften studieren, aber ich argwöhnte, dass andere Aufgaben Vorrang für sie hatten. Der Asket unterhielt ein Spionagenetzwerk, das sich über ganz Ravka erstreckte, und die Priestergardisten glaubten sich dazu berufen, Informationen zu sammeln, Nachrichten zu entziffern und den Kult der neuen Heiligen aufzubauen. Ich verglich sie unwillkürlich mit meinen Soldat Sol, meist jung und vielfach Analphabeten, die von den uralten Geheimnissen, die diese Männer hüteten, ausgeschlossen waren.
Als mir Morozovas Geschwätz unerträglich zu werden begann, rutschte ich auf dem Stuhl hin und her und versuchte, meinen Rücken wieder einzurenken. Danach griff ich nach einem alten Band, der hauptsächlich Debatten über das Gebet beinhaltete, zu meiner Überraschung aber auch eine Version des Martyriums von Sankt Ilya enthielt.
Hier war Ilya ein Steinmetz, und der Nachbarsjunge wurde unter einem Pferd begraben – das war mir neu, denn der Junge wurde sonst immer von einer Pflugschar erfasst. Das Ende war wie üblich erzählt: Ilya rettete das Kind von der Schwelle des Todes, woraufhin er von den Dorfbewohnern in Ketten gelegt und im Fluss ertränkt wurde. Manchmal hieß es, er sei nicht untergegangen, sondern bis zum Meer getrieben worden. Dann wieder, dass man seinen unversehrten und nach Rosen duftenden Leib Tage später auf einer viele Meilen entfernten Sandbank entdeckt habe. Ich kannte alle Versionen, doch in keiner war die Rede von dem Feuervogel, ganz zu schweigen von Dva Stolba als dem Ort, wo man mit der Suche beginnen müsse. Unsere Hoffnungen darauf, den Feuervogel aufzuspüren, ruhten ausschließlich auf einer alten Illustration: Sankt Ilya in Ketten, umringt von Hirsch, Meeresgeißel und Feuervogel. Hinter ihm waren ein Gebirge, eine Straße und ein Felsbogen zu sehen. Dieser war natürlich längst eingestürzt, aber ich bildete mir ein, dass sich seine Ruine in Dva Stolba befand, in der Nähe des Geburtsorts von Mal und mir. Das glaubte ich jedenfalls an guten Tagen. Heute war ich nicht mehr so fest davon überzeugt, dass Ilya Morozova und Sankt Ilya ein und dieselbe Person seien. Ich würdigte die Ausgaben der Istorii Sankt’ya keines einzigen Blickes mehr. Sie türmten sich in einer feuchten Ecke und schimmelten vor sich hin, schienen keine großartige Bestimmung mehr zu verheißen, sondern aus der Mode gekommene Kinderbücher zu sein.
David nahm seine Uhr in die Hand, legte sie wieder weg, griff ein zweites Mal danach, stieß ein Tintenfässchen um und richtete es umständlich auf.
»Was ist denn heute mit dir los?«, fragte ich.
»Nichts«, antwortete er barsch.
Ich blinzelte ihn an. »Deine Lippe blutet.«
Er wischte mit der Hand darüber, aber die Lippe blutete weiter. Er hatte offenbar daraufgebissen. Heftig.
»David …«
Er klopfte auf den Tisch. Ich wäre vor Schreck fast von meinem Stuhl aufgesprungen, denn wie aus dem Nichts waren hinter mir zwei Gardisten erschienen. Pünktlich und unheimlich wie immer.
»Hier«, sagte David und gab mir eine kleine Blechdose. Bevor ich sie ergreifen konnte, hatte sie einer der Gardisten an sich gerissen.
»Was soll das?«, fragte ich wütend. Ich wusste es natürlich. Alles, was zwischen den anderen Grisha und mir hin und her ging, wurde gründlich untersucht. Selbstverständlich nur zu meinem Schutz.
Der Priestergardist beachtete mich nicht. Er strich über Deckel und Boden der Dose, öffnete sie, beschnupperte den Inhalt, schloss sie wieder und reichte sie mir wortlos zurück. Ich schnappte sie mir von seiner Handfläche.
»Besten Dank«, sagte ich mürrisch. »Dir auch, David.«
Er beugte sich schon wieder über seine Kladde, scheinbar versunken in was auch immer er gerade las. Doch er hielt seinen Stift so fest gepackt, dass ich glaubte, er müsste zerbrechen.
Genya erwartete mich im sogenannten Kessel, der riesigen, fast kreisrunden Grotte, in der für alle gekocht wurde, die sich in der Weißen Kathedrale aufhielten. Vor den gewölbten Wänden stand ein Steinherd neben dem anderen, Relikte aus Ravkas Vorgeschichte, die, wie das Küchenpersonal klagte, nicht halb so viel taugten wie die Herde und Kachelöfen auf der Oberfläche. Die großen Drehspieße waren für riesige Braten gedacht, aber frisches Fleisch war hier unten eine Seltenheit. Stattdessen gab es Pökelfleisch, Eintöpfe mit Wurzelgemüse und ein Brot aus grobem, grauem Mehl, das leicht nach Kirschen schmeckte.
Die Köche hatten sich an Genya gewöhnt, zuckten bei ihrem Anblick jedenfalls nicht mehr zusammen und fingen an zu beten. Als ich ankam, wärmte sie sich hinten im Kessel an einem Herd. Das war inzwischen unser Stammplatz, und die Köche stellten uns jeden Tag einen kleinen Topf mit Haferbrei oder Suppe hin. Als ich mich mit der bewaffneten Eskorte näherte, ließ Genya ihr Tuch sinken, woraufhin die Männer wie erstarrt stehen blieben. Sie rollte ihr verbliebenes Auge und fauchte wie eine Katze. Die Gardisten wichen zum Eingang zurück.
»War das zu viel des Guten?«
»Nein, das war genau richtig«, erwiderte ich und freute mich über ihre Fortschritte. Dass sie über die Reaktion dieser Idioten lachen konnte, war ein sehr gutes Zeichen. Die Paste, die David für ihre Narben gemixt hatte, half zwar, aber Tamar gebührte wohl der größte Dank.
Nach unserer Ankunft in der Weißen Kathedrale hatte sich Genya wochenlang geweigert, ihre Kammer zu verlassen. Sie hatte im Dunkeln gelegen und sich nicht rühren wollen. Ich hatte unter Aufsicht der Wachen mit ihr gesprochen, ihr gut zugeredet und versucht, sie zum Lachen zu bringen. Alles vergeblich. Am Ende war es Tamar gewesen, die sie durch die Forderung, sie müsse wenigstens lernen, sich zu verteidigen, aus ihrer Höhle gelockt hatte.
»Was kümmert es dich?«, hatte Genya ihr zugemurmelt und die Decke bis über den Kopf gezogen.
»Es könnte mir egal sein. Aber wenn du nicht kämpfen kannst, gefährdest du auch uns.«
»Mir ist es gleich, ob ich verwundet werde.«
»Mir aber nicht«, erwiderte ich energisch.
»Alina muss auf sich selbst achtgeben«, sagte Tamar. »Sie kann nicht auf dich aufpassen.«
»Habe ich sie je darum gebeten?«
»Wäre es nicht wunderbar, wenn wir immer nur bekommen würden, worum wir gebeten haben?«, fragte Tamar. Danach hatte sie so lange argumentiert, gestichelt und genervt, bis Genya ihre Decke schließlich abgeworfen und sich auf eine einzige Übungsstunde eingelassen hatte – ganz privat, weit weg von den anderen, nur mit den Priestergardisten als Zuschauern.
»Die mache ich platt«, hatte sie gebrummelt. Meine Skepsis war mir offenbar anzusehen, denn sie pustete sich eine rote Locke aus der vernarbten Stirn und sagte: »Schön, dann warte ich eben, bis sie einschläft, und verpasse ihr einen Schweinerüssel.«
Doch sie war zu dieser und auch zur nächsten Übungsstunde erschienen, und soweit ich wusste, war Tamar weder mit einem Schweinerüssel noch mit versiegelten Augenlidern erwacht.
Genya bedeckte weiter ihr Gesicht und verbrachte die meiste Zeit in ihrer Kammer, aber sie ging nicht mehr gebückt und wich in den Gängen auch nicht mehr den Menschen aus. Sie hatte sich aus schwarzer Seide, dem Innenfutter eines alten Mantels, eine Augenklappe genäht, und ihr Haar wirkte eindeutig roter. Wenn Genya ihre Macht nutzte, um ihre Haarfarbe zu verändern, dann war möglicherweise etwas von ihrer Eitelkeit zurückgekehrt, was wiederum ein Fortschritt wäre.
»Lass uns anfangen«, sagte sie nun.
Genya kehrte dem Raum den Rücken zu. Dann zog sie ihr Tuch über den Kopf, wobei sie die fransigen Enden ausbreitete, sodass wir vor neugierigen Blicken geschützt waren. Beim ersten Mal waren die Gardisten sofort zur Stelle gewesen, aber als sie sahen, dass ich die Paste auf ihre Narben strich, waren sie wieder zurückgewichen. Sie hielten die Wunden, die Genya von den Nichevo’ya des Dunklen zugefügt worden waren, für eine Art Strafe Gottes. Ich wusste allerdings nicht, wofür man sie hätte bestrafen sollen. Sie hatte sich zwar auf die Seite des Dunklen geschlagen, aber diesen Fehler hatte jeder von uns schon einmal begangen. Was die Gardisten wohl zu den Bissspuren auf meinen Schultern sagen würden? Oder dazu, wie ich die Schatten tanzen lassen konnte?
Ich holte die Blechdose aus der Tasche und begann, die Paste auf ihre Wunden zu streichen. Der Geruch war so scharf, dass meine Augen tränten.
»Mir war nie klar, wie mühsam es ist, so lange still zu sitzen«, klagte sie.
»Du sitzt nicht still. Du hampelst herum.«
»Es juckt.«
»Soll ich dich mit einem Reißnagel piken? Würdest du das Jucken darüber vergessen?«
»Sag mir einfach Bescheid, wenn du fertig bist, du Schreckschraube.« Sie betrachtete meine Hände. »Heute kein Glück gehabt?«, flüsterte sie.
»Noch nicht. Sie haben bisher nur zwei Herde entfacht, und die Flammen sind klein.« Ich wischte meine Hände an einem schmierigen Geschirrtuch ab. »So«, sagte ich, »geschafft.«
»Dann bist du jetzt an der Reihe«, sagte sie. »Du siehst …«
»… schrecklich aus. Ja, ich weiß.«
»Das ist ein relativer Begriff.« Die Traurigkeit in ihrer Stimme war nicht zu überhören. Ich hätte mich am liebsten selbst in den Hintern getreten.
Ich legte ihr eine Hand auf die Wange. Zwischen den Narben war ihre Haut glatt und weiß wie die Alabasterwände. »Ich bin so ein Esel.«
Sie hob einen Mundwinkel zu dem Ansatz eines verzerrten Lächelns. »Ja, manchmal«, sagte sie. »Aber ich habe das Thema angeschnitten. Und nun sei still und lass mich arbeiten.«
»Aber bemüh dich nicht zu sehr, denn ich will, dass der Asket uns diese Begegnungen weiterhin erlaubt. Ich möchte ihm nicht die hübsche kleine Heilige bieten, mit der er sich brüsten kann.«
Genya seufzte theatralisch. »Das widerspricht meinen tiefsten Überzeugungen, und du wirst mich später dafür entschädigen.«
»Und wie?«
Sie legte den Kopf schief. »Ich finde, du solltest mir erlauben, dich in einen Rotschopf zu verwandeln.«
Ich verdrehte die Augen. »Nie im Leben, Genya.«
Während sie langsam mein Gesicht bearbeitete, spielte ich mit der Blechdose. Als ich den Deckel daraufzusetzen versuchte, stellte ich fest, dass sich auf dessen Innenseite etwas abgelöst hatte. Ich hob es mit den Fingernägeln an – es war eine dünne, wachsartige Papierscheibe. Genya sah sie im gleichen Moment wie ich.
Auf der Rückseite stand ein Wort in Davids fast unleserlicher Handschrift: Heute.
Genya riss mir die Papierscheibe aus der Hand. »Bei allen Heiligen! Alina …«
Da hörten wir draußen vor der Tür ein Gerangel und das Stampfen schwerer Stiefel. Ein Topf fiel mit lautem Knall auf den Fußboden, und einer der Köche schrie auf, als plötzlich Priestergardisten mit dem Gewehr im Anschlag in die Küche stürmten. In ihren Augen schien das Feuer ihres Glaubens zu lodern.
Der Asket rauschte in ihrem Gefolge mit wehender brauner Kutte herein. »Räumt die Küche!«, brüllte er.
Genya und ich sprangen auf. Die Priestergardisten drängten die verwirrt und verängstigt protestierenden Köche aus dem Raum.
»Was soll das?«, verlangte ich zu wissen.
»Alina Starkov«, sagte der Asket, »Ihr schwebt in Gefahr.«
Das Herz schlug mir bis zum Hals, aber ich versuchte, meine Stimme ruhig zu halten. »Gefahr durch was?«, fragte ich mit einem Blick auf die Töpfe, die auf den Herden brodelten. »Haferbrei?«
»Es gibt eine Verschwörung«, erklärte er und zeigte auf Genya. »All jene, die sich als Eure Freunde ausgeben, sind darauf aus, Euch zu vernichten.«
Weitere bärtige Schergen des Asketen marschierten hinter ihm zur Tür herein. Als sie ihre Reihen öffneten, erblickte ich David, der mit ängstlich aufgerissenen Augen dastand.
Genya rang um Atem, und ich legte ihr eine Hand auf den Arm, damit sie nicht losstürmte.
Danach führte man Nadia und Zoya herein, beide mit gefesselten Händen, um sie daran zu hindern, ihre Macht aufzurufen. Blut lief aus Nadias Mundwinkel, und unter den Sommersprossen war sie kreidebleich. Mal war bei ihnen, und auch sein Gesicht war blutüberströmt. Er presste eine Hand gegen seine Seite, als hätte er eine gebrochene Rippe, und krümmte sich vor Schmerz. Noch schlimmer war jedoch der Anblick der zwei Wachen, die ihn flankierten – Tolya und Tamar, die wieder ihre Äxte trugen. Beide waren ebenso schwer bewaffnet wie die Priestergardisten. Sie wichen meinem Blick aus.
»Verriegelt die Türen«, befahl der Asket. »Wir werden uns ganz privat um diese leidige Angelegenheit kümmern.«
2
Die mächtigen Türen des Kessels fielen mit lautem Krachen zu. Der Schlüssel knirschte im Schloss. Ich versuchte, die Übelkeit zu verdrängen, die in mir aufstieg, und zu begreifen, was hier vor sich ging. Nadia und Zoya – zwei Stürmerinnen –, Mal und David, ein harmloser Fabrikator. Heute, hatte er geschrieben. Was sollte das bedeuten?
»Ich frage noch einmal, Priester: Was soll das? Warum sind meine Freunde in Gewahrsam? Warum bluten sie?«
»Sie sind nicht Eure Freunde. Man hat eine Verschwörung aufgedeckt, die das Ziel hatte, die Weiße Kathedrale vor unseren Augen zu Fall zu bringen.«
»Was redet Ihr da?«
»Ihr habt den Ungehorsam des Jungen heute miterlebt …«
»Ach? Da liegt das Problem? Er zittert nicht genug in Eurer Gegenwart?«
»Wir haben es mit Verrat zu tun!« Er zog einen kleinen Stoffbeutel aus seiner Kutte und hielt ihn mir mit zwei Fingern hin. Ich runzelte die Stirn. Solche Beutel kannte ich aus den Werkstätten der Fabrikatoren. Man benutzte sie für …
»Sprengstoff«, sagte der Asket. »Von diesem nichtswürdigen Fabrikator aus Stoffen hergestellt, die von Euren angeblichen Freunden beschafft wurden.«
»David hat also Sprengstoff hergestellt. Dafür gibt es alle möglichen Gründe.«
»In der Weißen Kathedrale sind Waffen verboten.«
Ich zog eine Augenbraue hoch und warf einen Blick auf die Waffen, die auf Mal und meine Grisha gerichtet waren. »Und was sollen die Gewehre sein? Schöpfkellen? Wenn Ihr Beschuldigungen vorbringt, dann …«
»Ihre Pläne wurden belauscht. Tamar Kir-Baatar, tritt vor. Berichte, was du herausgefunden hast.«
Tamar verneigte sich tief. »Die Grisha und der Fährtensucher hatten vor, Euch unter Drogen zu setzen und an die Oberfläche zu entführen.«
»Ich will ja auch auf die Oberfläche zurückkehren.«
»Der Sprengstoff war dazu gedacht, Verfolger aufzuhalten«, fuhr sie fort. »Er sollte die Grotten über dem Asketen und Euren Gläubigen zum Einsturz bringen.«
»Mal würde nie den Tod Hunderter unschuldiger Menschen in Kauf nehmen. Das würde niemand von ihnen tun.« Nicht einmal Zoya, diese Zicke. »Außerdem ergibt das keinen Sinn. Wie sollte ich unter Drogen gesetzt werden?«
Tamar nickte zu Genya und dem Tee hinüber, der zwischen uns stand.
»Ich trinke diesen Tee selbst«, fauchte Genya. »Er ist nicht mit Drogen versetzt.«
»Sie ist eine gewiefte Giftmischerin und Lügnerin«, erwiderte Tamar frostig. »Sie hat Euch schon einmal an den Dunklen verraten.«
Genya griff mit beiden Händen nach ihrem Tuch. Wir wussten beide, dass dieser Vorwurf nicht ganz unberechtigt war. Wider Willen verspürte ich einen leisen Verdacht.
»Ihr vertraut ihr«, sagte Tamar. Ihr Tonfall war sonderbar. Es klang eher wie ein Befehl denn wie eine Anklage.
»Sie haben nur darauf gewartet, die passende Menge Sprengstoff beisammenzuhaben«, sagte der Asket. »Dann wollten sie Euch an die Oberfläche schaffen und an den Dunklen übergeben.«
Ich schüttelte den Kopf. »Glaubt Ihr allen Ernstes, ich würde Euch abkaufen, dass Mal mich an den Dunklen übergeben würde?«
»Er wurde selbst hinters Licht geführt«, sagte Tolya gelassen. »Er war so darauf versessen, Euch zu befreien, dass er zu einer Spielfigur des Dunklen wurde.«
Ich sah zu Mal. Sein Gesichtsausdruck war unergründlich. Erster echter Zweifel wurde in mir wach. Ich hatte Zoya nie vertraut, und kannte ich Nadia wirklich gut genug? Genya – Genya hatte so schwer durch den Dunklen leiden müssen, aber sie waren tief miteinander verbunden. Kalter Schweiß trat auf meinen Nacken, und ich spürte, wie mich die Panik zu erfassen begann und mein Denken trübte.
»Ein Gespinst von Verschwörungen«, zischte der Asket. »Ihr habt ein weiches Herz, und es hat Euch genarrt.«
»Nein«, erwiderte ich. »All das ergibt keinen Sinn.«
»Sie sind Spione und Betrüger!«
Ich drückte die Finger gegen meine Schläfen. »Wo sind meine anderen Grisha?«
»Sie bleiben in Gewahrsam, bis sie gründlich verhört werden können.«
»Ich hoffe, sie sind unverletzt.«
»Seht ihr, wie sehr sie sich um jene sorgt, die ihr Böses wollen?«, rief er den Priestergardisten zu, und mir wurde bewusst, dass er diese Situation nicht nur genoss, sondern auf sie gewartet hatte. »Es beweist ihre tiefe Güte und Großherzigkeit.« Er sah mir in die Augen.
»Es gibt tatsächlich leichte Verletzungen, aber man wird diese Verräter bestens versorgen. Es hängt allein von Euch ab.«
Die Warnung war klar, und ich begriff endlich, worum es hier ging. Ob sich die Grisha nun tatsächlich verschworen hatten oder ob all das nur ein vom Priester erfundener Vorwand war – dies war der Moment, auf den er gewartet hatte, die Gelegenheit, mich vollständig zu isolieren. Keine Treffen mit Genya im Kessel mehr, keine kurzen Gespräche mit David. Der Priester würde diese Gelegenheit nutzen, mich von allen zu trennen, die mir treuer ergeben waren als seinem Anliegen. Und ich war zu schwach, um ihn aufzuhalten.
Aber sprach Tamar die Wahrheit? Waren meine Verbündeten tatsächlich meine Feinde? Nadia ließ den Kopf hängen. Zoya stand mit erhobenem Kinn und herausforderndem Blick da. Es wäre durchaus möglich, dass sich eine oder sogar beide gegen mich wandten und mich dem Dunklen auslieferten, weil sie auf Gnade hofften. Und was David betraf, so hatte er geholfen, mir den Halsreif anzulegen.
Hatten sie Mal tatsächlich durch eine List dazu gebracht, ihnen bei ihrem Verrat zu helfen? Mal wirkte weder ängstlich noch besorgt, sondern sah aus wie damals, wenn er in Keramzin etwas ausgeheckt hatte, das uns beiden Ärger einhandeln würde. Man hatte ihn ins Gesicht geschlagen, aber mir fiel auf, dass er jetzt aufrechter dastand. Dann blickte er auf, als wollte er zum Himmel beten, aber ich wusste es besser, denn Mal war nie gläubig gewesen. Nein, er richtete seinen Blick auf den großen Rauchfang.
Ein Gespinst von Verschwörungen. Davids Nervosität. Tamars Worte. Ihr vertraut ihr.
»Lasst sie frei«, befahl ich.
Der Asket schüttelte betrübt den Kopf. »Unsere Heilige ist von den Menschen geschwächt worden, die vorgeben, sie zu lieben. Seht nur, wie gebrechlich und kränklich sie ist. Das liegt am verderblichen Einfluss ihrer angeblichen Freunde.« Einige Priestergardisten nickten. Ich sah das fanatische Funkeln in ihren Augen. »Sie ist eine Heilige, aber auch ein junges, ihren Gefühlen ausgeliefertes Mädchen. Sie begreift nicht, welche Kräfte hier am Werk sind.«
»Ich begreife, dass Ihr auf Abwege geraten seid, Priester.«
Der Asket schenkte mir wieder sein mitleidiges, nachsichtiges Lächeln. »Ihr seid krank, Sankta Alina. Euer Verstand ist getrübt. Ihr könnt Freund und Feind nicht mehr voneinander unterscheiden.«
Das ist ja auch kein Wunder, dachte ich düster und holte tief Luft. Dies war der Augenblick der Entscheidung. Ich musste jemandem Vertrauen schenken, und dieser Jemand war nicht der Asket, ein Mann, der zuerst den Zaren und danach den Dunklen verraten hatte und der mit Freuden meinen Märtyrertod inszenieren würde, wenn dies seinen Zwecken diente.
»Ihr werdet sie freilassen«, wiederholte ich. »Das ist meine letzte Warnung.«
Ein selbstzufriedenes Grinsen überflog sein Gesicht. Hinter seinem Mitleid verbarg sich Hochmut. Er wusste genau, wie schwach ich war. Ich konnte nur hoffen, dass die anderen wussten, was sie taten.
»Man wird Euch zu Euren Gemächern eskortieren. Dort werdet Ihr den Tag in stiller Einkehr verbringen«, sagte er. »Ihr werdet über die Ereignisse nachdenken und wieder zur Besinnung kommen. Heute Abend beten wir gemeinsam. Auf dass uns der rechte Weg gezeigt werde.«
Warum argwöhnte ich nur, dass er den rechten Weg zum Feuervogel und zu dem möglichen Aufenthaltsort Nikolai Lantsovs meinte?
»Und wenn ich mich weigere?«, fragte ich und ließ den Blick über die Priestergardisten gleiten. »Richten Eure Männer die Waffen dann gegen ihre Heilige?«
»Man wird Euch beschützen, nicht behelligen, Sankta Alina«, sagte der Priester. »Doch jenen, die Ihr für Eure Freunde haltet, kann ich diese Freundlichkeit leider nicht entgegenbringen.«
Schon wieder eine Drohung. Ich betrachtete die Gesichter und lodernden Augen der Gardisten. Sie würden Mal ermorden, Genya töten, mich in meine Gemächer sperren und all das auch noch für gut und gerecht halten.
Ich wich etwas zurück. Ich wusste, dass der Asket dies als Zeichen von Schwäche deuten würde. »Wisst Ihr, warum ich die Küche so oft aufsuche, Priester?«
Seine abfällige Handbewegung verriet seine Ungeduld. »Sie erinnert Euch an Euer Zuhause.«
Ich blickte kurz zu Mal. »Ihr solltet endlich begreifen«, erwiderte ich, »dass ein Waisenkind kein Zuhause hat.« Ich bewegte meine Finger in den Ärmeln. Schatten zuckten an den Wänden empor. Kein umwerfendes, aber ein ausreichendes Ablenkungsmanöver. Die Priestergardisten erschraken und fuchtelten mit den Gewehren, während die gefangenen Grisha entsetzt zurückzuckten. Mal zögerte keine Sekunde.
»Jetzt!«, schrie er, rannte los und entriss dem Asketen den Beutel mit Sprengstoff.
Tolya ballte die Fäuste. Zwei Priestergardisten brachen zusammen, die Hände gegen die Brust gepresst. Nadia und Zoya streckten die Arme aus, und Tamar durchtrennte ihre Fesseln mit einem Axthieb. Beide Stürmerinnen reckten die Arme, und ein Windstoß fuhr durch den Raum und wirbelte die Sägespäne auf dem Fußboden durcheinander.
»Ergreift sie!«, brüllte der Asket. Die Gardisten traten sofort in Aktion.
Mal warf den Beutel in die Luft. Nadia und Zoya trieben ihn weiter in die Höhe, in Richtung des großen Rauchfangs.
Mal griff einen Gardisten an. Er hatte den Rippenbruch offenbar nur vorgetäuscht, denn seine Bewegungen waren nicht mehr zögerlich. Ein Faustschlag, ein Ellbogenstoß. Der Priestergardist knickte ein. Mal entriss ihm die Pistole und zielte auf den Rauchfang, in die Dunkelheit.
Das war der Plan? Ein solcher Schuss konnte nicht gelingen.
Ein anderer Gardist versuchte, Mal zu packen, aber er entwand sich dem Griff und drückte ab.
Kurz trat angespannte Stille ein, dann ertönte hoch über uns der dumpfe Knall einer Explosion.
Eine Wolke aus Ruß und Geröll durch den Rauchfang rauschte auf uns zu.
»Nadia!«, rief Zoya, die mit einem Gardisten rang.
Nadia breitete ihre Arme in einem Halbkreis aus, und die Wolke blieb in der Luft hängen, drehte und verdichtete sich, bis sie die Gestalt einer Windhose angenommen hatte, die dann als harmloser Regen aus Dreck und Steinen auf dem Fußboden zusammenbrach.
Alles, was sich abspielte, nahm ich halb bewusst wahr – die Kämpfe, die Wutschreie des Asketen, das brennende Fett vor der hinteren Wand.
Genya und ich hatten uns nur aus einem einzigen Grund in der Küche getroffen: wegen der Herde. Nicht etwa wegen der Wärme oder der Gemütlichkeit, sondern weil jeder der uralten Herde mit dem großen Rauchfang verbunden war. Und dieser Rauchfang war der einzige Schacht in der Weißen Kathedrale, der bis zur Oberfläche führte. Zum Sonnenschein.
»Tötet sie!«, schrie der Asket den Priestergardisten zu. »Sie wollen unsere Heilige ermorden! Sie wollen uns alle ermorden!«