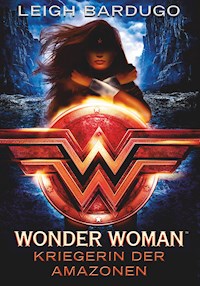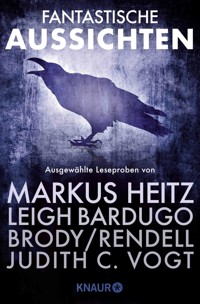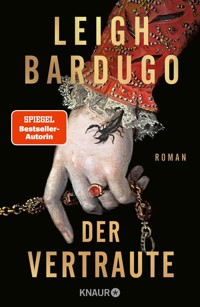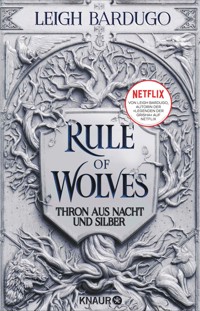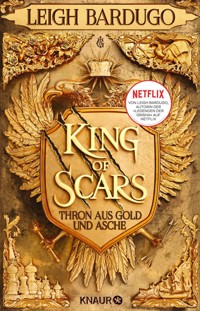
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die King-of-Scars-Dilogie
- Sprache: Deutsch
Freibeuter. Soldat. Bastard. Überlebender. Herrscher. Leigh Bardugo – Autorin der Fantasy-Bestseller »Das Lied der Krähen« und »Das Gold der Krähen« – erzählt die Geschichte der beliebtesten Figur ihrer Grisha-Trilogie weiter: Nikolai Lantsov Niemand weiß, was der junge König von Ravka, während des blutigen Bürgerkrieges durchgemacht hat. Und wenn es nach Nikolai selbst geht, soll das auch so bleiben. Jetzt, wo sich an den geschwächten Grenzen seines Reiches neue Feinde sammeln, muss er einen Weg finden, Ravkas Kassen wieder aufzufüllen, Allianzen zu schmieden und eine wachsende Bedrohung für die einstmals mächtige Armee der Grisha abzuwenden. Doch mit jedem Tag wird in dem jungen König eine dunkle Magie stärker und stärker und droht, alles zu zerstören, was er aufgebaut hat. Schließlich begibt Nikolai sich mit einem jungen Mönch und der legendären Grisha-Magierin Zoya auf eine gefährliche Reise zu jenen Orten in Ravka, an denen die stärkste Magie überdauert hat. Denn nur dort besteht eine Chance, sein dunkles Vermächtnis zu bannen. Einige Geheimnisse sind jedoch nicht dafür geschaffen, verborgen zu bleiben – und einige Wunden werden niemals heilen. »King of Scars« ist der erste Teil der Fantasy-Dilogie »Thron aus Gold und Asche« von Bestseller-Autorin Leigh Bardugo und unabhängig lesbar. Wie schon die Grisha-Trilogie und die Krähen-Dulogie, begeistert dieses Fantasy-Abenteuer mit Dialogwitz, düsterer Magie und facettenreichen Charakteren. Die Grisha-Trilogie ist in folgender Reihenfolge erschienen: - »Goldene Flammen« - »Eisige Wellen« - »Lodernde Schwingen« Die Krähen-Dilogie ist in folgender Reihenfolge erschienen: - »Das Lied der Krähen« - »Das Gold der Krähen« Noch mehr Geschichten aus der Grisha-Welt: - »Die Sprache der Dornen« (illustrierte Märchen aus der Welt der Grisha) - »Die Leben der Heiligen« (illustrierte Heiligen-Legenden aus der Welt der Grisha) - »Demon in the Wood. Schatten der Vergangenheit« (Graphic Novel zur Vorgeschichte des Dunklen)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 742
Veröffentlichungsjahr: 2019
Sammlungen
Ähnliche
Leigh Bardugo
King of Scars
Thron aus Gold und Asche
Ins Deutsche übertragen von Michelle Gyo
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Niemand weiß, was Nikolai Lantsov, der junge König von Ravka, während des blutigen Bürgerkrieges durchgemacht hat. Und wenn es nach Nikolai geht, soll das auch so bleiben.
Jetzt, wo sich an den geschwächten Grenzen seines Reiches neue Feinde sammeln, muss er einen Weg finden, Ravkas Kassen wieder aufzufüllen, Allianzen zu schmieden und eine wachsende Bedrohung für die einstmals mächtige Armee der Grisha abzuwenden.
Doch mit jedem Tag wird in dem jungen König eine dunkle Magie stärker und stärker und droht, alles zu zerstören, was er aufgebaut hat. Schließlich begibt Nikolai sich mit einem jungen Mönch und der legendären Grisha-Magierin Zoya auf eine gefährliche Reise zu jenen Orten in Ravka, an denen die stärkste Magie überdauert hat. Möglicherweise besteht so eine Chance, sein dunkles Vermächtnis zu bannen.
Einige Geheimnisse sind jedoch nicht dafür geschaffen, verborgen zu bleiben – und einige Wunden werden niemals heilen.
Inhaltsübersicht
Widmung
Karte
Die Grisha
Der Ertrinkende
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Die Hexe im Wald
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Danksagung
Für Morgan Fahey –
Befehlshaberin in Kriegszeiten
Consigliere in Friedenszeiten
liebste Freundin
(vor allem) huldvolle Königin
Die Grisha
Soldaten der Zweiten Armee
Meister der Kleinen Künste
Orden der Lebenden und der Toten
Entherzer
Heiler
Orden der Beschwörer
Stürmer
Inferni
Fluter
Orden der Fabrikatoren
Durasten
Alkemi
Der Ertrinkende
Dima hörte das Knallen der Scheunentüren, bevor es jemand anderem auffiel. In der Küche in dem kleinen Bauernhaus brodelte es wie in einem Topf, der auf dem Herd stand. Die Läden waren gegen den Sturm fest verschlossen, und die Luft im Zimmer war feucht und warm. Die Wände wackelten wegen des Radaus, den Dimas Brüder veranstalteten. Sie redeten laut durcheinander, und seine Mutter summte ein Lied, das Dima nicht kannte, und tappte dabei den Takt mit einem Fuß auf den Boden. Sie hielt den zerrissenen Ärmel vom Hemd seines Vaters straff gespannt auf dem Schoß, und die Nadel pickte wie ein aufgeregter Spatz am Stoff, während ein Wollfaden zwischen ihren Fingern hervorhing wie ein besonders fetter Wurm.
Dima war der jüngste von sechs Jungen, seine Mutter hatte ihn spät bekommen, lange nachdem der Arzt, der jeden Sommer ins Dorf kam, ihr eröffnet hatte, dass sie keine weiteren Kinder haben würde. Ein unerwarteter Segen, sagte seine Mama gern, wenn sie ihn an sich drückte und an ihm herumzupfte, während die anderen ihren Pflichten nachgingen. Ein unerwünschtes Maul zum Stopfen, murmelte sein älterer Bruder Pyotr gern.
Weil Dima so klein war, ließen seine Brüder ihn bei ihren Streichen oft außen vor, und auch bei den lärmenden Auseinandersetzungen vergaß man ihn meist, und genau deshalb stand er an diesem Abend im Herbst am Becken und spülte den Topf, den seine Brüder ihm zugeschustert hatten, als er das verfluchte Schlagen der Scheunentür hörte. Dima schrubbte heftiger, fest entschlossen, seine Arbeit zu erledigen und dann ins Bett zu gehen, bevor jemandem einfiel, ihn hinaus in die Dunkelheit zu schicken. Er hörte ihre Hündin, Molniya, die auf der Küchentreppe draußen winselte und um Essensreste und einen Schlafplatz im Warmen bettelte, und den Wind, der sich jetzt zu einem wütenden Heulen erhob.
Zweige peitschten gegen die Fenster. Mama hob den Kopf, und die grimmigen Falten um ihren Mund vertieften sich. Sie blickte finster, als ob sie den Wind ohne Abendessen ins Bett schicken könnte. »Der Winter kommt früh und bleibt zu lange.«
»Wie deine Mutter«, sagte Papa, und Mama versetzte ihm einen Tritt mit dem Stiefel.
An diesem Abend hatte sie ein kleines Glas Kvas hinter dem Herd stehen lassen, als Geschenk an die Hausgeister, die hinter dem alten Eisenofen schliefen und über den Hof wachten. Zumindest sagte Mama das. Papa verdrehte nur die Augen und beschwerte sich, weil sie den guten Kvas vergeudete.
Dima wusste, dass Pyotr, sobald alle im Bett wären, den Kvas trinken und auch das Stück Honigkuchen essen würde, das Mama in ein Tuch gewickelt danebengelegt hatte. »Urgroßmutters Geist wird dich heimsuchen«, sagte Dima manchmal warnend. Aber Pyotr wischte sich dann nur mit dem Ärmel übers Kinn. »Es gibt keine Geister, du kleiner Idiot. Baba Galina war ein Festmahl für die Friedhofswürmer, und das Gleiche wird dir zustoßen, wenn du nicht den Mund hältst.«
Jetzt beugte Pyotr sich zu Dima herab und versetzte ihm einen Stoß. Dima fragte sich oft, ob Pyotr wohl besondere Übungen machte, damit seine Ellbogen noch spitzer wurden. »Hast du das gehört?«, fragte sein Bruder.
»Da ist nichts«, sagte Dima, aber ihm wurde das Herz schwer. Falls Pyotr die Scheunentür gehört hatte …
»Etwas ist dort draußen, es reitet den Sturm.«
Sein Bruder versuchte bloß, ihm Angst einzujagen. »Sei nicht dumm«, sagte Dima, doch er war erleichtert.
»Hör doch nur«, sagte Pyotr, und als jetzt der Wind am Dach des Hauses rüttelte und das Feuer im Herd zischte, da glaubte Dima, etwas anderes als den Sturm zu hören – ein hohes, fernes Heulen, wie das Jaulen eines hungrigen Tiers oder das Schreien eines Kindes. »Wenn der Wind über den Friedhof fegt, weckt er die Geister aller Babys, die gestorben sind, bevor man ihnen ihren Heiligennamen geben konnte. Malenchki. Sie suchen nach Seelen, die sie stehlen können, damit sie sich so den Weg in den Himmel ertauschen können.« Pyotr beugte sich herab und stieß den Finger in Dimas Schulter. »Sie holen immer die Jüngsten.«
Dima war acht, alt genug, um es besser zu wissen, aber dennoch verirrte sich sein Blick zu den Fenstern und hinaus zu dem mondhellen Hof, in dem die Bäume vom Wind geschüttelt wurden. Er zuckte zusammen. Er hätte schwören können – nur für einen flüchtigen Augenblick –, dass er einen Schatten über den Hof huschen sah, der dunkle Fleck von etwas viel Größerem, als dass es ein Vogel hätte sein können.
Pyotr lachte und bespritzte ihn mit Seifenwasser. »Ich schwöre, du wirst jeden Tag irrsinniger. Wer würde deine kleine dumme Seele schon wollen?«
Pyotr ist nur böse, weil er der Kleine war, bevor du gekommen bist, sagte Mama immer zu Dima. Du musst versuchen, nett zu deinem Bruder zu sein, auch wenn er älter, aber nicht weiser ist. Dima versuchte es. Das tat er wirklich. Und doch wollte er Pyotr manchmal einfach nur zu Boden stoßen, um zu sehen, wie es ihm wohl gefiele, sich so hilflos zu fühlen.
Der Wind ließ plötzlich nach, und in der kurzen Stille war das laute Knallen, das über den Hof hallte, nicht mehr zu leugnen.
»Wer hat die Scheunentür offen gelassen?«, fragte Papa.
»Es war Dimas Aufgabe, heute Abend nach den Ställen zu sehen«, sagte Pyotr selbstgerecht, und seine Brüder, die um den Tisch versammelt saßen, schnalzten mit den Zungen.
»Ich habe sie verschlossen«, widersprach Dima. »Ich habe den Riegel fest vorgeschoben!«
Papa lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. »Bilde ich mir das Geräusch also ein?«
»Er denkt vermutlich, es war ein Geist«, sagte Pyotr.
Mama sah von ihrer Flickarbeit auf. »Dima, du musst rausgehen und die Scheunentür schließen.«
»Ich mache es«, sagte Pyotr mit einem schicksalsergebenen Seufzen. »Wir alle wissen, dass Dima Angst vor der Dunkelheit hat.«
Dima spürte, dass dies eine Prüfung war. Papa würde erwarten, dass er die Verantwortung übernahm. »Ich habe keine Angst«, sagte er. »Natürlich gehe ich und schließe die Stalltüren.«
Dima ignorierte Pyotrs selbstgefälligen Blick; er wischte sich die Hände ab, dann zog er seinen Mantel an und setzte den Hut auf. Mama gab ihm eine Blechlaterne. »Mach schnell«, sagte sie und stellte ihm den Kragen auf, damit sein Hals warm blieb. »Komm rasch zurück, und ich bringe dich ins Bett und erzähl dir eine Geschichte.«
»Eine neue?«
»Ja, und zwar eine gute, über die Meerjungfrauen des Nordens.«
»Kommt Magie darin vor?«
»Jede Menge. Und jetzt geh.«
Dima warf einen Blick zur Ikone von Sankt Feliks, die an der Wand neben der Tür war und über deren kummervolle Miene das Kerzenlicht flackerte. Sein Blick schien voller Mitgefühl, als wüsste er, wie kalt es draußen war. Man hatte Feliks auf Apfelbaumzweige gespießt und ihn dann bei lebendigem Leib gebraten, nur Stunden, nachdem er das Wunder der Obstgärten vollbracht hatte. Er hatte weder geschrien noch geweint, sondern nur vorgeschlagen, dass die Dorfbewohner ihn doch drehen sollten, sodass die Flammen auch seine andere Seite erreichten. Feliks würde sich sicher nicht vor einem Sturm fürchten.
Als Dima die Küchentür öffnete, wollte der Wind sie ihm aus der Hand reißen. Mit einem Knall schlug er sie hinter sich zu und hörte, wie der Riegel von der anderen Seite vorgelegt wurde. Er wusste, dass es nur für den Moment war, eine Notwendigkeit, aber es fühlte sich dennoch an, als bestrafte man ihn. Er sah zurück zu den erleuchteten Fenstern, dann zwang er seine Füße, die Stufen bis zur trockenen harten Erde des Hofs hinabzusteigen, wobei ihm der schreckliche Gedanke kam, dass seine Familie ihn in dem Moment vergessen hatte, in dem er die Küche verließ, und dass sie nicht weinen würden, wenn er nicht zurückkehrte. Der Wind würde Dima einfach aus ihrem Gedächtnis löschen.
Er musterte den langen, von Mondlicht erhellten Streifen, den er am Hühnerhaus und dem Gänsestall vorbei durchqueren musste, um zu der Scheune zu gelangen, in der sie ihr altes Pferd namens Gerasim und die Kuh Mathilde untergebracht hatten.
»Versehen mit Sägeblättern aus Stahl«, flüsterte er und strich mit der Hand über den neuen Pflug, als er daran vorbeiging, als wäre er ein Amulett. Er war nicht sicher, warum diese Klingen besser waren, aber als der Pflug angekommen war, waren das die Worte, die sein Vater den Nachbarn stolz gesagt hatte, und Dima hatte gefallen, wie stark das klang. Über den Pflug hatte es lange Debatten am Küchentisch gegeben, genauso wie über die Landwirtschaftsreformen des Zaren und welche Schwierigkeiten oder Hoffnung sie bringen mochten.
»Wir halten auf einen neuen Bürgerkrieg zu«, hatte Mama gemurrt. »Der Zar ist zu tollkühn.«
Aber Papa war zufrieden. »Wie kannst du dir Sorgen machen, wo dein Bauch voll und das Dach mit frischem Teer geflickt ist? Das ist das erste Jahr, in dem wir genug Ernte einfahren konnten, um davon etwas auf dem Markt zu verkaufen, statt nur uns durchzubringen.«
»Weil der Zar den Zehnten von Herzog Radimov zu einem Bruchteil dessen zusammengestrichen hat, was er war«, rief seine Mama aus.
»Und sollte uns das leidtun?«
»Das wird es, wenn der Herzog und seine noblen Freunde den Zaren in seinem Bett ermorden.«
»Zar Nikolai ist ein Kriegsheld!«, sagte Papa und winkte mit der Hand durch die Luft, als ob Ärger wie Pfeifenrauch vertrieben werden könnte. »Es wird keinen Putsch geben ohne die Armee, die ihn unterstützt.«
Sie drehten sich im Kreis, diskutierten Abend für Abend die gleichen Dinge. Dima verstand nicht viel davon, nur, dass er für den jungen Zaren beten sollte.
Die Gänse zischten und raschelten in ihrem Verschlag, vom Wetter oder Dimas nervösen Schritten aufgescheucht. Vor sich sah er die großen Holztüren der Scheune auf- und zuschwingen, so als seufzte der Bau, oder als wäre das Tor ein Maul, das ihn mit einem gewaltigen Atemzug einsaugen wollte. Am Tag war er gern in der Scheune, wenn das Sonnenlicht durch die Dachsparren fiel und alles nach Heu roch, wenn Gerasim schnaubte und Mathilde entrüstet muhte. Doch nachts wurde die Scheune zu einer leeren Hülle, die nur darauf wartete, von irgendeiner schrecklichen Kreatur ausgefüllt zu werden – ein gerissenes Ding, das die Türen auf- und zuschlagen ließ, um einen dummen Jungen nach draußen zu locken. Denn Dima wusste einfach, dass er diese Türen geschlossen hatte. Er war sich ganz sicher, und nun musste er an Pyotrs Malenchki denken, die kleinen Geister, die Seelen jagten.
Hör auf, schalt sich Dima. Pyotr hat die Türen entriegelt, damit du raus in die Kälte gehen musst, oder dich bloßstellst, wenn du dich nicht traust. Dima hatte jedoch seinen Brüdern und seinem Vater gezeigt, dass er mutig sein konnte, und dieser Gedanke wärmte ihn, als er jetzt den Kragen bis zu den Ohren hochzog und in dem beißenden Wind erschauderte. Erst jetzt fiel ihm auf, dass er Molniya nicht mehr bellen hörte. Sie war nicht an der Tür gewesen und hatte auch nicht versucht, sich heimlich in die Küche zu schleichen, als Dima sich nach draußen gewagt hatte.
»Molniya?«, fragte er, und der Wind packte seine Stimme und trug sie davon. »Molniya!«, rief er erneut, doch kaum lauter – falls noch etwas anderes als sein Hund dort draußen war und ebenfalls lauschte.
Schritt um Schritt durchquerte er den Hof, während die Schatten der Bäume über den Boden hüpften und zuckten. Hinter dem Wald erkannte er das breite Band der Straße. Sie führte bis zur Stadt, bis zum Kirchhof. Dima erlaubte seinem Blick nicht, ihr zu folgen. Zu leicht war es, sich einen dahinschlurfenden Leichnam in zerlumpten Kleidern vorzustellen, dessen Weg von Klumpen aus Friedhofsdreck gesäumt wurde.
Er hörte ein leises Wimmern irgendwo zwischen den Bäumen. Dima keuchte auf. Gelbe Augen starrten ihn aus der Dunkelheit an. Der Schein der Laterne fiel auf schwarze Pfoten, gesträubtes Fell und entblößte Zähne.
»Molniya!«, sagte er und seufzte erleichtert auf. Jetzt war er froh um das laute Ächzen des Sturms. Der Gedanke, dass seine Brüder seinen hohen, peinlichen Schrei gehört haben könnten und nun angerannt kämen, um festzustellen, dass bloß seine arme Hündin im Gebüsch kauerte, war zu schrecklich, um ihn auch nur zu Ende zu denken. »Komm her, mein Mädchen«, lockte er sie leise.
Molniya lag da, den Bauch fest auf den Boden gedrückt und die Ohren flach an den Kopf gelegt. Sie bewegte sich nicht.
Dima blickte zur Scheune zurück. Der Balken, der das Tor hätte verriegeln sollen, lag zersplittert im Gebüsch. Von drinnen ertönte ein leises, feuchtes Schnüffeln. War es ein verletztes Tier, das in die Scheune gelangt war? Oder ein Wolf?
Das goldene Licht, das durch die Fenster des Bauernhauses fiel, schien ihm unendlich weit entfernt. Vielleicht sollte er zurücklaufen und Hilfe holen. Sie erwarteten doch sicher nicht von ihm, dass er sich einem Wolf allein stellte. Aber was wäre, wenn nichts in der Scheune wäre? Oder wenn es nur eine harmlose Katze wäre, die Molniya erwischt hatte? Dann würden all seine Brüder ihn auslachen, und nicht mehr nur Pyotr.
Langsam schlurfte Dima los, die Laterne weit vor sich gestreckt. Er wartete, bis der Sturm sich kurz beruhigte, dann packte er die Kante der schweren Tür und hielt sie fest, damit sie ihn nicht traf, wenn er eintrat.
Die Scheune war dunkel, der Streifen Mondlicht reichte kaum bis hinein. Vorsichtig trat Dima tiefer in die Finsternis. Er dachte an Sankt Feliks’ sanften Blick, den Apfelzweig, der sein Herz durchbohrt hatte. In diesem Moment kam der Wind wieder auf, so als hätte der Sturm nur kurz den Atem angehalten. Die Türen schlugen mit einem Knall hinter Dima zu, und das schwache Licht der Laterne erlosch mit einem Zischen.
Draußen hörte er den Sturm wüten, aber in der Scheune war es still. Die Tiere waren ruhig geworden, als warteten sie auf etwas, und er nahm den säuerlichen Geruch ihrer Angst über der Süße des Heus wahr – und dann war da noch etwas anderes. Dima kannte diesen Duft von den Tagen, wenn sie Gänse für die Feiertage schlachteten: der stechende, kupfrige Geruch nach Blut.
Lauf zurück, dachte er.
In der Dunkelheit bewegte sich etwas. Dima sah ein Aufblitzen des Mondlichts, den Glanz von etwas, das Augen sein mochten. Und dann schien es, als risse sich ein Stück des Schattens los und glitte durch die Scheune.
Dima machte einen Schritt rückwärts und drückte die nun nutzlose Laterne an seine Brust. Der Schatten trug die zerfetzten Überreste von Kleidung, die wohl einmal fein gewesen war, und kurz hoffte Dima, dass sich ein Reisender in die Scheune verirrt hätte, der den Sturm hier verschlafen wollte. Die Bewegungen waren jedoch nicht die eines Menschen. Es bewegte sich zu elegant, zu lautlos, als die Gestalt sich nun dicht über dem Boden zusammenduckte. Als der Schatten sich ihm langsam näherte, wimmerte Dima. Die Augen waren schwarz, und dunkle Adern breiteten sich von den klauenartigen Fingerspitzen aus, als wären seine Hände in Tinte getaucht worden. Die Schattenranken zeichneten sich auf seiner Haut ab und schienen zu pulsieren.
Lauf, dachte Dima. Schrei. Er musste an die Gänse denken, die so vertrauensvoll zu Pyotr kamen und nicht einmal in den letzten Sekunden, bevor sein Bruder ihnen die Hälse umdrehte, protestierten. Dumm, hatte Dima da gedacht, aber jetzt verstand er sie.
Das Ding erhob sich auf die Hinterbeine, eine schwarze Gestalt, auf deren Rücken sich ein gewaltiges Paar Schwingen entfaltete, deren Ränder sich wie Rauch kräuselten.
»Papa!«, versuchte Dima zu rufen, aber das Wort war kaum ein Atemhauch.
Das Ding zögerte, als ob das Wort ihm irgendwie vertraut wäre. Es lauschte, den Kopf zur Seite geneigt, und Dima machte einen weiteren Schritt zurück, dann noch einen.
Der Blick des Monsters heftete sich sofort auf Dima, und plötzlich war die Kreatur nur noch Zentimeter von ihm entfernt und ragte über ihm auf. Das graue Mondlicht fiel auf die Gestalt, und Dima erkannte, dass die dunklen Flecken um das Maul und auf der Brust Blut waren.
Die Kreatur beugte sich vor, sog tief die Luft ein. Aus der Nähe hatte sie die Züge eines jungen Mannes – doch dann teilten sich die Lippen, die Mundwinkel zogen sich zurück, und lange schwarze Reißzähne kamen zum Vorschein.
Es lächelte. Das Monster lächelte – weil es wusste, dass es bald satt sein würde. Dima spürte etwas Warmes an seinem Bein hinablaufen, und er begriff, dass er sich eingenässt hatte.
Das Monster sprang.
Die Türen hinter Dima flogen auf, und der Sturm verlangte Einlass. Ein lautes Krachen erklang, als der Windstoß die Kreatur von den klauenbewehrten Füßen riss und den geflügelten Körper an die gegenüberliegende Wand schleuderte. Die Holzbalken zersplitterten unter der Wucht des Aufpralls, und das Ding sank zu Boden.
Eine Gestalt in einem grauen Mantel betrat die Scheune, und ein nicht natürlicher Windstoß ließ die langen schwarzen Haare aufwirbeln. Der Mond erhellte ihre Gesichtszüge, und Dima weinte heftiger, denn sie war zu schön für einen gewöhnlichen Menschen, also musste sie eine Heilige sein. Er war wohl gestorben, und sie war hier, um ihn in die strahlenden Lande zu geleiten.
Doch sie beugte sich nicht hinab, um ihn in ihre Arme zu nehmen oder ihm leise Gebete oder tröstende Worte zuzumurmeln. Stattdessen näherte sie sich dem Monster, die Hände vor sich ausgestreckt. Sie musste eine Kriegerheilige sein wie Sankt Juris, wie Sankta Alina von der Schattenflur.
»Sei vorsichtig«, brachte Dima leise hervor, da er sich um sie sorgte. »Es hat … Zähne.«
Doch seine Heilige hatte keine Angst. Sie stupste das Monster mit der Stiefelspitze an und rollte es so auf die Seite. Die Kreatur knurrte, als sie erwachte, und Dima packte die Laterne fester, als wäre sie ein Schild.
Mit ein paar raschen Bewegungen hatte die Heilige die klauenbewehrten Hände der Kreatur mit schweren Fesseln umschlungen. Sie zerrte fest an der Kette und zwang das Monster zum Aufstehen. Es schnappte nach ihr, aber sie schrie nicht auf und wich auch nicht zurück. Sie schlug der Kreatur nur auf die Nase, als wäre es ein unartiges Haustier.
Das Ding fauchte und zerrte vergeblich an den Fesseln. Die Schwingen schlugen einmal, zweimal, wollten sie mit hochheben, aber sie packte die Kette fester und stieß die andere Hand vor. Ein weiterer Windstoß traf das Monster und schleuderte es gegen die Scheunenwand. Dort sackte es zu Boden, ging auf die Knie, rappelte sich wieder auf und schwankte unsicher, was es sonderbar menschlich wirken ließ, so wie sein Papa, nachdem er lange in der Schenke gewesen war. Die Heilige murmelte etwas, und die Kreatur fauchte erneut, als der Wind um sie herum aufwirbelte.
Keine Heilige, begriff Dima da. Eine Grisha. Eine Soldatin der Zweiten Armee. Eine Stürmerin, die den Wind beherrschte.
Sie nahm ihren Mantel und warf ihn der Kreatur über Kopf und Schultern, dann führte sie ihren Gefangenen an Dima vorbei. Das Monster wehrte sich und schnappte immer noch nach ihr.
Sie warf Dima eine Silbermünze zu. »Für den Schaden«, sagte sie, die Augen hell wie Juwelen im Mondlicht. »Du hast heute Nacht nichts gesehen, verstanden? Halt den Mund, oder ich halte ihn nächstes Mal nicht im Zaum.«
Dima nickte und spürte, wie frische Tränen über seine Wangen rannen. Die Grisha hob eine Braue. Noch nie hatte er ein Gesicht gesehen wie ihres, es war schöner als jede Ikone, die Augen so blau wie die tiefsten Tiefen des Flusses. Sie warf ihm eine weitere Münze zu, und es gelang ihm gerade so, sie aus der Luft zu fangen.
»Die ist für dich. Teile sie nicht mit deinen Brüdern.«
Dima sah ihr hinterher, als sie durch die Scheunentür verschwand. Er zwang seine Füße, sich in Bewegung zu setzen. Er wollte ins Haus zurückkehren, zu seiner Mutter, und das Gesicht in ihren Röcken vergraben, aber er wollte auch unbedingt einen letzten Blick auf die Grisha und ihr Monster werfen. Er lief ihnen hinterher, so leise er konnte. In den Schatten neben der mondbeschienenen Straße wartete eine große Kutsche, deren Fahrer in Schwarz gehüllt war. Der Kutscher sprang herab und packte die Kette, half, die Kreatur hineinzuziehen.
Dima wusste, dass er träumen musste, trotz der Kühle des Silbers, das er in seiner Hand spürte, denn der Kutscher sah das Monster nicht an und sagte auch nicht Na los, du Untier! oder Du wirst diese Leute niemals mehr belästigen!, wie es der Held in einer Geschichte tun würde.
Stattdessen glaubte Dima zu hören, wie der Kutscher in den tiefen Schatten der schwankenden Kiefern sagte: »Achtet auf Euren Kopf, Eure Hoheit.«
Der Gestank nach Blut hing schwer in der Kutsche. Zoya presste sich den Ärmel vor die Nase, aber der muffige Geruch von schmutziger Wolle war keine sonderliche Verbesserung.
Übel. Es war schlimm genug, dass sie mitten in der Nacht in einer geliehenen, schlecht gefederten Kutsche durch Ravka fuhren, aber dann auch noch in einem solchen Kleidungsstück? Das war wirklich nicht akzeptabel. Sie riss sich den Mantel vom Leib. Der Geruch haftete an der Seide ihrer bestickten blauen Kefta, aber sie fühlte sich wieder ein wenig besser und etwas mehr wie sie selbst.
Sie waren zehn Meilen von Ivets entfernt, fast hundert Meilen von der sicheren Hauptstadt, und rasten jetzt über schmale Straßen zurück zum Anwesen des Gastgebers des Handelsgipfels, Herzog Radimov. Zoya hatte für Gebete nichts übrig, deshalb hoffte sie einfach, dass niemand beobachtet hatte, wie Nikolai seinen Gemächern entkommen und in den Himmel aufgestiegen war. Wären sie zu Hause, in Os Alta, wäre das hier niemals geschehen. Sie hatte geglaubt, sie hätten genug Vorkehrungen getroffen. Sie hätte sich nicht mehr irren können.
Die Hufe des Pferdes donnerten, und die Räder der Kutsche ratterten und sprangen, während neben ihr der Zar von Ravka mit den nadelspitzen Zähnen knirschte und an seinen Ketten zog.
Zoya hielt Abstand. Sie hatte gesehen, was ein Biss von Nikolai anrichten konnte, wenn er sich in diesem Zustand befand, und sie hatte wirklich keine Lust, einen Körperteil oder Schlimmeres zu verlieren. Am liebsten hätte sie Tolya oder Tamar, die Geschwister, die dem Zaren als persönliche Garde dienten, gebeten, mit ihr gemeinsam in der Kutsche zu fahren, bis Nikolai wieder seine menschliche Gestalt annahm. Der Vater der beiden war ein Shu-Söldner gewesen, der ihnen das Kämpfen beigebracht hatte, ihre Mutter war eine Grisha, von der sie die Gabe der Entherzer geerbt hatten. Die Anwesenheit der Zwillinge wäre angenehm gewesen. Aber ihr Stolz verhinderte das, und sie wusste auch, was es den Zaren kosten würde. Eine Zeugin für sein Elend war schlimm genug.
Draußen heulte der Wind. Es klang weniger wie das Gebell eines Tieres als wie das hohe, ausgelassene Lachen eines alten Freundes, der sie antrieb. Der Wind tat, was sie von ihm wollte, tat es, seit sie ein Kind gewesen war. Doch in solchen Nächten spürte sie, dass er nicht ihr Diener war, sondern ihr Verbündeter: ein Sturm, der sich erhob, um das Knurren einer Kreatur zu verbergen, die Geräusche eines Kampfes in einer wackligen Scheune zu vertuschen, die Streitereien auf Straßen und in Dorftavernen aufzupeitschen. Es war der Westwind, Adezku der Unruhestifter, ein würdiger Begleiter. Selbst wenn dieser Bauernjunge jedem in Ivets erzählte, was er gesehen hatte, würden sie es Adezku zuschreiben, dem schlitzohrigen Wind, der Frauen in die Betten ihres Nachbarn trieb und verrückte Gedanken wie gefallene Blätter durch die Köpfe der Männer wirbelte.
Wenig später verstummte das Knurren in der Kutsche; die Ketten klirrten nicht mehr, als die Kreatur sich immer tiefer in den Schatten zu drücken schien. Dann endlich erklang eine Stimme, rau und belegt. »Ich nehme nicht an, dass du mir ein frisches Hemd mitgebracht hast?«
Zoya hob ein Bündel vom Kutschenboden auf und zog ein sauberes weißes Hemd und einen pelzgefütterten Mantel hervor, beides fein gearbeitet, aber gründlich zerknittert – angemessene Bekleidung für einen Zaren, der die Nacht durchgezecht hatte.
Schweigend hielt Nikolai seine gefesselten Handgelenke hoch. Die Klauen hatten sich zurückgebildet, doch die schwarzen Linien, die er seit dem Ende des Bürgerkriegs vor drei Jahren trug, überzogen noch seine Hände. Der Zar trug häufig Handschuhe, um sie zu verbergen, aber Zoya fand, dass es falsch war. Die Narben waren eine Erinnerung an die Folter, die er durch die Hände des Dunklen erlitten hatte, und an den Preis, den er ebenso wie sein Land gezahlt hatte. Natürlich war das nur ein Teil der Geschichte, aber es war der Teil, mit dem die Leute aus Ravka am besten zurechtkamen.
Zoya öffnete die Ketten mit dem schweren Schlüssel, den sie um ihren Hals trug. Sie hoffte, dass sie es sich einbildete, aber die Narben auf Nikolais Händen schienen ihr in letzter Zeit dunkler, als wollten sie nie verblassen.
Als seine Hände frei waren, zog Nikolai das ruinierte Hemd aus. Er nutzte das Leinen und Wasser aus der Flasche, die sie ihm gab, um sich das Blut von Brust und Mund zu waschen, dann spritzte er etwas auf seine Hände und fuhr sich damit durchs Haar. Das Wasser rann ihm über Hals und Schultern. Er zitterte heftig, aber er sah wieder aus wie Nikolai – die grünbraunen Augen klar, das feuchte goldene Haar aus der Stirn zurückgestrichen.
»Wo hast du mich diesmal gefunden?«, fragte er und schaffte es beinahe, das Beben aus seiner Stimme zu verbannen.
Zoya rümpfte bei der Erinnerung die Nase. »Auf einem Gänsehof.«
»Ich hoffe, es war einer der moderneren Gänsehöfe.« Er mühte sich mit den Knöpfen des sauberen Hemds, seine Finger zitterten noch immer. »Wissen wir, was ich umgebracht habe?«
Oder wen? Die Frage hing unausgesprochen in der Luft.
Zoya schlug Nikolais bebende Hände von den Knöpfen weg und machte sich selbst an die Arbeit. Durch die dünne Baumwolle spürte sie die Kälte, die die Nacht auf seiner Haut zurückgelassen hatte.
»Du gibst eine vorzügliche Kammerdienerin ab«, murmelte er. Doch sie wusste, dass er es hasste, diese Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen, weil er so schwach war, dass er sie brauchte.
Anteilnahme würde es nur schlimmer machen, deshalb sagte sie schroff: »Ich vermute, du hast eine Menge Gänse getötet. Möglicherweise ein struppiges Pony.« War das alles gewesen? Zoya konnte nicht herausfinden, was das Monster vielleicht angerichtet hatte, bevor sie es gefunden hatten. »Du erinnerst dich an nichts?«
»Nur an Bruchstücke.«
Sie würden abwarten müssen, bis Nachrichten über Tote oder Verstümmelungen bekannt würden.
Die Probleme hatten sechs Monate zuvor begonnen, als Nikolai in einem Feld beinahe dreißig Meilen von Os Alta entfernt erwacht war, blutig und von Schrammen bedeckt, ohne Erinnerung, wie er aus dem Palast herausgekommen war oder was er in der Nacht getan hatte. Es scheint, ich schlafwandle seit Neuestem, hatte er Zoya und dem Rest der Triarchie verkündet, als er mit Verspätung zu ihrem morgendlichen Treffen aufgetaucht war, einen langen Kratzer auf der Wange.
Sie waren besorgt gewesen, aber auch verblüfft. Tolya und Tamar waren kaum die Art von Wache, die Nikolai einfach vorbeischlüpfen lassen würden. Wie bist du an ihnen vorbeigekommen?, hatte Zoya gefragt, während Genya den Kratzer mithilfe ihrer Macht geheilt und David etwas über Somnambulismus erzählt hatte. Doch falls es Nikolai beunruhigte, so hatte er sich nichts anmerken lassen. Ich bin in den meisten Dingen herausragend, hatte er gesagt. Warum nicht auch bei unwahrscheinlichen Ausbrüchen? Er ließ neue Schlösser an die Türen seiner Schlafgemächer anbringen und bestand darauf, dass sie sich wieder dem Tagesgeschäft zuwandten und einem seltsamen Bericht über ein Erdbeben in Ryevost, das Tausende silberner Kolibris aus einem Riss in der Erde freigesetzt hatte.
Gut einen Monat später hatte Tolya auf einem Stuhl vor den Gemächern des Königs gesessen und gelesen, als er das Geräusch splitternden Glases hörte und durch die Tür stürmte, wo er gerade noch sah, wie Nikolai vom Fenstersims sprang, auf dem Rücken Schwingen aus wirbelnden Schatten. Tolya hatte Zoya geweckt, und sie hatten den Zaren bis auf das Dach eines Kornspeichers fünfzehn Meilen entfernt verfolgt.
Danach hatten sie begonnen, den Zaren an sein Bett zu ketten – eine wirkungsvolle Lösung, die nur durchführbar war, weil Nikolais Diener im Palast sein Schlafgemach nicht betreten durften. Der Zar war schließlich ein Kriegsheld, und es war bekannt, dass er an Albträumen litt. Seither sperrte Zoya ihn jede Nacht ein und ließ ihn am Morgen wieder frei, und so schützten sie Nikolais Geheimnis. Nur Tolya, Tamar und die Triarchie kannten die Wahrheit. Würde jemand herausfinden, dass der Zar von Ravka seine Nächte in Ketten verbrachte, so wäre er das perfekte Ziel für einen Mordanschlag oder einen Putschversuch, mal abgesehen davon, dass er zur Witzfigur werden würde.
Und genau das machte Reisen so gefährlich. Doch Nikolai konnte nicht für immer hinter den Mauern von Os Alta bleiben.
»Ein Zar kann nicht in seinem eigenen Schloss eingesperrt bleiben«, hatte er verkündet, als er beschlossen hatte, seine Reisen wieder aufzunehmen. »Da riskiert man ja, weniger wie ein Regent als wie eine Geisel auszusehen.«
»Du hast Gesandte, die diese Staatsangelegenheiten für dich erledigen«, hatte Zoya dagegengehalten, »Botschafter, Untergebene.«
»Die Öffentlichkeit könnte vergessen, wie gut ich aussehe.«
»Das bezweifle ich. Dein Gesicht ist auf dem Geld.«
Nikolai weigerte sich dennoch einzulenken, und Zoya musste zugeben, dass er nicht ganz unrecht hatte. Sein Vater hatte den Fehler begangen, anderen das Herrschen zu überlassen, und das hatte ihn einiges gekostet. Man musste das Gleichgewicht halten, schätzte sie, zwischen Vorsicht und Wagemut, so ermüdend Kompromisse auch sein mochten. Das Leben verlief einfach glatter, wenn es nach ihrem Willen ging.
Nikolai und Zoya konnten nicht mit einer Truhe voller Ketten auf Reisen gehen, die neugierige Diener entdecken könnten, deshalb verließen sie sich in diesen Fällen auf ein starkes Beruhigungsmittel, das Nikolai ans Bett fesselte und das Monster in Schach hielt.
»Genya wird mein Mittel stärker machen müssen«, sagte er und streifte sich den Mantel über.
»Oder du könntest in der Hauptstadt bleiben und aufhören, so dumme Risiken einzugehen.«
Bisher hatte sich das Monster damit begnügt, Vieh anzugreifen, und seine Opfer hatten sich auf ausgeweidete Schafe und ausgesaugte Rinder beschränkt. Sie beide wussten jedoch, dass dies nur eine Frage der Zeit war. Was immer die Macht des Dunklen in Nikolai gepflanzt hatte, es gierte nach mehr als nur tierischem Fleisch.
»Der letzte Zwischenfall liegt kaum eine Woche zurück.« Er rieb sich mit der Hand übers Gesicht. »Ich dachte, ich hätte mehr Zeit.«
»Es wird schlimmer.«
»Ich halte dich gern auf Trab, Nazyalensky. Andauernde Anspannung bewirkt Wunder für den Teint.«
»Ich schicke dir eine Dankeskarte.«
»Mach das unbedingt. Du strahlst förmlich.«
Es geht ihm schlechter, als er sich anmerken lässt, dachte Zoya. Nikolai war immer freigebiger mit Komplimenten, wenn er müde war. Es stimmte, sie sah blendend aus, sogar nach einer schrecklichen Nacht, doch Zoya wusste, dass den Zaren ihre Erscheinung nicht weniger kümmern könnte.
Sie hörten einen scharfen Pfiff von draußen, als die Kutsche langsamer wurde.
»Wir nähern uns der Brücke«, sagte Zoya.
Der Handelsgipfel in Ivets war erforderlich für ihre Verhandlungen mit den Nationen Kerch und Novyi Zem, aber Zoll- und Steuerangelegenheiten hatten auch die Tarnung für ihre wahre Mission geboten: einen Besuch der Stätte von Ravkas neuestem angeblichen Wunder.
Vor einer Woche waren die Dorfbewohner von Ivets hinter Herzog Radimovs mit Schleifen geschmücktem Wagen ausgezogen, um das Fest von Sankt Grigori zu feiern, hatten auf Trommeln geschlagen und auf kleinen Harfen gespielt, die das Instrument nachahmen sollten, das Grigori geschaffen hatte, um die Tiere des Waldes vor seinem Märtyrertod zu beruhigen. Doch als sie den Obol erreichten, war die Holzbrücke, die die Schlucht überspannte, zusammengestürzt. Bevor der Herzog und seine Vasallen in die wütenden Wildwassermassen unter ihnen stürzen konnten, war unter ihnen eine weitere Brücke aufgetaucht, die aus den Wänden des Abgrunds und den zerklüfteten Felsen des Schluchtenbodens zu erblühen schien. Zumindest hatten die Berichte so gelautet. Zoya gab wenig auf Geschichten, sie schrieb sie der Übertreibung zu, vielleicht sogar einer Sinnestäuschung der Menge – bis sie die Brücke selbst sah.
Zoya blickte aus dem Kutschenfenster, als sie um die Kurve in der Straße fuhren und die Brücke in Sicht kam; die hohen, schlanken Säulen und langen Träger weiß glänzend im Mondlicht. Sie hatte sie schon gesehen, war mit dem Zaren darüber gelaufen, aber der Anblick war dennoch atemberaubend. Aus der Ferne sah sie aus, als wäre sie aus Alabaster. Erst wenn man näher herankam, wurde deutlich, dass die Brücke gar nicht aus Stein bestand.
Nikolai schüttelte den Kopf. »Als Mann, der sich regelmäßig in ein Monster verwandelt, ist mir klar, dass ich mir vielleicht kein Urteil über Stabilität erlauben sollte, aber wissen wir, dass sie sicher ist?«
»Nein«, sagte Zoya und versuchte, den Klumpen in ihrem Magen zu ignorieren. Als sie die Brücke mit den Zwillingen überquert hatte, war sie zu sehr darauf konzentriert gewesen, Nikolai zu finden, um sich darüber Gedanken zu machen, ob die Brücke hielt. »Aber es ist die einzige Möglichkeit, die Schlucht zu überqueren.«
»Vielleicht hätte ich meine Gebete aufpolieren sollen.«
Der Klang der Räder veränderte sich, als die Kutsche auf die Brücke fuhr, vom Rumpeln der Straße zu einem gleichmäßigen Rattern. Die Brücke, die auf so wundersame Weise aus dem Nichts gewachsen war, war nicht aus Stein oder Ziegeln oder Holzbalken. Ihre weißen Träger und Querbalken bestanden aus Knochen und Sehnen, die Pfeiler und Streben wurden von faserigen Knorpelsträngen zusammengehalten. Ratter, ratter, ratter. Sie fuhren über ein Rückgrat.
»Das Geräusch gefällt mir gar nicht«, sagte Zoya.
»Stimmt. Ein Wunder sollte würdiger klingen. Ein bisschen Glockengeläut vielleicht, oder ein Chor himmlischer Stimmen.«
»Nenn es nicht so«, blaffte Zoya.
»Einen Chor?«
»Ein Wunder.« Zoya hatte in ihrer Kindheit genug vergebliche Gebete geflüstert, um zu wissen, dass die Heiligen niemals antworteten. Die Brücke war Grisha-Werk, und es gab keine rationale Erklärung für ihr Auftauchen, die sie herausfinden würden.
»Wie würdest du eine Brücke nennen, die aus Knochen besteht und gerade noch rechtzeitig auftaucht, um eine ganze Stadt vor dem Tod zu bewahren?«
»Es war keine ganze Stadt.«
»Halbe Stadt«, korrigierte sich Nikolai.
»Ein unerwartetes Ereignis.«
»Die Menschen könnten der Meinung sein, dass diese Beschreibung diesem Wunderwerk nicht gerecht wird.«
Und es war ein Wunderwerk – zugleich elegant und grotesk, ein Gewölbe aus sich kreuzenden Balken und geschwungenen Bögen. Seit sie aufgetaucht war, hatten Pilger an beiden Enden ihr Lager aufgeschlagen, hielten dort Tag und Nacht Wache. Sie hoben nicht ihre Köpfe, als die Kutsche vorbeirollte.
»Wie würdest du das Erdbeben von Ryevost nennen?«, fragte Nikolai. »Oder die Statue von Sankta Anastasia bei Tsemna, die blutige Tränen weint?«
»Ärger«, sagte Zoya.
»Du hältst das immer noch für das Werk von Grisha, die Parem benutzen?«
»Wie sonst sollte jemand solch eine Brücke erschaffen, oder ein Erdbeben nach Bedarf?«
Jurda Parem. Zoya wünschte sich, sie hätte diese Worte niemals gehört. Die Droge war das Produkt von Experimenten in einem Labor der Shu. Sie konnte die Macht einer Grisha in etwas völlig Neues und Gefährliches verwandeln, und der Preis für dieses bisschen Ruhm war Abhängigkeit und schließlich der Tod. Sie mochte es einem abtrünnigen Fabrikator ermöglichen, die Erde zu erschüttern, oder einem Korporalki, eine Brücke aus einem Körper zu erschaffen. Aber zu welchem Zweck? Konnten die Shu Grisha-Sklaven nutzen, um Ravka zu destabilisieren? Konnte der Asket, der angebliche religiöse Berater der Krone, daran beteiligt sein? Bisher hatte er nur verkündet, dass er wegen der Zwischenfälle betete und dass er vorhatte, eine Pilgerreise zu den Stätten zu unternehmen. Zoya hatte dem Priester noch nie getraut, und sie hatte keinen Zweifel, dass er eine Möglichkeit finden würde, dieses Spektakel zu seinem eigenen Vorteil zu nutzen, falls er eine Möglichkeit gefunden hatte, solche Wunder zu inszenieren.
Aber die wahre Frage, die Frage, die sie hierher nach Ivets gebracht hatte, war, ob diese seltsamen Geschehnisse in Ravka an die dunkle Macht gebunden waren, die sich in Nikolai verbarg. Die Vorkommnisse hatten etwa zur gleichen Zeit begonnen wie Nikolais nächtliche Anfälle. Das mochte ein Zufall sein, aber sie waren in der Hoffnung nach Ivets gekommen, einen Hinweis zu finden, eine Verbindung, die dabei helfen würde, Nikolai von dem Willen des Monsters zu befreien.
Sie erreichten die andere Seite der Brücke, und das beruhigende und gewöhnliche Rumpeln der Räder auf einer unbefestigten Straße erfüllte wieder die Kutsche. Es war, als wäre ein Bann von ihnen genommen worden.
»Wir müssen Herzog Radimov heute verlassen«, sagte Nikolai. »Und hoffen, dass niemand gesehen hat, wie ich auf dem Gelände herumgeflattert bin.«
Zoya wollte zustimmen, aber da sie die Reise schon gemacht hatten … »Ich kann deine Dosis von Genyas Mittel verdoppeln. Ein Tag Verhandlungen steht noch aus.«
»Lass Ulyashin sie abwickeln. Ich will zurück in die Hauptstadt. Wir haben Proben von der Brücke für David. Er könnte daraus etwas erfahren, das wir nutzen können, um mit meinem …«
»Leiden?«
»Ungebetenen Gast.«
Zoya verdrehte die Augen. Er sprach, als würde er von einer galligen Tante geplagt. Aber es gab einen wichtigen Grund, in Ivets zu bleiben. Sie war misstrauisch der Reise gegenüber gewesen, skeptisch wegen der Brücke, hatte Angst vor den Risiken gehabt, aber sie hatte auch gewusst, dass der Handelsgipfel ihnen eine gute Gelegenheit bot – mit einem gewissen Hiram Schenck und seinen beiden heiratsfähigen Töchtern.
Sie tippte mit den Fingern gegen den Samtsitz, überlegte, wie sie fortfahren sollte. Sie hatte gehofft, ein Treffen zwischen Nikolai und den Schenck-Mädchen einzufädeln, ohne dass er bemerkte, dass sie sich einmischte. Der Zar mochte es gar nicht, gelenkt zu werden, und wenn er spürte, dass er gedrängt wurde, konnte er genauso störrisch sein wie … nun ja, wie Zoya.
»Rede, Nazyalensky. Wenn du deine Lippen so spitzt, siehst du aus, als hättest du eine Zitrone geküsst.«
»Was für eine glückliche Zitrone«, sagte Zoya und schnaubte. Sie glättete den Stoff ihrer Kefta über ihrem Schoß. »Hiram Schencks Familie hat ihn nach Ivets begleitet.«
»Und?«
»Er hat zwei Töchter.«
Nikolai lachte. »Hast du deshalb dieser Reise zugestimmt? Damit du dich in Kuppeleien ergehen kannst?«
»Ich habe zugestimmt, weil jemand dafür sorgen muss, dass du niemanden frisst, wenn dein ungebetener Gast beschließt, mitten in der Nacht hungrig zu werden. Und ich bin keine Mama, die sich einmischt und ihren Lieblingssohn verheiratet sehen will. Ich versuche, deinen Thron zu schützen. Hiram Schenck ist ein hochrangiges Mitglied des Händlerrats. Er könnte praktisch garantieren, dass Ravkas Darlehen von Kerch einen Aufschub bekommt, von dem gewaltigen Vermögen ganz zu schweigen, das eine seiner hübschen Töchter erben wird.«
»Wie hübsch?«
»Wen schert’s?«
»Nicht mich, gewiss. Zwei Jahre mit dir zusammenzuarbeiten, hat meinen Stolz erschöpft. Ich will sichergehen, dass ich nicht mein Leben damit verbringe zuzusehen, wie andere Männer meine Ehefrau angaffen.«
»Wenn sie das tun, kannst du sie köpfen lassen.«
»Die Männer oder meine Frau?«
»Beide. Sieh nur zu, dass du zuerst ihre Mitgift bekommst.«
»Skrupellos.«
»Praktisch veranlagt. Wenn wir noch eine Nacht blieben …«
»Zoya, ich kann keine Braut umwerben, wenn die Möglichkeit besteht, dass ich versuche, sie zu meinem Abendessen zu machen.«
»Du bist ein Zar. Du musst niemanden umwerben. Dafür sind der Thron und die Juwelen und der Titel da, und sobald du verheiratet bist, wird deine Zarin deine Verbündete.«
»Oder sie rennt schreiend aus unserem Hochzeitsgemach und erzählt ihrem Vater, dass ich erst an ihrem Ohrläppchen knabberte und dann versuchte, das ganze Ohr zu verspeisen. Sie könnte einen Krieg auslösen.«
»Aber das wird sie nicht, Nikolai. Wenn ihr beiden eure Ehegelübde abgelegt habt, wirst du sie so bezaubert haben, dass sie dich liebt, und dann bist du ihr Problem.«
»Selbst mein Charme hat seine Grenzen, Zoya.«
Falls dem so war, hatte sie sie noch nicht erlebt. Zoya warf ihm einen ungläubigen Blick zu. »Ein gut aussehender Monsterehemann, der ihr eine Krone auf den Kopf setzt? Das ist das perfekte Märchen für ein blauäugiges Mädchen. Sie kann dich nachts einsperren und dir am Morgen einen liebevollen Kuss auf die Lippen drücken, und Ravka ist sicher.«
»Warum gibst du mir nie einen liebevollen Kuss am Morgen, Zoya?«
»Ich mache gar nichts liebevoll, Eure Hoheit.« Sie schüttelte ihre Ärmel aus. »Warum zögerst du? Ravka bleibt so lange verwundbar, bis du heiratest, bis du einen Erben hast.«
Nikolais Abwehrhaltung sank in sich zusammen. »Ich kann keine Frau heiraten, während ich in diesem Zustand bin. Ich kann keine Ehe schließen, die auf Lügen gründet.«
»Tun das nicht die meisten?«
»Immer so romantisch veranlagt.«
»Immer praktisch veranlagt.«
»Kerchs Bräute außen vor … wir müssen weg, bevor Schenck mich weiter über die Izmars’ya ausfragen kann.«
Zoya fluchte. »Also hatten die Zwillinge recht – es gab eine undichte Stelle bei der alten Forschungseinrichtung.« Die Izmars’ya waren Schiffe, die unter der Wasseroberfläche fuhren. Sie würden entscheidend für Ravkas Überleben werden, wenn die Marine der Fjerdan wuchs und insbesondere wenn Nikolai die Schiffe mit Waffen ausstatten konnte, wie er es vorhatte.
»Es scheint so. Aber die Kerch wissen nicht, wie weit wir sind, zumindest noch nicht.«
Diese Worte halfen wenig, Zoya aufzuheitern. Die Kerch hatten bereits zu viel gegen Ravka in der Hand. Schenck hätte die Izmars’ya beim Zaren nicht leichtfertig angesprochen. Was hatte er mit seinem neuen Wissen vor?
Ein weiterer scharfer Pfiff ertönte vor der Kutsche, zwei rasch aufeinanderfolgende Töne – Tolyas Signal, dass sie sich dem Torhaus näherten.
Zoya wusste, dass es einige Verwirrung unter den Wachen geben würde. Niemand hatte gesehen, wie die Kutsche abgefahren war, und sie trug kein Siegel des Zaren. Tolya und Tamar hatten sie am Brunnen vor dem Anwesen des Herzogs bereitgehalten, nur für den Fall, dass Nikolai ausbrach. Sie hatte sie sofort aufgesucht, als sie merkte, dass er weg war.
Heute Nacht hatten sie Glück gehabt. Sie hatten den Zaren gefunden, bevor er zu weit gestreunt war. Wenn Nikolai flog, konnte Zoya spüren, wie er den Wind ritt, und ihn anhand dieser Störung in den Strömungen verfolgen. Doch wenn sie nicht rechtzeitig bei diesem Hof angekommen wäre, was hätte geschehen können? Hätte Nikolai diesen Jungen getötet? Das Ding in ihm war nicht nur ein hungriges Tier, sondern etwas weitaus Schlimmeres, und sie wusste mit absoluter Sicherheit, dass es sich nach menschlicher Beute sehnte.
»Wir können so nicht weitermachen, Nikolai.« Sie würden schließlich ertappt. Diese abendlichen Jagden und schlaflosen Nächte würden sie am Ende überwältigen. »Wir alle müssen tun, was erforderlich ist.«
Nikolai seufzte und breitete die Arme für sie aus, als die Kutsche ratternd zum Stehen kam. »Dann komm her, Zoya, und küsse mich so liebevoll, wie das eine junge Braut tun würde.«
So viel zur Schicklichkeit. Dank Zoyas spätabendlichen Besuchen, um sicherzugehen, dass der Zar in seinen Gemächern gefesselt war, gab es bereits viele Gerüchte, dass ihre Beziehung mehr als nur politisch war. Zaren nahmen sich Mätressen, und man hatte sich schon Schlimmeres über Anführer zugeflüstert. Zoya hoffte nur, dass die Schenck-Mädchen von der unvoreingenommenen Sorte waren. Der Ruf des Zaren konnte ein wenig Skandal aushalten; die Wahrheit würde er nicht überstehen.
Zoya nahm eine zweite Flasche aus dem Bündel und tupfte Whiskey auf ihre Handgelenke wie Parfum, bevor sie sie Nikolai reichte, der einen tiefen Zug nahm und dann den Rest großzügig auf seinem Mantel verteilte. Zoya zerzauste sich das Haar und ließ ihre Kefta von einer Schulter gleiten, dann sank sie in die Arme des Zaren. Diese Scharade war nötig, und die Rolle war leicht zu spielen, manchmal zu leicht.
Er vergrub das Gesicht in ihrem Haar und atmete tief ein. »Wie kommt es, dass ich nach Gänsescheiße und billigem Whiskey rieche, und du, als wärst du gerade durch eine Wildblumenwiese gelaufen?«
»Das ist meine Skrupellosigkeit.«
Er atmete erneut ein. »Was ist das für ein Geruch? Er erinnert mich an etwas, aber ich kann ihn nicht ganz einordnen.«
»Das letzte Kind, das du versucht hast zu fressen?«
»Das muss es sein.«
Die Tür der Kutsche wurde aufgerissen.
»Eure Hoheit, wir hatten nicht bemerkt, dass Ihr heute Nacht ausgegangen seid.«
Zoya konnte das Gesicht der Wache nicht sehen, aber sie hörte das Misstrauen in seiner Stimme.
»Dein König pflegt nicht, um etwas zu bitten, und schon gar nicht um Erlaubnis«, sagte Nikolai gelangweilt, aber mit der verächtlichen Schärfe eines Herrschers.
»Natürlich, natürlich«, sagte die Wache. »Wir hatten nur Eure Sicherheit im Sinn.«
Zoya bezweifelte das. West-Ravka hatte sich unter den neuen Steuern und Gesetzen erhoben, die mit der Vereinigung gekommen waren. Diese Wachen mochten den Doppeladler tragen, aber ihre Loyalität gehörte dem Herzog, der das Anwesen führte und den Widerstand zu Nikolais Herrschaft aufgerührt hatte. Ohne Zweifel würde ihr Meister sich darüber freuen, wenn er die Geheimnisse des Zaren aufdeckte.
Zoya beschwor ihren klagendsten Ton herauf und sagte: »Warum fahren wir nicht?«
Sie spürte, wie sich das Interesse ihr zuwandte.
»Eine gute Nacht also?«, fragte der Wächter, und sie konnte beinahe sehen, wie er versuchte, einen besseren Blick in die Kutsche zu bekommen.
Zoya warf ihr langes schwarzes Haar zurück und sagte mit der verschlafenen Stimme einer Frau, die eine hübsche Zeit verbracht hatte: »Eine sehr angenehme Nacht.«
»Spielt sie nur mit dem Zaren?«, fragte der Wächter. »Sieht aus, als könnte man mit ihr Spaß haben.«
Zoya spürte, wie Nikolai sich anspannte. Sie war ebenso so berührt wie verärgert, dass er glaubte, es machte ihr etwas aus, was irgendein Idiot dachte, aber es gab heute Abend keinen Grund, den Ritter zu spielen.
Sie warf dem Wächter einen langen Blick zu, dann sagte sie: »Du hast keine Ahnung.« Er schnaubte und winkte sie durch.
Als die Kutsche weiterrollte, spürte Zoya das schwache Zittern von Nikolais Wandlung, das noch in ihm nachhallte, und ihre eigene Erschöpfung, die sich über sie legte. Es wäre zu leicht, die Augen zu schließen, ihren Kopf an seine Brust zu betten und sich der Illusion der Geborgenheit hinzugeben. Aber der Preis für diesen Luxus wäre zu hoch. »Das Monster wird irgendwann entdeckt werden«, sagte sie. »Wir hatten bisher kein Glück auf der Suche nach einem Heilmittel oder auch nur einem Anzeichen davon. Heirate. Schließe ein Bündnis. Zeuge einen Erben. Sichere den Thron und Ravkas Zukunft.«
»Das werde ich«, sagte er müde. »Ich werde das alles tun. Aber nicht heute Nacht. Lass uns heute Nacht so tun, als wären wir ein altes, verheiratetes Ehepaar.«
Hätte ein anderer Mann das gesagt, sie hätte ihm ins Gesicht geschlagen. Oder ihn vielleicht sogar für ein paar Stunden mit ins Bett genommen. »Und was schließt das ein?«
»Lass uns einander Lügen erzählen, so wie es verheiratete Paare tun. Es wird ein schönes Spiel sein. Mach schon, Frau. Erzähl mir, dass ich ein gut aussehender Kerl bin, der niemals altert und mit all seinen Zähnen im Mund sterben wird. Sag es so, dass ich es dir glaube.«
»Das werde ich nicht.«
»Ich verstehe. Du konntest noch nie gut lügen.«
Zoya wusste, dass er sie neckte, aber dennoch fühlte sie sich in ihrem Stolz verletzt. »Wie kannst du dir da so sicher sein? Vielleicht ist die Liste meiner Talente ja so lang, dass du einfach noch nicht bis zum Ende vorgedrungen bist.«
»Na, dann mach weiter, Nazyalensky.«
»Liebster Ehemann«, sagte sie mit honigsüßer Stimme, »wusstest du, dass die Frauen meiner Familie die Zukunft in den Sternen lesen können?«
Er stieß ein schnaubendes Lachen aus. »Das wusste ich nicht.«
»Oh ja. Und ich habe dein Schicksal in den Sternbildern gesehen. Du wirst alt werden, fett und glücklich, ein Vater vieler unerzogener Kinder, und sie werden deine Geschichte in Liedern und Gedichten besingen.«
»Sehr überzeugend«, sagte Nikolai. »Du bist gut in diesem Spiel.« Eine lange Stille folgte, in der nur das Rattern der Kutschräder erklang. »Und jetzt erzähl mir, dass ich einen Weg hier herausfinde. Sag mir, dass alles gut wird.«
Sein Ton war fröhlich, neckend, aber Zoya kannte ihn zu gut. »Alles wird gut«, sagte sie mit aller Überzeugungskraft, die sie aufbringen konnte. »Wir werden dieses Problem lösen, genau, wie wir auch schon alle anderen zuvor gelöst haben.« Sie neigte den Kopf, um zu ihm aufzublicken. Seine Augen waren geschlossen, und eine Sorgenfalte verunzierte seine Stirn. »Glaubst du mir?«
»Ja.«
Sie setzte sich auf und richtete ihre Kleider. Unwahrheiten waren unvermeidlich, vielleicht sogar notwendig zwischen einem Ehemann und seiner Frau. Eine Befehlshaberin und ihr Zar konnten sie sich kaum leisten.
»Siehst du?«, sagte sie. »Du bist auch gut in diesem Spiel.«
Nina umklammerte ihr Messer und versuchte, das Gemetzel zu ignorieren, das sie umgab. Sie blickte auf ihr Opfer hinab, ein weiterer Körper, der hilflos vor ihr lag.
»Tut mir leid, Freund«, murmelte sie auf Fjerdan. Sie rammte das Messer in den Bauch des Fischs, zog es Richtung Kopf hoch, riss die feuchten, pinkfarbenen Innereien heraus und warf diese auf die verdreckten Bretter, wo sie mit dem Schlauch weggespritzt würden. Der ausgenommene Kadaver kam in ein Fass zu ihrer Linken, das von einem der Läufer geleert und zum Verpacken gebracht werden würde. Oder zum Verarbeiten. Oder Einlegen. Nina hatte keine Ahnung, was wirklich mit dem Fisch geschah, und es war ihr auch ziemlich egal. Nach den zwei Wochen Arbeit in der Konservenfabrik, von der aus man den Hafen von Elling überblickte, hatte sie nicht vor, jemals wieder etwas mit Schuppen oder Flossen zu essen.
Stell dir vor, du liegst in einem warmen Bad mit einem Teller voll Karamellbonbons. Vielleicht würde sie auch einfach die Wanne mit Karamell füllen und das Ganze gleich vollkommen dekadent angehen. Das könnte der letzte Schrei werden. Karamellbäder und Waffelpeelings.
Nina schüttelte den Kopf. Dieser Ort trieb sie langsam in den Wahnsinn. Ihre Hände waren dauernd verschrumpelt, die Haut von winzigen Schnitten übersät, weil sie so ungeschickt mit dem Filetiermesser war; der Fischgeruch ging nicht aus ihrem Haar raus, und ihr Rücken schmerzte, weil sie vom Morgengrauen bis zum Abend vor der Konservenfabrik stand, bei Regen und Sonnenschein, vor den Elementen nur von einem Vordach aus Wellblech geschützt. Doch es gab nicht viel Arbeit für unverheiratete Frauen in Fjerda, deshalb hatte Nina – unter dem Namen Mila Jandersdat – die Stellung mit Freuden angenommen. Die Arbeit laugte sie aus, aber sie machte es ihrem Kontakt hier vor Ort leichter, ihre Nachrichten zu bekommen, und noch dazu verschaffte ihr der Platz zwischen den Fischfässern eine perfekte Aussicht auf die Wächter, die im Hafen patrouillierten.
Heute waren es viele, die in ihren blauen Uniformen über die Docks streiften. Kalfisk nannten die Einheimischen sie – Tintenfische –, weil sie ihre Tentakel in allem drin hatten. Elling befand sich da, wo der Stelge und die Isenvee aufeinandertrafen, und es war einer der wenigen Häfen an Fjerdas steiniger Nordwestküste, die großen Schiffen leichten Zugang zum Meer boten. Der Hafen war für zwei Sachen bekannt: fürs Schmuggeln und für den Fisch. Seelachs, Seeteufel, Schellfisch; Lachs und Störe aus den Flussstädten im Osten; Torpedobarsch und Silbermakrelen aus den tiefen Gewässern vor der Küste.
Nina arbeitete neben zwei Frauen – eine Hedjut-Witwe mit Namen Annabelle, und Marta, eine alte Jungfer aus Djerholm, die so beschränkt war wie eine Ritze in den Dielenbrettern und ständig den Kopf schüttelte, als würde ihr alles missfallen. Ihr Schnattern lenkte Nina ab und war eine willkommene Quelle für eine Mischung aus Tratsch und Informationen, wobei es schwer war, das eine vom anderen zu unterscheiden.
»Es heißt, Kommandant Birgir hat eine neue Mätresse«, fing Annabelle zum Beispiel an.
Marta schürzte dann die Lippen. »Na, mit den Bestechungsgeldern, die er nimmt, kann er sie sich sicher mal halten.«
»Sie haben die Patrouillen verstärkt, seit man diese blinden Passagiere geschnappt hat.«
Marta schnalzte mit der Zunge. »Bedeutete mehr Arbeit, aber wahrscheinlich mehr Ärger.«
»Heute kamen mehr Männer aus Gäfvalle. Der Fluss wurde oben bei der alten Festung bitter.«
Martas Kopf zuckte wie der Schwanz eines glücklichen Hundes vor und zurück. »Ein Zeichen von Djels Unmut. Jemand sollte einen Priester schicken, der Gebete spricht.«
Gäfvalle. Eine der Flussstädte. Nina war nie dort gewesen, hatte nicht einmal davon gehört, bis sie vor zwei Monaten mit Adrik und Leoni auf Befehl von Zar Nikolai hier angekommen war. Doch der Name versetzte sie immer in Unruhe, er schien von einem Seufzen in ihr begleitet, als wäre der Name der Stadt weniger ein Wort als vielmehr der Anfang einer Beschwörungsformel.
Jetzt klopfte Marta mit dem Griff ihres Messers auf die Holzoberfläche des Arbeitstischs. »Der Vorarbeiter kommt.«
Hilbrand, der Vorarbeiter mit dem ernsten Gesicht, ging durch die Reihen der Buden und rief den Läufern zu, die Fischeimer wegzubringen.
»Dein Tempo stimmt wieder nicht«, blaffte er Nina an. »Ist ja, als hättest du noch nie einen Fisch ausgenommen.«
Stell dir vor. »Tut mir leid, Herr«, sagte sie. »Ich mach es besser.«
Er machte eine harsche Geste mit der Hand. »Zu langsam. Die Schiffsladung, auf die wir gewartet haben, ist eingetroffen. Du kommst in den Packraum.«
»Ja, Herr«, sagte Nina mürrisch. Sie ließ die Schultern sinken und den Kopf hängen, obwohl sie eigentlich am liebsten losgesungen hätte. Die Bezahlung für die Packer war bedeutend geringer, deshalb musste sie sich die Niederlage deutlich ansehen lassen, aber sie verstand Hilbrands wahre Botschaft: Der letzte Grisha-Flüchtling, auf den sie gewartet hatten, hatte es endlich in den Unterschlupf in Elling geschafft. Jetzt lag es an Nina, Adrik und Leoni, die sieben Neuankömmlinge an Bord der Verstoten zu schaffen.
Sie folgte Hilbrand dichtauf, als er sie zur Konservenfabrik führte.
»Du musst schnell machen«, sagte er, ohne sie anzusehen. »Es gibt Gerede über eine Überraschungsinspektion heute Abend.«
»In Ordnung.« Ein Hindernis, aber nichts, womit sie nicht zurechtkamen.
»Da ist noch was«, sagte er. »Birgir hat Dienst.«
Natürlich. Ohne Zweifel war diese Überraschungsinspektion seine Idee. Er war der korrupteste unter den Kalfisk, aber auch der schlaueste und aufmerksamste. Wenn man eine legale Schiffsladung durch den Hafen bekommen wollte, ohne dass sie ewig beim Zoll festhing – oder wenn man eine illegale Fracht unbemerkt vorbeischleusen wollte –, so bestach man Birgir.
Ein Mann ohne Ehre, hörte sie Matthias’ Stimme in ihrem Kopf. Er sollte sich schämen.
Nina schnaubte. Wenn die Menschen sich dann schämen würden, wenn sie es sollten, hätten sie für sonst nichts Zeit.
»Ist irgendetwas lustig?«, fragte Hilbrand.
»Kämpf nur gegen eine Erkältung an«, log sie. Hilbrands schroffe Art versetzte ihr einen Stich ins Herz. Er war breitschultrig und humorlos und erinnerte sie auf schmerzhafte Weise an Matthias.
Er ist kein bisschen wie ich. Was für eine Heuchlerin du doch bist, Nina Zenik. Nicht alle Fjerdan sehen gleich aus.
»Du weißt, was Birgir mit diesen blinden Passagieren gemacht hat«, sagte Hilbrand. »Ich muss dir nicht sagen, dass ihr vorsichtig sein sollt.«
»Nein, brauchst du nicht«, sagte Nina schärfer als beabsichtigt. Sie war gut in dem, was sie tat, und sie wusste ganz genau, was auf dem Spiel stand. An ihrem ersten Morgen an den Docks hatte sie gesehen, wie Birgir und einer seiner Lieblingsschläger, Casper, eine Mutter und ihre Tochter von einem Walfänger mit Ziel Novyi Zem gezerrt und sie blutig geschlagen hatten. Der Kommandant hatte ihnen schwere Ketten um den Hals gehängt, mit Schildern daran, auf denen Drüsje stand – Hexe. Dann hatte er sie mit Drecksbrühe und Fischinnereien aus der Fabrik übergossen und sie vor der Hafenstation in der sengenden Sonne angebunden. Seine Männer hatten lachend zugesehen, wie der Gestank und die Aussicht auf Futter die Möwen anzogen. Nina hatte ihre Schicht damit verbracht, zuzusehen, wie die Frau versuchte, ihre Tochter mit ihrem Körper abzuschirmen, und den Gefangenen dabei zuzuhören, wie sie vor Schmerz schrien, während die Möwen an ihren Leibern pickten und kratzten. Ihr Kopf hatte tausenderlei Möglichkeiten ersonnen, wie sie Birgirs Hafenwächter an Ort und Stelle ermordete und Mutter und Tochter in Sicherheit brachte. Sie könnte ein Boot stehlen. Sie könnte einen Schiffskapitän dazu zwingen, sie weit wegzubringen. Sie könnte irgendetwas tun.
Doch sie erinnerte sich zu gut daran, wie Zoya Zar Nikolai wegen ihrer Tauglichkeit gewarnt hatte, was die verdeckte Mission betraf: »Sie ist kein bisschen unauffällig. Nina darum zu bitten, keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, ist so, als würde man Wasser darum bitten, nicht den Berg runterzufließen.«
Der Zar war mit Nina ein Risiko eingegangen, und sie würde die Gelegenheit nicht verschwenden. Sie würde die Mission nicht in Gefahr bringen. Sie würde ihre Tarnung nicht kompromittieren, und sie würde Adrik und Leoni nicht in Gefahr bringen. Wenigstens nicht am helllichten Tag. Sobald die Sonne untergegangen war, hatte sie sich wieder in den Hafen geschlichen, um die Gefangenen zu befreien. Doch sie waren weg gewesen. Aber wohin? Und um welche Schrecken zu erleiden? Sie glaubte nicht mehr daran, dass das Schlimmste, was Grisha durch die Hände der Fjerdan-Soldaten erlitten, der Tod war. Jarl Brum und seine Hexenjäger hatten ihr das zur Genüge gezeigt.
Als Nina Hilbrand in die Fabrik folgte, ließ das Mahlen der Maschinen ihren Kopf dröhnen, und der Gestank des Salzkabeljaus überwältigte sie. Es würde ihr nicht leidtun, Elling für eine Weile zu verlassen. Der Laderaum der Verstoten war voller Grisha, die ihre Mannschaft – oder eigentlich Adriks Mannschaft – gerettet und nach Elling gebracht hatte. Seit Ende des Bürgerkriegs hatte Zar Nikolai Mittel und Gelder zweckentfremdet, um ein Untergrundnetzwerk aus Informanten zu unterstützen, das seit Jahren in Fjerda existierte, mit dem Ziel, im Verborgenen lebenden Grisha bei der Flucht aus dem Land zu helfen. Es nannte sich Hringsa, Lebensbaum, nach der großen Esche, die Djel geweiht war. Nina wusste, dass Adrik bereits neue Informationen von der Gruppe erhalten hatte, und sobald die Verstoten sicher auf ihrem Weg nach Ravka war, würden Nina und die anderen frei sein, ins Innere des Landes zu gehen und mehr Grisha aufzuspüren.
Hilbrand führte sie in sein Büro, schloss die Tür und strich dann mit den Fingern über die gegenüberliegende Wand. Ein Klicken ertönte, und eine zweite, versteckte Tür öffnete sich zur Fiskstrahd, der belebten Straße, in der die Fischhändler ihre Geschäfte betrieben und wo ein allein herumlaufendes Mädchen in der Menge verschwinden konnte, ohne die Aufmerksamkeit der Hafenpolizei zu erregen.
»Danke«, sagte Nina. »Wir schicken dir bald mehr.«
»Warte.« Hilbrand packte sie am Arm, bevor sie hinaus in den Sonnenschein huschen konnte. Er zögerte, dann stieß er eilig hervor: »Bist du es wirklich? Das Mädchen, das Jarl Brum geschlagen hat und ihn blutend auf einem Dock in Djerholm liegen ließ?«
Nina riss sich los. Sie hatte getan, was sie tun musste, um ihre Freunde zu befreien und das Jurda Parem vor den Fjerdan geheim zu halten. Es war jedoch die Droge, die diesen Sieg ermöglicht hatte, und sie hatte einen schrecklichen Preis gefordert, Ninas Leben und sogar ihre Macht als Grisha völlig verändert.
Wären wir niemals ins Eistribunal eingebrochen, wäre Matthias dann noch am Leben? Wäre mein Herz noch heil? Sinnlose Fragen. Keine Antwort würde ihn zurückbringen.
Nina sah Hilbrand mit einem vernichtenden Blick an, den sie von Zoya Nazyalensky höchstpersönlich gelernt hatte. »Ich bin Mila Jandersdat. Eine junge Witwe, die jede Arbeit annimmt, um durchzukommen, und die auf eine Anstellung als Übersetzerin hofft. Welcher Idiot würde es auf eine Auseinandersetzung mit Kommandant Jarl Brum anlegen?« Hilbrand öffnete den Mund, aber Nina fuhr fort. »Und welcher Idiot würde es riskieren, die Tarnung eines Agenten zu kompromittieren, wenn so viele Leben auf dem Spiel stehen?«
Nina drehte ihm den Rücken zu und tauchte dann in den Menschenstrom ein. Gefährlich.