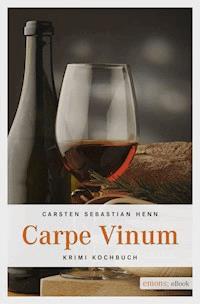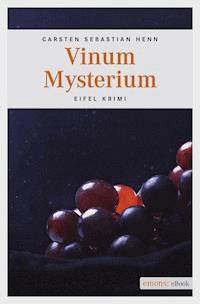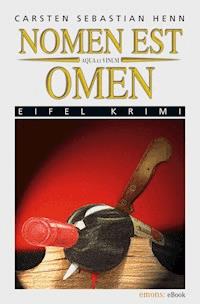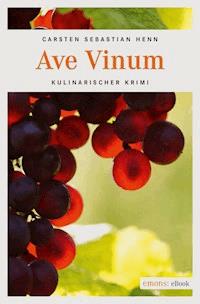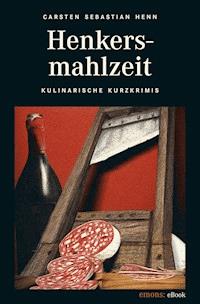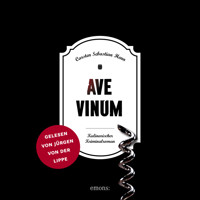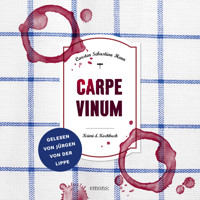Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kulinarische Kriminalromane
- Sprache: Deutsch
Martin Störtebäcker, 72 Jahre alt und von seinen Freunden liebevoll »der Käpt’n« genannt, lebt friedlich in der deutschen Rum-Metropole Flensburg, wo sich sein Faible für den köstlichen Zuckerrohrbrand her-vorragend pflegen lässt. Aber dann segnet sein bester Freund Lasse das Zeitliche – und gibt dem Käpt’n aus dem Grab einen letzten Auftrag mit: Er soll zur legendären Rum-Insel Jamaika reisen und sich endlich auf die Suche nach seinem dort verschollenen Bruder begeben. In der Karibik angekommen freundet sich der Käpt’n schnell mit einer abenteuerlustigen Taxifahrerin an, die ihn bei seiner Suche unterstützt. Doch schon bei der Besichtigung der ersten Rum-Distillery stellen sie fest: Etwas stimmt ganz und gar nicht in dem tropischen Paradies. Der Brennmeister der Distillery wird auf brutale Weise ermordet aufgefunden – und es wird nicht der letzte Mord gewesen sein. Ein rasantes Katz-und-Maus-Spiel beginnt …
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Martin Störtebäcker, 72Jahre alt und von seinen Freunden liebevoll »der Käpt’n« genannt, lebt friedlich in der deutschen Rum-Metropole Flensburg, wo sich sein Faible für den köstlichen Zuckerrohrbrand hervorragend pflegen lässt. Aber dann segnet sein bester Freund Lasse das Zeitliche – und gibt dem Käpt’n aus dem Grab einen letzten Auftrag mit: Er soll zur legendären Rum-Insel Jamaika reisen und sich endlich auf die Suche nach seinem dort verschollenen Bruder begeben. In der Karibik angekommen freundet sich der Käpt’n schnell mit einer abenteuerlustigen Taxifahrerin an, die ihn bei seiner Suche unterstützt. Doch schon bei der Besichtigung der ersten Rum-Distillery stellen sie fest: Etwas stimmt ganz und gar nicht in dem tropischen Paradies. Der Brennmeister der Distillery wird auf brutale Weise ermordet aufgefunden – und es wird nicht der letzte Mord gewesen sein. Ein rasantes Katz-und-Maus-Spiel beginnt …
Carsten Sebastian Henn erzählt augenzwinkernd und mitreißend von kaltblütigen Morden unter karibischer Sonne: ein spannender Kriminalroman, gespickt mit allerlei Wissenswertem zum Thema Rum.
© David Weimann
Carsten Sebastian Henn ist Kulinariker durch und durch. Er besitzt einen Weinberg an der Mosel, hält Hühner und Bienen, studierte Weinbau, ist ausgebildeter Barista und einer der renommiertesten Restaurantkritiker Deutschlands. Seine Romane und Sachbücher haben eine Gesamtauflage von fast einer Million Exemplare. Mit ›Der Buchspazierer‹ stand er über ein Jahr lang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Bei DuMont erschienen zuletzt ›Der Gin des Lebens‹ (2020) und ›Der Mann, der auf einen Hügel stieg und von einem Weinberg wieder herunterkam‹ (2022).
CARSTEN SEBASTIAN HENN
RUMODER EHRE
Kriminalroman
eBook 2021
© 2021 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildungen: Kompass/Pistole/Segelschiff:
© Alamy Stock Foto; Papagei: © Shutterstock;
Glas: ©123 rf/ Erin Cadigan
Innenseiten: © cartomedia-karlsruhe
Alle Illustrationen im Innenteil: © Rüdiger Trebels
Satz: Fagott, Ffm
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-7113-1
www.dumont-buchverlag.de
FÜRMEINE MUTTER,
MITDERICHDAS FERNWEHTEILTE.
»Alle schlechten Eigenschaften entwickeln sich in der Familie. Das fängt mit Mord an und geht über Betrug und Trunksucht bis zum Rauchen.«
Alfred Hitchcock
PROLOG
Hey Tagebuch,
hast du alles gepackt? Bist du gut vorbereitet?
Also ich kann weder die eine noch die andere Frage mit Ja beantworten. Aber es ist ein verdammt gutes Gefühl, wenn das Leben den Weg ändert und man selbst die Richtung ausgesucht hat! Meiner soll über mehr als achttausend Kilometer in die Karibik nach Jamaika führen. Auf die Insel der Rastafaris und Sprinter, die Insel von Rum und Reggae. Keine Ahnung, ob das alles nur Vorurteile oder Werbe-Images der Tourismusbehörde sind. Ich werde es herausfinden!
Und du wirst alles erfahren. Denn ab heute wirst du immer mit dabei sein, damit ich hier alles reinschreiben kann, was ich erlebe.
Und manches loswerde.
Es ist nämlich nicht alles eitel Sonnenschein, weiß Gott nicht.
Vielleicht habe ich die krude Hoffnung, dass es sich anfühlt, als hätte ich mein Leben irgendwie unter Kontrolle, wenn ich darüber schreibe. Auch wenn ich das nicht habe. Ganz und gar nicht. Es ist ein Gefühl wie bei einer sich nähernden Gewitterfront. Ne, noch schlimmer. Es ist, als stündest du mitten im Gewitter, kalter Regen peitscht dir ins Gesicht, und du weißt ganz sicher, dass der nächste Blitz dich trifft. Wenn ich in Flensburg bleibe, passiert etwas – und zwar mir. Wenn ich nur dieses schreckliche Unglück ungeschehen machen könnte … Ich fühle mich extrem schuldig, obwohl ich ja eigentlich nichts dafür kann. Eigentlich … drei Silben, aber sie ändern alles. Sie machen den ganzen Unterschied.
Ich werde Martin natürlich nicht erzählen, wie ich mich fühle und was noch hinter der Reise steckt, er macht sich sonst nur Sorgen. Macht er sich ja eh immer um mich, guter großer Bruder. Ich werde ihm nur den offiziellen Grund für die Reise nennen: dass ich mit fast vierzig jetzt endlich Rum machen will, wie es die Jamaikaner tun. Und dafür muss ich zu einem werden. Flensburg ist einfach nicht karibisch genug, egal, wie viel Reggae-Musik ich auflege und wie viele Palmenposter an den Wänden hängen. Flensburg wird immer an der Ostsee liegen. Man braucht schon verdammt viel Rum, damit es sich zumindest ein wenig wie Karibik anfühlt.
Ich werde meinen großen Bruder sehr vermissen, doch auch das darf er nicht wissen, sonst will er noch mitkommen. Aber er gehört hierhin, sein Anker hat sich tief eingegraben in den Grund der Förde. Ich werde ihm schreiben von jenseits des Ozeans. Und wenn ich Rum wirklich verstanden habe, dann komme ich vielleicht zurück. Falls das Gewitter sich verzogen hat. Dann trage ich Jamaika nämlich in mir. Und vermutlich eine Menge Rum.
Bis morgen, Tagebuch!
Christian
EINS
»I Can See Clearly Now«
Martin glaubte nicht an Übersinnliches, aber an diesem Tag sprach ihn jemand aus dem Grab an.
Natürlich war es Lasse.
Martin hieß mit Nachnamen Störtebäcker (zu seinem Bedauern nicht verwandt mit dem Seeräuber ähnlichen Namens), aber alle nannten ihn nur den Käpt’n. Oder den Einbeinigen, obwohl er in der Regel auf zwei Beinen unterwegs war. Wenn er sich das linke hochband, war er für seine Piratenschule im Einsatz und veranstaltete Kindergeburtstage. Dabei fragten die Kinder ihn oft, ob er in Wirklichkeit Käpt’n Iglo wäre, wegen des weißen Barts, und auch sonst sähe sein Gesicht aus, als gehörte es auf eine Packung Fischstäbchen. Martin musste dann immer bedauernd verneinen, denn das Geld für solch einen Werbedeal hätte sicher dafür gesorgt, dass er nicht immer knietief im Dispo steckte.
Geldsorgen waren allerdings das Letzte, was ihn in diesem Moment beschäftigte: Der Mann, der heute beerdigt wurde und in dessen Grab er gerade mit einem Schäufelchen voller Erde in der Hand herabsah, war Lasse, sein bester Freund.
Lasse und er hatten eine Wette laufen gehabt: Wer zuerst stirbt, hat gewonnen. Dabei hatte Lasse wegen seiner schwachen Pumpe und seinem jahrzehntelangen Diabetes die deutlich besseren Chancen gehabt. Der Einsatz: ein HSV-Trikot. Wenn Martin zuerst gestorben wäre, hätte er Lasses 1979er von Kevin Keegan bekommen, also mit ins Grab. Martin musste ihm nun sein von Uwe Seeler bei der Meisterschaft 1960 vollgeschwitztes und signiertes Trikot hinterherwerfen. Das tat echt weh, aber Wettschulden waren Ehrenschulden. Außerdem wusste Martin, dass Lasse bestimmt an dieses Trikot gedacht hatte, als ihm klar geworden war, dass der Herzinfarkt sein Ende einläutete.
Die Beerdigung fand auf dem Mühlenfriedhof statt, Lasse hatte ein Grab in direkter Nähe des Wasserturms bekommen – was dem alten Segler sicher gut gefallen hätte. Und falls er wiederauferstehen würde, wäre der Ausgang auch nicht weit.
Viele Leute waren nicht zu seiner Beerdigung gekommen, vielleicht zwei Dutzend, fast alle in Lasses Alter. Das leider auch Martins Alter war: zweiundsiebzig. Und egal, was Udo Jürgens mal gesungen hatte, das Leben hatte leider nicht erst mit sechsundsechzig angefangen. Martins Knochen fühlten sich morsch an, die Lunge löchrig, und die meisten Muskeln hatten schon längst das sinkende Schiff verlassen.
Obwohl Lasses drei Exfrauen anwesend waren, trat Martin als Erster ans Grab, so war es vereinbart. Zwar hatte Lasse sich auf seine alten Tage und in Anbetracht seines miserablen Gesundheitszustands mit ihnen allen ausgesöhnt, aber der Käpt’n war nun mal bis zum Schluss der wichtigste Mensch in seinem Leben gewesen.
Damit das Trikot halbwegs ordentlich auf dem Sarg lag, beugte Martin sich ächzend hinunter, breitete den Stoff aus und machte sich bereit loszulassen.
Das war der Moment, in dem Lasse aus dem Grab sprach.
Beim Klang seiner Stimme schrien einige in der Trauergemeinde vor Schreck auf, eine entfernte Cousine von Lasse lief sogar weg. Die meisten wurden leichenblass, was dem Anlass natürlich gut entsprach. Martin selbst erstarrte, seine Halsschlagader pochte schwer.
Lasses erstes Wort heulte wie eine Sirene durch die Luft. Er zog die Vokale lang, wie immer, wenn er Martin begrüßte.
»Käääääpt’n, du alte Bangbüüüüüx! Jetzt bin ich tot, du aber nicht. Also mach was draus, ja? Du weißt, wie es mit den letzten Wünschen von Verstorbenen ist, oder? Die muss man erfüllen! Komme, was da wolle! Achtung, hier ist meiner: Mach endlich die Reise nach Jamaika, auf den Spuren deines verschwundenen Bruders. Du hast mich jahrelang damit gequält, immer wieder über diesen Traum geschnackt, und dann biste doch nie los. Das ertrage ich nicht mehr! Vor allem weil ich jetzt tot bin.«
Lasse, man konnte es nicht anders nennen, beömmelte sich.
»Und einen zweiten Wunsch habe ich noch: Amüsiere dich dabei, lass es dir auf deine alten Tage gut gehen. Du hast es echt verdient. Und jetzt wirf endlich das verdammte Trikot runter, sonst komm ich nämlich hoch und hol es mir!«
Martin warf schnell das Trikot ins Grab, bevor sich der Sargdeckel noch öffnete.
Natürlich war ihm klar, dass Lasses Stimme eine Aufzeichnung gewesen sein musste, aber sicher war sicher.
Dann trat einer der Sargträger vor. Es war Knut, in seiner Hand eine Fernbedienung mit einem einzigen großen Knopf, wie man sie von Garagentoren kannte. Knut war Elektriker und Teil der Kegelrunde von Lasse und Martin.
»War sein letzter Wunsch«, sagte Knut entschuldigend. »Also einer seiner letzten. Ich musste auf die Alex schwören.«
Die Alex, eigentlich Alexandra, war der Salondampfer im Hafen von Flensburg, dem Knut sein Leben verschrieben hatte. Im Förderverein hielten sie den 1908 erbauten und heute letzten seegehenden kohlenbefeuerten Passagierdampfer Deutschlands instand. Knut und die Alex führten seit vielen Jahren eine intensivere Beziehung, als die meisten Ehen eine waren.
Martin rappelte sich mühsam auf, trat zu Knut, legte ihm die Pranke auf die Schulter und fing an zu lachen. Zuerst war er der Einzige, aber dann machte Knut mit und schließlich die ganze Trauergemeinde.
Sogar die Cousine kam zurück und lachte mit.
Das hätte Lasse gut gefallen, dem nie ein Witz zu flach, nie eine Pointe zu derb war. Als Achtjähriger hatte er mal ein Furzkissen auf den Platz des Pfarrers in der Marienkirche gelegt – und seitdem hatte sich sein Humor nicht wirklich weiterentwickelt.
Es war einer der Gründe, warum Martin ihn so ins Herz geschlossen hatte.
Danach trafen sich alle im »Piet Henningsen« unter an die Decke gepinnten Netzen und Schlangenhäuten. Martin versuchte, sich nicht davon irritieren zu lassen, dass ausgestopfte Fische, ein Taucherhelm und eine Gallionsfigur ihn beim Essen beäugten. Es gab Hering. Er konnte Fisch nicht besonders gut leiden, was er in Flensburg natürlich niemandem sagen durfte, weil sonst sein Charakter angezweifelt worden wäre. Über die Jahre hatte er deshalb viele Ausreden entwickelt, warum er ausnahmsweise keinen Fisch aß, obwohl er ihn sonst natürlich über alles liebte.
Dieser Leichenschmaus war ein weiterer posthumer Witz von Lasse. »Und dann drücken die sich alle den fiesen Hering rein!«, hatte er gesagt, als er ihm bei einer guten Flasche Rum von diesem Plan für die Festlichkeiten nach seinem Ableben erzählt hatte. »Nur weil ich tot bin! Ich schmeiß mich weg!«
Nach dem Essen musste Martin schnell zurück in seine Mühle, denn für den Nachmittag hatte sich eine Kindergeburtstagsgruppe angemeldet, die bei ihm auf die Piratenschule gehen wollte.
Erst als die schwere hölzerne Tür hinter ihm ins Schloss fiel, in die Martin vor nicht allzu langer Zeit in mühevoller Kleinstarbeit die Köpfe berühmter Piraten geschnitzt hatte, kamen die Tränen. Martin hatte nie gelernt, vor seinen Freunden zu weinen. Er konnte mit ihnen stundenlang über Gott und die Welt reden, laut feiern, dreckig lachen, sich besinnungslos besaufen, nur das Weinen hatte er sich nie mit ihnen zu teilen getraut. Seinen Tränen ließ er nur in seiner Mühle freien Lauf, die er vor ein paar Jahren der Stadt abgekauft und renoviert hatte, ja eigentlich immer noch renovierte. Das alte Mädchen hielt ihn auf Trab, indem sie immer wieder irgendwo etwas kaputtgehen ließ. Martin lief das Wasser herunter, weil Lasse ihm so verdammt fehlte – und er sich so elend allein fühlte. Lasse war Kernfamilie gewesen, das letzte Mitglied davon. Es gab andere Freunde und etliche Bekannte, aber Lasse war der Letzte gewesen, mit dem ihn ein richtig dickes Band verbunden hatte.
Martin ging die Treppe hoch in den ersten Stock. Sie war steil und schmal, die in den zweiten sogar noch enger. Der Aufstieg verlangte ihm einiges ab. Es war, wie in einen Trichter zu kraxeln. Martin war schon lange nicht mehr ganz oben gewesen, obwohl der Raum dort der schönste war, die Aussicht traumhaft. Es war das Zimmer seines kleinen Bruders Christian. Oder eher dessen Museum. Martin hatte viele der Möbel und Sachen aus Christians ehemaliger Wohnung mitgenommen und hier wieder aufgebaut – falls er irgendwann zurückkehren würde. Da waren die Reggae-Poster und -Platten von Peter Tosh, Gregory Isaacs und natürlich Bob Marley, die angebrochenen Rum-Flaschen, Dutzende. Egal, ob weiß oder braun, spiced, flavoured, ob in der Karibik gelagert oder in Europa, die Buddel in Form eines Totenkopfs oder mit aufwendig gezeichnetem Etikett, sein kleiner Bruder liebte Rum in all seinen Facetten. Auch Christians altes Aquarium mit darin versenktem Buddelschiff stand hier, und der leere Glaskubus machte Martin mehr als alles andere klar, dass sein kleiner Bruder fehlte. Christian war das klassische Nesthäkchen, für alle überraschend zwölf Jahre nach dem Erstgeborenen auf die Welt gekommen. Ein Unfall oder ein Wunder, je nachdem, wie man es sah. Von klein auf war das strohblonde Energiebündel der Sonnenschein der ganzen Familie gewesen. Martin hatte in der Jugend fast väterliche Gefühle für seinen Bruder entwickelt – wenn er sich nicht gerade darüber geärgert hatte, dass er auf ihn aufpassen musste. Sehr lange her war das. Es wirkte fast wie aus einem anderen Leben.
Martin ging zu dem alten Telefunken-Plattenspieler und legte das Album mit den größten Reggae-Hits aller Zeiten auf, das ihm Christian damals aus Jamaika geschickt hatte. In der Hülle steckte eine Postkarte, das Letzte, was er von ihm gehört hatte. Die Tinte war verblichen, aber Martin wusste genau, was daraufstand: Mach dir keine Sorgen um mich, großer Bruder! Genieß dein Leben!
Keine Platte hatte er seit dem Verschwinden Christians so oft gehört. Martin konnte alles mitsingen, hatte darüber Englisch gelernt, wenn auch eines mit stark jamaikanischem Akzent.
»Gerade haben wir Lasse beerdigt«, sagte Martin und schaute das Foto an der Wand an, das Christian mit dem Gewinnerpokal des Chemiewettbewerbs der weiterführenden Schulen Norddeutschlands zeigte. Die Hoffnung ihrer Eltern war groß gewesen, einen zukünftigen Nobelpreisträger in der Familie zu haben. Aber dann war eine andere Art von Experimenten viel interessanter für Christian geworden – nämlich mit Mädchen.
Er sah seinem Bruder sehr ähnlich, fast kam es Martin vor, als blicke er nicht auf ein Foto, sondern in sein eigenes Spiegelbild, wenn auch eines, das Jahrzehnte jünger war. Allerdings hatte er nie das Accessoire getragen, das Christian auf dem Schnappschuss trug und um das ihn damals alle Jungs beneidet hatten: eine Halskette mit einem kopflosen Piraten als Anhänger, auf dessen Brust die Zahl elf prangte. Jeder, der sich für Freibeuter interessierte, wusste natürlich, warum. Klaus Störtebeker war nach seiner Hinrichtung kopflos an elf seiner Männer vorbeigegangen, um ihnen die Todesstrafe zu ersparen. Verschont wurden sie dann allerdings doch nicht, der Bürgermeister von Hamburg brach sein Versprechen. So was hatte Tradition, nicht nur in Hamburg.
»Lasse will, dass ich dich auf Jamaika suche. Jetzt, nachdem du gut zwanzig Jahre weg bist.«
Er würde natürlich nicht nach Jamaika reisen. Er war längst zu alt dafür. Wenn er tatsächlich in den Spiegel blicken würde, sähe er wahrscheinlich nur wenig lebendiger aus als Lasse.
Jamaika, das war immer eine Verheißung gewesen, der Name klang wie schwungvolle Musik, wie ein exotischer Cocktail oder eine schöne Frau, deren Sprache man nicht beherrschte. Martin mochte es, das Wort auszusprechen, es fühlte sich irgendwie köstlich am Gaumen an. Und es war wundervoll gewesen, den Traum von Jamaika all die Jahre zu haben. Aber es war eigentlich nie mehr gewesen, nur ein Traum.
»Besser, du kommst jetzt endlich mal zurück, kleiner Bruder«, sagte Martin mit brüchiger Stimme. »Ich könnte dich hier wirklich gut gebrauchen.« Jetzt noch mehr, wo Lasse fort und keiner mehr da war, mit dem er bis spät in die Nacht am Lagerfeuer sitzen und Seemannslieder singen konnte, und zwar so schlecht, dass allen in Hörweite die Ohren abfielen.
Er setzte sich aufs Bett und blieb noch ein paar Minuten, dann ging er leise und schloss sanft die Tür. Er musste noch einiges für den Piratengeburtstag vorbereiten: sich selbst in einen echten Piraten verwandeln, den Schatz verstecken, die Stroboskopblitze im nachgebauten Piratenschiff anschließen und das Skelett prüfen, das aus einem Schrank hüpfen sollte. In letzter Zeit war es häufiger hängen geblieben, und statt sich wohlig zu gruseln, hatten die Kinder sich schlappgelacht. Was für eine Horde wilder siebenjähriger Piraten allerdings völlig in Ordnung war. Auch die Pyramide aus rostigen Blechdosen musste aufgebaut werden, das war besonders wichtig. Die Kinder sollten sie mit handtellergroßen Steinen zum Einsturz bringen. Martin behauptete seinen Schülern gegenüber immer, die Piraten hätten früher so ihre Wurftechnik geübt. War natürlich Blödsinn, aber ein großer Spaß. Er war über die Jahre verdammt gut im Zielen geworden, was ihm stets bewundernde Blicke der Kinder einbrachte. In denen ein kleines bisschen Angst lag, er könnte sie mit etwas abwerfen.
Diese Angst erleichterte seine Arbeit ungemein.
Jetzt erst bemerkte er den Umschlag auf dem Teppich, den der Briefträger durch den Türschlitz geworfen haben musste, während er selbst oben gewesen war. Die Schrift, in der sein Name daraufstand, erkannte Martin sofort: Es war Lasses. Das war überraschend, denn dieser hatte seit Jahren so sehr unter Parkinson gelitten, dass er keinen geraden Satz mehr hatte schreiben können. Martin hob den Umschlag auf und sah, dass das Papier vergilbt war. Es war sicher etliche Jahre alt.
Die alte Schiffsglocke über der Eingangstür läutete. Martin blickte auf seine Armbanduhr: Noch eine halbe Stunde, bis die Kinder eintreffen sollten. Wer auch immer das war, er hatte keine Zeit für ihn. Schnell öffnete er die Tür – und blickte in überraschte Kinderaugen. Es waren die von Dennis, der heute Geburtstag feierte. Daneben stand seine Mutter mit einer Geburtstagstorte in Form einer Totenkopfflagge im Arm. »Hallo, Herr … Käpt’n. Ich dachte, ich bringe die schon mal vorbei, dann muss ich sie gleich nicht mitschleppen.«
Martin salutierte vor dem Jungen. »Wünsche einen mörderisch schönen Geburtstag, junger Pirat!«
Dennis hatte schon sein Kostüm an, Typ »Roter Korsar«. Er zeigte mit dem Säbel auf Martins Beine. »Du hast ja zwei! Wieso hast du zwei? Du bist doch der Einbeinige! Hast du dir ein neues gekauft?«
Martin sah Dennis’ Mutter hilfesuchend an, aber die verschränkte die Arme und signalisierte damit, dass er das mal schön selbst ihrem desillusionierten Sohn erklären sollte.
»Ist mir … nachgewachsen, hat die … ähm … Meerhexe gezaubert.«
Dennis’ Mutter zog die Augenbrauen hoch. Anscheinend war das die falsche Antwort gewesen.
»Ich habe es nur für kurze Zeit bekommen«, fuhr Martin fort. »Gleich will sie es wieder zurück. Weißt du, es kostet sehr viel Gold, wenn man für ein paar Stunden wieder ein Bein haben möchte. Ist aber sehr praktisch.«
»Ja, das kann ich mir gut vorstellen«, sagte Dennis mit Kennermiene.
Als er begann, Piratengeburtstage zu veranstalten, hatte Martin es zuerst als Einarmiger versucht. So war er allerdings arg eingeschränkt, wenn er mal wieder einen kleinen übermütigen Hosenscheißer aus der Takelage entknoten musste. Als Nächstes war die Augenklappe dran gewesen. Für ein paar Stunden ging das gut, doch nach einem ganzen Tag einseitigen Sehens hatte sein Kopf gebrummt, als wäre ein Bienenvolk eingezogen. Das mit dem Beinhochbinden war zwar auch nicht ideal, aber seit er eine extrem weite Piratenhose gefunden hatte, bei der er das Bein nicht mehr so eng anlegen musste, war sein Unterschenkel nach einer Geburtstagsfeier wenigstens nicht mehr komplett taub.
Dennis’ Mutter stellte den Kuchen ab. »Wenn wir gleich wiederkommen, sind Sie hoffentlich zurück von der Meerhexe …«
»Klar, die wartet schon in Wassersleben auf mich. Ich segele gleich mit dem Fliegenden Holländer zu ihr.«
Die beiden hatten ja keine Ahnung, dass er nie zur See gefahren war, weil ihm immer schlecht wurde, sobald er ein Schiff betrat.
Wieder rollte Dennis’ Mutter die Augen. Vermutlich würde ihr Sohn jetzt nie mehr nach Wassersleben wollen. Na ja, man konnte nicht alles haben.
Das Piratenleben war hart und unbarmherzig.
Er konnte in den Augen von Dennis’ Mutter lesen, was er in den Augen vieler Flensburger sah: Für die meisten war er das städtische Faktotum, der verrückte Alte. Dabei machte er einfach nur sein Ding, war geradeaus und nahm kein Blatt vor den Mund. Er war einfach Martin. Durch und durch. Und je älter er wurde, desto mehr war es so, desto schnurzpiepegaler wurde ihm die Meinung der anderen.
Als sich abends seine Freunde bei ihm im Garten zum Kegeln trafen, hatte Martin den Umschlag von Lasse immer noch nicht geöffnet. Es würden die letzten Worte seines besten Kumpels sein, die ihn erreichten, und die wollte er nicht hastig in den wenigen Minuten lesen, die ihm zwischen dem Versuch, den Kuchen aus der Piratenflagge zu bekommen, und dem Vorbereiten des Grillguts zur Verfügung gestanden hatten. Er wollte sie ganz in Ruhe lesen, mit einem Glas, nein, einer ganzen Flasche von Lasses Lieblingsrum in der Hand. Und zwar am Steg, wo dessen geliebtes, wenn auch leicht marodes Segelboot, die Hoppetosse, lag. Nachdem Beate Uhse ihn damals entlassen hatte, weil die großen Zeiten des Flensburger Versands Geschichte waren, war Lasse aufs Segeln umgestiegen, als Lehrer. Wenden waren die einzigen Kurven, die ihn von da an noch interessiert hatten.
Bei ihren Kegelrunden hatten sie noch nie gekegelt. Keiner von ihnen konnte es. Weder Rutger, Knut, Bendix noch Imke, Lasse oder Martin. Aber Lasse hatte irgendwann mal aus Witz gesagt, sie könnten sich ja zum Kegeln treffen, weil das sportlicher klang. Und es war hängen geblieben. Genau wie diese komische Truppe aneinander hängen geblieben war. Manches passierte einfach.
Die verbliebenen Kegler saßen in Martins Garten ums Lagerfeuer und schwiegen. Wind war aufgekommen, die Flügel der Mühle drehten sich, krächzten und ächzten, der schwere Stoff knarzte, als würden Waschfrauen Laken stramm aufspannen.
»Auf Lasse!«, sagte Rutger schließlich und hob sein Glas mit Rum. »Seine schlechten Witze werden uns fehlen! Und seine guten werden wir jetzt nie erleben!«
»Hört! Hört!«, erwiderten die anderen und: »Auf Lasse!«
Rutger trug immer eine Arbeitsweste, die unzählige Taschen besaß: Vom Angelhaken über Feuerzeug, Zigaretten, Zigarillos, Zigarren bis Sekundenkleber, Allzweckwerkzeug, Würfel und Pflaster hatte er darin alles parat. Er war wie ein kleiner Heimwerkerladen auf zwei Beinen. Jetzt wandte er sich an Martin.
»Und was das betrifft, also das, was der Lasse gesagt hat, ich meine auf dem Friedhof, im Grab, also aus dem Grab heraus«, so umständlich, wie Rutger eine Glühbirne eindrehte, sprach er auch, »das lässt du mal schön bleiben. Nach all den Jahren findest du da bestimmt keine Spur mehr von deinem Bruder. Außerdem bist du in deinem Alter gar nicht mehr fit genug für so eine Reise.« Er blickte zu Bendix, Knut und Imke. »Oder seht ihr das etwa anders?«
Bendix schüttelte entschieden den Kopf. »Und mal abgesehen von Christian: Was fasziniert dich überhaupt so an Jamaika?«
»Rum?«, fragte Martin grinsend, der Bendix gern ein bisschen foppte. Der regte sich dann immer so herrlich auf.
»Haben wir hier auch«, stellte Bendix fest.
»Ist meist aber nur Verschnitt«, erwiderte Martin.
»Aber den Rum aus Jamaika kannst du auch hier kaufen. Also, was erhoffst du dir von der Reise?«, hakte Rutger ein, nun schon mit deutlich mehr Nachdruck in der Stimme.
»Sonne?«
»Gibt es hier genauso. Also manchmal. Und sonst garantiert im Sonnenstudio.«
»Strand?«
»Was ist mit der Solitüde? Da bekommst du sogar was zu essen und zu trinken, und Eis gibt es auch.« Rutgers Gesicht wurde leicht rot. »Ist also quasi genau wie Jamaika!«
»Andere Gesichter?«
»Ach was!« Rutger holte eine Zigarre aus einer Westentasche und einen silbernen Zigarrenschneider aus einer anderen. »Gibt es hier alles auch. Fährste einfach nach Glücksburg oder Harrislee oder Sønderborg oder was weiß ich, kommt dich alles viel billiger.« Routiniert schnitt er die Spitze der Zigarre ab und zündete sie am Lagerfeuer an. »Meine Meinung: Du solltest hierbleiben. Hier hast du alles, was du brauchst.«
»Wir haben ja auch die Alex«, sagte Knut. Seine erste richtige Bemerkung an diesem Abend. »So ein Dampfschiff wie die Alex gibt es nirgendwo anders.« Das war für ihn schon ein sehr ausführlicher Wortbeitrag. Am meisten redete Knut eigentlich im Schlaf, wenn er mal am Lagerfeuer wegknackte. Dann konnte man die besten Gespräche mit ihm führen.
Martin nickte, denn es stimmte, was Knut gesagt hatte. Dann blickte er zu Imke, die auffallend ruhig geblieben war. Sie war Christians Freundin gewesen und damals genauso verlassen worden wie er. Imke war eher der burschikose Typ, kurze Haare, trug niemals Rock und hatte schon mehr als einen Kerl unter den Tisch gesoffen. Am rechten Unterarm trug sie noch immer ein Tattoo mit dem Namen seines Bruders in einem Herz. Es war nie ein neues dazugekommen.
Imke arbeitete in einem Supermarkt an der Kasse und wirkte so, als hätte sie schon alles im Leben gesehen. Das mochte sogar der Fall sein, aber es bedeutete nicht, dass sie alles unberührt ließ. Manchen wuchs eine Hornhaut um die Seele, Imke ließ das die Leute nur denken. So sah Martin das zumindest.
»Ach, weißt du …« Sie winkte ab und stieß mit ihm an.
»Ne, weiß ich ja eben nicht«, sagte Martin. »Also eigentlich schon, aber ich will es hundertprozentig wissen.« Martin hatte das Gefühl, jetzt und hier die letzten Prozentpunkte an Unklarheit bezüglich dieser Frage tilgen zu müssen.
Imke nahm einen großen Schluck des Flensburger Rum-Verschnitts, den sie nur tranken, weil Knut manchmal bei der Brennerei aushalf und das Zeug billiger bekam. Es war zwar ohnehin nicht teuer, aber ab einem gewissen Konsum machten auch ein paar Euro weniger aufs Jahr gerechnet viel aus. »Das mit Christian ist so lange her, viel zu lange. Und man muss auch nicht jeder dummen Idee von Lasse folgen. Finde ich.«
Martin nickte, spürte allerdings, dass sich ein großes »Aber« in seinem Kopf bildete. Dieses »Aber« kratzte an seiner Seele, wie ein treuer Hund, den man ausgesperrt hatte.
»Wovon würdest du das auch bezahlen wollen?«, fragte Rutger. »Lasse hat dir sicher nichts vererbt. Außer ein paar alten Fischköppen.« Er lachte schallend.
Rutger half Martin bei der Steuer und wusste um seine Finanzen. Kinder feierten leider nicht jedes Jahr einen Piratengeburtstag, sondern meist nur einmal im Leben. Und die alte Mühle verschlang ständig Geld.
»Weißt du, Martin, wir wollen dich nicht auch noch verlieren«, sagte Bendix, der mit jedem Jahr mehr aussah wie Helmut Schmidt. Wie er das machte, war allen ein Rätsel. Er hatte mal als Gerhard Schröder angefangen. Immerhin blieb er einer Partei treu. Natürlich konnte im hohen Alter noch Konrad Adenauer folgen, zuzutrauen war es Bendix’ Gesicht.
Bendix legte eine Hand auf Martins Schulter und drückte liebevoll zu. »Ohne dich hätte Flensburg keinen Einbeinigen mehr. Und das gehört sich nicht für eine alte Piratenstadt.« Er holte tief Luft, war anscheinend noch nicht fertig. »Das mit Jamaika war bei deinem Bruder schon eine Schnapsidee, der hätte einfach hierbleiben sollen. Christian war Flakes bester Mann, das weiß jeder. Mit dem hätten die nie zugemacht, der wäre da heute Geschäftsführer, wenn ihm nicht sogar der ganze Laden gehören würde. Jedes Fass kannte der mit Vornamen und konnte Verschnitte zusammenstellen wie kein Zweiter. Der Christian war ein Magier in Sachen Rum, hab ich immer gesagt. Aber was hat ihm das gebracht? Nu ist er verschwunden, Jamaika hat ihn verschluckt. Mach nicht denselben Fehler wie dein Bruder, Käpt’n.«
»Ihr habt ja recht«, sagte Martin.
»Sowieso«, sagte Rutger. »Also ich immer!«
Martin stand auf und holte ein paar Äste mit Stockbrot, die von der Piratenfeier übrig geblieben waren. »Für jeden von euch ist noch eins da, das Feuer hat jetzt genau die richtige Temperatur.«
Sie hielten den Brotteig in die knisternden Flammen und sahen schweigend zu, wie er nach und nach braun und an einigen Stellen schwarz wurde.
Martin blickte auf den freien Platz in der Runde, er hatte ganz automatisch wieder sechs Baumstümpfe um das Feuer gestellt. »Er fehlt an allen Ecken und Enden …«
Rutger grunzte. »Auf Jamaika würden wir alle dir fehlen. Und es gäbe noch nicht mal Ecken und Enden, die du kennst. Komm, ist gut jetzt.«
»Wir Dänen sagen immer: Wie hoch ein Vogel auch fliegen mag, seine Nahrung sucht er auf der Erde.« Bendix nickte, als hätte nicht er selbst, sondern jemand anders etwas Kluges gesagt, dem er zustimmen würde.
»Du bist kein Däne«, sagte Martin. »Du bist in Gelsenkirchen geboren.«
»Ich bin Däne nach Gesinnung! Und ihr wisst alle sehr gut, dass das bei uns in Flensburg reicht. Deshalb habe ich auch einen dänischen Pass. Vor Gott und der Welt bin ich Däne!«
Rutger schüttelte den Kopf. »Du kannst kein Wort Dänisch.«
»Skål!«
»Okay, eins.«
Martin war froh über das Geplänkel, denn es verschaffte ihm eine Pause vom Nachdenken über seinen Bruder, über Lasse und über den Tod.
Er lachte sogar, als Rutger lautstark über sein Stockbrot fluchte, das sich in ein Brikett verwandelt hatte. Während die anderen palaverten (oder im Falle Knuts stumm nickten), nippte Martin an seinem Glas Rum und ließ sich von innen wärmen. An manchen Abenden war es verdammt schön, dass es Trost in flüssiger Form gab.
Martin hatte schon leicht einen im Kahn, als er sich Ölzeug und Südwester griff. Es trieb ihn in die Stadt, an einen Platz, an dem er sich Lasse näher fühlen würde.
Der Regen hatte Flensburg leer gefegt, und Martin genoss, dass die Wege und Straßen ihm jetzt allein gehörten. Er war schon lange nicht mehr spazieren gegangen, zumindest nicht als Martin. Als Käpt’n gehörte es zu seinem Job, mit einem Plüschpapagei auf der Schulter Seemannslieder zu singen und Werbeprospekte für seine Piratengeburtstage zu verteilen. Die Innenstadt war seine Arbeitsstelle, jetzt allein im Regen war sie seine Heimat.
Und überall traf er Lasse.
Der sich über die Stadt lustig machte.
Manchmal, wenn Lasses Geld mal wieder knapp gewesen war, hatte er Stadtführungen gegeben, aber den Leuten immer nur die geschminkte Version von Flensburg gezeigt, um sie nicht zu verschrecken. »Wenn ich nicht mehr auf deren Kohle angewiesen bin«, hatte er mal zu Martin gesagt, »werde ich ihnen Flensburg ohne Make-up geben. Das wird ein Spaß!«
Martin beschloss, die Rum-&-Zucker-Meile abzugehen, die aus immerhin zwanzig Stationen bestand, vor allem aus ehemaligen, zum Teil sogar abgerissenen Handelshäusern. Er würde Lasses Traum heute Nacht wahr werden lassen! Wer brauchte schon echtes Publikum? Er stellte sich einfach eine Touri-Gruppe vor und legte los: »Früher hatten wir über dreißig Rum-Produzenten in Flensburg, echte Dynastien wie Johannsen, Asmussen und Dethleffsen. Jede Familie, deren Name auf ›sen‹ endete, machte damals mit Rum rum! Heute gibt es nur noch zwei. Der in der Roten Straße füllt vor allem Spiced Rum ab – nichts als Panscherei!« Er rief das letzte Wort anklagend in die Nacht. »Der in der Marienstraße verkauft hauptsächlich Rum-Verschnitt und süßen Likörkram. Rum-Verschnitt ist auch gepanschtes Zeug. Allerdings …« Er hob energisch den Zeigefinger und geriet dabei etwas aus dem Gleichgewicht. »… ist das in unserem Fall geschichtlich bedingt, und deshalb meint man, es euch Touris als Traditionsware verkaufen zu können.« Martin bemerkte, dass er zu humpeln begann, als hätte er sein Holzbein umgeschnallt. Die Sache fing an, ihm Spaß zu machen. »Früher war Flensburg Teil Dänemarks und ein Zentrum des Rum-Handels. Im 18.Jahrhundert wurden dann mit einem Mal hohe Einfuhrzölle auf Spirituosen, allen voran auf Rum, erhoben. Die Flensburger, gar nicht dumm, mischten den Rum mit Wasser und neutralem Alkohol. Versteht ihr waRUM?« Er blickte zu seiner imaginierten Touri-Gruppe und stellte sich vor, Lasse wäre unter ihnen. Der hätte sich köstlich amüsiert! »Weil man dadurch geringere Mengen importieren musste, zahlte man automatisch weniger Einfuhrzoll. Wie viel echter Jamaika-Rum ist wohl in so einer Buddel Verschnitt drin? Na, wer weiß es?« Keine Antwort. »Gerade mal fünf Prozent! Damit das Zeug überhaupt nach etwas schmeckt, braucht man den stärksten, den wildesten und verrücktesten Rum als Grundlage: den aus Jamaika. Die produzieren dort extra für den deutschen Markt ein so intensives Destillat, dass man es pur nicht trinken kann. Die Rum-Stadt Flensburg ist also eine Stadt der Verdünnisierer!«
Es war Martin, als würde Lasse neben ihm kichern.
In der Johannisstraße, wo er eigentlich über Flensburgs erste Zuckersiederei referieren wollte, von der heute nur noch ein Speicher existierte, kam er zu einem abrupten Halt.
Er stand vor seinem alten Elternhaus.
Das erste Mal seit Jahren.
Martin hatte immer einen Bogen darum gemacht, ohne es so richtig zu merken. Als läge im Zentrum von Flensburg ein schwarzes Loch, dessen Ereignishorizont er nicht überschreiten durfte, wollte er nicht eingesogen werden.
Nun hatte er es getan.
Nach dem verfluchten Unfall hier war Christian nach Jamaika gegangen. Martin, der damals noch in einer kleinen Wohnung in Tarup lebte, hatte seine Eltern in der Zeit danach immer seltener besucht. Das Verschwinden ihres jüngsten Sohns zog seine Mutter und seinen Vater in eine trostlose Düsternis: Sie stellten unzählige Fotos von ihm auf, mit schwarzem Trauerband, und verschrieben sich ganz der Erinnerung. Martin hatte das irgendwann nicht mehr ausgehalten und war ganz ferngeblieben. Nach dem Tod der Eltern hatte er das Haus dann schnell verscherbelt und sich mit dem Geld die Mühle gekauft.
Martin blickte über den niedrigen Jägerzaun in den Garten, der aussah, als wäre nie etwas Tragisches in ihm geschehen.
Als die Erinnerungen sich weiter verfestigten und wie Geschwüre auf sein Herz drückten, ging er schnell weiter.
Die Führung war beendet.
Der Regen wurde dünner und langsamer, wie die Strahlen einer Gießkanne, die sich nahezu geleert hatte. Und dann war er plötzlich fort. Der Wind aber verschwand nicht, er wehte so stark, als wolle er Flensburg schnell wieder trocken bekommen.
In der Jollensammlung des Museumshafens lag Lasses historisches Segelboot.
Die Hoppetosse war klein, und man sah ihr an, dass die ochsenblutrote Farbe an Steuerbord abblättern würde, sobald sie an Backbord komplett aufgetragen war. Es war ein Lebenswerk. Eines von der Sorte, das seinen Namen zu Recht trug, weil es nie im Leben fertig wurde. Die Hoppetosse sah nicht aus, als würde sie den kleinsten Törn überstehen, aber Lasse hatte immer behauptet, dass die Winde stets auf seiner Seite waren. Segelschüler hatte er allerdings nie auf sein heiliges Schiff gelassen.
Martin setzte sich auf den Steg. Dies war der richtige Ort für den Abschied von Lasse. Nicht der Friedhof, auf dem Lasse nie zuvor gewesen war und wo nun seine sterbliche Hülle lag. Wenn seine Seele sich tatsächlich einen neuen Platz gesucht hatte, dann in diesem Schiff – zumindest bis es irgendwann auf den Grund des Hafens sank.
Es war der Platz, an dem er Lasse gestehen musste, dass er seinen letzten Wunsch nicht erfüllen würde. Martin redete nicht lange um den heißen Brei herum.
»Tut mir wirklich leid, Lasse, aber das mit Jamaika wird nichts. Ich will auch nicht von dir überredet werden, den Brief hättest du dir sparen können.«
Er warf den Umschlag ins Wasser.
Beziehungsweise: Er versuchte es.
Der Wind warf ihn zurück.
Martin sah auf die Hoppetosse. Ihm war, als säße Lasse dort mit prall aufgeblähten Wangen und pustete in seine Richtung. Doch da war natürlich niemand, also warf er den Umschlag wieder zum Wasser, diesmal mit mehr Kraft.
Aber der Wind hatte seine Kraftreserven noch nicht geleert. Als der Umschlag wieder vor seinen Füßen landete, schüttelte Martin den Kopf. »Lasse, du alter Dickkopf! Ich will nicht!« Er holte tief Luft. »Okay, ich lass mich auf einen Deal ein: Wenn du mir den Umschlag noch einmal zurückbläst, öffne ich ihn und lese den Brief, okay?«
Der Wind heulte leise. »Ich nehme das mal als Ja.«
Um mehr Schwung zu bekommen, stand Martin auf und holte weit aus.
Diesmal flog der Umschlag schnurgerade Richtung Wasser.
Für einen Moment schien es völlig windstill zu sein.
Bis wieder eine Böe eingriff und den Umschlag abermals ans Ufer warf wie einen frischen Fang.
»Hast es spannend gemacht«, sagte Martin und musste grinsen. Er gestand weder sich noch Lasses Geist ein, dass er trotz des weiten Ausholens etwas schwächer geworfen hatte als die Male zuvor.
Sachte öffnete er den Umschlag und faltete den Brief vorsichtig auseinander. Rechts oben stand ein Datum, der 11.März 1999. Rund zwanzig Jahre war das her. Damals war sein Bruder seit zwei Monaten auf Jamaika gewesen – und der Kontakt abgebrochen. In dieser Zeit war Lasse von einem guten zu Martins wichtigstem Freund geworden. Und es bis an sein Lebensende geblieben.
Martin begann zu lesen.
Ahoi, Käpt’n!
Wenn du das liest, bin ich tot. Deshalb erst mal: mein tief empfundenes Beileid. Ich gehe mal schwer davon aus, dass mein Tod dich mehr schmerzt als mich. Denn ich bin jetzt ja bei den Fischen oder wo immer ihr mich entsorgt habt.
Ich find’s super, dass ich jetzt so einen »Im Todesfall versenden«-Brief schreiben darf, und vielleicht schreibe ich gleich noch ein paar. Einfach aus Spaß an der Freude. Außerdem habe ich da noch ein paar Rechnungen offen, die ich ausgesprochen gern begleichen würde, ohne dass ich Rache befürchten muss.
Der Brief stammte auf jeden Fall von Lasse.
Ich sag, wie es ist: Ich habe mir Mut angetrunken. Mit Rum aus Jamaika, genauer aus Trelawny, von der Hampden Distillery, wo dein Bruder eine Zeit lang gejobbt hat. Also da, wo sie das Zeug mit dem hohen Estergehalt produzieren, das nur Verrückte trinken. Das Rum-Äquivalent zur Whisky-Insel Islay. Entweder du vergötterst das Zeug, oder du verachtest es. Schmeckt so was von nach Banane und flambierter Ananas, irre. Ich schweife ab, aber du kennst das ja.
Die Buddel, die ich mir gerade genehmige, hat mir dein Bruder geschenkt, bevor er sich vom Acker gemacht hat. Und um deinen Bruder geht es jetzt auch … Sitzt du, Käpt’n? Bestimmt sitzt du, du fauler Hund!
Martin musste lächeln. Es tat gut, und es tat weh.
Dein Bruder hat mich ein paarmal aus Jamaika angerufen – er hatte nämlich eine Wette verloren. Ich sag nur: Bismarck-Heringe! Es bekommt halt keiner mehr von dem Zeug runter als ich. Auf jeden Fall war er verpflichtet, mir Lageberichte zu geben. Dich hat er nicht angerufen, weil er nicht wollte, dass du dir Sorgen machst.
Und du hättest dir welche gemacht.
Das wäre allerdings auch angemessen gewesen …
Bei einem Anruf meinte er, dass er fast bei einem Brand ums Leben gekommen ist, und bei einem anderen, dass er sich mit Leuten eingelassen hat, mit denen man sich echt nicht einlassen sollte.
Ihm ist etwas passiert, da bin ich mir ganz sicher. Und wenn du wissen willst, was, musst du nach Jamaika. Du fragst dich jetzt sicher, warum ich dir das alles nicht direkt erzählt habe.
Das hatte sich Martin in der Tat gefragt.
Ganz einfach: weil dein Bruder mich darum gebeten hat. Er hatte Angst, dass dir etwas passiert, falls du nach Jamaika reist. Ich musste ihm hoch und heilig schwören, dir nix zu sagen, mein ganzes Leben lang. Merkst du was? Jetzt darf ich!
Ich mach hier Faxen, dabei ist die Sache sehr ernst. Käpt’n, ich glaube, dein Bruder ist ermordet worden. Und ich glaube nicht, dass die jamaikanische Polizei davon weiß, geschweige denn erfolgreich ermittelt. Was bedeutet: Du bist der Einzige, der die Chance hat, rauszufinden, was passiert ist, und den Täter zur Rechenschaft ziehen kann. Für deinen kleinen Bruder! Aber pass gut auf dich auf, ja?
Martins Hände krampften sich um das Papier. Es kostete ihn viel Kraft weiterzulesen.
Ich habe dir einen Zettel beigelegt, auf dem steht, wo Christian auf Jamaika überall war. Das sind die Orte, von denen ich weiß. Was immer ich von hier oben aus für dich tun kann, werde ich machen. Okay, zugegeben, ich bin wohl eher nach unten gereist. Aber vielleicht gibt es da ja auch ein paar Hebel. Für Blitzschlag oder so, Heuschreckenregen, was weiß ich.
Dein Lasse (der jetzt mehr weiß als alle Wissenschaftler. Wenn das meine alte Klassenlehrerin noch erlebt hätte, die meinte ja immer, ich würde nie etwas begreifen!)
Martin erhob sich zitternd.
Als er auf die Häuser im Hafen von Flensburg blickte, sagte er leise Lebewohl.
Über achttausend Kilometer entfernt, unter der flirrenden Sonne Jamaikas, saß in diesem Augenblick eine Frau in ihrem Wagen und blickte konzentriert auf eine Rum-Distillery. Es gab insgesamt sechs auf der Insel, einige davon waren für Besucher geöffnet, bei anderen wussten mitunter nicht einmal Rum-Experten, wo sie sich befanden.
Diese gehörte zur zweiten Sorte.
Jo’anna Desmond hatte ihr in den Unterlagen den Codenamen »Kill Devil« gegeben. Unter dieser Bezeichnung war Rum jahrhundertelang bekannt gewesen, vermutlich weil der Genuss des Zuckerrohrbrands alles Teuflische abtötete – oder gleich den Teufel selbst.
Seit Stunden schon hockte sie allein in ihrem blauen Honda Civic und beobachtete das Geschehen in der Distillery mit einem Fernglas. Das Ensemble aus Wellblechgebäuden und Schornsteinen wirkte wie ein auf Grund gelaufener, alter Frachtkahn. Da es keinen Publikumsverkehr gab, machte man sich offenbar nicht die Mühe, irgendetwas aufzuräumen: Rostige Gerätschaften und ausgediente Fässer lagen rundherum, etliches davon hatte sich die Natur schon zurückgeholt und überwuchert.
Der Civic war ihr privater Wagen, nicht ihr dienstlicher von der JCF, der Jamaica Constabulary Force. Auch ihre Uniform trug Jo’anna nicht, sondern hatte sie gegen ein geblümtes Kleid eingetauscht. In der JCF hatte Jo’anna den Rang eines Inspectors inne, aber heute war sie nicht in offizieller Mission unterwegs. Was Superintendent Reginald Bolt sicher nicht gefallen würde. Egal. Er war ihrer Meinung nach ein absoluter Vollidiot, dessen Dummheit durch die Verbeamtung nur zementiert worden war. Bolt mochte keine Frauen, noch weniger mochte er Frauen über fünfzig, und am allerwenigsten mochte er Frauen mit Jo’annas Körperumfang. Aber wenn sie etwas Selbstgemachtes ins Police Office mitbrachte, wie Brown Stew Chicken, Peppercorn Soup oder ihren berühmten Rhum Cake, dann schlug Bolt immer hemmungslos zu.
Jo’anna zündete sich eine Zigarette an, um ihre Nerven zu beruhigen. Sie rauchte Matterhorn, nicht wegen des Geschmacks, der zugegebenermaßen etwas fragwürdig war, sondern weil sie das Bild des schneebedeckten Berges auf der Packung so herrlich exotisch fand. Einmal in ihrem Leben wollte sie so einen Berg sehen. Aber ihr Gehalt gab nicht viel her, und das meiste ging für die Familie drauf. Jo’anna strich mit den Fingerspitzen über den Umriss des Berges, der nur entfernt an das echte Matterhorn erinnerte, wie sie aus einer Dokumentation auf Television Jamaica wusste.
Aus den Boxen des Wagens drang Joan Hicksons angenehme Stimme, die Agatha Christies »Ein Mord wird angekündigt« vorlas. Jo’anna liebte Miss Marple und fand, dass die berühmte Detektivin durchaus etwas Jamaikanisches hatte. Zum Beispiel kannte sie alle ihre Nachbarn sehr gut – und all deren Schwächen. Genau wie Jo’anna.
Aber jetzt stellte sie das Hörbuch aus.
Sie brauchte Beweise.
Handfeste Beweise.
Und das bedeutete: Fotos, Videos, etwas Schriftliches.
Jo’anna blickte aus dem Fenster. Die wenigen Menschen, die vor der Distillery zu sehen waren, rauchten auch oder telefonierten. Gestern hatte Jo’anna durch einen Kontaktmann erfahren, dass die Spuren eines Rings, der illegale Arbeitet vermittelte, hierherführten. Es ging ihr bei dieser Undercover-Ermittlung nicht nur um das Gesetz, es war eine persönliche Sache. Ihr Sohn Isaac war bei einer Konkurrenz-Distillery entlassen worden, weil deren Rum nicht mehr so gut lief, seit »Kill Devil« die Preise gesenkt hatte – was aufgrund der unterbezahlten illegalen Arbeiter plötzlich möglich war. Es war Isaacs erster fester Job seit Monaten gewesen, jetzt lungerte er wieder den ganzen Tag in Spelunken rum, rauchte Marihuana, trank billiges Bier und versuchte, beim Dominospiel Geld zu gewinnen, verlor aber nur mehr und mehr. Er war ein guter Junge – mit schlechten Angewohnheiten. Sie konnte ihn ermahnen, so viel sie wollte, von der Straße bekäme sie ihn nur mit einem Job.
Und dafür musste sie jetzt etwas tun.
Jo’anna beschloss, den Versuch zu wagen, die Arbeiter anzusprechen. Sie schnippte die Zigarette aus dem offenen Fenster, richtete ihr dunkles, dichtes Haar und stieg aus.
In diesem Moment fiel ein Schuss.
Und er traf sein Ziel.
ZWEI
»I Got You Babe«
Martin hatte gedacht, ihn würde auf Schiffen die schlimmste Übelkeit ereilen.
Das lag allerdings nur daran, dass er noch nie geflogen war.
Eingeklemmt in einem schmalen Economy-Class-Sitz hätte Martin alles dafür gegeben, an der Reling eines Überseekreuzers zu stehen und auf Wasser zu starren. Wasser war zumindest deutlich handfester als Luft, von der sich viel zu viel unter dem Rumpf des Flugzeugs befand. Um das zu vergessen, beschäftigte er sich intensiv mit der Bordbar, vor allem die geschmacklichen Unterschiede der dort angebotenen Alkoholika unterzog Martin einer intensiven Inspektion. Aber gnädigen Schlaf schenkten sie ihm nicht.
Als er am Sangster International Airport von Montego Bay aus dem Flugzeug stieg, war er deshalb gleichermaßen angetrunken wie übermüdet. Am liebsten hätte er sich sofort auf den Boden gelegt und ein Nickerchen gemacht oder gleich zwei, die nahtlos ineinander übergingen. Aber er musste zunächst die langwierigen Einreisemodalitäten über sich ergehen lassen.
Der Mann in der Schlange hinter ihm hustete, und Martin musste an die vergangene Woche denken, in der er die Reise vorbereitet hatte und das erste Mal seit Langem mal wieder bei seinem Hausarzt Dr.Simon Schäfer vorbeigeschaut hatte, um sich gegen Hepatitis A, B, gegen Typhus und Tollwut impfen zu lassen. Dabei war auch gleich ein Check-up gemacht worden, mit EKG, Blutdruck, Urinuntersuchung und großem Blutbild.
Das Ergebnis war überraschend gewesen.
Überraschend schlecht.
Die Leberwerte waren nah an der Zirrhose, Cholesterin und Triglyzeride schossen durch die Decke, auch der Blutdruck war viel zu hoch, der Puls dafür zu niedrig. Martins Gesamtzustand war so mies, dass Dr.Schäfer, der ein offenes Wort schätzte und Einfühlsamkeit eher weniger, ihm gesagt hatte, dass sein Ende absehbar war, falls sich nicht grundlegend etwas änderte.
Die Aussage war Martin vorgekommen, als hätte der Arzt ein Verfallsdatum auf seine Stirn geschrieben. In Rot.
Vielleicht würde er es schon hier auf Jamaika erreichen.
Es kam Martin wie eine Ewigkeit vor, bis ihn die Flughafentüren auf die Insel spuckten. Wo ihm die Luft wie ein lauwarmer, nasser Waschlappen ins Gesicht schlug. Und neckisch auf alle anderen freien Körperstellen, als wäre es für alle Beteiligten ein großer Spaß.
Dafür hatte er also seine Lebensversicherung gekündigt.
Seinen alten Volvo verkauft.
Und die Mühle mit einer so schweren Hypothek belastet, dass ihre Flügel sich eigentlich nicht mehr bewegen dürften.
Andererseits war er nicht hier, um eine gute Zeit zu haben. Wer an einem zwanzig Jahre fest verschlossenen Mysterium rüttelte, musste damit rechnen, dass es unbequem wurde. Gut möglich, dass ihn derjenige hörte, der damals den Schlüssel abgezogen hatte.
Dies war das Land seiner Träume, aber es konnte sein, dass er in einem der Träume gelandet war, die sich in einen Albtraum verwandelten.
Dank des Alkohols in seinem Blut kam Martin der Gedanke allerdings gerade wie ein guter Witz vor, und er musste grinsen.
Er brauchte jetzt ein Taxi, das ihn zu einem Hotel mit einem Bett fahren würde oder auch nur einer Pritsche, egal. Er würde gerade sogar auf einer Schotterpiste schlafen. In seinem Alter steckte man eine zehnstündige Flugreise nun mal nicht mehr so leicht weg. Aber was tat er nicht alles für Lasse – und für seinen eigenen Seelenfrieden.
Der Typ neben ihm im Flieger hatte ihm erklärt, wie man auf Jamaika ein Taxi rief: Man hielt den Finger hoch, wenn man jemanden für eine lange Strecke brauchte, und nach unten, wenn es um eine kurze ging. Da es bis Kingston ein ordentliches Stück war, hielt Martin den Finger sehr hoch. Der Typ hatte zudem gesagt, er solle darauf achten, eines der Taxis mit rotem Nummernschild zu nehmen, das staatlich geprüften Route-Taxis vorbehalten war. Sie fuhren zwar erst, wenn sie voll besetzt waren, dafür kamen sie einen billiger als Charter-Taxis, die von Durchschnittstouristen bevorzugt wurden.
Doch bevor Martin sich die Nummernschilder der Fahrzeuge vor dem Flugzeug in Ruhe anschauen konnte, tauchte eine junge Frau vor ihm auf. »Taxi?«
Prompt erschien hinter ihr ein stämmiger Jamaikaner und kreuzte die muskulösen Arme vor der Brust. »Willst du mir etwa schon wieder einen Kunden wegschnappen, Babe?«
Sie achtete nicht auf ihn. »Ich mache Ihnen einen guten Preis! Lassen Sie sich nicht von dem Typen da über den Tisch ziehen!«
»Stell dich hinten an«, sagte der Jamaikaner. »Immer wieder machst du den Typen schöne Augen. Das endet irgendwann böse, Babe!« Er packte sie an den Schultern.
Aber die junge Frau behielt Martin im Blick. »Ich brauch das Geld, bitte!«
Der Taxifahrer schob sich vor sie. »Frauen können sowieso nicht Auto fahren.« Er lachte schallend. »Steigen Sie in mein Reggae-Taxi, kleine Sightseeing-Tour inklusive.« Er zeigte auf einen Wagen, der in den Nationalfarben Jamaikas gelb, schwarz und grün gestrichen war.
»Ich fahre mit ihr«, sagte Martin. »Frauen am Steuer sind mir lieber!«
Das stimmte nicht, im Gegensatz zu vielen anderen Männern seiner Generation war es ihm völlig egal, welches Geschlecht hinter dem Steuer saß. Es war ihm aber überhaupt nicht egal, welches Geschlecht dumme Sprüche machte.
»Ich muss allerdings erst meine ganzen Koffer in den Griff bekommen.«
Die Frau schnappte sich einen Teil des Gepäcks und führte Martin, der den Rest schleppte, zu ihrem Auto.
Es war ein flamingorosa gestrichener Golf.
»Ein deutsches Auto?«, fragte Martin, als er auf dem Beifahrersitz Platz nahm.
»Ist stabil. Und es gefällt den deutschen Touristen.« Sie grinste.
»Absolut.«
Sie startete den Wagen und fuhr ohne Schulterblick los. »Woher stammst du?«
»Flensburg. Das ist im Norden. Fast schon Dänemark.«
»Ah, Flensburg, kenne ich.«
»Das sagst du doch jetzt nur so, oder?«
»Nein, wegen der Schießerei, die wir vor Kurzem hier hatten. In einer Rum-Distillery sind Fässer angeschossen worden – die sollten eigentlich nach Flensburg. Es sind auch Menschen angeschossen worden, aber das mit den Fässern hat die Leute hier mehr mitgenommen. Willkommen auf Jamaika!« Sie reichte ihm die Hand. »Ich bin Babe, und wer bist du?«
»Ich bin der Käpt’n. So nennen mich alle. Eigentlich heiße ich anders.«
»Da haben wir etwas gemeinsam.« Sie nahm die nächste Kurve so scharf, dass Martin sich wie in einer Achterbahn vorkam. Der Linksverkehr machte das Ganze doppelt beängstigend. »Ich heiße eigentlich auch anders. Aber als Kind wollte ich nie einschlafen, und das Einzige, was geholfen hat, war ›I Got You Babe‹ von Sonny & Cher. Meine Mum hat den Song immer in der Reggae-Version gesungen. Der Ohrwurm meines Lebens!«
Jetzt erst kam Martin dazu, sich seine Fahrerin richtig anzuschauen. Babe erinnerte ihn an eine Sängerin mit cappuccinobrauner Haut aus den Achtzigern, die auch mal in einem schmalzigen Film mitgespielt hatte. Kevin Costner war auch darin, und die Frau hieß … Whitney Houston! Babe sah mit ihrer Löwenmähne, bei der man fast Mühe hatte, ihr Gesicht zu finden, aus wie Whitney Houston in diesem Film. »They say we’re young and we don’t know, we won’t find out until we grow«, sang Babe die ersten Zeilen des berühmten Sonny-&-Cher-Songs.
»Well I don’t know if all that’s true, ’cause you got me and baby I got you«, stieg Martin mit seinem tiefen Bass ein.
»Du kennst den Song?« Babe strahlte über das ganze Gesicht.
»In- und auswendig.«
»Das gibt einen dicken Sonderpunkt! Warst du schon mal auf Jamaika?«
»Nur hiermit«, er tippte gegen seine Schläfe. »Und hiermit«, Martin klopfte auf sein Herz.
Babe sah ihn stirnrunzelnd an. »Warum sprichst du dann Englisch mit jamaikanischem Akzent?«
Martin lächelte. »Weil ich gut zuhören kann. Ich habe zu Hause eine Platte mit den besten Reggae-Hits aller Zeiten. Die Texte habe ich mir alle draufgeschafft und so Englisch gelernt. Okay. Ein bisschen Volkshochschule kam auch dazu. Aber da hat mich die Lehrerin immer wegen meines Akzents getadelt.«
»Und warum bist du nach Jamaika gekommen? Urlaub? Oder geschäftlich?«
»Wegen einer Familienangelegenheit. Man könnte auch sagen: weil ich es einfach nicht ertrage, das Ende einer Geschichte nicht zu kennen. Vor allem nicht, weil ich am Buch mitgeschrieben habe.«
Sie setzte den Blinker, wechselte aber im selben Augenblick die Spur. »Sprichst du immer in Rätseln?«
»Eigentlich nie, ich bin ja Norddeutscher.« Als Babe ihn fragend anblickte, setzte er hinzu: »Wir sind dafür bekannt, klare Kante zu zeigen. Gerade bin ich allerdings nur müde und muss dringend ins Bett.«
»Ich habe ganz vergessen zu fragen, wo du hinwillst! Dachte automatisch, du hast ein Zimmer in MoBay.«
»Nein, ich will hierhin.« Er hielt ihr den Zettel von Lasse hin, der während des tagelangen Aufenthalts in seiner Hosentasche deutlich gelitten hatte, und zeigte auf den Namen ganz oben. »Da fängt alles für mich an.«
»Echt? Bist du dir sicher, dass du da absteigen willst?«
»Völlig. Wieso?«
»Da sieht man kaum Touristen. Hat keinen so guten Ruf.«
»Hab ich auch nicht.« Martin lachte dröhnend. »Dann werde ich mich da sicher wohlfühlen.«
Ein paar Sekunden blickte Babe auf die Straße, an deren Rändern so viele Schilder standen, wie Martin es noch nie gesehen hatte. Auf Jamaika liebten sie anscheinend Schilder über alles. Oder der Schilderproduzent war der Schwager des Staatschefs.
»Ich kann dich gut leiden«, sagte Babe.
»Das sagst du aber jetzt nur, weil du auf ein ordentliches Trinkgeld hoffst.«
»Nö.«
»Sondern?«
Babe klimperte mit ihren langen Wimpern. »Weil ich gern deine Fahrerin hier auf Jamaika wäre. Aus einem ganz uneigennützigen Grund: damit die allerbeste dich fährt. Das hast du verdient.« Sie hob den linken Arm und spannte ihren Bizeps an. »Außerdem mach ich auch Kickboxen, kann dich also verteidigen. Ist praktisch, wenn man weiß, wohin man am besten tritt und schlägt. Vor allem als Frau auf Jamaika.«
»Kann ich mir dich denn überhaupt leisten? Ich bin nämlich kein Millionär.«
»Käpt’n«, sagte Babe. »Da haben wir schon wieder etwas gemeinsam!« Wieder dieses strahlende Lächeln. »Sagst du mir, wohin ich dich bei deiner ersten Tour fahren soll? Dann kann ich schon mal alles vorbereiten.«
Als sie hörte, wohin es ging, war sie ganz aufgeregt.
Auf dem Zettel von Lasse stand unter der Unterkunft der Name der Distillery, bei der Christian damals zuerst gejobbt hatte. Ihr Name: Hampden.
Hey Tagebuch,
verdammt, ich bin in einem echten Drecksloch von Hotel gelandet. Dabei heißt es »Jamaican Heavenly Palace«! Ich meine, das klingt doch nach was. Also nach goldenen Wasserhähnen, Marmorbüsten und leicht bekleideten Frauen, die einem mit Palmwedeln Abkühlung verschaffen. Tja, ich sag mal so: Jede deutsche Jugendherberge ist komfortabler – und zwar Stand 1960. Die Frau an der Rezeption, okay: am Verschlag, sagte eben, ich soll gut aufpassen, denn es gäbe Gegenden, da sollte man nachts als Touri nicht hingehen. Und als ich fragte, welche denn zum Beispiel, antwortete sie: Na ja, genau die hier zum Beispiel.
Kein Wunder, dass ich mich verfolgt fühle.
Ist sicher nur die ungewohnte Umgebung, Kingston ist halt nicht Flensburg.
Und Trenchtown erst recht nicht.
Immerhin bin ich hier in der Keimzelle des Reggae, die Tuff Gong Studios in der Little Bell Road liegen gleich um die Ecke. Vorhin hab ich das Mischpult, an dem schon Wailers-Songs gemischt wurden, gesehen und Bob Marleys alten Flügel. Ich durfte ihn sogar berühren!
Danach bin ich die Orange Street rauf und runter, die galt in den Sechzigern bis Anfang der Achtziger als Epizentrum des Reggaes. In den Aufnahmestudios und Plattenläden, da wurden viele Stars geboren. Doch die Zeiten sind leider vorbei. Alles ist zwar bunt, aber runtergekommen, etliche Plattenläden sind für immer geschlossen. Bei Butch Braithwate im »Rockers International Records« hab ich aber noch ein paar Raritäten finden können, und er hat extra für mich Peter Toshs erstes Album aufgelegt! Das fühlte sich an, wie zu Hause sein. Mit Butch hab ich echt lange gesprochen, er hat viel von sich erzählt und dabei etwas gesagt, das mich echt zum Nachdenken gebracht hat: Hier auf Jamaika kommst du nur raus, wenn du hart arbeitest und eine Chance kriegst, meinte er. Aber Chancen sind rar auf diesen Straßen. Musik ist immerhin eine. Verbrechen eine andere. Trotz dieser bedrückenden Aussichten sind die Menschen hier entspannt und nett. Deshalb mache ich mir auch keinen Kopf und gehe heute Abend auf eine Streetparty. Hab auf einer bunten Tafel an einem Strommast davon gelesen. Ab morgen gucke ich mir dann mal an, was die Distillerys auf Jamaika so zu bieten haben. Ich will mir erst ein paar anschauen und dann mal überlegen, wo ich anheuere. Über Hampden hab ich viel Gutes gehört, aber die erste Besichtigung ist bei Appleton gebucht. Ich bin gespannt.
Jamaika, ich bin endlich da!
Flensburg, ich bin endlich weg!
Und jetzt ruh dich aus, Tagebuch. Heute Abend musst du fit sein!
Dein Christian
Martin mochte den »Jamaican Heavenly Palace« auf Anhieb. Der junge Mann an der schlichten, aber aufgeräumten Rezeption wirkte zwar nicht direkt wie ein Bankangestellter, aber einigermaßen vertrauenswürdig. Das Haus war sauber, das Zimmer einfach, die Matratze angenehm fest.
Nach Babes Warnung hatte er eine andere Behausung erwartet. Vielleicht hatten das Hotel und die Gegend auch nur den Ruf, gefährlich zu sein. Das mit dem Ruf war immer so eine Sache. Über ihn sagten ja auch einige Flensburger, er sei etwas wunderlich, womöglich sogar gefährlich, nur wegen dieser Piratensache. Die Leute sahen manchmal Gefahren, wo einfach nur Menschen waren, die sich von ihnen unterschieden.
Nachdem Martin vierzehn Stunden am Stück geschlafen hatte, fühlte er sich ein wenig frischer. Aber das Klima machte ihm zu schaffen und die fremde Umgebung auch. Alles war so gar nicht Flensburg. Ihm fehlte seine Mühle, seine Kegelrunde, der Geruch der Ostsee. Martin fühlte sich wie eine Pflanze, die in die falsche Erde umgetopft worden war und deren Wurzeln keinen Halt fanden.
Aber hier im Hotelzimmer würden sie diesen auch nicht finden.
Wie eine Pflanze musste er die Blätter Richtung Sonne strecken, dann kam die Kraft.
Er beschloss, sich die Beine zu vertreten. Nach einigem Herumspazieren in den von der Sonne flirrenden Straßen, einem frittierten gelben Fisch, den ihm ein Händler an einem Straßenstand aufgeschwatzt hatte, und einem kühlen Bier, das er sich danach besorgt hatte, landete er in einem Laden namens »Rockers International Records«. Außer ihm war niemand in dem kleinen, engen Geschäft, und er kam schnell mit dem Besitzer ins Gespräch. Butch trug graue Dreadlocks, und sein Gesicht erinnerte an einen Schrumpfkopf, was vermutlich vom Kettenrauchen kam. Die ganze Zeit hatte Butch eine glühende Fluppe im Mundwinkel.
»Was hast du denn so an Reggae-Platten?«, fragte er Martin. Ohne die Fluppe dafür aus dem Mundwinkel nehmen zu müssen.
»Am liebsten mag ich ›The 40Greatest Reggae Hits of All Times‹. Die kam Ende der Achtziger raus. Ist da alles Wichtige drauf?«
»Ja, klar«, sagte Butch. »Mehr braucht absolut niemand an Reggae.«
»Wirklich?«
Butch lachte laut auf und breitete die Arme aus. »Dann könnte ich meinen Laden zumachen! Du weißt nichts über jamaikanische Musik, mein Freund, gar nichts! Hier, hör dir das mal an. Bob Marley ist großartig, aber kennst du Peter Tosh? Sein erstes Album? Wenn du ein Herz hast, gehört es danach dem Reggae. Ansonsten bist du kein Mensch, dann bist du ein Stein!«
Er drehte die Anlage auf, und die ersten Takte von »Legalize It« dröhnten durch den kleinen Laden, brachten sogar die Platten an den Wänden zum Vibrieren.
Dann klingelte Butchs Handy, er drehte die Musik seufzend leiser, nahm den Anruf an und sprach dabei Patois, die jamaikanische Kreolsprache – Martin verstand kein Wort. Deshalb schaute er sich um und blätterte durch die unzähligen LPs mit bunten Farben und miserablen Fotos. Als Butch das Telefonat beendete, ging Martin mit Peter Toshs erstem Album zur Theke: Er vertraute dem Musikgeschmack des Ladenbesitzers. Martin öffnete sein Portemonnaie, und Butch erblickte den Personalausweis. Ein breites Grinsen erschien in seinem Gesicht.
»Deutschland!«, stieß er aus. »Ich liebe eure traditionelle Musik.«
Martin zog die buschigen Augenbrauen empor. »Die ist aber das Gegenteil von Reggae.«
Butch beugte sich hinter dem Tresen hinunter und kam mit mehreren LPs wieder hoch. Martin traute seinen Augen nicht.
»Wildecker Herzbuben! Großartig! Kastelruther Spatzen! Fantastisch!« Butch schunkelte, um seine Zuneigung zu demonstrieren. »Und erst die Zillertaler Schürzenjäger! Ich liebe sie!«
Martin war gelinde gesagt fassungslos. »Wie bist du denn an all die Platten gekommen?«
»Mir hat mal ein Deutscher von den Bands erzählt. Und dann habe ich mir die besorgt. War gar nicht so einfach.«
»Der wollte dich sicher auf den Arm nehmen.«
»Nein, der war ein Freund. Er sagte: Falls du mal was richtig Abgefahrenes hören willst, dann besorg dir die. Abgefahrener geht’s nicht. Soll ich eine davon auflegen?«
»Ne, lass mal stecken. Vielleicht ein andermal.« Martin schob das für die LP abgezählte Geld über den Tresen.
»Wie heißt du eigentlich?«
»Ich bin der Käpt’n«, sagte Martin. »Ganz einfach der Käpt’n.«
Butch salutierte, und Martin salutierte zurück. Es war zwar Blödsinn, aber Butch schien seinen Spaß dabei zu haben.
Martin schlenderte zurück ins »Jamaican Heavenly Palace« und fragte Babe per SMS