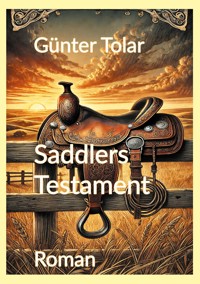
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ludwig stammt aus einfachsten Verhältnissen aus Wels in Oberösterreich. Er hat das Handwerk des Sattlers gelernt. Das 20. Jahrhundert verschlägt ihn in den 2. Weltkrieg. In der Normandie gerät er in amerikanische Kriegsgefangenschaft und wird über Intervention eines amerikanischen Offiziers mit einem Gefangenentransport nach Amerika ausgelagert. Dort wird er bald Sattler - Saddler in einem Reitklub. Dort lernt er einen auf Cowboy-Filme spezialisierten Filmproduzenen aus Hollywood kennen, der ihn engagiert. Ludwig heiratet, ein Sohn ist das Produkt. Auch der heißt Ludwig, der II. sozusagen. Ludwig I. macht sich selbstständig, baut seine Firma aus, expandiert und wird reich. Als sich Ludwig I. zurückzieht, übernimmt Ludwig II. die Firma. Seine Eheversuche scheitern, er hat keinen Nachfolger und keine Erben in Amerika. Er beschließt, die Firma zu verkaufen, nach Wels zu übersiedeln und seine erbberechtigte Verwandtschaft zu suchen, um ein maßgeschneidertes Testament zu erstellen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Gerald
Geschrieben: 9.1.2024 – 10.1.2025
INHALTSVERZEICHNIS
1. Jugend und Krieg
2. Nach Amerika
3. Frei in Amerika
4.Nach Hollywood
5. Ludwig der II.
6. Ludwig der II. steigt ein
7. Ludwig der II. ist Chef
8. Ludwig II. allein
9. Der Plan
10. In Wels
11. Die Ergebnisse des Ahnenforschers
12. Beschleunigung
13. Die Verwandtschaft
14. Das Testament
1. Jugend und Krieg
Sie waren vier Brüder. Adolf, Leopold, Josef und der Jüngste, einer der zwei Helden unserer Geschichte, Ludwig. Ihre Heimat war Wels. Der Vater Ignaz war aus dem 1. Weltkrieg einbeinig zurückgekommen und konnte seinen Beruf als Eisengießer nicht mehr ausüben. Er erhielt eine kleine Rente, sah keinen Sinn mehr in seinem Leben und verfiel immer mehr in alles Mögliche, vor allem in die Sinnlosigkeit seines Daseins. 1919, im Geburtsjahr seines vierten Sohnes - Ludwig - starb er. Die Mutter Maria hat dann allein die Familie über Wasser gehalten, wobei der Wegfall ihres Mannes ihr Leben erleichterte. Da war ein Esser weniger. Und er war kein leichter Pflegefall, physisch wie psychisch. Sie starb 1929, als Ludwig 10 Jahre alt war. Der Älteste, Adolf war damals 18 und stand schon im Beruf. Der Zweite, Leopold war zwei Jahre jünger, der Dritte, Josef weitere zwei Jahre. Die Straße, in der sie wohnten, sie trug den schönen Namen Rosenauerstraße, war dem Verfall preisgegeben. Dort wohnten sie in einer armseligen Souterrain-Wohnung. Eigentlich konnte man das gar nicht Wohnung nennen. Es war ein großer Raum, der mit einer dünnen Wand geteilt war. Diese Trennwand war nur ein Holzgestell, das mit einem dicken geblümten Papier überzogen war. Wenn man sich dagegen gelehnt hätte, wäre man durchgebrochen. Zwei Drittel des Raumes waren Wohnraum und Küchenecke, ein Drittel, das hinter der Wand diente als Schlafstelle. Von Wand zu Wand reichte ein Brettergestell, auf dem einige Matratzen, Kopfpolster und Decken lagen. Die vier Burschen und die Mutter schliefen nebeneinander, bis 1919 auch der Vater, den sie allerdings immer öfter baten, draußen auf dem Sofa zu schlafen, weil er unter seinen Phantomschmerzen oft sehr laut stöhnte. Die Mutter ruhte etwas abgesondert in einer Ecke. Wenn sie am nächsten Tag früh aufstehen musste, schlief sie nach dem Tod ihres Mannes draußen im Wohnraum auf dem großen Sofa, um die Buben nicht aufzuwecken, wenn sie aufbrechen musste. Ihr Beruf als Waschfrau verlangte ein sehr frühes Aufstehen.
Die Bildungswege der Burschen waren höchst unterschiedlich und den wenigen Möglichkeiten, die sich Menschen wie ihnen boten, angepasst. Adolf ging bis zu seinem 18. Lebensjahr immerhin ins Gymnasium. Die Mutter konnte ihre Armut nachweisen, so bekam Adolf einen Freiplatz in der gebührenpflichtigen Schule. Leopold besuchte bis zu seinem 14. Lebensjahr die Bürgerschule, anschließend machte er eine Lehre als Verkäufer in einem Herrenmodegeschäft. Josef – Pepi genannt – absolvierte die achtklassige Volksschule und ging anschließend in eine damals noch sehr neue Lehre als Kraftfahrzeug-Mechaniker. Als die Mutter starb, war Adolf schon stellvertretender Fahrdienstleiter bei der Eisenbahn, den BBÖ, wie sich die Bundesbahnen Österreichs abkürzten. Er war der Hauptverdiener in der Vier-Männer-Familie. Leopold war schon Gewand-Verkäufer, auch er trug finanziell etwas bei. Pepi half mit seinem Lehrgeld. Ludwig, der Jüngste mit zehn Jahren musste durchgefüttert werden. Die Frau Ramseder, die im oberen Stockwerk, also genau genommen im etwas höheren Parterre wohnte und ebenfalls Kriegswitwe war, kochte manchmal für sie, das heißt, sie bekamen das, was bei Ramseders übrig blieb. Ludwig machte nach der Bürgerschule eine Lehre als Sattler, wo er lernte, Sättel, Zaumzeug, Kummet und anderes Fahrgeschirr wie Zügel und Riemen herzustellen. Die Brüder lachten ihn immer ein wenig aus wegen seiner eigenartigen Berufswahl. Mit 18 Jahren war er ausgelernter Sattler. In seiner ersten Zeit reparierte er zumeist kaputtes Zaumzeug, tauschte Sattelpolster aus, fettete Riemen ein, durfte aber auch schon den einen oder den anderen Sattel herstellen. Da nicht nur die Bauern, sondern auch das Militär und die Polizei Pferde hatten, war ziemlich viel zu tun. Er war zufrieden, ein Sattler mit Leib und Seele.
Die Brüder gingen bald ihre eigenen Wege und lebten sich auseinander. Adolf heiratete eine Beate, Leopold eine Emilie, Pepi eine Marianne, nur Ludwig war noch solo und wohnte nun allein in der Souterrain-Wohnung. Die anderen schufen sich eigene Domizile.
Im Jahr 1938 marschierten die Deutschen in Österreich ein, Österreich durfte es nicht mehr geben. Ostmark hießen sie jetzt.
Im Jahr 1939 wurden die Wege der Brüder gewaltsam getrennt. Sie wurden vom damals schon deutschen Militär eingezogen. Jeder der vier kam in eine andere Waffengattung. Ludwig hatte, so sagten die anderen, das große Los gezogen, weil er die Pferde der Parteibonzen zu betreuen hatte. Vorerst. Dem Drängen, für seine Freistellung vom Militärdienst Parteimitglied zu werden, hielt er stand. Anfang 1944 musste auch er an die Front, weil den Deutschen im Krieg die Luft auszugehen begann. Er kämpft zuerst irgendwo bei Orel in Russland, dann wurden sie in die Normandie verlegt, wo er bei der Invasion durch die Alliierten in amerikanische Gefangenschaft geriet. Sie waren immerhin mehr als 100.000 Männer. Jeder Kriegsgefangene erhielt sofort nach seiner Gefangennahme eine Postkarte, auf der er seinen Angehörigen Angaben über seinen Gesundheitszustand, aber nicht über seinen Aufenthaltsort machen durfte. Da Ludwig gar nicht wusste, wem er schreiben sollte, vergaß er die Postkarte. Den Kontakt zu seinen Brüdern hatte er verloren. Lediglich im Jahr 1943 erreichte ihn – noch in der Rosenauerstraße - eine Feldpostkarte von seinem ältesten Bruder Adolf, der aber nicht zu entnehmen war, wo er sich befand und wie es ihm geht. Die Karte besagte nur, dass Adolf noch lebte, jedenfalls an dem Tag, als er sie schrieb. Leopold und Pepi waren irgendwo.
Ludwig landete in einem der sogenannten Rheinwiesenlager in Deutschland. Der amerikanische Name dieser Lager – es gab mehrere - war Prisoner of War Temporary Enclosure, PWTE. Er kam in das Lager Bad Kreuznach, das am Rand der Stadt lag, unterhalb des sogenannten Galgenberges, deshalb hatte es auch den makabren Namen Lager Galgenberg. Die Kriegsgefangenen mussten ihre soldatische Feldausrüstung, auch Zelte und Decken abgeben, nur die bis zur Unkenntlichkeit dreckigen Uniformen durften oder mussten sie anbehalten. Mit der Bewachung der Lager war die 106. Infantry Division des amerikanischen Heers beauftragt, die mit der Leitung der Lager völlig überfordert war. Die Organisation überließen sie notgedrungen den deutschen Gefangenen, die interne Verwaltung der Lager und die Posten als Lagerleiter, Lagerpolizei, Ärzte, Köche, Arbeitskommandos etc. waren von Deutschen besetzt.
Ludwigs bemerkte erst jetzt, als er zur Ruhe gleichsam gezwungen war, dass die kurze Zeit seines militärischen Einsatzes ihm traumatische Erlebnisse beschert hatte. Bilder von grässlich zerfetzten Leichen verfolgen ihn, weit aufgerissene tote Augen, die gellenden Schreie der Verwundeten und das langsam leiser werdende Stöhnen der Sterbenden kriegte er nicht aus dem Sinn. Mit quälendem Schaudern malte er sich in schlaflosen Nächten aus, wie er das alles, was er gesehen hatte, daheim abarbeiten, vielleicht sogar vergessen wollte. Und daheim? In dieses Loch, in dem er aufgewachsen war, wollte er nicht mehr zurück. Er konnte sich das sogenannte normale Leben in seiner alten Umgebung nicht mehr vorstellen. Seine Brüder hatten schon eigene Familien, eigene Wohnungen, ein eigenes Leben, wenn sie überhaupt überlebt hatten. Wer weiß, welche Gräuel ihn daheim erwarteten. Vielleicht waren sie alle tot. Eines wurde ihm immer klarer, er wollte überall hin, nur nicht mehr heim. Er hatte Angst vor daheim.
Es sprach sich im Lager herum, dass die Amerikaner deutsche Gefangene nach Amerika verlegten. Angeblich füllten sie die Nachschub-Transportschiffe auf der Rückfahrt mit Gefangenen, um Leerfahrten zu vermeiden. Auch Ludwig hörte davon. Er hoffte inständig, mit einem dieser Transporte nach Amerika verlegt zu werden. Dort würde er sicher einen Weg finden, ein neues Leben zu beginnen.
Aber wie wollte er das anstellen? Zu den Transporten konnte man sich nicht melden, da wurde man wahllos wie ein Vieh einfach hineingetrieben. Da die Lagerleiter notgedrungen alle Deutsche waren, musste er sich bemühen, irgendwie in die Nähe der Amerikaner zu gelangen. Er übte ein wenig sein dürftiges Englisch und suchte nach einer Möglichkeit, mit einem von den Amis ins Gespräch zu kommen. Die Fraternisierung mit den Gefangenen war den Amerikanern aber verboten, wie sollte er da ein Gespräch beginnen?
Doch dann geschah etwas. War es ein Zufall? Ludwig wusste es nicht. Er suchte eine Latrine auf. Während er noch schiss, tauchte ein amerikanischer Soldat, sichtlich einer der höheren auf und befahl in kaum gebrochenem Deutsch, Ludwig solle sich im Lagerkommando melden, und zwar um Punkt 4 Uhr PM. Der Diensthabende würde ihn weiterführen. So schnell er aufgetaucht war, so schnell verschwand der Amerikaner auch wieder. Ludwig hatte noch gar nicht ausgeschissen.
Wieder zurück in seinem Quartier legte er sich auf die leise knarrende Pritsche und versuchte, das eben Erlebte zu ordnen. Er sollte sich im Lagerkommando melden. Offenbar bei den Amerikanern.Gut. Der Diensthabende würde ihn weiterführen. Wohin? Und wozu? Was hatte das zu bedeuten? Wenn jemand anderer gerade scheißen gewesen wäre, hätte es dann den getroffen? Oder war Ludwig gezielt derjenige, der sich melden sollte. Es war zwei Uhr, das grausige Mittagessen hatte er schon hinter sich – und zum Teil auch schon unter sich in der Latrine abgeliefert. Er verspürte eine leise Angst. Was geschah, wenn er nicht hinging? Dass er nicht verstanden habe, konnte er nicht als Ausrede gebrauchen, der Ami hatte deutsch gesprochen und Ludwig hatte genickt.
Fast hätte er das tägliche Antreten um drei Uhr versäumt. In größeren Blocks standen sie stramm, vor jedem Block stand ein Ami und brüllte irgendwas. Dann ging er weg, die Gefangenen aber mussten noch stehen bleiben. Nach etwa zehn Minuten kam der Ami wieder und brüllte „Abtreten!“, worauf sie wieder in ihre Quartiere wanderten. Ludwig aber war in Gedanken noch voll bei vier Uhr. Er überlegte, was er zu der geheimnisvollen Audienz anziehen solle, und musste achselzuckend grinsen, denn er hätte über seine ziemlich desolate deutsche Uniform nur den noch desolateren Mantel anziehen können, was sein Aussehen auch nicht verbessert hätte. Er musste schließlich nicht imponieren, er war ein Gefangener, der noch immer die Uniform trug, die er bei seinem letzten Einsatz getragen hatte.Einzig die Unterwäsche war gewaschen worden, für die Zwischenzeit bekamen sie hellgraue Boxerhosen.
Um zehn Minuten vor vier Uhr machte sich Ludwig auf den Weg. Er hatte jetzt Angst und schaute sich um, als würde er alles zum letzten Mal sehen. Der Sitz des amerikanischen Lagerkommandanten war eine niedrige Baracke mit einer Türe als Eingang, die aussah wie eine Wohnungstüre. Als er um die Ecke wanderte und sich der Türe näherte, kam, bevor er sie noch erreicht hatte, ein Soldat heraus. Ein fescher Kerl, fand Ludwig, der allerdings selbst auch sehr fesch war.Der Soldat winkte und zerrte ihn wie einen Delinquenten zu einer Nebenbaracke und hinein in einen Vorraum. Zwei Türen waren zu sehen. Der Soldat zeigte auf die rechte und deutete, Ludwig möge anklopfen. Dabei lächelte er ein wenig und ging wiegenden Schrittes wieder hinaus. Ludwig war in eine Art Fatalismus gefallen. Nun war er schon einmal da, die Vorgänge waren seltsam, aber er hatte keine andere Wahl. Er klopfte.
„Come in!“, erklang von drinnen.
Ludwig ging hinein und sah sich dem hinter einem kleinen Schreibtisch sitzenden Offizier von der Latrine gegenüber, der ihm, so schien es Ludwig, mit gespannter Erwartung entgegen schaute. Ludwig sah ihn jetzt genauer. Er mochte etwa 30 Jahre alt sein, hatte ein sympathisches rundes Gesicht und den amerikanischen Bürstenhaarschnitt. Zwei Sessel und ein kleines rundes Tischchen bildeten so etwas wie eine Sitzgarnitur. Links war noch eine Tür, die wohl in das Zimmer führte, dem die linke Türe des Vorraums gehörte. Ludwig las auf dem Namensschild auf der Uniform Colonel, den Namen konnte er nicht lesen. Der Colonel stand auf und deutete Ludwig auf einem der Sessel Platz zu nehmen. Jetzt sah Ludwig, dass er etwa gleich groß war wie er und sehr schlank, fast schlaksig. Er setzte sich auf den einen Sessel, der Colonel auf den anderen.
Die folgende Unterhaltung war ein Sprachgemisch aus deutsch und englisch. Der Colonel sprach leidlich deutsch, Ludwig ein wenig englisch.
„Schön, dass Sie gekommen sind“, begann der Colonel, wie Ludwig meinte, etwas schüchtern. Und per Sie, soweit das im Englischen erkennbar war. You. Das war nach dem ihn hereinführenden Soldaten nun schon der zweite auffallend fesche Mann, dem Ludwig begegnete.
Seine Antwort aber war sehr sachlich: „Sie haben es mir befohlen.“
Lächelnd schüttelte der Colonel den Kopf. „Befohlen! Wie das klingt. Ich habe Sie gebeten, mich zu besuchen.“
Ludwig aber blieb trocken: „Bei der Latrine. Ich mit hinuntergelassener Hose.“
Die Antwort war verblüffend: „Dort war die einzige Möglichkeit, unbeobachtet mit Ihnen zu sprechen.“
„Sie haben mir einen Befehl erteilt, das können Sie auch beobachtet tun. Sie sind der Boss.“
Der Colonel wand sich: „Sie wissen schon, dass das, was wir hier tun, verboten ist.“
„Ihnen ist es verboten, sich zu fraternisieren. Ich bin unschuldig. Sie haben mich hierher beordert – hier bin ich. Befehlsgemäß.“
Der Verlauf des Gesprächs passte dem Colonel sichtlich nicht. Er war sogar leicht verärgert: „Können Sie nicht versuchen, Befehl und Gehorchen wegzulassen?“
„Sie sind ein feindlicher Offizier, ich bin Ihr Gefangener. Sagen Sie mir, wie ich mit Ihnen reden soll.“
Ludwig wunderte sich über sich selbst, aber er hatte den deutlichen Eindruck, die Oberhand zu haben. Was wollte der Typ von ihm!
Der Colonel schlug einen anderen Ton an: „Nehmen wir einmal an, Sie sind ein Mensch und ich bin ein Mensch. Ganz einfach.“
„Sie wissen genau, beim Militär kommt der Rang vor dem Menschen. Ich habe keinen Rang.“
„Und ich lege meinen hiermit ab. Sind Sie jetzt zufrieden?“
Ludwig atmete tief durch: „Ok, Mister…“
„Cameron, Steve Cameron. Und Sie, Herr …“
„Sie haben mich doch auf der Liste …“
„Bitte geben Sie das Spiel auf. Herr …“
„Gismayer. Ludwig Gismayer.“
Der Colonel seufzte erleichtert: „Ok, Ludwig.“
Ludwig war noch immer mutig: „Ok, - - Steve!“
„Na also“, stellte der Offizier fest, als hätte er das erreicht, was er erreichen wollte.
Ganz begriff Ludwig die neue Situation nicht. Er zögerte: „Ok – Steve, warum hast du mich hierher – „
„Gebeten!“, ergänzte der Colonel.
„Ok. Warum?“
„Vielleicht“, der Ami zögerte, dann nahm er sich einen Anlauf, „weil ich angesichts dieses Krieges hin und wieder auch was Gutes tun möchte.“
Jetzt war Ludwig überrascht: „Mir? Ausgerechnet mir?“
„Ja, ausgerechnet dir!“ Der Colonel sagte das sehr fest, seht bestimmt.
Ludwig sah seine Oberhand schwinden.
Vorsichtig sondierte er: „Ausgerechnet. Hast du dir mich ausgesucht? Wir sind hier im Lager einige Tausend Mann …“
„Und?“
„Naja …“ Pause. Die beiden schauten einander abwartend und ein wenig kontrollierend an.
Der Colonel brach das Schweigen: „Hast du einen Wunsch?“
„Was?“, klang es entsetzt.
„Du wirst doch einen Wunsch haben.“
„Ja. Ich will raus hier.“
Der Colonel nickte verständnisvoll: „Nach Hause.“
Ludwig erschrak. Genau das wollte er nicht. Er wollte wo anders hin.
Jetzt lag die Unsicherheit aufseiten des Amis: „Nicht nach Hause?
Wo anders hin?“
Ludwig hatte Angst, sich lächerlich zu machen: „Nach Amerika.“
Das Staunen des Colonels war groß: „Nach Amerika?“
Er schüttelte ratlos den Kopf: „Und wie stellst du dir das vor?“
„Na mit einem dieser Schiffstransporte, die ihr dauernd hinüberschickt.“
„Du bist gut informiert. Und drüben?“
Ludwig zuckte hilflos mit den Achseln.
Der Colonel verstand: „Willst du abhauen.“
Sich der Sinnlosigkeit bewusst nickte Ludwig. Wahrscheinlich hatte er jetzt sowieso alles verdorben.
Der Colonel antwortete sehr ruhig: „Das mit einem Transport ist gar nicht so einfach.“
Ludwig nickte hoffnungslos ergeben.
„Lass mich ausreden! Vielleicht gibt es einen Weg.“
Das Lächeln des Colonels, als er das sagte, fand Ludwig höchst eigenartig.
Der Ami stand auf und bat seinen Gefangenen: „Komm mit Ludwig.
Ich zeige dir was.“
Ludwig stand auf. Der Colonel ging auf die Seitentüre zu, bat Ludwig, hineinzugehen, Ludwig ging hinein, der Colonel folgte ihm, schloss die Türe, drehte Ludwig zu sich her und küsste ihn auf den Mund.
Ludwig war starr vor Schreck und wehrte sich nicht. Aus den Augenwinkeln sah er nur ein großes Doppelbett. Ein Liebesnest? Ein perverses?
Der Colonel löste langsam den Kuss und zeigte sofort Verständnis:
„Nicht alles auf einmal. Kommst du morgen um Punkt vier Uhr wieder? Dann weiß ich vielleicht einen Weg, wie du nach Amerika kommst. Jetzt geh! Du kannst gleich die direkte Türe benützen.“
Ludwig ging wortlos, das feuchte Gefühl auf seinen Lippen trug er mit sich. Draußen wartete grinsend der Soldat, der ihn hergebracht hatte, sagte „Sorry“ und packte Ludwig, als wollte er ihn abführen.
Vor der Hauptbaracke war kein Mensch zu sehen. Er ließ Ludwig los, gab ihm einen leichten Stoß und murmelte „Go! Tomorrow!“
Ludwig hatte in seinem Hirn einiges zu klären. Steve – er nannte ihn in seinem Gedanken schon so – wollte Liebe mit ihm machen. Sex.
Als Kaufpreis für Amerika? Was war das jetzt? Erpressung? Ehrliche Wunscherfüllung für ein bisschen Liebe? Ein bisschen Liebe? Ludwig war nicht homosexuell. Er wusste auch gar nicht, was und wie es die Homosexuellen trieben, wenn sie Sex machten. Irgendwer hatte einmal von Hinten gesprochen. Das andere kannte er, seine zwei Freundinnen, die er bisher hatte, hatten ihn mit ihrem Mund befriedigt. Seine derzeitigen Sexgelüste erledigte er mit gelegentlichem Selbermachen. Und jetzt das! Steve Cameron. Colonel der US-Army.
Ein Warmer. Und wenn Ludwig sich ihm zur Verfügung stellte, dann … Ja, was dann? Der Ami hatte alle Möglichkeiten offen. Zuerst benützte er Ludwig, und dann vergaß er ihn. Das war die Variante, wenn Ludwig von einem anderen Menschen schlecht dachte. Vielleicht aber war Steve – schon wieder nannte er ihn so – ein guter Mensch, ein ehrlicher. Amerika. Ludwig wusste nicht ein und aus.
Den Abendfraß überlebte er, er legte sich bald schlafen, die zehn anderen in seinem Quartier waren ihm sowieso egal. Amerika überwog, er schlief gut.
Der nächste Tag war noch immer voll von Gedanken. Amerika.Steve Cameron. Ludwig Gismayer. Er war 26 Jahre alt. Steve schätzte er auf knapp 30. Er war ein fescher Kerl. Braune Haare, soweit Ludwig es bei dem Kurz-Haarschnitt ausnehmen konnte, braune Augen, gleich groß wie Ludwig, etwa 1,80, sie waren auf gleicher Höhe gewesen beim Kuss. Der Kuss. Das war nicht ein Busserl, das war ein richtiger Schlecker wie mit der – den Namen der Freundin hatte er vergessen. Ludwig erschrak, er taxierte Steve genauso, wie er ein Mädchen taxiert hätte. Er schüttelte sich. Innerlich. Aber warum schüttelte er sich? Was war denn schon dabei, wenn er mit Steve – ja was? - Sex? Liebe machte? Liebe? Das war zu viel verlangt.Sex? Ja. Wenn es sein musste. Amerika. In seinem Quartier, die zwei auf Platz neun und zehn in der Ecke schlüpften immer zueinander, wenn das große Licht ausgeschaltet war und nur das Nachtlicht brannte. Ludwig hatte sie gesehen, wie sie verkehrt aufeinander lagen. Eine Freundin hatte das die 69er-Stellung genannt. Er hatte aber auch den Neuner auf dem Zehner sitzen und wippen gesehen. Wie ungeniert die es miteinander trieben! Aber niemand beachtete sie.Das finale Keuchen unterdrückten sie, obwohl das gar nicht notwendig gewesen wäre, denn wenn einige von den anderen onanierten stöhnten sie ja auch, wenn es ihnen kam. Ludwig musste aufpassen, es war Vormittag und er war erregt. Sehr sogar. So sehr, dass er sehr stark sein musste, um nicht Hand an sich zu legen. Aber das ging denn doch nicht. Was zum Teufel machte ihn so geil? Steve? Nein, Amerika. Aber der Weg nach Amerika führte über Steve. Über Steve, Ludwigs Fantasie drohte zu entgleisen. Über Steve? Oder unter Steve?
Sein Denken wurde unterbrochen, er musste sich in die Schlange einreihen, den Mittagsfraß zu holen. Dann hatte er eine Stunde Küchendienst, er musste die Fressnäpfe in dreckiges Wasser tunken, was die Deutschen Abwasch nannten. Die Küchenchefs waren alles Deutsche, weil die Amis die niedrigen Arbeiten von den Gefangenen verrichten ließen. Lassen mussten, hatte er wo gehört, weil sie nicht genügend Personal hatten. Um drei hatten sie Antreten. Und um vier… Wenn der nette Steve ihm Amerika nur vorgaukelte, um den dummen Ludwig zum Sex zu kriegen? Ludwig fasste einen Entschluss.Er wollte abwarten. Für Amerika war das, was Steve von ihm wollte, ein niedriger Preis. Das konnte er sich gerade noch leisten.Um vier – dasselbe Spiel wie gestern. Der Diensthabende geleitete ihn wie einen Häftling in die andere Baracke. Der Soldat wackelte ein wenig mit dem Hintern, Ludwig dachte, warum nimmt sich Steve nicht den Burschen? Ein wenig Herzklopfen hatte er schon, als er nach Steves „Come in“ das Büro betrat. Steve strahlte über das ganze Gesicht, sprang auf und gab Ludwig einen kurzen Begrüßungskuss.Er trug nicht die strenge Uniform von gestern, sondern war im Hemd, das er vorne drei Knöpfe weit offen hatte und eine zart muskulöse unbehaarte Brust zeigte.
Ludwig leistete sich sogar ein wenig Humor. Er salutierte und meldete: „Prisoner Gismayer meldet sich zum Dienst!“
Steve lachte: „Dienst? Es soll dir nichts Schlimmeres passieren.“
Er hängte sich bei Ludwig ein und zog ihn ins Nachbarzimmer. „Auf ins Brautgemach!“, flüsterte er fröhlich. Im Zimmer setzte Steve sich sogleich auf den Bettrand, zog den stehenden Ludwig zu sich, sodass er mit seinem Gesicht auf gleicher Höhe war wie Ludwigs Unterleib.
Er nestelte an Ludwigs dreckiger Uniformhose herum, und lachte: „Mit deutschen Uniformen kenne ich mich nicht aus. Hilf mir!“ Ludwig fand sich in der seltsamen Situation, für seine Demütigung selbst aktiv werden zu müssen. Als er mit der Uniformhose bei den Knien in seiner hellgrauen amerikanischen Boxerhose dastand, wurde ihm heiß. Steve zog die Hose langsam hinunter, stöhnte auf, als er erblickte, was da auftauchte und, wie Ludwig erstaunt feststellte, sehr bereit war. Dann hatte Steve plötzlich ein feuchtes Tuch in der Hand, mit dem er Ludwigs mittlerweile sehr angewachsenes Ding reinigte.
Steve hatte sein eigenes ausgepackt, das steil nach oben stand, und besorgte es sich selbst, während er Ludwig oral bediente. Der war, wie man bei ihm daheim sagte, überstandig und warnte stöhnend: „Vorsicht, ich komme gleich!“
„Ich auch“, verkündete Steve und arbeitete sofort weiter an Ludwigs Erlösung, die gleichzeitig mit Steves Entladung erfolgte.
Schreckstarre war in Ludwig. Was kommt jetzt?
Nichts kam. Steve sagte nur: „Danke. Du warst sensationell.“
Ludwig nickte. Er erinnerte sich, dass auch seine Freundinnen sehr zufrieden mit ihm waren.
„Und du hast es genauso nötig gehabt wie ich!“
Ludwig nickte wieder und löste sich langsam. Noch immer stand er gleichsam im Freien, die Hose bei den Knien.
„Zieh dir die Hose hinauf, dass du nicht hinfällst“, lachte der Colonel.
Ludwig schämte sich. Die Situation war ihm jetzt plötzlich peinlich.
Steve aber hatte das Kommando: „Wasserleitung haben wir keine.
Komm!“
Er stand auf und führte Ludwig zu einem blechernen Waschtisch mit einem Lavoir. Daneben stand ein großer Krug mit Wasser. Ein Waschlappen hing auf einem Handtuchhalter, und ein Handtuch, das eher ein Geschirrtuch war. Steve schüttete Wasser in das Lavoir. Sie wuschen jeder liebevoll den anderen, dabei sah Ludwig, dass Steve beschnitten war.
„Bist du ein Jud?“, fragte er.
Der Colonel klärte ihn auf, dass in Amerika die Männer fast alle beschnitten seien. „Und Jude bin ich nicht“, vervollständigte er die Auskunft.
Während sie sich restaurierten, fragte Steve: „Wenn ich Jude wäre, hättest du dich dann geweigert?“
„Ist mir sowas von wurscht“, knurrte Ludwig.
„Was ist wurscht?“
Ludwig lächelte: „Ach so. Egal.“
„Du bist doch Deutscher.“
„Erstens bin ich Österreicher und zweitens ist nicht jeder von uns gegen Juden.“
„Aha“, nickte der Colonel, „wurscht nennt man das.“
Jetzt lachten sie beide und gingen wieder nach nebenan in das Büro, wo sie sich in die Sitzecke setzten.
„Was zu trinken?“, bot der Gastgeber an und ergänzte heiter anzüglich: „Ich muss nämlich was hinunterspülen!“
Ludwig lächelte auch und bekam einen roten Kopf.
Während Steve aus einer unteren Lade seines Schreibtisches eine Flasche Whisky und zwei Wassergläser holte, sagte er fast liebevoll: „Ich finde es schön, dass einer mit 20 Jahren noch erröten kann!“
„26“, korrigierte Steve.
„Entschuldige, ich habe das Datum in deiner Akte gesehen, aber nicht nachgerechnet.“
„Bist du jetzt enttäuscht?“, fragte Ludwig, der gleichzeitig vermerkte, dass Steve sich mit seiner Akte beschäftigt hatte. War das ein gutes Zeichen?
Der Colonel schaute Ludwig sehr lieb an: „Enttäuscht? Nach dem, was wir gerade erlebt haben, bin ich nicht enttäuscht, sondern voller Hoffnung.“
Er hatte mittlerweile je drei cm hoch in jedes Glas eingeschenkt.
„Leider warm, Eis habe ich nicht. Cheers!“
Ludwig nahm sein Glas und sagte: „Prost!“
Steve stutzte kurz, dann tranken sie jeder einen Schluck.
Ludwig fasste Mut: „Ich bin auch voller Hoffnung.“
Der Colonel nickte: „Ich weiß. Amerika. Ich habe Verbindung aufgenommen mit dem zuständigen Officer. Es schaut gut aus. Er sondiert noch, wie wir dich rauskriegen.“
Dann lächelte Steve: „Aber es wird einige Zeit dauern. Du musst mich also noch ein wenig ertragen.“
So schlimm wars gar nicht, dachte Ludwig. Er nickte: „Ich bin dir sehr dankbar.“
Der Colonel wurde sachlich, als er fragte: „Dann bis morgen? Um vier?
Ludwig nickte.
Das ging so etwa drei Wochen, auch Samstag. Aber nicht am Sonntag. Religiöse Gründe, die Steve nicht näher erklärte, erlaubten ihm Sex am Sonntag nicht. Ludwig war nicht böse über die Pause. Ihre sexuellen Aktivitäten verliefen so, dass Ludwig dabei nicht beschädigt wurde. Er musste Steve von hinten hinein, aber der wollte das nie von Ludwig, wofür der sehr dankbar war, denn er konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, wie es wäre, wenn ihm ein Mann von hinten eindränge. Steve nannte auch hygienische Gründe.Klar. Sie hatten sich auf einer Latrine kennengelernt. Und Amerika?
2. Nach Amerika
Eines Tages im kalten und nassen November teilte ihm Colonel Steve Cameron strahlend mit: „Am 8. Dezember startest du in Liverpool.“
Ludwig war perplex: „Nach Amerika?“
„Nach New York.“
„Und warum Liverpool? Das ist doch in England.“
„Einer von den Liberty-Frachtern, die Nachschub aus den USA bringen und leer zurückfahren müssten. Daher benützen wir sie auf der Rückfahrt für Gefangenentransporte.“
Das wusste Ludwig schon, aber jetzt klang es so bedrohlich, er erschrak sichtlich.
Steve sagte mit einer hilflosen Geste: „Noch bist du Deutscher in amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Anders kann ich dir nicht helfen.“
„Und wie komme ich nach Liverpool?“
„Mit einem Gefangenentransport.“
„Mit anderen Gefangenen?“
„Ja. Ich sagte es schon, anders gehts nicht.“
„Und wenn ich in New York ankomme?“
„Das ist alles genau festgelegt. Tu einfach, was die dort wollen. Es bleibt dir sowieso nichts anderes übrig.“
Jetzt, da die Erfüllung seines Wunsches sich anschickte, real zu werden, hatte Ludwig plötzlich Angst: „Und dann?“
„Ich finde einen Weg. Was bist du von Beruf?“
„Sattler.“
Steve notierte auf dem vor ihm liegenden Akt: „Saddler. Das wird nicht schwer sein.“
Ludwig wunderte sich, weil Steve so viel Optimismus ausstrahlte:„Also ich weiß nicht …“
„Ludwig, dann bist du in den USA. Dort findet sich ein Weg.“
In der folgenden Woche war Ludwig hauptsächlich damit beschäftigt, seine Angst in Zuversicht umzudenken.
Anfang Dezember überraschte Steve nach dem Sex den sich eben waschenden Ludwig: „Jetzt heißt es Abschied nehmen. Heute ist Samstag, morgen, Sonntag sehen wir uns nicht. Am Montag startet dein Transport nach Liverpool.“
Ludwig wunderte sich: „Du bist so fröhlich! Ich habe nur Angst.“
Der Colonel beruhigte: „Der Krieg ist demnächst zu Ende. Wir sehen uns in den USA wieder.“
Steve gab Ludwig seine USA-Adresse und seine dortige Telefonnummer. „Seattle. Melde dich auf jeden Fall. Wo ich dich finde, weiß ich ja, ich habe deine Akte.“
Jetzt sprang der Colonel auf Steve zu, umarmte ihn und weinte in seine Schulter hinein. Dann stieß er Ludwig zur Türe hinaus und schlug sie hinter ihm zu.
Der abführende Diensthabende sagte nur: „Finish“, führte seinen Gefangenen wie immer ab und entließ ihn dann mit: „Bye, bye, darling!“
Am Morgen des 8. Dezember wurde Ludwig aufgefordert, zusammenzupacken und sich auf den Appellplatz zu begeben. Er hatte schlecht geschlafen. Albträume quälten ihn, die Schiffsreise, Amerika, die Sprachschwierigkeiten, alles flog durcheinander und verflocht sich, verknäuelte sich. Sehr müde schulterte er in der Frühe den Sack mit seinen paar Habseligkeiten. Die anderen Quartierinsassen ignorierten ihn. Kein Abschied. Er wanderte auf den großen Platz, auf dem zwei mit Plachen bespannte Lkws warteten. Es war nasskalt, die Kälte zog sich schon jetzt in seine Uniform hinein. Immerhin hatte er wenigstens noch den Mantel. Etwa 50 oder 60 andere deutsche Soldaten warteten schon, sie mussten in einer langen Reihe antreten. Ein Ami-Offizier verlas von einer Liste die Namen, der jeweils Aufgerufene musste mit Yes antworten. Ludwig verstand vorerst seinen Namen nicht, Gismayer sprach der Officer Scheismeidscha aus, am Vornamen Ludwig erkannte er sich und brüllte schnell sein Yes. In zwei Gruppen wurden sie in die zwei Lkws mit Längsbänken gesetzt und ab ging die Fahrt.
Von Bad Kreuznach fuhren sie etwa sieben Stunden lang mit zwei streng bewachten Pinkelpausen in den Hafen von Ostende. Dort wurden sie in eines der Landungsboote getrieben, das kein Dach und keine Sitze hatte, wie eine Schachtel ohne Deckel. Es war sehr eng, sie setzten sich auf den Boden, die Wand entlang, dicht aneinandergedrängt, sodass sie einander ein wenig wärmten. Keiner redete, sie zogen dahin wie stumme Zombies. Ludwigs Hoffnung war einem Fatalismus gewichen, es war ihm alles egal.
Die Überfahrt nach Dover dauerte über zwei Stunden. Einige Gefangene mussten sich übergeben. Drüben angekommen wurden sie von Bord und in ein Gebäude getrieben, das im Untergeschoss einen großen Saal hatte, in dem Pritschen standen. Vorerst aber wurden sie durch einen Nebenraum geleitet, in dem es Erdäpfeleintopf und Wasser gab. Die Toiletten waren nur für die Notdurft eingerichtet, Waschen war nicht möglich. Ludwigs Fatalismus verhalf ihm zu einem guten Schlaf. In aller Herrgottsfrühe wurden sie durch gebrüllte Befehle geweckt, bekamen im Nebenraum jeder einen Becher mit einer Flüssigkeit, die die Farbe von Kaffee hatte, aber wie Tee schmeckte.Egal, es war warm. Dazu aßen sie etwas, das in Ludwigs Augen wie ein Krapfen aussah, aber salzig schmeckte. Egal, er hatte was im Magen. Wieder warteten zwei Plachen-Lkws, diesmal englischer Herkunft, wieder wurden sie namentlich aufgerufen, wieder erklommen sie die Lkws und setzten sich auf die Längsbänke. Alles wiederholte sich. Sie waren wieder etwa sieben Stunden unterwegs, hatten zwei Stopps für Pinkeln unter Bewachung, irgendwann am Nachmittag endete die Reise und sie wurden wieder hinausgetrieben. Ludwig sah, dass sie jetzt eindeutig in einem Hafen angelangt waren. Liverpool.Vermutete er. Einer von seinen Sitznachbarn bestätigte: „Det is Liverpool.“ Woher er es wusste, war nicht klar, denn nirgends war eine Tafel oder Aufschrift zu sehen. Die Unterkunft war zum Unterschied von der vorigen – Ludwig hatte schon vergessen, wo das war – komfortabel. In dem großen Turnsaal standen zwar auch nur ausreichend Pritschen, aber der Saal war geheizt, sie konnten sich von ihrer Kleidung etwas erleichtern. Ludwig zog Mantel und Jacke aus. Dabei stellte er fest, dass er stank wie ein Büffel. Aber Waschgelegenheit war auch hier keine. Das Essen war noch etwas grauslicher als das vorige, Ludwig vermutete, dass es sich um eine Art gekochte Rüben handelte, dazu ein Stück Brot, für das man gute Zähne brauchte. Aber auch hier schlief er gut. Das Frühstück bestand aus Tee und einer Scheibe Brot, das von gestern übriggeblieben sein dürfte, denn es war noch ein wenig härter. Nach abermaligem Verlesen ihrer Namen wurden sie auf eine Mole hinausgeleitet. Dort wartete die Überraschung, denn eine große Zahl deutscher Soldaten war schon da. Sie waren wohl mit anderen Transporten aus anderen Lagern gekommen. Das Schiff, mit dem sie reisen sollten, war ein Frachter. Die Ladeflächen unter Deck waren in mehrere Räume für jeweils etwa 80 bis 100 Mann unterteilt. Wie viele Räume und wie viele Gefangene sie insgesamt waren, wusste Ludwig nicht. Seine Gruppe wurde in einen der Räume eingewiesen, wieder erwarteten sie Pritschen, hier allerdings mussten sie sich für längere Zeit einnisten.
Ludwig erinnerte sich später mit Schaudern an diese Reise. Es war sehr eng. Die Pritschen waren teilweise übereinandergestapelt wie Stockbetten. Die vorhandenen Toiletten und Waschgelegenheiten waren meist überlastet, es gab lange Warteschlangen, manche Kameraden schissen sich während des Wartens schon an. Das Wachpersonal passte sehr auf und desinfizierte immer wieder alles, um die Ausbreitung von Krankheiten zu vermeiden. Die Ernährung war sehr einfach, sie bestand aus Eintöpfen, Konservenfleisch, Brot und Erdäpfeln. Da aufgrund der Kriegslage nicht klar war, wie lang die Reise dauern würde, musste die Nahrung gestreckt und das Trinkwasser rationiert werden. Etwa jeden dritten Tag durften sie streng bewacht ein wenig an Deck, um frische Luft zu bekommen. Ludwig fand die strenge Bewachung reichlich überflüssig – wohin hätten sie denn flüchten sollen? Die Wetterbedingungen waren zumeist schlecht. Das Schiff schaukelte, einige übergaben sich, aber das Wachpersonal sorgte immer sofort für halbwegs Reinlichkeit. Vermutlich hatten auch sie Angst vor dem Ausbruch von Krankheiten. Unter Deck war die Luft entsetzlich schlecht, Zigarettenrauch, Schweiß und der Duft der Toiletten und der Desinfektionsmittel ergaben eine grausige Mischung. Einige Mitreisende rasteten aus. Sie hatten Angst wegen der möglichen deutschen U-Boot-Angriffe.
Aber was blieb den Gefangenen übrig? Sie mussten es aushalten.
Ludwig hatte jedes Zeitgefühl verloren. Erst nach seiner Ankunft in den USA stellte er fest, dass die Überfahrt 21 Tage gedauert hatte. 21 Tage in der Hölle. Ludwig wurde viele Jahre später noch schlecht, wenn die Erinnerung zumeist in der Nacht in ihm auftauchte.
Das einzig Positive, das er von dieser Horror-Reise mitbrachte, waren gute Englischkenntnisse. Sein Pritschennachbar hatte ein Lehrbuch für das amerikanische Englisch, das sie fleißig studierten und alle Übungen machten, indem sie sich gegenseitig abfragten. Sie hatten sogar Gemeinsames gefunden. Der Pritschennachbar war Englischlehrer im Gymnasium im oberösterreichischen Freistadt, allerdings musste auch er das amerikanische Englisch erst lernen. Ludwig erzählte ihm, dass er gelernter Sattler sei. Der Professor freute sich und sagte, er reite sehr gern. Wenn sie allerdings in ihrer Situation an Amerika dachten, dämpfte sich ihre Freude wieder.
Mit Erleichterung stellte er fest, dass in New York alles etwas freundlicher herging. Ludwig präzisierte später seine Wahrnehmungen, es ging sachlicher her, einfach korrekt. Sie wurden von Militärpersonal empfangen, von dem sogar manche ein wenig Deutsch konnten. Die militärischen Ausdrücke waren ihnen geläufig, die Befehle und ein paar Fachausdrücke. Bevor sie noch registriert wurden, schickte man sie in eine Art chemische Reinigung, Desinfektion und Entlausung. Zu dem Zweck wurden ihre Kopfhaare abgeschoren, auch die Achselhaare und die Schamhaare mussten weg. Ihre Identifikationsnummern brachten die Gefangenen mit, sie blieben auch in Amerika gleich. Die anschließende medizinische Untersuchung glich der wie bei einer Musterung. Sie mussten sich nackt ausziehen, wurden abgehorcht, abgetastet, in die Eier wurden ihnen gegriffen und den After inspizierten sie. Ihre Uniformen und ihre gesamte Unterwäsche wurden ihnen abgenommen und vermutlich verbrannt. Sie bekamen eine Art Einheitskleidung, bestehend aus einer Jacke und einer Hose in der Farbe Olivgrün. Alles war aus sehr robusten Stoffen. Feste Schuhe, einfache Unterwäsche, Socken, Hygieneartikel – Seife, Zahnbürste und Rasierer. Auch Winterkleidung war vorgesehen. Und eine Kopfbedeckung. Alles in allem fand Ludwig die Ausrüstung zufriedenstellend. Auf jedem Kleidungsstück waren die Buchstaben PW (Prisoner of War) aufgedruckt, sogar auf den Unterhosen und Socken.
Das dauerte ganze vier Tage, an denen sie zwar auch auf Pritschen, aber gut und geheizt untergebracht waren. Auch die Verpflegung war ausreichend, Ludwig schmeckte manches sogar. Am fünften Tag begann das, worauf Ludwig besonders neugierig war, die Aufteilung in Lager. Nach welchem Schlüssel oder nach welchen Kriterien die Gefangenen in welches Lager geschickt wurden, konnte er nicht erkennen. Es hatte aber den Anschein, dass da kein Plan dahintersteckte, sondern dass ganz einfach die verschiedenen Lager gleichmäßig gefüllt wurden.
Ludwig kam erst sehr spät dran. Es war alles wie bei den anderen. Er wurde aufgerufen, nach seinem Beruf gefragt – Saddler – und dann zugeteilt.
Da aber kam die Abweichung: Ein beisitzender Officer sagte plötzlich: „Just a moment!“, und schob das vor ihm liegende Papier zu dem zuteilenden Beamten. Der schaute kurz, wackelte mit dem Kopf, schaute Ludwig, wie der meinte erstaunt an und sagte: „Fort Lawton!“, gab Ludwig das Zuweisungspapier und murmelte noch „An intervention.“ Ludwig verstand nicht und sagte ein typisch österreichisches „Ha?“. Der Beamte sagte etwas lauter „An order!“, wobei er mit dem Zeigefinger nach oben deutete. Mit „Good luck!“, deutete er ihm weiterzugehen. Ludwig hatte sich die Worte order und good luck gemerkt und fragte den Englischprofessor, der irgendwohin nach Texas eingeteilt war, was die beiden Worte genau bedeuteten. „Eine Anordnung und viel Glück“, lautete die Übersetzung. Der Professor fügte noch an. „Oder: hast a Massel gehabt.“
„Massel?“
„Hast Glück gehabt.“
Dann hakte der Professor aber doch nach: „Hast du einen Anschieber in Amerika?“
Ludwig verstand nicht sofort.
„Ich meine einen, der dir eine Sonderbehandlung verschafft?“
Colonel Steve Cameron. Der warme amerikanische Gespiele aus Bad Kreuznach fiel ihm ein, sein Latrinenfreund. Dort wird sich ein Weg finden, hatte er gesagt. Und wo du bist, weiß ich ja. Sollte Steve einen so starken Einfluss haben? Der Officer hatte bei Order nach oben gedeutet. Steht ein Colonel über – ja wem? Ludwig wusste nicht, welchen Rang das Empfangspersonal hatte. Steve war sicher noch in Europa. Wie auch immer, Ludwig tappte im Dunkeln und hoffte nur, dass diese Sonderbehandlung, wie der Professor es genannt hatte, nichts Negatives bedeutete. Sonderbehandlung hatte bei den Deutschen nämlich nichts Gutes verheißen.
Mit noch etwa 20 anderen wurde Ludwig unter Bewachung in einem Armee-Bus zu einem Bahnhof gebracht, dort wurden sie, immer streng bewacht, in einen Zug gesetzt. Fort Lawton lag an der Westküste, es ging also quer durch ganz Amerika. Die Reise dauerte vier Tage. Sie mussten nicht umsteigen, sondern wurden immer an einen anderen Zug angehängt. Nach der Ankunft in Seattle stiegen sie um in einen Armee-Bus und wurden in das Lager gebracht.
Seattle? Ludwig erinnerte sich, Colonel Steve Cameron lebte in der Stadt, wenn er da war. Aber er war sicher noch in Europa. Etwa acht Meilen waren es vom Lager bis nach Seattle. Ludwig begann sich an die hier üblichen Meilen zu gewöhnen. Schließlich wollte er ein guter Amerikaner werden. Aber vorerst war er nur Gefangener, deutscher auch noch dazu. Fort Lawton war ein ehemaliger Militärstützpunkt, daher waren die Unterkünfte recht komfortabel. Maximal 10 Gefangene hausten in einem Zimmer, die Pritschen waren bequem, und vor allem die sanitären Anlagen waren nach langer Zeit total in Ordnung. Verpflegung, Unterkunft, medizinische Versorgung und sogar Freizeitaktivitäten und eine Grundversorgung, die – so interpretierte es Ludwig später – genau den Regeln der Genfer Konvention entsprachen. Und sie mussten arbeiten. Für Ludwig als Saddler hatten sie keine Verwendung, er musste den Garten betreuen, sowohl den Gemüsegarten als auch den Garten, der für die Freigänge vorgesehen war, ebenso das Sportgelände und die dortigen Kabinen und Duschen. Als Lohn erhielten sie Lagergeld, mit dem sie in den Lagerläden einkaufen konnten. Ludwig liebte Schokolade … Sein Fazit: Es ging ihm gut, er war in Amerika, aber er war nicht frei.Ende Mai 1945, der Krieg war seit drei Wochen mit der Kapitulation Deutschlands beendet, drohte neues Ungemach. Es sprach sich im Lager herum, dass die Gefangenen nach und nach repatriiert werden sollten, was so viel hieß wie nach Hause geschickt. In Ludwig keimte Verzweiflung auf. Die ganze Tortur, Transporte, Schifffahrt, Kälte, Nässe, grausiges Essen, ganz abgesehen davon, mehrere Wochen lang ungewaschen leben zu müssen – das alles sollte umsonst gewesen sein? Steve hatte ihn da hineingeritten, der schwule Colonel, dem er für Sex zur Verfügung stehen musste. Ludwig graute, wenn er an seine schwule Epoche dachte, die nichts anderes als Erpressung war.Und er Trottel war darauf hineingefallen. Er hätte doch ahnen müssen, dass sich ein amerikanischer Offizier einen feschen Burschen aussuchte, um seine Sexualität bedienen zu können. Allerdings hatte es Steve geschafft, ihn nach Amerika zu bringen. Und der Wink von oben, den der aufteilende Officer angedeutet hatte? War das Steve?Fort Lawton lag wie gesagt nur acht Meilen von Seattle entfernt. Und Steves Adresse, die er ihm gegeben hatte, lag in Seattle. Er hatte auch eine Telefonnummer, aber Briefe schreiben war möglich, telefonieren nicht. Einen Brief wollte er nicht schreiben, dazu reichte sein Englisch nicht aus. Sprechen ging, aber schreiben … Wieder vergingen einige Wochen, als Ludwig drankam. Er wurde außer der Reihe in ein Büro gebeten, klopfte an – und es wurde ihm heiß. „Come in!“ Die Stimme. Ludwig trat ein und sah sich Steve gegenüber.
„Endlich“, rief der Colonel, sprang auf Ludwig zu, umarmte ihn und küsste ihn. Ludwig reagierte wie beim ersten Mal in Bad Kreuznach, er war starr und wehrte sich nicht.
Steve schüttelte ihn ungeduldig: „Na? Freust du dich nicht? Komm tu mit!“ und küsste ihn wieder. Aber Ludwig kam ihm nur halbherzig entgegen.
Steve bemerkte das und meinte: „Na klar! Nach dem, was du alles durchgemacht hast, muss sich der Krampf erst lösen.“
Ludwig nickte und musste sich gar nicht bemühen, einen gedrückten Eindruck zu machen.
„Mein armer Ludwig!“, sagte Steve und er hatte Tränen in den Augen. „Aber das wird sich jetzt schnell alles ändern.“
Langsam fasste Ludwig Fuß: „Was soll sich ändern? Ich bin Gefangener und werde nach Hause zurückgeschickt. Ihr Amerikaner seid eben sehr korrekt!“
Steve lachte: „Sei ganz beruhigt. Ich habe dich übernommen.“
Misstrauisch fragte Ludwig: „Übernommen? Was heißt das?“
Jetzt platzte die Bombe: „Du bist frei. Aber ich habe die Verantwortung über dich. Du wohnst bei mir.“
Atemlosigkeit herrschte in Ludwig: „Und wo werde ich arbeiten?“
„Zuerst bekommst du eine vorläufige Arbeitserlaubnis, die dann, wenn du einen Job hast, in eine unbefristete übergeht.“
Ludwig starrte seinen Wohltäter an: „Und wann …?
„Morgen hole ich dich ab.“
3. Frei in Amerika
Ludwig war perplex. So einfach ging das in Amerika, wenn man Beziehungen hat. Fast wie daheim. Morgen würde er frei sein. Frei in Amerika. Und er durfte arbeiten. Und wohnen konnte er bei Steve.Hier begann Ludwig, nachdenklich zu werden. Bei Steve wohnen hieß wohl auch, mit ihm schlafen. Das würde aber auf Dauer nicht funktionieren. Schon wieder war er in der Situation gelandet, die er aus Bad Kreuznach kannte: Er musste mitspielen, ob er wollte oder nicht. Er wollte in Amerika Fuß fassen. Im Lager hatte er gehört, dass sie in Amerika, besonders im Westen die Homosexuellen gleichsam in den Untergrund zwangen. Wenn es aufkam, war einer erledigt. Ludwig kam sich schlecht vor, als er da eine Chance witterte. Aber vielleicht ließ sich alles in Wohlgefallen lösen. Die Hoffnung … Ludwig hatte neutrale Bekleidung bekommen, ohne die Buchstaben PW. Die Autofahrt aus dem Lager führte durch drei Kontrollpunkte, die sie mit Steves Buick anstandslos passierten.
Nach dem dritten Checkpoint sagte Steve strahlend: „So! Jetzt bist du frei.“
Ludwig schämte sich seiner Tränen und sagte gar nichts. Er war überwältigt. Wenn er jetzt aus dem Auto sprang … Steve streichelte ihn am Oberschenkel: „Nicht weinen: Du hast ja mich!“
In Ludwig überschlugen sich die Stimmungen. Freude, er war frei, Angst vor dem Leben mit Steve, sein neues Leben, von dem er geträumt hatte, musste jetzt in die Realität umgesetzt werden. Was immer er dachte, er brauchte Steve. Und Steve hätte ihm einfach ein guter, sein bester Freund sein können, wenn da nicht dieser gottverdammte Sex gewesen wäre. Oder Liebe. Liebe war es wohl auf Steves Seite. Noch schlimmer. Enttäuschte Liebe ist etwas ganz Arges, das wusste Ludwig. Seine zweite Beziehung endete damit, dass sie sich einem anderen zuwandte. Ludwigs Schmerz war unerträglich gewesen. Wie immer er sich befreien wollte, er musste Steve irgendwann diesen Schmerz zufügen.
Vor einem schmucken Appartementhaus im Stadtteil Capitol Hill parkte Steve seinen Buick schwungvoll und gekonnt ein. Die Haustüre war unversperrt. Sie gingen in den 1. Stock, auf dem zwei Appartements lagen. Das linke sperrte Steve auf. Galant sagte er: „Du gestattest, dass ich vorausgehe. Oder soll ich dich über die Schwelle tragen?“
Sie lachten beide, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, ließen das Hochzeitszeremoniell aber bleiben. Das Appartement war sehr geräumig. Ein großes Vorzimmer mit Kleiderhaken, Schirmständer und Schuhablage, dann kam die Küche mit einem Herd, einem großen Kühlschrank, vielen Laden und Türen und einem kleinen Esstisch mit zwei Sesseln. „Der Frühstückstisch“, verkündete Steve.
Eine direkte Verbindung führte zu dem großen Wohnzimmer mit einer ausladenden Couch-Landschaft, die mit einigen Polstern belegt war. Ein Barschrank. Eine schmale, aber voll belegte Bücherwand.
Eine Kommode oder Anrichte mit einem großen Radio. Ein Zimmer mit einem Esstisch für sechs Personen. Das Bad mit Wanne und Dusche, das Klo getrennt. Und das Schlafzimmer. „Unsere Lustwiese“, strahlte Steve, „aber wir wollen nicht sofort …, richte dich erst einmal ein. Ich schlafe immer rechts.“ Ludwigs Beklemmung meldete sich leise. Aber Steve wollte ja nicht sofort … Es gab dann noch ein kleineres Zimmer, Ludwig hätte es Kabinett genannt.
„Das Gästezimmer. Zwei Personen, mehr Gäste schaffen wir nicht.“Sie lachten wieder ihr unterschiedliches Lachen. Zwischen Vorzimmer und Schlafzimmer war etwas, das Ludwig so nicht kannte: ein begehbarer Schrank. Links und rechts waren Stangen wie in einem Kleidergeschäft mit Kleiderbügeln aller Formate. Zwei Schränke waren da, Steve öffnete einen davon: „Das ist deiner. Da kannst du gleich alles einräumen, was du mitgebracht hast.“
Ludwig hatte in seinem Sack aber nur eine komplette Garnitur Unterwäsche, das Englischbuch und – sonst nichts. „Dafür brauche ich nicht einmal ein Regal“, seufzte er.





























