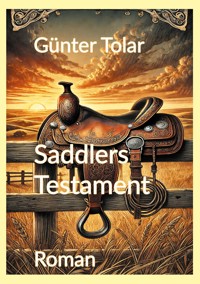Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Ich-Erzähler ist 80 Jahre alt geworden und sieht die Zeit gekommen, eine Zwisschenbilanz zu ziehen. Er hat seine 80 Jahre in Österreich verbracht, seine Bilanz ist aber ein Rundumschlag, der nicht an das Land gebunden ist, sondern an die Tatsache, 80 Jahre lang gelebt zu haben - und jetzt zurückzuschauen. Es ist eine Abrechnung mit der eigenen Vergangenheit aus der Sicht eines Mannes, der damit rechnet, 80% seines Lebens geschafft zu haben
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FÜR GERALD
Inhaltsverzeichnis
00 D
ER
ALTE M
ANN
... UND WAS ER I
HNEN
VORNEWEG SAGEN WILL!
01 ... UND SEINE M
EINUNGEN
02 ... UND SEINE K
INDHEIT
03 ... UND DIE E
INSAMKEIT
04 ... UND WAS WICHTIG IST
05 ... UND SEINE VIERTELJÜDISCHE M
AMA
06 ... UND DIE L
ANGEWEILE
07 ... UND SEINE W
ÜNSCHE
08 ... UND DIE L
IEBE
09 ... UND DAS A
BENTEUER
10 ... UND SEINE K
REISE
11 ... UND ICH
12 ... UND DAS A
LT
SEIN
13 ... UND DAS G
LÜCK
14 ... UND DIE V
ERGANGENHEIT
15 ... UND DIE J
UNGEN
16 ... UND DIE ALTEN L
EUTE
17 ... UND DIE M
USIK
18 ... UND DIE W
ICHTIGKEIT
VON B
EDEUTUNG
19 ... UND DER S
CHLAF
20 ... UND DER T
OD
21 ... UND DIE A
NGST
22 ... UND SEINE D
EFINITION
23 ... UND DER S
EX
24 ... UND DAS S
CHWEIGEN
25 ... UND DIE L
AUNEN
26 ... UND FRÜHER
27 ... UND SEINE B
EWEGGRÜNDE
28 ... UND G
OTT
29 ... UND DIE G
ERÜCHTE
30 ... UND DAS U
NIVERSUM
31 ... UND DIE P
OLITIK
32 ... UND DAS L
ESEN
33 ... UND DER N
EID
34 ... UND DAS LANGE L
EBEN
35 ... UND WORÜBER ER (NICHT) REDET
36 ... UND NOCH EINMAL G
OTT
37 ... UND WAS ER WILL
38 ... UND DIE A
BSCHIEDE
39 ... UND DIE K
UNST
40 ... UND DIE W
AHRHEIT
41 ... UND DIE ANDERE S
ICHTWEISE
42 ... UND DAS E
RWACHSEN
WERDEN
43 ... UND DER T
OD
(SCHON WIEDER!)
44 ... UND DER S
INN
45 ... UND DIE P
OLITIK
(SCHON WIEDER!)
46 ... UND DIE K
INDER
47 ... UND SEINE Z
IELE
48 ... UND (NOCH EINMAL) DIE W
AHRHEIT
49 ... UND DER FALSCHE (?) W
EG
50 ... UND DAS J
ÜNGSTE
G
ERICHT
51 ... UND SEINE S
ELBSTDIAGNOSE
52 ... UND (NUN DOCH) SEINE Z
UKUNFT
D
ANKSAGUNG
00 Der alte Mann ... und was er Ihnen vorneweg sagen will!
Die formelle Anrede Sie sei mir verziehen, ich komme aus einer Zeit, in der das Du ein Privileg war, ein Geschenk, eine Ehre, jedenfalls nicht der Allerwelt-Gebrauchsartikel, zu dem dieses kostbare Juwel Du verkommen ist. In der heutigen Zeit spricht mich fast jeder mit Du an, ich wehre mich nicht dagegen, denn das wäre, als würde ich mich gegen die Zeit wehren. Das von mir legitimierte Geschenk, zu mir Du sagen zu dürfen, besitzen aber nur ganz wenige.
Ich bin 80 Jahre alt. Was sagt mir das? Wenn ich davon ausgehe, 100 Jahre alt werden zu wollen, dann habe ich 80% der mir zur Verfügung stehenden Lebenszeit konsumiert. Mindestens 80%, denn das mit den 100 Jahren ist ja nur eine hypothetische Annahme, von der ich nicht weiß, ob sie gerechtfertigt ist oder einfach nur ein Wunschgedanke. Ich kenne derzeit persönlich keinen 100jährigen. Ich kenne aber sehr viele Männer zwischen 80 und 95, denen es genauso gut geht wie mir. Und ich kenne noch mehr Männer zwischen 50 und 80, denen es wesentlich schlechter geht als mir. Sie merken schon, ich denke, ich mache mir Gedanken. Ich tu was! Ab einem gewissen Alter ist Denken Tun. Ein Mann in meinem Alter, der sich Gedanken über seine Zukunft macht, ist arm und möglicherweise auf einem tragischen Irrweg, weil die zu bedenkenden verbleibenden 20% durch nichts begründbar sind und zudem in undurchdringlichem Nebel liegen. Ein 61jähriger Freund, Sportler, immer unterwegs, immer in Bewegung, erlitt kürzlich einen Schlaganfall. Seine linke Körperseite ist labil geworden und seine Sprache leicht unscharf. Er hat’s überlebt, schleppt sich jetzt etwas mühsam durch sein Leben und macht mir, der ich sowieso schlecht höre, das Zuhören zur Qual. Wenn ich ehrlich bin, ich verstehe die Hälfte nicht von dem, was er mir erzählt, weil da eben die zwei Komponenten einander ergänzen: Er spricht undeutlich und ich höre, trotz Hörhilfen, schlecht.
Was soll ich als 80jähriger Mann also tun? Wie soll ich mich verhalten? Wie soll ich meine Planung anlegen? Soll ich überhaupt planen? Was ist die Alternative? Warten? Abwarten? So tun, als wären da keine 80 Jahre? Einfach weiterwursteln? Irgendwie? Wird schon gehen? Bei einer Autofahrt durch dichten Nebel habe ich die Möglichkeit, anzuhalten. Das geht aber im Leben nicht, denn das fährt auch ohne mein Zutun weiter.
In Anbetracht der Tatsache, dass ich ja gar nicht weiß, für welchen Zeitraum ich planen dürfte, scheint die Option, so zu tun, als wäre da nichts, noch die geeignetste. Ignorieren und Ignoranz sind jedoch nicht gerade von mir geschätzte Verhaltensweisen. Frühzeitig aufgeben geht nicht und will ich nicht, also heißt es weiterrennen, weiterfahren, bis ich in die Mauer knalle, von der ich nicht weiß, wie weit sie weg ist und die ich auch, wenn ich Pech (oder Glück) habe, gar nicht sehe, wenn ich auf sie zu fahre. Oder renne. Oder schreite. Oder gehe. Oder schleiche. Oder krieche. Selbst wenn ich mich selber nicht bewege, die Zeit rennt weiter, sie bewegt sich auf mich zu. Meine Zeit. Denn jeder Mensch hat seine eigene Zeit, und je länger sie währt, desto mehr wird sie meine eigene Zeit.
Seit 20 Jahren schaue ich von meinem ruheständischen Arbeitsplatz in den Wald hinaus, der sich hinter meinem Garten befindet. Ein Föhrenwald ist es, am Rand bemühen sich ein paar Fichten um ihre Daseinsberechtigung in der von Maria Theresia zwecks Harzgewinnung angelegten Monokultur. Gerade eben sind die Baumstämme von der untergehenden Herbstsonne auf ihrer West-Seite schwach vergoldet. Sie standen schon da, als ich vor 20 Jahren hierherkam, waren sicher etwas kleiner, oder jedenfalls jünger, und stehen noch immer. Und sie werden noch stehen, wenn ich eines Tages, je nach Aufgehen meiner Prozentrechnung, mehr oder weniger bald nicht mehr da sein werde. Plötzlich fühle ich mich als ein sehr schwaches Glied in der Natur. Jeder Berg, jeder Baum, ja sogar jeder Strauch überlebt mich und tut so, als wäre ich nie dagewesen. Die Natur braucht uns Menschen nämlich gar nicht, um das zu sein, was sie ist, Natur. Die Kunst, ja, sie kommt vom Menschen. Jede Beethoven-Symphonie überlebt uns alle. So alt wie die Werke von Bach, Beethoven, Mozart, Wagner, Bruckner (ich verliere mich in mein Lieblingsland, die Musik) sind nur die Schildkröten und die Berge, die wenigsten Bäume schaffen das. Das Gold ist übrigens wieder weg, die Bäume verschwimmen zu einer grauen Masse, deren stramme Strukturierung nur durch das schwach durchleuchtende Gegenlicht noch halbwegs zu erahnen ist. Bald werden sie von der Finsternis verschlungen sein, um morgen von Neuem aufzutauchen, allerdings, wenn sie das Glück haben, mit Vergoldung von der anderen Seite. Und ich? Ich muss bis dahin schlafen und froh sein, wenn ich wieder aufwache.
Sehr stark komme ich mir nicht vor. Der Wald hinter meinem Haus macht mich klein. Ein Baum wächst und wächst, ich hingegen schrumpfe und schrumpfe. Fast sinnlos komme ich mir vor angesichts der Übermacht der Natur, der ich ja ursprünglich auch einmal angehörte und von der ich mich im Gleichschritt mit dem homo sapiens nach und nach so weit entfernt habe, dass Natur und Mensch einander schon beinahe als Feinde gegenüberstehen. Aber was schert das die Bäume, die da draußen langsam von der Dunkelheit eingehüllt werden, schützend deckt die Nacht sie zu, schützend auch vor dem Menschen, weil in der Nacht sicher niemand zur Motorsäge greifen wird. Die Nacht. Diese meine Nacht, der ich mich nähern darf, ohne eine Uhr zu haben, die mir zeigt, wie lange mein Tag noch dauert.
Ich schaue mich in den Spiegel. Ich schaue mich jeden Tag in den Spiegel, am Morgen, wenn ich mein Gesicht mit Kaltwasser zu reparieren versuche. Was sehe ich? Einen 80jährigen Mann, der auch schon einmal schöner war. Nicht viel schöner, aber doch. Furchen, Falten sehe ich, zerklüftet in alle Richtungen ist dieses mein Gesicht, das mich mein Leben lang typisiert hat. Lachfalten? Grämlich hinuntergezogene Mundwinkel? Kann alles sein. Jeden Tag anders. Freunde sagen, ich sähe nicht aus wie 80. Meine Haare haben sich, vor allem in der Mitte, zurückgezogen, die verbliebenen sind langweilig grau. Wenn sie wenigstens weiß wären. Jeden Tag die blöde Frage: Bin ich zufrieden mit meinem Aussehen? Wirklich eine blöde Frage ist das, denn was bringt es mir, wenn ich zufrieden bin? Und selbst, wenn ich aussähe wie 60, ich bin trotzdem 80. Das Aussehen ändert nichts an meinem Alter. Wozu also am Aussehen herumbasteln und mich lächerlich machen? Genau genommen sind ja die chirurgischen Kämpfer gegen das Alter arme Schweine, weil sie nicht wissen, dass gerade die deutlich sichtbare Korrektur sie noch älter macht. Chirurgisch geglättetes Gesicht plus (mindestens) 20%, das ist die blamable Formel, der sich die Lifting-Opfer unterwerfen. Der Dichter Werner Schwab sagt es sehr deutlich in seinem Stück Der reizende Reigen: Das Alter ist ein Schwein mit Rotlauf. Das Alter ist der Rotlauf, die Seele ist das Schwein. Und da können Sie Ihr gesamtes Innenvermögen auf den Rotlauf setzen, er gewinnt immer, auch wenn das Schwein als Seele noch so jung bleibt. Im Alter bleibt einem nichts, als mit einem weisheitlichen Charakter über alle Menschen hinwegzulatschen.
Mein Fazit? Ich bin zu meiner eigenen Laborratte geworden. Der alte Mann untersucht sich selber. Daraus folgt, dass Sie der Überschrift jedes der folgenden Kapitel nur Der alte Mann... voransetzen müssen. Oder sollten, ich kann Ihnen ja nichts befehlen. Klar muss Ihnen sein, dass ich das, was ich hier schreibe schreiben muss, weil es die einzige Möglichkeit ist, mir die Qual der notwendigen Bewältigung zu nehmen.
01 ... und seine Meinungen
Ja, Meinungen. Mehrzahl. Der alte Mann hat zum selben Thema manchmal verschiedene Meinungen. Denn wer spricht da zu Ihnen? Der alte Mann, ja. Ich lasse aber alle alten Männer in mir zu Wort kommen. Ich will einmal in meinem Leben versuchen, ganz, wirklich ganz ehrlich mit mir selber zu sein. Ich lasse sie alle reden, den Grantigen, den Traurigen, den Zweifelnden, den Reaktionären, den Rebellen, den Ironischen, den Sarkastischen, den Überheblichen, den Blasphemischen, den Wehleidigen, den Gerechten, den Ungerechten, den Gescheiten und den Blöden, sogar ein Agnostiker ist dabei und sein Gegenspieler, der es sich mit den Religionen gut stellen will. Ego – und viele Alter Egos (ist das die Mehrzahl von Ego?), wobei die Wortgleichheit alter Ego und alter Mann reiner, wenn auch seltsamer, Zufall ist.
Der alte Mann tut das, woran ihn sein Alter nicht hindert, nicht hindern kann: Er macht sich so seine Gedanken. Er will sein eigenes Ergebnis überprüfen. Er will wissen, wo er gelandet ist, was er gedacht hat und was er denkt, wie er geworden ist.
Vorausgeschickt sei, dass einer von denen darauf Wert legt, einmal bekannt gewesen zu sein. Der andere besteht darauf, schwul zu sein, ein geouteter Schwuler (irgendwann hat es irgendjemand interessiert). Der Schwule ist übrigens mit einem Mann verheiratet, der noch im arbeitspflichtigen Alter ist, also jünger. Und noch etwas: Der 80er, der das hier niedergeschrieben hat, ist sehr erstaunt über die Vielschichtigkeit, die er in sich entdeckt hat.
Bruno Kreisky (wahrscheinlich auch noch jemand anderer) hat einmal gesagt, ich bin durchaus bereit, eine einmal geäußerte Meinung zugunsten einer besseren zu ändern.
Der alte Mann, in dem Fall ich, ich habe mir diese Meinung zur Meinung zu eigen gemacht. Allerdings konnte ich mir diese Frechheit erst erlauben, als meine Meinungen nicht mehr berufliche Maximen oder von oben diktierte öffentliche Denklinien waren, oder zu sein hatten. Kreisky hat sich die Freiheit der Meinungsänderung genommen, ich hingegen musste den Genuss dieser scheinbaren (hinreißenden) Disziplinlosigkeit erst erlernen. Die ideologische Entkrampfung brachte mir die Vielfalt und nahm mir nach und nach die Angst davor, Linienuntreue zu begehen. Es soll sich einer bei mir melden, dessen ganzes Leben in (oder nach) einer Linie verlaufen ist.
Es gibt Meinungen, die man sagt, und es gibt Meinungen, die man (besser) nicht sagt. Jeder Mensch trägt seinen mehr oder minder großen, mehr oder weniger versteckten Rassismus in sich. Ich staune, anlässlich meiner rückschauenden Gewissenserforschung manchmal selber sehr, wenn ich entdecke, wie viele Meinungen in mir stecken. Stecken ja. Sie waren am Herauskommen gehindert. Der zurückhaltende alte Mann wird weiterhin zurückhaltend bleiben. Ich kann jedoch nicht für den alten Mann garantieren, der sich sagt, was habe ich zu verlieren, wenn ich endlich auch die Meinung sage, die ich mein Leben lang zurückgehalten habe? Oder die Meinung, die ich mir angesichts der politischen Entwicklungen erst im Lauf meines Lebens (bis heute) bilden musste?
Wundern Sie sich also nicht, wenn der alte Mann (welcher auch immer) zum selben Thema nicht nur eine Meinung hatte und hat, sondern vielleicht noch eine andere, oder eine dritte, und der sie jetzt auch kundtut, je nach Zusammenhang, Gemütslage, Ausgangslage, Alter, Situation oder Apropos. Ich will einen ganzen Menschen abrechnen, nicht nur den, der mir oder Ihnen gerade gefällt.
02 ... und seine Kindheit
Das mit der Kindheit ist so eine Sache, weil sie immer wieder herangezogen wird als Ursache für spätere Probleme – und oft auch maßgeblich daran beteiligt ist.
Meine Kindheit hat vor 70 bis 80 Jahren stattgefunden, also in den Jahren 1939 bis 1949. Nur zur Klärung, bis 1945 war Krieg. Papa war Soldat (Funker, weil er eine lädierte Stimme hatte und für Kommandoposten ungeeignet war, was ihn sehr schmerzte, was ihm aber, da die Funker zumeist im sogenannten 2. Glied arbeiteten, vermutlich das Leben gerettet hat). Mama war jüdisch belastet (1/4, jüdischer Mischling II. Grades, ihr Großvater war der Jude gewesen). Sie hat seit 1933 im Dorf meiner Kindheit (Wimsbach) als Lehrerin unterrichtet und ist 1938 aus der Schule geflogen. Wir waren damals bettelarm, nach heutigen Begriffen waren wir eine humanitäre Katastrophe, weil Mama Papas Wehrsold sehr gekürzt bekam. Allerdings waren damals alle um uns herum gleich arm. Der Vater war fast bei allen weg, die Mütter mussten allein für die Kinder sorgen. Ja, es gab auch reichere Leute in unserem Dorf, die Bauern als Selbstversorger - und den Herrn Pfarrer. Wir gewöhnlichen Leute mussten von dem und mit dem leben, was eben jeweils da war. Die Gemischtwarenhändlerin musste die Preise verlangen, die ihr vorgeschrieben waren – und die waren nicht eben hoch. Preistreiberei gab es nicht, dafür sorgte der Nazi-Ortsgruppenleiter, Verstöße konnte man ihm allerdings abkaufen. Der Herr Pfarrer, ja, der betrieb im Pfarrhof auch noch einen Bauernhof, mit dem er wuchernd wirtschaftete, neben den Einkünften, die er sonst noch hatte. Er verkaufte jeden Versehgang, jede Hochzeit, jedes Begräbnis, jede Seelenmesse (deren damals viele anfielen wegen der im Krieg Gefallenen, die es in fast jedem Haus gab) – und wenn meine Mutter Milch für meinen kleinen Bruder brauchte, gab er ihr kostenlos nur Magermilch, die Vollmilch (die etwas gekostet hätte, Geld, das die Mama nicht hatte) verfütterte er an die Schweine.
Dennoch erinnere ich mich nicht an irgendwelche Beeinträchtigungen. Ich kann mich auch nicht an Hunger erinnern. Ja, wir hatten manchmal Engpässe, die wir nach den damaligen Vorgangsweisen überwinden mussten. Wenn uns im Sommer das Mehl ausging und es auch keines zu kaufen gab, dann gingen wir nach-ernten. Auf den gemähten Kornfeldern blieb immer was liegen. Meine Mutter und ich gingen los, jeder mit Umhängetaschen bestückt, ich mit meinen fünf Jahren hatte vor meinem Bäuchlein eine hängen, wir sammelten die liegengeblieben Ähren auf, brachen sie ab und hinein damit in den Sack. Daheim lösten wir die Körner aus. Mit dem Körnersack gingen wir dann in die Mühle, wo der Müller die Körner abwog und ausrechnete, wieviel Mehl das ergäbe. Bemerkenswert war, dass der Körnersack etwa 20 Zentimeter hoch war, der Mehlsack dann aber bestenfalls 5 Zentimeter.
Wir mussten beim Durchstreifen der Felder immer aufpassen, dass wir auf kein judenfeindliches Terrain gerieten. Einmal passierte es. Etwa 100 Meter von dem Bauernhof entfernt, zu dem das Feld gehörte, das wir eben abernteten, verirrten wir uns. Unglücklicherweise war es das Feld eines Nazi-Bauern. Unglücklicherweise saß auch der Bauer gerade vor dem Haus, sah uns und aktivierte sofort seinen riesigen Hund, ein, aus meiner heutigen Sicht, schwarzes Ungetüm. Fass, schrie der Bauer so laut, dass wir es hören mussten. Der Hund setzte sich sofort in Trab, Mama und ich in Panik auch. Ich stolperte, fiel hin, Mama verlor meine Hand, rannte fünf Meter weiter und schrie, der Bauer wiederholte sein Fass, da war der Hund schon über mir. Noch heute spüre ich seinen heißen, nicht gut riechenden, Atem. Aber was tat er? Er drehte mich auf den Rücken und schleckte mein Gesicht so fest ab, dass ich meinte, er wolle mir die Haut abziehen. Dann trollte er sich langsam. Seit damals habe ich ein, sagen wir, respektvolles Verhältnis zu Hunden. Ein offenbar aggressiv abgerichteter Hund verweigerte den Befehl, weil er einem Kind nicht wehtun wollte. Wie es der schreckliche Bauer etwa vor einem Gericht vertreten wollte, wenn uns der Hund angefallen, schwer verletzt, oder vielleicht sogar getötet hätte? Aber damals hätte ihm ein Gericht – zumal in der Ostmark – sicher Recht gegeben. Aber wie sah das denn mit seinem Gewissen aus, wenn er seinen Hund auf wehrlose Leute, die sichtlich arm waren, hetzte?
Etwa 15 Jahre später, als meine Kindheit gerade der Studentenzeit gewichen war, besuchte ich den Ort des Geschehens und suchte auch den Bauernhof auf.
Der alte Bauer? Der ist erst voriges Jahr gestorben. Total verkrebst. Warum fragen Sie?
Ich erzählte die Geschichte.
Der etwa 40jährige Mann, der sich als der jetzige Bauer herausstellte, sagte gar nichts. Die Frau neben ihm, offenbar seine Frau, sagte nur, jaja, so war er!
Halt’s Maul, murrte der Bauer so scharf in ihre Richtung, dass sie schweigend das Vorhaus, weiter war ich gar nicht gekommen, verließ.
Mich aber schaute er herausfordernd an. Noch was?
Etwas eingeschüchtert verneinte ich.
Er drehte sich um und ließ mich stehen.
Bevor er durch den Hinterausgang, der wohl in den Hof hinausführte, verschwand, drehte er sich noch einmal um und murrte (offenbar konnte er nur murren), wir haben keinen Hund mehr!
Es gab aber auch Menschen in unserem Dorf, die nichts gegen uns hatten, dies aber – zur eigenen Sicherheit - besser nicht öffentlich zeigten. So kam es, dass immer wieder eine Seite Speck oder ein Laib Brot über die Hecke in unseren Garten geworfen wurden. Immer in der Nacht. Sogar eine große Kanne Milch stand einmal in unserem Gärtchen. Wie sie da hineingekommen ist, daran rätsle ich noch heute. Werfen konnte der Spender sie ja wohl nicht. Mama füllte die Milch in unser eigenes Geschirr um, stellte die leere Kanne wieder auf den Platz, auf dem wir sie vorgefunden hatten, am nächsten Tag war sie weg.
Wir waren also arm, ich sagte es schon, bettelarm, aber wir hatten immer irgendwas zu essen. Ob die Ernährung für ein fünfjähriges Kind die richtige war, die Frage stellte sich damals gar nicht. Aber man kann damit offenbar auch 80 Jahre alt werden.
In einem Sommer, es war 1944, ging uns der Zucker aus. Zu kaufen gab es keinen, also blieb nur eine Lösung: Sirup aus Zuckerrüben. Die sogenannte Zuckerrüben-Kampagne war in vollem Gang. Immer wieder zogen langsam Ochsengespanne, schwer beladen mit Zuckerrüben, an unserem Haus vorbei. Da brachte mir meine Mama das Stehlen bei.
Der Kutscher döste vor sich hin, die Ochsen kannten den Weg. Ich sprang, genau nach den Anweisungen meiner Mama, auf die hintere Deichsel und wartete, bis das Fuhrwerk bei einer Hausecke um eine scharfe Rechtskurve fuhr, sodass die Sicht des Kutschers, hätte er sich wider Erwarten umgedreht, behindert gewesen wäre. Da griff ich hinauf und warf ein paar Rüben hinunter auf die Straße. Mit dem Einsammeln musste ich mich sehr beeilen, denn eine alte Frau, die unserem Haus gegenüber wohnte, stürzte sofort heraus, so schnell sie halt konnte, um die eine oder die andere oder vielleicht sogar alle Rüben zu ergattern. Ich aber war schneller und warf die Rüben über die Hecke in unseren Garten, wo sie meine Mama einsammelte. Die alte Frau aber rief nur Diebsgesindel, elendiges. Juden, grausliche. Beim jüngsten Gericht wird abgerechnet!
Da die Alte auf alles und jedes schimpfte, war das nichts Neues.
Später wurde mir immer wieder die Frage nach meiner Kindheit gestellt, eine der üblichen Interviewfragen halt. Wenn ich an die Einzelheiten denke, kommt es mir schon eigenartig vor, wenn ich sage, ich hatte eine glückliche Kindheit.
Vielleicht, weil ich sie überstanden habe. Vielleicht, weil ich immerhin 80 Jahre alt geworden bin, was man angeblich mit einer unglücklichen Kindheit nie werden kann. Vielleicht, weil damals kaum jemand eine andere Kindheit hatte, mir also der schen gekommen ist, seit sie angefangen haben, zu vergleichen. Ranking nennt man diese Vergleichswut. Vielleicht ist die Erinnerung einfach die schönfärbende Sehnsucht des alten Menschen, wieder ganz jung zu sein. An dieser Stelle meines Denkens melden sich aber doch einige Einzelheiten wie Sirenengeheul, Rennen in den Luftschutzkeller, das Sirren eines abstürzenden Flugzeugs – nein, es war sicher damals nicht leicht, ein Kind zu sein. Aber wann ist es denn schon leicht, ein Kind zu sein? Jede Zeit hat für die Kinder aktuelle Tücken bereit. Aus dieser Sicht möchte ich kein Kind mehr sein, weder damals, noch heute.
Ach was, meine Kindheit war glücklich – und heute bin ich auch glücklich, wobei mir letzteres wichtiger ist.
03 ... und die Einsamkeit
Stand da nicht unlängst in einer Zeitung, dass die größte Angst der alten Menschen die Angst vor der Einsamkeit ist? Diese Erkenntnis war sicher das Ergebnis einer der vielen Studien, mit denen die Welten und Gegenwelten einander gegenseitig überfluten. Ich wundere mich ja immer, was es da für Studien gibt, und vor allem, was da für Ergebnisse herauskommen.
Wer viel isst, wird mit hoher Wahrscheinlich dicker – Studiendauer zwei Jahre.
Wer wenig schläft neigt mehr zu Müdigkeit – Studiendauer drei Jahre.
Wer länger lebt, wird älter – Langzeitstudie.
Nein, die letzte habe ich erfunden, es würde mich allerdings nicht wundern, wenn es sie nicht doch gäbe.
Wie ist das aber nun mit der Einsamkeit der alten Menschen und ihrer Angst davor? Ich bin misstrauisch, ob das nicht doch auch so ein Studienoutput (modern ausgedrückt) ist. Aber vielleicht sollte ich gar nicht in die Ergebnisfalle einer Studie tappen. Ich könnte mich ja selber fragen: Bin ich einsam?
Keine Antwort.
Ich kämpfe mit der Definition von Einsamkeit.
Wenn ich allein bin, ist niemand da, außer mir, es kann aber immer wieder jemand kommen. Wenn ich jedoch einsam bin, dann bin ich allein und es ist niemand da, der kommen könnte. Oder es gibt sehr wohl Leute, die kommen könnten, jedoch nicht kommen, die mich also bewusst, oder zumindest von mir als bewusst empfunden, allein lassen.
Wer sind die Menschen, die mich absichtlich allein lassen, obwohl er oder sie mich besuchen könnten? Anders gefragt: Wer könnte schuld sein an meiner Einsamkeit?
Meine engere Verwandtschaft ist nicht eben sehr kontaktfreudig, was meine Person betrifft. Was die mir so Nahestehenden aber nicht wissen: Ich erleide keinerlei Mangelerscheinung, wenn sie mich nicht besuchen.
Ich denke nach und denke nach – und finde niemand, bei dem es mir wehtut, dass er mich nicht besucht.
Ich bin oft allein, ja. Ich lebe auf dem Land, mein Mann arbeitet von Montag bis Freitag etwa 60 km entfernt in Wien. Aber dieses Alleinsein ist mir noch nie auf den Kopf gefallen wie die berühmte Decke. Mein Leben ist ausgefüllt mit – ja, mit Leben, mit der Bewältigung des Alltags, angefangen von der Überwindung diverser körperlicher Notwendigkeiten, bis zur Sauberhaltung des Hauses, der Erledigung der Rechnungen, der Verwaltung des Kühlschranks, der Herstellung der Nahrung (zum Beispiel des eigenen Brotes!), des Waschens und (wo notwendig) Bügelns der Wäsche – und so weiter. Ich erschrecke ja geradezu vor der Fülle an Aufgaben, die ich zu bewältigen habe. Dabei ist die Aufzählung bei Weitem nicht vollständig.
Nein, ich bin nicht einsam.
Ohne eine Studie zu quälen, leite ich daraus ab, dass nur der Mensch einsam ist, der keine Aufgaben mehr hat, oder der nicht mehr in der Lage ist, Aufgaben bewältigen zu können, der also – brutal ausgedrückt – nur herumsitzt oder herumliegt – und sonst nichts hat. Und vor allem: Der sonst niemand hat. Dem bleibt nichts, als warten. Auf Besuch? Auf einen Menschen? Auf den Tod? Wer wartet schon gern auf den Tod. Wenn da aber kein Mensch mehr ist? Gar nicht, weil mich keiner mag, sondern weil sie vielleicht alle selber krank oder schon weggestorben sind?
Ich habe niemand mehr. Ich habe nichts mehr.
Vor dieser Form der Einsamkeit hätte ich auch Angst. Angst, ja. Schreckliche Angst. Ich spüre sie sogar jetzt, da ich sie mir ausdenke, intensiv ausdenke, vielleicht zu intensiv ausdenke. Ich denke manchmal etwas zu intensiv. Wenn ich einmal nichts und niemand mehr habe, möchte ich auch nicht mehr leben als eine allein, sinn- und zwecklos vor sich hin brummende Maschine, die nur frisst und scheißt.
Ich will nicht weitermalen. Hilflos und allein ist gleich einsam. Diese Gleichung ist grässlich und macht mir ein körperliches Unbehagen, dass ich zum reinen Selbstschutz diese Gedankenkette schnellstens abreißen muss, radikal. Und mir schnellstens einen Einsamkeitsbrecher suche.
Wir haben zwei Hunde. Der Rüde muss dringend gebürstet werden. Und da er sich überschwänglich freut, wenn er die Bürste sieht, verkommt meine etwaige Einsamkeit zum Gewäsch.
04 ... und was wichtig ist
Auf die Frage, was ist für dich wichtig, gebe ich normalerweise (in Österreich Seitenblicke-)-Antwort: Gute Menschen, gutes Essen, guter Schlaf, guter Schiss!
Wenn mir jemand diese Frage stellt, handelt es sich wahrscheinlich um ein offizielles Interview, da muss ich dann den Schiss immer irgendwie umschreiben, habe das Wort aber auch schon im Fernsehen ausgesprochen und viel Zustimmung erhalten. Da war kaum jemand, der meine Ausdrucksweise vulgär, gewöhnlich oder primitiv genannt hätte. Eigentlich niemand. Dass dazu genau genommen auch noch ein, von einer störrischen Prostata möglichst nicht behindertes, wenig zeitraubendes Urinieren gehört, lasse ich weg. Ebenso den Wunsch nach guter Gesundheit, weil die ja Voraussetzung für alle meine Wünsche ist. Belassen wir es also bei den vier Punkten. Menschen, Essen, Schlafen und Stuhlgang – sie sind die wichtigsten Forderungen, die ich an mein Dasein stelle, weil sie auch am heftigsten auffallen, wenn sie nicht funktionieren. Wobei ich hier die Reihenfolge umdrehen muss, denn schlechter Stuhlgang, zu hart, oder zu flüssig, oder gar nicht, beeinträchtigt schon sehr das, was ich an Lebensqualität fordere. Am Vormittag immer wieder warten zu müssen, bis die Entleerung ein Stadium erreicht hat, das mir erlaubt, für längere Zeit aus dem Haus zu gehen, ist unangenehm. Frühe Termine sind so fast unmöglich. Ich muss mein Auto zum Service bringen, um halb acht, na hoffentlich passiert nichts... Das kann ganz schön nerven. Und je größer die Angst ist, dass da unterwegs etwas passiert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert. Ich weiß längst, dass es sich hier nicht nur um ein physisches, sondern, vielleicht sogar in erster Linie, um ein psychisches Problem handelt. Einige Jahre, wirklich Jahre, habe ich gebraucht, um die Sache in den Griff zu bekommen. Ich musste den mir selbst gegebenen Befehl Scheiß dich nicht an! wörtlich nehmen. Normalerweise heißt das Hab’ keine Angst! In diesem Fall aber gilt der Befehl doppelt. Das Rezept lautet, keine Angst haben vor dem Ereignis und das Ereignis damit gleichsam verdrängen, bis die Gelegenheit da ist. In meinem Beispiel das Klo. Ich hätte nie gedacht, dass Scheißen auch Kopfarbeit ist.
Den guten Schlaf habe ich längst umgetauft in ausreichenden Schlaf. Denn wirklich gut schlafe ich nie. Träume, Harndrang, übersäuerter Magen, Krämpfe in den Beinen, es ist viel los in der Zeit, in der ich eigentlich schlafen sollte. Ich rechne so: Sechs Stunden Schlaf genügen, dazu eine Stunde für die diversen Unannehmlichkeiten. Von Mitternacht bis sieben Uhr, das ist meine Zeit, wobei sieben Uhr durch die Hunde markiert ist, deren Häufchen-Zeiten in beneidenswerter Verlässlichkeit stattfinden. Irgendwer sagt zwar, der Schlaf vor Mitternacht sei der wichtigste, weil der beste. Mag schon sein. Aber nicht für mich. Wenn ich um zehn Uhr schlafen gehe bin ich um fünf Uhr putzmunter. Aus dieser Rechnung resultiert aber auch, dass ich einen 17-Stunden-Tag habe.
Machst du keinen Mittagsschlaf, fragte mich erst unlängst eine gleichaltrige Freundin, und fügte gleich noch ihren Zeitplan hinzu, eine Stunde von eins bis drei.
Ich verkniff mir das Nachrechnen.
Mittagsschlaf? Also nein! Manchmal, aber wirklich nur manchmal, überfällt mich Müdigkeit so um vier Uhr Nachmittag, da kann es dann schon sein, dass ich mich hinlege und sogar eine Stunde ganz gut schlafe. Wenn ich dann aber aufwache, bin ich kaputt, und damit fast der ganze verbleibende Tag. Ich finde dann nicht mehr zu der gewohnten Helligkeit in mir, ich bleibe dumpf, wie im Sumpf, oder im Nebel, reduziert, heruntergefahren, auf Sparflamme, die ich nicht mehr so richtig hochbekomme. Bleibt als dritte Wichtigkeit das Essen. Mein Hausarzt hat mir allerdings schon vor langer Zeit gesagt, dass der Mensch ohne Essen mehrere Tage lang aushalten kann, aber nicht einen Tag ohne Trinken. Das Trinken sollte eigentlich den Wichtigkeit-Platz des Essens einnehmen. Ja, ja, schon gut! Ich trinke sowieso immer etwas zum Essen. Und zwischendurch auch. Abends Bier. Untertags Sodawasser. Schädlich, sagt ein Spezialist. Wenn es Ihnen guttut, sagt der andere. Also trinke ich es!
Mit meinem Mann ist eine hohe Qualität des Essens bei uns eingekehrt, er kocht vorzüglich und immer Haubenverdächtig. Das Kompliment machen vor allem unsere Gäste, die er gerne akribisch, liebevoll und kreativ bekocht. Der Haken an der Sache: Er ist von Montag bis Freitag gar nicht da. Ich muss mich, genau genommen, von Sonntag-Abend bis Freitag-Mittag selbst versorgen. Da sieht die Sache schon anders aus, denn ich kann überhaupt nicht kochen, lerne aber dazu. Waren es bisher gegrillte Würste aller Arten, die mir den Beinamen Du mit deine Würscht’ eingebracht haben, so brate ich mir jetzt schon einmal ein Hühnerfilet oder ein Fischfilet, mache mir einen Salat, im Air-Fryer backe ich mir Pommes oder Wedges. Wenn mir gar nichts einfällt, dann wärme ich mir eine tiefgekühlte Pizza auf, oder ich lasse mir vom Schnitzelplatzl ein köstliches Cordon Bleue kommen.
Habe ich in meinen Wichtigkeits-Erläuterungen die Menschen