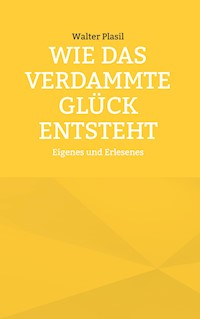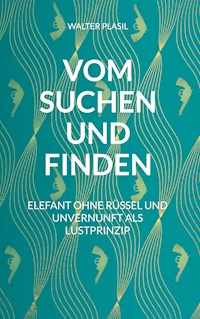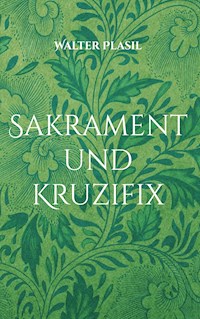
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Etwas glauben zu können, oder eben nicht, ist wesentlicher Teil unseres Alltags. Hunderte Male am Tag stehen wir vor der Notwendigkeit, zu beurteilen, ob das, was wir gerade sehen, lesen oder hören, auch stimmen kann. Im ersten Teil des Buches stellt der Autor seine persönliche Sicht zum religiösen Glauben vor. Unter dem Titel: "Warum ich nicht glaube" geht es darum, unter Beachtung der gleichen Kriterien der Logik, die wir Tag für Tag dafür benutzen, um darüber zu entscheiden, was uns richtig oder falsch vorkommt, die Religionen zu durchleuchten. Am Ende ergibt sich daraus ein sehr kritisches Bild. Danach, im zweiten Teil öffnet der Autor die Türen in Richtung der Gläubigen und wirbt dafür, ein hermeneutisch angelegtes Forum für Diskussionen zwischen den Ansichten von Religionsfreien und Religiösen zu entwickeln. Das zeigt sich als ein spannendes Projekt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt:
WARUM ICH NICHT GLAUBE
Essay
PLÄDOJER FÜR HERMENEUTIK
Essay
BILD Ohne Titel
Ohne Titel
WARUM ICH NICHT GLAUBE
Essay
Vorwort
Vieles - wenn nicht gar alles von dem - was ich hier als Begründung für meine Ansichten gesammelt habe, müsste gar nicht neu verfasst werden. Es gibt eine lange Liste von Autoren, die zum Thema „Glauben“ ähnlich kritische Standpunkte formuliert haben.
Warum ich es dennoch getan habe? Erstens war es mir ein Bedürfnis, es für mich aufzuschreiben. Einfach deswegen, um die Entschiedenheit meiner Ansichten und die Hintergründe meiner Gedanken zum Thema zu dokumentieren. Zweiten, weil ich vermute - und hoffe - dass andere Leute Interesse daran haben könnten, sich so etwas durchzulesen.
Die religionskritischen Bücher, die seit 2006, dem Erscheinen von „Gotteswahn“ von Richard Dawkins erschienen sind, bestätigen, dass es sich nach wie vor lohnt, religionsfreie Positionen deutlich und umfassend darzustellen. Mein Ziel ist es, mit dem vorliegenden Text einen bescheidenen Beitrag zum Thema zu leisten.
Was ich hier vorlege, ist kein wissenschaftliches Werk, sondern ein Essay, der seine ihm zugemessenen Stilmittel einsetzt, um dem Anliegen Gutes zu tun.
Ob religiöse Leser, die so offen sind, solche Bücher wie das meine zu lesen, beleidigt darauf reagieren, weiß ich nicht. Aber dass Religionen es sich gefallen lassen müssen, an ihrer eigenen Geschichte, an den konkreten Handlungen ihrer Repräsentanten und dem Verhalten ihrer Anhänger gemessen zu werden, dabei bin ich mir sicher. Und ohne ein Horchen in die Vergangenheit ist die aktuelle Realität nicht gut genug einschätzbar.
Doch nun ganz schnell zum Kern der Sache:
Warum denn überhaupt auf Religionen einschlagen und die Gläubigen kritisieren? Schon höre ich Leser, die der Ansicht sind, man müsse doch auch bedenken, dass die Gebote der Religionen, speziell deren Appelle an Menschenliebe, das Einmahnen von Wohlverhalten, Mildtätigkeit oder Verständnis für die armen Sünder doch etwas Gutes darstellen.
Die Repräsentanten, die dieses Gute predigen, und vor allem die schwachen Gläubigen selbst, das sind halt auch nur Menschen, und die machen bekanntlich Fehler. Der Geist wäre ja willig, aber das Fleisch?
Wenn es also hier zu Differenzen zwischen Anspruch und Praxis kommt - so die Verteidiger - solle man deswegen nicht gleich die ganze Idee verwerfen. Denn die Kritik daran, was die oft fehlgeleiteten Menschen aus der von Gott gegebenen religiösen Weisheit auch immer machen, müsse an der hell gleißenden Strahlkraft der Botschaft, die immerhin dem göttlichen Ratsschluss entsprungen ist, abprallen.
Und das Fehlverhalten des weltlichen Bodenpersonals könne die Richtigkeit des Kurses des Kapitäns aus dem Jenseits auch nicht abmindern. Alles liege eben nicht in Menschen - sondern in Gotteshand. Und der weiß immer was er tut. So, oder so ähnlich könnte die Überlegenheit einer Religion gegenüber allen despektierlichen weltlichen Anfechtungen dargestellt werden.
Rückblick und Ansichten
Betrachtet man das Christentum aus historischen Perspektiven, scheint es so zu sein, dass man heutzutage, nach sehr vielen Wandlungen im Inhalt und Auftreten seitens der Kirche, mit den anfangs hellenistischen Prägungen gar nichts mehr zu tun haben möchte. Scheinbar waren auch die urschriftlichen Religionsdokumente, die erst lange nach der Zeit des angeblichen Jesus entstanden sind, in griechischer Sprache abgefasst. Und man darf fragen: Ist da noch mehr an antikem Griechischen im Christlichen drin? Könnte es sein, dass man durch Studien der Fragmente der Uralt-Dokumente noch geschichtliche Fakten findet, von denen wir bisher noch nichts wussten? Vielleicht enthalten die ersten Schriften sogar neue Aspekte der Anfänge, auf die heutige Religionen stolz sein könnten. Die Grundlagenforschung zum Christentum ist ja noch lange nicht abgeschlossen.
Einiges ist ja bekannt, wenn auch die bestätigten historischen Quellen jener Zeit um das Jahr Null v.u.Z (vor unserer Zeitrechnung) nicht sehr viel Belastbares hergeben. Von der Frühzeit des Christentums könnte man in gewisser Weise auch von der Zeit des Entstehens einer neuen Philosophie, besser vielleicht einer neuen Richtung von Philosophie sprechen.
Allem Anschein nach wurden, trotz der damals neuen monotheistischen Sichtweise alte Ansätze, wie man sie aus den Vorläufer-Religionen des Altertums bereits kannte, da oder dort umformuliert und uminterpretiert. So hat also das frühe Christentum nicht alles neu erfunden, sondern sich viele Gedanken einverleibt, die so originell nicht waren. Das Entstehen einer Religion müssen wir ja gerechter Weise auch danach bewerten, aus welcher Zeit heraus sie entstanden ist.
Vor der ersten Äußerung als Christen, die sich halt dann so nannten, waren sie ja Juden gewesen, die für den Wechsel zum Christentum ihrer alten Religion den Rücken gekehrt haben. Irgendetwas muss sie dazu bewogen haben.
Wer damals angesichts der Wunder, die sich (angeblich) vor den Augen der ehemals gläubigen Juden ereignet haben und die mit dem Auftreten eines Propheten namens Jesus zu tun hatten, war der Beweis für die Existenz des göttlichen Willens als Zustimmung zur neuen Religion von ganz oben erbracht worden.
Die neue Glaubensgemeinschaft dürfte sich quasi als Inkarnation eines göttlichen Logos empfunden haben. Sie fühlten sich auserwählt, vielleicht sogar nach dem Beispiel, nach dem sich die Juden einst als auserwähltes Volk empfanden.
Die Christen empfanden sich als Träger und Verbreiter des Samens der allumfassenden Wahrheit. Einer Wahrheit, die von irgendwoher, jedenfalls aber über glaubwürdige Botschafter aus einem mystischen, unsichtbaren Teil der Welt, (meist von oben) über sie gekommen sein soll. Wer konnte da angesichts der Existenz des von Gott persönlich geschickten Messias, der noch dazu dessen Sohn sein soll, noch zweifeln?
Botschafter aus dem Reich des Unsichtbaren - das trifft sowohl auf die Propheten Israels, als auch auf jene im alten Hellenismus zu - wurden immer schon (angeblich) von Obergöttern (Zeus) oder einzelnen Göttern ausgeschickt. Dem jeweiligen Messias wurde zugemessen, dass er zuvor auf wunderbare Weise erleuchtet worden ist. All die (meist aus dem Himmel) hernieder gekommenen hatten den Auftrag, auf der sündigen Erde, der einzigen Welt, von der man wusste, Ordnung zu schaffen. Göttliche Ordnung.
Die neue Bewegung der Christen war, das meinen zumindest manche Religionshistoriker, anfangs sehr kontemplativ und theoretisch angelegt. Dieser Teilaspekt schien auch damals dem Bedürfnis der Menschen entsprochen zu haben. Nämlich jenem, über die Realität hinaus zu denken und sich gefühlsmäßig in mystische Welten begeben zu können, in der die letzten Fragen des menschlichen Lebens abgehandelt werden können.
Das hat wahrscheinlich mit dem Hintergrund zu tun, dass es vor Tausenden von Jahren für Menschen mehr als rätselhaft war, wo das, was da war, hergekommen sein soll. Allem Anschein nach war da jede Art von Erklärung dafür hilfreich, wenn damit nur die Frage nach dem Entstehen von Materie beantwortet wurde.
Es lief bei Religionen ja immer auf eine Art von Schöpfung raus. Irgendwer, irgendwas hat die Erde und alles andere Sichtbare gleich dazu erschaffen. Da konnte man sich dann zufrieden zurücklehnen, weil das Rätsel nun gelöst war.
Vielleicht empfanden es die Menschen auch einleuchtend, dass es nur einen Gott, einen Anführer geben könne, der anordnet, wo es langgeht. Zuvor wurde ja den Leuten ein Sammelsurium von Göttern und Mächten eingeredet, bei dem sich kaum einer auskennen konnte. Viele Götter aus der Zeit der Antike, griechische, römische oder auch nordische, kämpften ununterbrochen gegeneinander und zeugten, der Sage nach, noch unzählige Halbgötter dazu. Wer konnte sich da noch auskennen. Sogar Kaiser und Könige empfanden sich als gottgleich. So ging das über Hunderte von Jahren vor sich.
Unter dem neuen Christentum konnten dann, so die Einschätzung von kundigen Fachleuten, die verbreitete platonische Metaphysik, die stoische Ethik, der alte Mythos und der traditionelle Kult vereint werden.
Ein Beleg für diese Einschätzung findet sich zum Beispiel schon beim antiken, zum Christentum übergetretenen Philosophen Justin. (hingerichtet im Jahr 165) Immerhin herrschte damals (bis zu Beginn des 4. Jahrhunderts) noch Christenverfolgung. Damals war es noch lebensgefährlich, dieser Lehre anzugehören.
Die vielen Jahrhunderte danach war es dann umgekehrt. Dort, wo das Christentum zur Staatsreligion geworden war, wurde der Spieß umgedreht.
Schon 416 wurden beispielsweise im Römischen Reich alle Nichtchristen aus den staatlichen Ämtern entfernt und schon 435 wurde von den Christen die Ausübung traditioneller heidnischer Kulte bei Todesstrafe verboten. Die christliche Botschaft der Liebe, die zwischen allen Menschen herrschen soll, war ganz schnell der Botschaft der Intoleranz gegenüber „Ungläubigen“ gewichen.
Katholisch, dieses Wort bedeutete angeblich ursprünglich: ganz, allgemein, oder allumfassend. Nicht sehr viel später verstand man unter katholisch aber: rechtgläubig, oder orthodox zu sein. Das rechte Leben, das ist die Orthopraxie und die zugehörige rechte Lehre die Orthodoxie. Und damit basta!
Freilich ist Religion nicht nur das, was man als den täglich gelebten Glauben bezeichnen könnte. Da ist natürlich noch mehr dran. Religionen bieten Übersinnliches in vielen Variationen. Sie gehen von unendlich mächtigen, kreativen, allwissenden und steuernden Göttern aus, die für alles und jedes im Universum Ursache und Herr (Frau?) sein sollen.
Es wird behauptet, dass Menschen schon zu Lebzeiten mit den Übermächtigen in Kommunikation treten können. Und diese Übermächtigen wirkten zudem sowohl für tote Materie, wie auch für alles, was da kreucht und fleucht, Schicksal bildend.
Je nach Ausmaß der individuellen Regeleinhaltung der Religionsvorschriften können die Götter Menschen nach deren Leben auf Erden in einem Jenseits bestrafen oder belohnen oder ihn gar für die kommenden Wiedergeburten up oder down graden.
Wer die Muße dazu aufbringt, sollte auch einmal in die Texte der jüdischen Kabbala hineinlesen. Unter anderem findet man dort eine unglaubliche Anzahl von Regeln darüber, was man als Gläubiger alles zu tun oder zu lassen hat.
Der unsichtbare Gott erscheint gemäß Kabbala in der Welt in Form von zehn Emanationen (aus Gott Hervorgegangenes). Dafür gibt es dann die zehn verschiedenen göttlichen Namen. Diese Gottfiguren werden als Synonyme benutzt (Schönheit bedeutet z.B. Gott Jehova). Es geht dabei darum, eine mystische und ekstatische Schau Gottes zu erreichen, weil man ihn eben nicht sehen kann.
Drum herum sind eine ausufernde Zahlenmystik und eine verworrene kosmologische Symbolik von Zeichen aufgebaut, die ein Nicht – Kabbalist auch nach lebenslangem Studium niemals erfassen kann.
Außerdem wird ausführlich beschrieben, dass das, was geschieht, immer direkt von Gott angetrieben ist. Alles, was an Realität vorgefunden wird, sei in Wahrheit etwas ganz anderes und bietet sich nur in anderer Gestalt dar. Alles Reale habe tatsächlich aber eine bestimmte Bedeutung und enthalte immer eine göttliche Botschaft. Um die herauszufiltern, bedarf es eben der Kenntnis einer Geheimlehre.
Mir ist es bisher nicht gelungen, ein Buch in die Hände zu bekommen, in dem, wie in der Kabbala, der Unsinn quasi aus den Seiten herausquillt. Kein Wunder, denn Kabbala ist eben die Bezeichnung für Mystik und Geheimlehre. Allerdings habe ich auch nicht übertrieben eifrig nach ähnlichem gesucht.
Das schriftliche Werk, das auf der Basis des Alten Testaments fußt, wurde in der Renaissance dann sogar von Christen geschätzt, entsprechend interpretiert und als Christliche Kabbala verbreitet.
Dem ersten lateinischen Kirchenschriftsteller Tertullian (ca. 160–220) wird der Ausspruch zugeschrieben: Credo, quia absurdum. Das heißt nichts anderes, als: Ich glaube, weil es widersinnig ist. Man könnte auch sagen, die Sentenz bedeutet: Ich glaube, weil es die Grenzen des menschlichen Verstehens überschreitet.
Mir scheint, dass sich diese antike Halsstarrigkeit im Denken bei Gläubigen bis zum heutigen Tag erhalten hat. Dabei geht es ums nicht denken wollen und ums nicht erkennen wollen, zugunsten eines dekretierten Glaubens.
Ich habe große Mühe zu verstehen, warum nicht in unserem Zeitalter jeder denkende Mensch angesichts des innerhalb von zweitausend Jahren gewachsenen Wissensstandes der Menschheit längst die absolute Gewissheit hat, dass Religionen eigentlich nicht viel mehr als in grauen Vorzeiten entstandene Gedankengebilde sind. Früher wusste man es halt nicht besser.
Von diesen Geschichten fanden sich auch schon damals im Leben der Gläubigen nur die Behauptungen der Prediger in der Realität wieder. Religion wurde immer schon nur erzählt oder geschrieben. Niemand konnte oder wollte Beweise für die Richtigkeit der aufgestellten Behauptungen sehen. Das galt für damals und gilt bis heute.
Ich verstehe, dass man in Urzeiten noch nicht so weit war, um erkennen zu können, dass auch eine Welt ohne Götter vorstellbar ist. Aber unverzagt erklären Religionen auch noch heutzutage die alten, krausen Geschichten assertorisch zu letzten Wahrheiten.
Und nichts davon ist im Lauf der Zeit plausibler geworden. Im Gegenteil dazu. Die Kluft zwischen dem menschlichen Selbstverständnis in unserer täglichen Realität und dem unbewiesenen Glauben wird immer größer. Glauben heißt eben nicht wissen. Und ich möchte mehr ein Wissender und weniger ein Glaubender sein.
Seien wir uns doch ehrlich! Das Angebot, das zum Beispiel die katholische Kirche allen Ernstes im Religionsunterricht macht, nämlich zu glauben, die Welt existiere, weil ein Gott sie in 7 Tagen aus dem Nichts erschaffen habe, ist doch infantil, um nicht noch schlimmere Klassifizierungen dafür verwenden zu müssen.
Das meiste davon, was im Alten Testament steht, kann auch nur mit gequältem Lächeln quittiert werden. Es pendelt zwischen wundersamen Begebenheiten und abgrundtiefem Grauen. Ich finde, es ist aus heutiger Sicht nicht einmal gut erfunden, weil man sich beim Lesen schon denkt: Na so kann das wirklich nicht gewesen sein. Und im Neuen Testament geht es über weite Strecken in dieser Tonart weiter. Eine Zumutung für den wachen Intellekt eines Durchschnittsmenschen!
Auch die psychisch auffälligen amerikanischen christlichen Kreationisten, die das Alter der Erde mit 6.000 Jahren angeben und immer noch nach den Überesten der Arche Noah suchen, bewegen sich auf einem Niveau, das keinen guten Eindruck auf den Geisteszustand dieser Gläubigen hinterlässt.
Das Christentum: Aufgewachsen in einer Todfeindschaft gegen die Realität ... (Friedrich Nietzsche)
Und gleich noch etwas Wichtiges zum Thema Glauben: Es muss einem klar sein, dass dieses Wort „glauben“ doppeldeutig ist. Zum einen bedeutet es eben, an eine bestimmte Religion zu glauben und zum anderen verwenden wir das Wort häufig im Alltag ohne religiösen Hintergrund.
Wenn ich zum Beispiel glaube, dass das Wetter morgen wieder schöner werden wird, bin ich noch lange kein Gläubiger. Das Wort „glauben“ wird im üblichen Sprachgebrauch anstatt des Wortes „vermuten“ verwendet. Es wäre natürlich korrekter, wenn „vermuten“ gemeint ist, auch „vermuten“ zu sagen.
Wenn also jemand sagt, jeder Mensch glaubt doch an irgendetwas, dann ist zu klären, welche Bedeutung in dieser Frage das Wort „glauben“ haben soll. Ich zum Beispiel glaube nach wie vor, dass das Wetter morgen wieder schöner werden wird (natürlich vermute ich es nur, aber ich habe im konkreten Fall meine Gründe, das zu glauben, weil ich den Wetterbericht kenne), möchte damit aber wirklich nicht bewiesen haben, dass ich im tiefsten Herzen auch ein Gläubiger bin.
„Glauben“ also religiöse Menschen, oder „vermuten“ sie nur?
Religionen sind mehr oder weniger fromme Märchen. Die christlichen und muslimischen Religionserzählungen garnieren das Ganze noch mit einer Menge an Grausamkeiten. Wer etwa wissen möchte, was an menschlicher Brutalität, an Mord und Totschlag alles möglich ist, wird in der Bibel und im Koran fündig.
Um die Zeit des Jahres 600 hat sich nämlich der Prophet Mohammed gedacht, das Christentum sei nichts für ihn und hat sich davon in Form der Gründung einer neuen Religion getrennt. Dem Islam.
Also wurde dem alten christlichen Märchen ein neues islamisches hinzugefügt. Und die Vergangenheit wurde vom Propheten anders und neu bewertet. Zu den Ereignissen, die sich tatsächlich im Lauf von 600 Jahren gemeinsamer Geschichte des Christentums mit dem späteren Islam abgespielt haben, sagten dann plötzlich die Neuen, es sei nicht so gewesen. Die alten, die Christen, die beharrten darauf und sagten, es war sehr wohl so. Und alleine diese Meinungsdifferenz hat all die folgenden Jahrhunderte, und hat bis heute, ganz schreckliche Auswirkungen.
Religionen streiten untereinander, welches Märchen aus ihren zur Wahrheit umgetauften Texten das alleinig wahre ist.
Es sind jedenfalls nur Märchen, wer auch immer sie verbreitet, die in religiöse Schriften gefasst sind. Und diese Schriften haben sich im Lauf von Jahrhunderten immer wieder verändert. Man war sich halt nicht immer einig, was nun gerade das richtige, das gültige Märchen sein soll und wer das Recht hat, es abzuändern oder wer es verkünden darf. Daran hat sich bis heute nichts geändert.
Alle Märchen umfassen Episoden, in denen Menschen vorkommen. Es geht um Ereignisse, die sich angeblich tatsächlich ereignet haben und aus denen man Schlüsse ziehen soll. Das freilich ist vor allem die Aufgabe der Priester. Aber auch der gewöhnliche Gläubige ist angehalten, im Selbststudium diese Ereignisse nachzulesen und deren Inhalt zu erfassen.
Bei Religion geht es um eine Anleitung dafür, man könnte auch sagen, um eine Vorschrift, wie man die Welt interpretieren müsse und andererseits, wie man sein eigenes Leben führen soll. Als Anleitung für beides dienen eben genau diese erfundene Geschichten.
Die wichtigsten Episoden aus diesen Märchen wurden zu Gedenktagen erhoben, damit man als Gläubiger an sie erinnert wird. In festen jährlichen Zeitabständen werden solche Tage immer wieder
öffentlich gefeiert, besser gesagt, zelebriert.
Christen praktizieren allerlei mystische Riten. Meistens wird dabei von einem Priester etwas gespendet. Beispielsweise eines der Sakramente. Die Teilnehmer am Ritus gehen dabei davon aus, dass der angerufene, unsichtbare Gott wirklich an diesen formalisierten Zeremonien (persönlich?) teilnimmt.
Dafür wurden im Lauf der Jahrhunderte unzählige Regeln und Vorschriften erfunden. Manche davon galten früher, manche davon gelten erst neuerdings. Die Festlegungen dafür werden von den religiösen Führen getroffen.
Alle Aufführungen von Religion folgen einer strengen Dramaturgie. Es sind traditionell gewachsene Spektakel in Form von Auftritten der ranghohen Geistlichen, die uns Jahr für Jahr dasselbe verkünden.
Man kann das auch so sehen: Anlässlich periodischer Versammlungen von Gläubigen werden von Priestern oder Mullahs Sermon - artig alte Märchen erzählt. Die werden dann mit dunkler oder fröhlicher Bedeutungsschwere koloriert. Ziel ist es, die vorgestellten Episoden am Ende als erstrebenswerte Denk- und Handlungsmuster für rechtschaffene Menschen zu preisen.