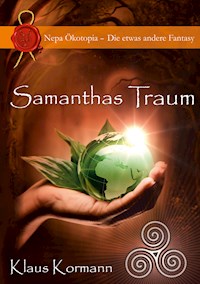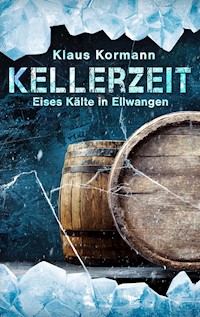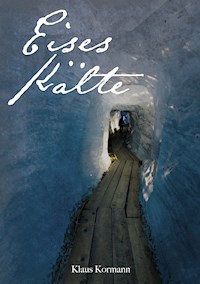8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klaus Kormann
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Samanthas Traum« ist ein modernes Märchen: Die Geschichte eines kleinen Mädchens, dessen Bestimmung es ist, die Menschheit mit Hilfe seiner besonderen Fähigkeiten vor der Vernichtung zu bewahren. Es geht um uraltes Wissen, die verzweifelte Suche eines Vaters nach seiner Tochter und den Glauben daran, dass noch nicht alles zu spät ist.Wann fängt dieser Planet an, sich gegen seine Ausbeutung zu wehren?Wann wird die Klimakatastrophe ein Ausmaß erreicht haben, dasvollkommen unbeherrschbar ist? Hat das Leben auf der Erde dann noch eine Chance?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Klaus Kormann
Samanthas Traum
Personen und Handlung dieses Romans sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
2022
Alle Rechte vorbehalten
Klaus Kormann
Spindelstraße
48356 Nordwalde
www.klaus-Kormann.de
+4915202011692
Cover: Dream Design – Cover and Art, Eitzweiler
ISBN9783987564451
Originalausgabe 2012
© 2012 NEPA Verlag, Merkers-Kieselbach
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung des Autors wiedergegeben werden.
Klaus Kormann
Samanthas Traum
Roman
Für Rebecca, Benjamin und Rosalyn
Und für alle Menschen, die davon träumen, dass wir es doch noch schaffen, den Klimawandel zu verhindern oder wenigstens erträglich zu gestalten.
Sam
»Hallo Papi, ich liege hier, neben dir!«
»Das ist schön, Sam.«
Toms Hand taste sich einige Zentimeter weiter nach rechts. Dann berührte er Samanthas zarte Hand. Sofort schlossen sich ihre Fingerchen und hielten sich fest.
»Das ist schön hier, Papi. Und so schön warm!«
Sie lagen auf dem vielleicht zehn Quadratmeter großen, mit grünem Kunstrasen bezogenen Holzpodest im Schwimmbad im Schwarzwaldhotel.
Tom lag auf dem Rücken und hatte die Augen geschlossen. Um sie zusätzlich zu schützen, hatte er sein Handtuch über die Augen gelegt. Über ihnen brannten rote und weiße Lampen, die hauptsächlich wärmten, aber auch einen Bräunungseffekt haben sollten. Er musste aufpassen, dass die zarte Haut der fast Viereinhalbjährigen nicht verbrannte. Sie würden nur wenige Minuten hier liegen bleiben und dann wieder schwimmen gehen. Er dachte an den Kunstrasen unter ihnen und daran, dass dieser vermutlich von Bakterien wimmelte.
»Hast du dein Handtuch untergelegt?«, fragte er.
»Ja!«
»Und liegst du auf dem Bauch und guckst nicht in die Lampen?«
»Ja!«
»Braves Mädchen!« Er tätschelte sanft die Hand des Kindes.
Gestern Abend waren sie angekommen, und heute Morgen hatte sie ihr erster Weg in das Schwimmbad geführt. Samantha hatte es sich gewünscht und in diesem Urlaub würde sie alles bekommen, was sie wollte. Tom würde es irgendwie ermöglichen, auch wenn das Geld knapp war.
Es war die erste gemeinsame Auszeit, die sich die beiden genommen hatten, seit Cynthia verschwunden war. Vier Tage Tochter und Vater zusammen in einem kleinen Hotel. Er hoffte, dass sie hier einigermaßen zur Ruhe kommen würden.
Sekunden, nachdem er verschwitzt und alarmiert hochgeschreckt war, verriet ihm der Blick auf den Wecker, dass es noch nicht einmal zwei Uhr morgens war. Benommen legte er sich wieder zurück, seine Hand tastete sich vorwärts und erwischte das Lampenkabel. Er knipste den Schalter. Das viel zu helle Licht, das auf die an das Dunkel gewöhnten Netzhäute traf, ließ die Lider sofort herunterschnellen. Er hielt seine Hand in die Höhe und versuchte, die stärksten Strahlen abzuhalten. Mühsam öffnete er die Augen. Was er sah, war jedoch auch keine Aufmunterung: ungewaschene Klamotten auf dem Boden, an der Zimmerdecke Spinnweben. Tom atmete schwer und konzentrierte sich darauf, die Luft bewusst bis in den Bauch zu transportieren, wie ihm sein Arzt geraten hatte. Die Gedanken kamen ungerufen. Seit mehr als zweieinhalb Jahren schlief er keine Nacht durch, immer wurde er von den gleichen Bildern heimgesucht. Jede Nacht! Jedes Mal, wenn er erschöpft die Augen schloss. Auch die allabendliche Betäubung mit immer stärkerem Alkohol verschaffte ihm keine Ruhe. Er versuchte, sich zu erinnern: Es mussten gestern fünf oder sechs Gläser Whisky gewesen sein, vielleicht mehr. Machte es einen Unterschied? Interessierte es jemanden? Nicht einmal ihn!
Tom konnte immer noch nicht begreifen, was damals passiert war.
Er kniff die Augen zusammen und ging seine Erinnerungen zum tausendsten Mal durch.
Er war eingeschlafen, und als er aufwachte, war Samantha, die alle nur Sam nannten, nicht mehr da. Er wusste, dass er nur einen kurzen Augenblick eingenickt sein konnte, denn er erwachte, als die Lampen über ihm erloschen. Dies taten sie alle 15 Minuten automatisch. Da er schon eine Zeit lang wach auf dem Podest gelegen und mit Samantha gesprochen hatte, konnte er nur für maximal fünf Minuten eingeschlafen sein. Wie ein immer und immer wieder gesehener Film hatten sich die folgenden Stunden in sein Gedächtnis eingebrannt.
Zuerst hatte er noch alleine nach seiner Tochter gesucht, hatte sogar in die Damentoilette hineingerufen. Doch es kam keine Antwort. Eine blonde junge Frau war so freundlich gewesen, die einzelnen Kabinentüren zu öffnen und nach Sam zu suchen. Ohne Erfolg. Er selbst hatte sich nicht getraut, die Räume mit der stilisierten Frau an der Tür zu betreten.
Dann hatte er den Bademeister informiert, der eine Lautsprecherdurchsage machte. Danach hatten sie noch einmal gemeinsam in alle Winkel im Badebereich geschaut, aber das Kind war nirgends zu finden. Beide Männer waren zutiefst beunruhigt gewesen.
Exakt zwölf Minuten hatte die Polizei gebraucht, um nach dem Alarm zu erscheinen. Plötzlich waren überall die blau uniformierten Gestalten zu sehen. Das gesamte Gebäude war professionell durchsucht worden, während Tom nägelkauend an dem großen Fenster stand und versuchte, irgendwo da unten im Gebüsch ein kleines Kind huschen zu sehen.
Voller Furcht beobachtete er, wie ein Notarztwagen auf dem Parkplatz vor dem Hotel einbog. Ein Taucher war in jedes Becken gestiegen und hatte sich mit der seiner Berufsgattung eigenen Kaltblütigkeit an die Arbeit gemacht. Das Schwimmbad gehörte zu einem Hotelkomplex, den man ebenfalls komplett durchsucht hatte. Alle Gäste waren befragt worden, auch die am Morgen Abgereisten hatte man telefonisch vernommen. Das gesamte Personal, Zulieferer und Handwerker, die sich an diesem Tag im Haus befunden hatten, unterzog man eingehenden Befragungen.
Wie im Film liefen die immer gleichen Szenen in Toms Gedächtnis ab: Während das Hotel von den Kriminalbeamten gründlich durchsucht wurde, saß er alleine in der Lobby. Genau da, wo ihn der Kommissar vor mehr als zweieinhalb Stunden hingesetzt hatte. Zuvor musste er allerdings mühselig überzeugt werden, sich endlich umzuziehen. Viel zu lange schon lief er in seiner Badehose herum und fing bereits an zu husten. Vor Nervosität hatte er die Fingernägel bereits fast vollständig abgekaut, eine Angewohnheit, die er eigentlich schon vor Jahrzehnten abgelegt hatte.
Der Kaffee, den ein mitfühlender Angestellter ihm auf den Tisch gestellt hatte, war längst kalt geworden.
Gelegentlich kam der leitende Ermittlungsbeamte, Hauptkommissar Dreyer, wie Tom sich erinnerte, zu ihm und stellte Fragen.
Niemand hatte das Kind gesehen.
Voller Beklemmung erkannte Tom aus dem, was ihm Dreyer erzählte, beziehungsweise aus der Art, wie er Fragen stellte, dass sich offensichtlich keiner der Badegäste im Schwimmbad an Samantha erinnern konnte. Auch die anderen Hotelgäste und die Angestellten konnten keine Angaben machen.
Natürlich hatte die Polizei sofort in Toms Zimmer nachgeschaut, ob das Kind sich dort befand. Doch jetzt kam man endlich auf die Idee, den Raum gründlich zu inspizieren. Es ergaben sich keinerlei Hinweise darauf, dass sich in dem Raum ein Kind aufgehalten hatte. In den Anmeldeunterlagen des Hotels tauchte Samantha nicht auf. Tom war laut Anreisebestätigung und Buchung allein angereist.
Am späten Nachmittag endlich war der diensthabende Ermittler auf Tom zugekommen. Er war mechanisch aufgestanden. Dreyer hatte sich ein quietschgelbes Bonbon in den Mund gesteckt und gesagt: »Herr Stolbe, bitte begleiten Sie mich ein Stück!«
Er war dem Mann gehorsam, fast apathisch aus der Hotellobby gefolgt. Der Kommissar ging voraus, den Pfad hinunter, der vor dem Hotel verlief.
Tom hatte Angst vor dem, was er ihm mitteilen würde. Sie gingen eine Zeit lang nebeneinander her.
Schließlich brach der Beamte das Schweigen. »Hören Sie, ich weiß nicht, was hier los ist. Zuerst waren wir sehr besorgt, als wir hörten, dass ein kleines Mädchen vermisst wird. Wir gehen natürlich immer vom Schlimmsten aus und sind dann erleichtert, wenn sich die Befürchtungen auflösen, weil der Sachverhalt ganz harmlos ist.«
»Sie haben Samantha gefunden? Ist sie vielleicht bei ihrer Mutter?« Tom fasste den Kommissar am Arm und fragte nochmals hoffnungsvoll: »Hat Cynthia sich gemeldet? Ist Samantha bei ihr?«
»Nein!«
Dreyer wischte Toms Hand von seinem Ärmel. »Nein, ist sie nicht. Wir haben zwar überhaupt keine Information über diese Cynthia, die Sie damals als vermisst gemeldet haben, aber Ihre Tochter ist garantiert nicht da. Doch ich will Ihnen der Reihe nach und in aller Ruhe sagen, was wir angenommen hatten: Zuerst rechneten wir mit einem Unfall, was sich zum Glück nicht bewahrheitet hat. Dann damit, dass das Kind sich verlaufen haben könnte. Aber auch das können wir mittlerweile mit Sicherheit ausschließen. Dann befürchteten wir einen Entführungsfall. Doch das ergab überhaupt keinen Sinn. Warum sollte ein Entführer, der vielleicht Lösegeld erpressen will, sich die Mühe machen und alle Hinweise auf das Kind vernichten?«
Dreyer machte eine kurze Pause, bevor er fortfuhr: »Dann rückten Sie in den Fokus unserer Ermittlungen.«
Tom blieb stehen und sah den Kommissar entsetzt an. Harte, stahlblaue Augen erwiderten seinen Blick. Dann nickte der Mann jedoch ernst und ging ruhig weiter. Tom folgte ihm.
»Sie wären leider nicht der erste Vater, der sein eigenes Kind tötet und dann versucht, den Verdacht von sich zu lenken. Zugegeben, diese Geschichte wäre ziemlich abstrus, aber wir haben in der Vergangenheit noch viel unwahrscheinlichere Sachen erlebt. Verbrecher zeichnen sich in der Regel nicht durch eine besonders hohe Intelligenz aus.«
Tom sah entsetzt und verwirrt zu dem Kommissar auf. »Sie – Sie haben mich in Verdacht? Ich soll …«
»Nein«, unterbrach Dreyer ihn entschieden. »Nein, haben Sie nicht. Sie haben vermutlich niemandem etwas getan, außer uns auf Trab zu halten. Normalerweise müsste ich gegen Sie Anzeige erstatten wegen Vortäuschung einer Straftat oder wenigstens wegen groben Unfugs, aber das werde ich nicht tun. Ich denke eher, dass Sie sich in Behandlung begeben sollten.«
»Ich … ich verstehe Sie nicht«, stotterte Tom, der nicht glauben konnte, was er gerade hörte.
»Sehen Sie, Herr Stolbe«, erläuterte Kommissar Dreyer. »Wir gehen in solchen Verdachtsfällen immer gleich vor. Zuerst versuchen wir, festzustellen, wer wann Ihre Tochter zuletzt gesehen hat. Dann checken wir das Umfeld: Freunde, Schule und so weiter. In diesem Fall natürlich nicht die Schule, sondern den Kindergarten. Wir sprechen mit der Erzieherin oder dem Erzieher, ob ihnen irgendetwas aufgefallen ist, was das Verhältnis Eltern – Kind angeht. Bei größeren Kindern kontaktieren wir selbstverständlichen die Schule und suchen die Lehrer auf, oftmals gehen wir in die Sportvereine und sprechen mit den Trainern. Das ist das normale Vorgehen, das immer zu irgendwelchen Erkenntnissen führt. So auch in diesem Fall.«
Dreyer machte eine kurze Pause, wohl in der Hoffnung, Tom zu irgendeiner Reaktion zu bewegen, doch der blieb stumm.
Dann fuhr er fort: »Unsere Erkenntnis ist, dass niemand eine Samantha Stolbe kennt. Kein Kindergarten, keine Spielstube, keine Nachbarn, keine Freunde und so weiter, auch kein Kinderarzt. Alle von Ihnen angegebenen Kontakte sind ins Leere gelaufen. Und unsere Anfrage beim Melderegister hatte das Resultat, dass dort niemals eine Samantha Stolbe gemeldet war.«
Er sah Tom nachdenklich und gleichzeitig auffordernd an. »Ich denke, Sie sind mir eine Erklärung schuldig.«
Tom hatte Schwierigkeiten, das Gehörte zu verarbeiten. Er verstand das alles nicht.
»Sie wollen mir erklären, dass Sie mir nicht glauben?«, fragte er leise.
»Ich will Ihnen erklären, dass wir auch über Sie Nachforschungen angestellt haben. Und dass Sie diese Nummer nicht zu oft abziehen sollten. Damals mit Ihrer angeblichen Frau, jetzt mit ihrer Toch…«
Weiter kam der Beamte mit seiner Erklärung nicht, denn Tom griff ihn mit einer Gewalt und Geschwindigkeit an, die er sich selbst nicht zugetraut hätte. Doch für Dreyer war er bei Weitem nicht schnell genug. Sekundenbruchteile später lag er auf dem Boden, den Arm auf den Rücken gedreht. Der Kriminalbeamte drückte ihm sein Knie ins Kreuz.
»Hören Sie, Stolbe«, zischte der Mann durch seinen kaum geöffneten Mund. »Ich weiß nicht, was mit Ihnen los ist. Ich persönlich glaube nicht, dass Sie gefährlich sind, obwohl ein Angriff auf einen Polizeibeamten immer eine kritische Sache ist. Es kann allerdings sein, dass meine Kollegen das ganz anders sehen. Also empfehle ich Ihnen jetzt, ganz ruhig zu bleiben, denn ansonsten verschwinden Sie für einige Zeit in einer Anstalt. Ich lasse Sie jetzt los und Sie stehen ruhig auf. Ich werde nichts gegen Sie unternehmen und Sie versprechen mir, in Zukunft die Polizei in Ruhe zu lassen. Keine Vermisstenmeldungen mehr, die nur Ihrem Hirn entsprungen sind! Okay?«
Tom nickte langsam, der Druck in seinem Rücken ließ nach. Vorsichtig stand er auf. Dreyer schien ihn in Ruhe zu lassen. Aber er ahnte, dass er von dem Polizisten oder seinen Kollegen keine Hilfe mehr zu erwarten hatte.
»Sie sollten einen Arzt aufsuchen!« Die Stimme klang dumpf, wie durch zähen Nebel.
Dreyer stand vor ihm und redete auf ihn ein. Tom nickte nur noch, vollkommen erschöpft. Langsam gewann die Erkenntnis Oberhand, dass ihm niemand helfen würde. Auch dieser Mann war offensichtlich überzeugt, dass Samantha nur ein Hirngespinst von ihm war. Genauso, wie man es damals bei Cynthia dargestellt hatte. Und er selbst konnte wahrscheinlich froh sein, wenn man ihm wegen des angeblich unnötigen Polizeieinsatzes keine Scherereien machte. Er schüttelte den Kopf und ging langsam zurück, Richtung Hotel.
»Gehen Sie zu einem Arzt!«, rief Dreyer ihm nochmals hinterher.
Im Hotel packte er seine Sachen.
Es war ausschließlich Kleidung für einen erwachsenen Mann in den Schränken, nichts für ein vierjähriges Kind. Der kleine rosa Rollkoffer, den seine Tochter so geliebt hatte, war ebenfalls verschwunden. Benommen ging Tom hinunter zur Rezeption, um auszuchecken. Dort sah man ihn mitleidig an. Auf der Rechnung war nur ein Erwachsener ausgewiesen.
Es war, als wäre Samantha niemals da gewesen.
Gent
Tom konnte es nicht fassen, dass er tatsächlich hier war.
Gent!
Cynthia hatte immer davon gesprochen, dass sie unbedingt diese Stadt besuchen wollte. Er selbst hatte vorher kaum eine Ahnung gehabt, wo sie genau lag.
Doch in der vorletzten Nacht hatte er erstmals nicht von Samantha geträumt, sondern die Vision einer Stadt gehabt. Er hatte Kanäle gesehen, Kirchen und französische Restaurants. Und es war ihm vollkommen bewusst, dass dieser unbekannte Ort Gent war.
Noch während des Frühstücks – eine Tasse schwarzer Kaffee und eine Scheibe eingetrockneter Toast war alles, was er Frühstück nennen konnte – hatte er den Rechner hochgefahren und gegoogelt.
Die Kirchen und die Kanäle, die Restaurants, jedes einzelne Bild aus seinem Traum erschien auf dem Bildschirm!
›Das kann nicht sein! Hatte ich die Seiten vielleicht vorher schon mal aufgerufen? Und dann davon geträumt?‹
Gedanken, flüchtig und ohne Ursprung, stiegen in ihm auf. Wie so oft in den letzten Monaten fing er an, an seiner Zurechnungsfähigkeit zu zweifeln. Dann stellten sich sämtliche kleinen Härchen auf seinen Armen auf. Der Schauder lief langsam über seine Schultern und dann den Rücken herunter.
»Geh’ nach Gent!«, sagte Samanthas Stimme.
»Sam?«, hatte er aufgeregt gerufen.
Doch da war nur Stille.
Gent?
Cynthia hatte immer von Gent gesprochen, sie hatte unbedingt einmal dorthin gewollt. Er hasste die Stadt schon aus dem Grund, weil ihn allein ihr Name an seine Frau erinnert hatte. An die Frau, die ihn, ohne ein Wort zu sagen und ohne an ihre kleine Tochter zu denken, verlassen hatte.
Niemals wäre er auf den Gedanken gekommen, auf Cynthias Spuren zu wandeln. Doch jetzt sah die Sache anders aus! Jetzt hatte Sam ihn gerufen!
Sofort hatte er seine Sachen gepackt und sich in den alten Nissan geworfen. Vier Stunden später war er bereits durch die Einbahnstraßen der alten belgischen Stadt geirrt. Auf der Suche nach einem bezahlbaren Hotel oder wenigstens einem Parkplatz.
Das war gestern gewesen. Jetzt saß er in einem Bistro an der Korenlei und überlegte, wie er so irrational hatte handeln können. Früher, als er noch einen Job hatte, wäre ihm das nie passiert. Er hatte keinen Grund, hier zu sein.
Außer einer Stimme, die es ihm gesagt hatte. Eine Stimme, die seiner Tochter gehörte, deren Existenz er mittlerweile fast selber anzweifelte.
Ihm wurde klar, dass sich seine Gedanken ausschließlich um Samantha drehten, sein geliebtes Kind, das auch nach Auskunft seines Arztes niemals existiert hatte. Genauso wenig wie nach Auskunft der Kindergärten, Nachbarn und Freunde.
Alle logen ihn an.
›Du musst unbedingt einen Arzt finden, der dich versteht und behandeln kann‹, sagte er sich in einem lichten Moment.
Es war einer der ersten schönen Frühlingstage und die Straßencafés hatten sofort geöffnet, um jeden Euro mitzunehmen, den es zu verdienen gab. Er sah nachdenklich über den Kanal auf das gegenüberliegende Ufer, die Graslei.
›Graslei! Korenlei! Komische Namen haben die Straßen hier. Hauptsache, irgendwas mit ›lei‹. Was hatte Cynthia hier gewollt? Die Typen anschauen, die da drüber sitzen? Die kommen anscheinend auch alle raus, wenn die Sonne erscheint. Penner, Junkies, Bordsteinschwalben!‹
Überhaupt die Frauen. Tom war schlechter Laune, trotz des schönen Wetters. Der Gedanke, sich ernsthaft einer Therapie unterziehen zu müssen, verdrängte jedes positive Gefühl. Niemals hätte er gedacht, dass Frauen allgemein so ungepflegt aussehen könnten. Einzelne vielleicht einmal, okay. Aber heute hatte er das Gefühl, dass alle Mädchen irgendwie billig und schlampig aussahen. Hohe Hacken, dünne Kleidchen, alles sah aus wie von »Cheap and Awfull«. Nichts passte zusammen, nichts hatte Stil. Na ja, die Kerle, die sich offensichtlich sowieso nie wuschen, hatten auch nichts Besseres verdient! Aber die Frauen!
Er schüttelte den Kopf. Er wusste, dass seine schlechte Laune überhaupt nichts mit dem Aussehen der Frauen und Männer in seinem Umfeld zu tun hatte, sondern dass er sich schlicht und einfach ärgern wollte, um ein Ventil für seine Missstimmung zu haben. Er beschloss, im Sommer noch einmal hierherzukommen, wenn es wärmer wäre. Dann würden die Kleider sicherlich noch etwas kürzer sein und er könnte dem Anblick vielleicht doch etwas abgewinnen! Eventuell würde sich dann seine Stimmung heben.
›Was mache ich hier?‹, fragte er sich zum hundertsten Mal.
Heute früh war er in einem kleinen, für ihn eigentlich viel zu teuren Hotel am Kanal aufgewacht. Nur weil ein Traum und eine imaginäre Stimme ihm gesagt die Anweisung gegeben hatten, nach Gent zu fahren!
›Sehen Sie, Herr Doktor, mir hat eine Stimme gesagt, dass ich fahren soll, und da bin ich natürlich sofort losgefahren! Ich mache immer, was mir irgendwelche Stimmen sagen.‹
Er malte sich aus, wie ihn der Therapeut sofort einweisen lassen würde. Wenigstens seinen Sarkasmus hatte er offensichtlich wiedergewonnen. Und doch wusste er, dass diese Stimme tatsächlich der Grund für die Reise gewesen war. Samantha hatte zu ihm gesprochen und er war ihr gefolgt. So einfach war das Leben manchmal. Ohne weiter zu hinterfragen, ob seine Reaktion eine vernünftige war, hatte er seine Sachen gepackt. Zwanzig Minuten später war er auf die Autobahn Richtung Belgien eingebogen.
Tom schüttelte den Kopf, als er jetzt mit etwas Abstand darüber nachdachte. Irrational handeln, das war ihm aus seinem früheren Leben völlig fremd. Erinnerungsfetzen tauchten auf.
›Früher‹, dachte er …
Früher. Das war, bevor Samantha verschwunden war … Als sie noch eine Familie waren … Früher, als er noch einen richtigen Job hatte … als Geld noch kein Problem war …
Cynthias Verschwinden hatte er noch überwinden können. Sam war da und sie brauchte ihren Vater. Er hatte keine Zeit gehabt, sich verlassen zu fühlen. Funktionieren war angesagt. Er hatte eine Aufgabe und einen Lebensmittelpunkt, musste für seine Tochter da sein und zusätzlich sein eigenes Leben meistern. Wenig Raum blieb da für die Frau, die ihn und die gemeinsame Tochter ohne ein Wort im Stich gelassen hatte. Er musste einfach funktionieren!
Doch als auch sein Kind genauso spurlos und unerklärlich verschwunden war, brach alles über ihm zusammen. Er wurde fahrig, unzuverlässig. Irgendwann erschien er nicht mehr zur Arbeit, sie bedeutete ihm nichts mehr. Alkohol nahm nach und nach die Position des verlässlichen Partners ein. Immer und überall verfügbar, niemals Fragen stellend.
Obwohl es erst früh am Nachmittag war, bestellte er sich ein frisches Bier und sah sich weiterhin das Treiben auf den Straßen an. Junge Frauen in ihren luftigen Kleidchen, lange Beine. Die Gedanken an Samantha verliefen sich im Grau seiner Erinnerungen, der Hass auf Cynthia ebenso. Die Mädchen; alle falsch; alle künstlich; alle Flittchen; alle irgendwie … schneller, dreckiger Sex kam ihm in den Sinn.
›Wenn die hier meine Gedanken hören könnten!‹ Tom sah sich schon im Kanal treiben, das Gesicht nach oben und blutverschmiert. ›Die Belgier verstehen da sicherlich keinen Spaß! Und es ist auch einfach unfair, so zu denken. Das sind alles normale junge Frauen. Ich bin derjenige, der hier falsch ist. Vielleicht falsch in dieser Welt, an diesem Ort, in dieser Zeit. Ich muss zur Ruhe kommen! Positiv denken. Muss diese Trugbilder loswerden; muss wissen, wer ich wirklich bin.‹
»Es ist richtig so!« Er erstarrte. »Du darfst mich nicht aufgeben! Es muss alles so passieren, wie es passiert. Es ist alles richtig so.«
Samanthas Stimme war so klar und deutlich, wie er sie selten gehört hatte. Vorsichtig sah er sich um. Da war diese Angst, vielleicht einen Schatten oder irgendein anderes flüchtiges Bild zu verscheuchen. Das Einzige, was er wahrnahm, war die unübersehbar reale Kellnerin, die sich mit seinem Bier näherte. Sie stellte es auf seinen Tisch und wartete. Mechanisch zog er sein Portemonnaie, guckte die Frau kaum an. Sie kassierte und verschwand.
Ein kalter Schauer legte sich auf seinen Nacken, als seine Vernunft ihm sagte, dass er Stimmen hörte. Stimmen, die nicht da waren! Ein klassisches Signal für beginnenden Wahnsinn, nur mit dem Unterschied, dass er diese Wahrnehmung jetzt schon seit so langer Zeit immer wieder hatte.
Er verstand, was das bedeutete. Seit mehr als zwei Jahren jagte er jetzt Samantha hinterher. Seiner Tochter, von der alle behaupteten, dass sie nur ein Hirngespinst, eine Einbildung, sei. Ebenso wie Cynthia.
Mit allen, die die Existenz seiner Tochter oder seiner Frau infrage gestellt hatten, hatte er über kurz oder lang gebrochen. Er hatte diese Leute wahlweise für verrückt, ignorant oder böswillig erklärt und die Verbindung zu ihnen abgebrochen. So war es wohl am einfachsten.
Doch allmählich wurde ihm bewusst, dass in Wirklichkeit wohl er es war, der sich seine Familie schlichtweg erdacht und darüber den Kontakt zu den echten Menschen verloren hatte. Er war derjenige, der nicht normal war. Es musste sich etwas ändern. Er musste etwas ändern!
Die Bilder auf seiner Netzhaut fingen an zu flimmern. Tom schloss die Augen und konzentrierte sich.
Als er wieder aufblickte, sah er vor sich sein Bier, dahinter den Kanal und auf der anderen Uferseite die Junkies und Penner. Und die Nutten, ›die normalen jungen Frauen‹, wie er sich selbst zur Ordnung rief, sahen aus wie vorher. Irgendwie war auch das idyllisch, aber vor allen Dingen war es die Wirklichkeit, keine Wahnvorstellungen.
›Ich muss in der Realität ankommen, sonst gehe ich kaputt! Ich brauche eine Therapie!‹
Als er sein Glas erneut in die Hand nehmen wollte, bemerkte er auf der anderen Kaimauer eine Bewegung. Einer der Penner fing an, in einer alten Plastiktüte zu kramen. Er fummelte eine Bierdose heraus und öffnete sie umständlich. Tom konnte das Ploppen und Zischen über den Kanal hinweg hören. Viel Schaum spritzte auf den Uferweg. Offensichtlich war die Dose vorher ordentlich durchgeschüttelt worden. Und genauso offensichtlich freute sich der Penner über den Schaum und darüber, dass noch etwas Bier in der Dose verblieben war. Kichernd setzte sich der Clochard aufrecht hin. Dann nahm er mit der linken Hand seine Schirmmütze ab und wischte sich mit dem Ärmel über die schweißnasse Stirn und Glatze.
Der Mann mit dem rundlichen Gesicht hob die Bierdose in die Höhe und prostete über den Kanal hinweg Tom zu. Über fast zwanzig Meter Entfernung brannte sich ein stahlblauer Blick in Toms Augen. Eine unbeschreibliche Klarheit und Tiefe lag in dem Blick des Penners.
Tom stockte der Atem. Sein Herz schien einen Moment auszusetzen. Er erkannte im gleichen Augenblick, dass er genau wegen dieser Begegnung nach Gent gerufen worden war.
Er sprang auf und stieß dabei gegen seinen Tisch. Das Glas fiel herunter, zersprang und ergoss seinen Inhalt auf den Boden, doch zu diesem Zeitpunkt war er schon einige Meter entfernt.
»Bastard!«, rief ihm die Kellnerin hinterher.
Die Khynn
Dyron stand in seinem Refugium und sah aus dem Fenster, das von der Zimmerdecke bis zum Boden reichte. Sein Blick fiel über den Loch Snizort Beag, der sich im Osten tief unterhalb der Klippen befand.
Das Schloss der Khynn, High Pasture Hall, lag auf der Isle of Skye im Nordwesten Schottlands.
Der Frühling kündigte sich mit stürmischem Wind an. Zerfetzte, graudunkle Regenwolken rasten über den Himmel und bildeten immer neue Formationen, eine lange Dünung ließ vereinzelte, kleine Boote in der lang gezogenen Bucht tanzen. An der felsigen Küste brachen sich die Wellen, weiße Gischt erhob sich für Sekundenbruchteile und fiel zurück in das graue Wasser. Möwen zerschnitten den scharfen Wind und stießen immer wieder hinab auf die Wasseroberfläche, um irgendwelches Getier oder sonstige Beute zu erhaschen.
Lange verharrte der Großmeister vor dem Fenster, die Hände auf dem Rücken. Es schien, als betrachtete er den aufziehenden Morgen, der sich mühsam durch die stürmische Szene arbeitete.
In Wirklichkeit aber dachte er an die uralte Prophezeiung, die innerhalb des Ordens von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Er erinnerte sich an den genauen Wortlaut, so wie er ihn von seinem Lehrmeister übernommen und wie er ihn selber unzähligen Schülern zur Bewahrung gelehrt hatte.
Obwohl die Druiden schon seit Jahrtausenden die Schriftsprache beherrschten, wurden die wirklich wichtigen Dinge immer nur mündlich überliefert. Der Zwang, die Geschichten zu erzählen und zu behalten, hielt sie lebendig. Alles Geschriebene hingegen galt den Druiden als tot und geriet im Laufe der Jahre in Vergessenheit.
Creol stand im Zimmer und wartete geduldig. Dyron stand den Khynn seit mehr als dreißig Jahren als Großmeister vor. Und obwohl er der mächtigste lebende Magier der Erde war und sein Können das Creols bei Weitem übertraf, verband eine innige Freundschaft die zwei Druiden. Beide wussten, dass ihnen eine große Herausforderung bevorstand.
»Es ist so weit, wir müssen uns wappnen. Die Mutter erwacht. Fast 30.000 Jahre war sie ruhig, aber jetzt erfüllt sich die Prophezeiung. Ich spüre es.«
Endlich drehte sich Dyron wieder dem wartenden Creol zu. Der Angesprochene nickte langsam.
»Ja, ich spüre es auch. Seit einigen Tagen, es wird immer stärker. Eine Schwingung, wie ich sie noch nie empfunden habe. Ja, es ist so weit. Gaia erwacht!«
Er ging ein paar Schritte auf den voluminösen Schreibtisch zu, von dem aus Dyron normalerweise die Geschicke der Khynn leitete, und stützte sich mit den Fingerspitzen darauf ab.
»Ist sie bereit?«
»Dyron, wir sind noch nicht so weit. Wir machen Fortschritte, aber …«
»Ich weiß, der Zeitrahmen war zu knapp. Dennoch, es ist seit Jahrtausenden die Aufgabe der Khynn. Und jetzt? Die Mutter erwacht zu früh, wir sind noch nicht vorbereitet. Sie wird sich der Menschheit entledigen, wenn wir sie nicht aufhalten! Wir haben nur diese einzige Hoffnung …«
Der Unfall
Tom war ausgelaugt, konnte sich nicht richtig konzentrieren. Er hatte den gestrigen Tag noch in Gent verbracht, doch es war nichts weiter passiert. Eine Zeit lang hatte er noch nach dem Clochard gesucht, doch der Mann blieb verschwunden.
Zurück im Hotel beendete er den Tag, indem er auf ein Abendessen verzichtete und stattdessen die Minibar fast leer räumte.
Direkt nach dem Frühstück – wieder Kaffee und ein trockener Toast – hatte er dann seinen Ausflug abgebrochen und sich auf den Rückweg begeben. In seinem Kopf schwirrten die Erinnerungen an die gestrige Begegnung.
›Es kann nicht sein, ich muss mich getäuscht haben. Ich kann den Mann noch niemals zuvor gesehen haben. Die Ähnlichkeit mit dem Polizisten damals muss Zufall gewesen sein.‹
Gent war aufwühlend und letztlich doch enttäuschend gewesen. Er wusste immer noch nicht genau, was ihn bewogen hatte, in diese ihm bis dahin völlig unbekannte Stadt zu reisen.
Natürlich, Samantha hatte ihn gerufen. Er hatte so viel Hoffnung in diese Reise gelegt, ohne eine Vorstellung davon zu haben, worauf er eigentlich hoffte. Die Begegnung mit dem Clochard hatte ihn sehr erregt. Tom hätte wetten können, dass er den Mann kannte. Die Erinnerung an den Kriminalbeamten, der bei Samanthas Verschwinden die Ermittlungen vor Ort geführt hatte, war überwältigend gewesen. In einem Flashback sah er den Polizisten von damals vor sich. Den Mann, der versucht hatte, ihn zu überzeugen, dass es in seinem Leben niemals eine Tochter gegeben hätte. Tom wollte ihn unbedingt zur Rede stellen, doch als er die andere Kaimauer erreicht hatte, war der Penner bereits verschwunden.
Frustriert über seinen sinn- und freudlosen Ausflug hatte Tom die Rückreise angetreten. Die Sehenswürdigkeiten Gents hatte er ignoriert. Wenige Minuten, nachdem er die deutsche Grenze überquert hatte, bemerkte er, wie ausgelaugt er eigentlich war. Diese Suche nach seiner verschwundenen Tochter, von der alle behaupteten, dass sie niemals existiert hatte. Die ständigen Selbstzweifel, ob er noch bei klarem Verstand war. All das hatte seine Spuren hinterlassen.
Und jetzt spielte sein Gehirn ihm auch noch Streiche, indem es ihm Menschen sehen ließ, die nicht da waren …
›Ich werde langsam, aber sicher verrückt. Bilde mir das alles nur ein. Der Penner in Gent war ein Penner und sonst nichts. Und Sam? Es muss ein Ende haben! Wenn ich zu Hause bin, gehe ich zum Arzt.‹
Tom fuhr sich mit der Hand über die Augen. Die Gegenfahrbahn schien Wellen zu werfen.
›Ich brauche dringend eine Pause!‹ Er zwinkerte mehrfach.
Kreischende Bremsen, das Geräusch von zersplitterndem Glas. Ein blauer Bus durchbrach ungefähr einhundert Meter vor ihm die Leitplanken und überquerte die Gegenfahrbahn. Wie durch ein Wunder konnten zwei entgegenkommende Fahrzeuge gerade noch ausweichen.
Entsetzt sah Tom das riesige Gefährt auf sich zukommen. Er riss das Steuer nach links und schaffte es knapp, dem Bus nicht in die Seite zu krachen. Er verfehlte ihn um vielleicht einen halben Meter. Im Rückspiegel beobachtete er, wie das gewaltige Fahrzeug von der Straße auf den Seitenstreifen geriet und fast in Zeitlupengeschwindigkeit auf die linke Seite kippte. Dabei rasierte es einige kleinere Bäume und Büsche ab und verschwand aus Toms Blickfeld, der wie paralysiert auf den Spiegel starrte und dabei versuchte, sein Auto auf der Straße zu halten.