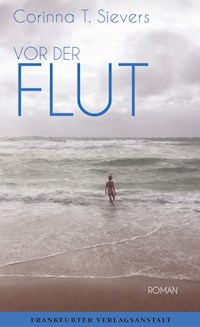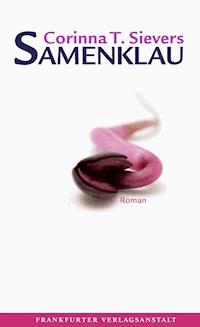
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Phoebe ist 42 und Kieferorthopädin in einer Gemeinschaftspraxis in Berlin. Auch wenn sie keine Beziehung hat, die für eine Ehe herhalten könnte, will sie noch ein Baby. Phoebes beste Freundin Pia hat schon Zwillinge und dafür ihren Beruf an den Nagel gehängt. Sie kann partout nicht verstehen, was Phoebe an Kindern findet, berät sie trotzdem und schickt sie nach Zürich in das Fünf-Sterne-Hotel "Baur au Lac". Wo sie, wie Pia meint, auf potente Erzeuger treffen dürfte. Tatsächlich macht Phoebe in Zürich die Bekanntschaft zweier Männer. Und mit einem von ihnen könnte sie sich weit mehr als nur eine Nacht vorstellen. Doch als sie ihn in Hamburg besucht, begegnet sie seiner ehemaligen Verlobten. Und Phoebe erfährt etwas, das ihre Pläne zunichte macht. Es kommt zum Eklat und die Katastrophe nimmt ihren Lauf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Corinna T. Sievers
S A M E N K L A U
Roman
Als Phoebe erwachte, roch sie Blut.
Sie sprang auf. Ein tiefrotes Koagel, das sich in der Horizontalen gebildet hatte, entwich und klatschte auf das Parkett. Sie fluchte und kniff die Schamlippen zusammen. Hechtete ins Badezimmer, über den Rand der Wanne und richtete den scharfen Strahl der Brause zwischen ihre Beine. Das Duschwasser färbte sich hellrot. Als es klar blieb, kletterte sie hinaus und suchte nach einem Tampon. So versorgt, begutachtete sie die Spur, die sie hinterlassen hatte. Auf dem Parkett rote Zehen. Fersen. Der Teppichboden war verschont geblieben. Sie holte einen Lappen.
Vierundzwanzig Tage dauerte ihr Zyklus und überraschte sie jedes Mal.
Phoebe sah in den Spiegel. Taxierte die Größe ihrer Poren. Die Tiefe ihrer Krähenfüße und von schräg seitlich ihr Kinn. Sie seufzte und griff nach einem Cremetiegel.
Phoebe war zweiundvierzig, Kieferorthopädin und pharmakologisch bewandert. Sie verfolgte wöchentlich die Fachliteratur zum Thema »Hautalterung«. Demnach halfen drei Dinge im Kampf gegen den Verfall:
UV-Strahlung zu vermeiden.
Äußerlich angewandte Säuren.
Und Hormone wie das Östrogen.
Phoebe hatte den Kampf aufgenommen.
Sie mied die Sonne.
Presste eine Zitrone täglich.
Und vermengte den Saft mit einer Salbe, die Patientinnen mit trockener Scheide die Gleitfähigkeit derselben zurück versprach.
Sie nannte ihr Rezept »Dr. Weihrauchs Jungbrunnen«. Bespachtelte Gesicht, Hals und Dekolleté. Busen und Po. Nur nicht die Scheide.
Die interessierte derzeit niemanden. Leider.
Gecremt, geschminkt und frisiert trat Phoebe zurück. Murmelte: »Nicht schlecht für Perimenopause«, und ging in die Küche.
Sie maß einen Meter siebzig und wog vierundfünfzig Kilo. Ihre Augen waren groß, rund, blau und kurzsichtig. Hinter einer Hornbrille bis zur Unkenntlichkeit verkleinert. Mamas Erbe. Zu besonderen Anlässen trug sie Kontaktlinsen. Die eine Qual waren.
Ihre Lippen voll. Das naturblonde Haar reichte bis zur Hüfte und war noch frei von grau. Fast.
Dann war da die Nase. Papas Erbe und etwas zu groß. Dennoch hatte Phoebe der Versuchung widerstanden, sich unter das Messer zu legen. Sie tröstete sich mit dem Gedanken an Lady Di, Barbra Streisand und Meryl Streep. Die Armada der Großnasigen.
Ihr Frühstück bestand aus Müsli, einer Tasse frisch gemahlenem Kaffee und einem Glas kalter Milch. Der Zeitungsmann hatte den »Tagesspiegel« auf die Fußmatte vor der Wohnungstür geschmettert. Phoebe begann mit den Todesanzeigen.
Sie bewohnte eine Altbau-Wohnung im fünften Stock eines Berliner Hinterhauses. Hundert Meter weiter nördlich stieß die Straße auf den Kurfürstendamm, und die Miete war hoch. Lediglich das Fehlen eines Aufzuges hatte die Eigentümerin davon abgehalten, Phoebe noch tiefer in die Tasche zu greifen. Die prominente Eigentümerin, bekannt aus Fernsehen und Klatschspalten. Die Küche ging offen in den stuckverzierten Flur über. Bot Ausblick auf die Dächer Berlins, Morgensonne zu jeder Jahreszeit und eine Bar.
Hier saß Phoebe, als ihr Blick auf das leere, zweite Sesselchen fiel. Bis vor einem Jahr hatte dort Peter gesessen. Ein smarter, gynäkologischer Kollege, mit dem sie außer dem Frühstück das Bett geteilt hatte. Gelegentlich jedenfalls. Wenn nicht seine Ex-Frau nach ihm rief. Ob Peter auch deren Bett noch teilte, blieb bis zum Ende beweislich unklar. Phoebes weibliche Intuition sagte »ja«.
»Mach dir keine Sorgen, dass deine biologische Uhr tickt, Liebling«, hatte Peter eines Morgens gesagt. Einen Blick auf Phoebes zerknittertes Frühstücksgesicht geworfen, »Frauen können heute ohne Weiteres bis fünfundvierzig gebären. Oder wir entnehmen dir einige Eizellen und frieren sie ein. Dann hast du noch mal zwanzig Jahre Zeit, dich für einen Erzeuger zu entscheiden.« Phoebe war zutiefst gekränkt gewesen. Fühlte sich damals meilenweit von der Menopause entfernt und gab Peter den Laufpass.
Als Nächstes hatte sie beschlossen, ihre Schlafgewohnheiten zu ändern. Wollte den morgendlichen Knitterfalten auf ihrer Stirn Paroli bieten und verzichtete auf ein Kopfkissen. Das half.
Sie blätterte um und stieß auf die Geburtsanzeigen.
Das Thema Kinder ließ sie nicht los. Nagte auch an diesem Morgen an ihrem Inneren. Sie griff zum Telefon und tippte die Nummer ihrer besten Freundin Pia. Die war eine promovierte Juristin, deren glanzvolle, akademische Karriere wegen eines zweijährigen Zwillingspärchens ruhte. Man konnte sie ohne Weiteres um sieben Uhr früh erreichen. Die Zwillinge waren schon lange auf den Beinen. »Sie schlafen nie«, erklärte Pia gelegentlich, »nicht einmal in der Nacht. Sie sind vollkommen resistent gegen jeden Ratschlag, der mir zuteil wird. Ich sehe morgens aus wie ein alter Waschlappen.« Phoebe hätte gern wie ein alter Waschlappen ausgesehen. Würden ihr nur die Zwillinge gehören.
»Pia Andarmani«, meldete sich eine atemlose Stimme. Pia hatte den Namen ihres persischen Ehemannes angenommen. Die Jungen dessen olivfarbenen Teint. Sie heulten im Hintergrund. »Pia«, sagte Phoebe, »wir müssen uns sehen.« – »Hast du Sorgen?« fragte Pia. Erwog bereits die Kandidaten, die als Babysitter für denselben Abend zur Verfügung standen, und beschloss, ihren Mann in die Pflicht zu nehmen. »Ich brauche deinen Rat«, erklärte Phoebe, »heute Abend um neun in der ›Weißen Maus‹?« Pia sagte zu.
Vor Phoebe lag ein langer Arbeitstag. Nach Hause käme sie nicht mehr. Würde direkt von der Praxis in die ›Weiße Maus‹ fahren. Sie trat vor den Kleiderschrank und packte eine Tasche mit angemessen erscheinender Abendgarderobe. Einer Jeans. Und einem Wildledertop von Escada, das weich und fleckenlos war. Phoebe hasste es, wenn etwas kratzte. Schlimmer noch, Flecken hatte. Vielleicht war sie ein wenig zwanghaft.
An der Küchenwand hing eine Schwarzwälder Uhr. Der Kuckuck rief sie zurück in die Realität. Schon acht »Kuckucks«. Sie warf den Löffel in die Müslischale, griff nach der Tasche und eilte aus der Tür.
In der Parkgarage gegenüber wartete ihr gelber SLK. Mochte die Kinderlosigkeit Entbehrungen mit sich bringen, so erlaubte sie jedenfalls gewisse Privilegien. Einen Sportwagen zum Beispiel.
Unter dem Scheibenwischer klemmte ein Zettel. Phoebe runzelte die Stirn, rief sich zur Ordnung und murmelte: »Mimikfalten vermeiden.« Denn die machten alt. Sie griff nach dem Briefchen und las: »Botschaft ihres Parkplatznachbarn (Saab Cabrio). Möchte mir erlauben, ein Gläschen Prosecco mit Ihnen zu teilen, um den zauberhaften Eindruck, den Sie täglich hinterlassen, zu vertiefen. Heute Abend, irgendeine Bar?« Phoebe schmunzelte, zerknüllte den Brief und vergaß ihn.
Sie kurvte aus dem Parkhaus und dachte an ihre Patienten.
Sie liebte ihren Beruf. Die Praxis befand sich in Steglitz. Phoebe teilte dreihundert Quadratmeter mit einer Kollegin, sieben Mitarbeiterinnen und einem Zahntechniker. So viele Frauen beanspruchten Aufmerksamkeit. Eine war immer schwanger. Phoebe nie.
Unter den Patienten waren auch Erwachsene. Berlins Establishment, das sich nach vierzig den Luxus einer perfekten Zahnstellung leistete. Frauen mittleren Alters, deren Bemühen um den Erhalt der Jugend auch den Zähnen galt. Manchmal kam ein Mann. Er war wohlhabend, anspruchsvoll und selten zum Verlieben. Entweder verheiratet oder verschroben.
»Vielleicht sind alle erwachsenen Männer, die noch zu haben sind, neurotisch«, sagte Phoebe und stieß die Praxistür auf. Fragte sich nur, was aus Frauen wie ihr würde. Akademikerinnen, die es der Karriere wegen verpasst hatten, auf den Zug zu springen.
Die Sprechstunde begann um halb neun. Phoebe blieben zehn Minuten. Sie warf einen kurzen Blick auf ihre Post, schlüpfte in einen blütenweißen Kittel und schrubbte sich die Hände. Trug eine duftende Handcreme und ein Tröpfchen Chanel No. 5 auf. Während der Behandlung kam sie den Patienten sehr nahe. Sie sollten sich wohl fühlen.
Dazu gehörte auch Musik. Ihre CD-Sammlung konnte sich sehen lassen. Phoebe wühlte und wählte eine historische Aufnahme. Chopins Klavierkonzert Nr. 1 mit Arthur Rubinstein. Die Wände erzitterten in e-moll. Die Putzfrau hatte zum hundertsten Mal den Lautstärkeregler verstellt. Phoebe sprang auf und drehte leise. Warf einen letzten Blick in den Spiegel, kniff sich in die Wangen und ging dem ersten Patienten entgegen.
Die Patienten mochten Phoebe. Die meisten jedenfalls. Doch sie hütete sich vor Selbstzufriedenheit. Schließlich kommt Hochmut vor dem Fall. Auch bei Ärzten.
Heute erwartete sie Herrn Eberle, der bei ihrem Anblick aufsprang und mit beiden Händen winkte. Phoebes Augen befanden sich auf Höhe seines Adamsapfels. Den Kopf in den Nacken gelegt, lächelte sie ihm zu. Ging voran ins Behandlungszimmer und bat ihn, auf dem Behandlungsstuhl Platz zu nehmen. Befestigte eine Papierserviette über der haarigen Brust, wusch sich erneut die Hände und schlüpfte in die Handschuhe aus Latex.
Herr Eberle war homosexuell. Er befand sich seit einem Jahr in kieferorthopädischer Behandlung und gelegentlich auch in psychologischer, wie er berichtete. Wenn das Leben als Schwuler seinen Tribut forderte. Phoebe stellte die Rückenlehne des Stuhles zurück und strich ein wenig Creme auf die vollen Lippen. Was erotisch hätte sein können, würden diese nicht andere Männer küssen. »Bitte öffnen«, sagte sie und betrachtete ihr Werk.
Herrn Eberles Kiefer waren zu klein, die Zähne zu groß. Zur Platzbeschaffung hatte er vier davon opfern müssen. Das meiste war getan. Die Schneidezähne standen gerade. Fast schon ein George Clooney. Es waren noch einige kleine Lücken zu schließen.
Herr Eberle trug Brackets. Er war es als bekennender Schwuler gewöhnt, Aufmerksamkeit zu erregen. Da kam es auf die Zahnspange nicht mehr an.
Phoebe entdeckte allerlei Speisereste. Mit der Mundhygiene hatte das männliche Geschlecht seine Schwierigkeiten. Sie griff zur Polierpaste und bürstete hochtourig. Fünf Minuten später waren optimale Verhältnisse hergestellt.
Sie straffte Federn und tauschte Drähte. Nickel-Titan gegen Stahl. Legte sie ein in Schlitze und Röhrchen und ließ ihren Patienten wählen: »Welche Gummis zum Ligieren, Herr Eberle?« – »Lila und grün«, entschied der, woraufhin sein Gebiss einem Tulpenbeet glich.
Heterosexuelle hätten Tarnfarben bevorzugt.
Sie straffte den Rücken und sagte: »Das war’s für heute.« Verzichtete auf eine Ermahnung wegen mangelnder Mundpflege und würde die Politur auf die Rechnung setzen. Bat: »Fühlen Sie noch einmal, ob alles in Ordnung ist, Herr Eberle«, und beobachtete, wie die Zunge alle Winkel des Mundes erkundete. Überflüssigerweise auch nach außerhalb schnellte. Sie dachte: Jahrelange Übung, und sah sie Körperhöhlen erforschen. Leider keine weiblichen.
Herr Eberle lächelte und sagte: »Alles bestens.« Phoebe befreite ihn von seinem Umhang und der Opferrolle: »Wir werden noch zwei Monate lang Lücken schließen. Dann folgt die Feineinstellung. In spätestens einem halben Jahr sind Sie die Brackets los, Herr Eberle. Darf ich Sie bitten, den nächsten Termin in vier Wochen zu vereinbaren?« Herr Eberle nickte enthusiastisch, hopste vom Stuhl und tänzelte zur Tür.
Als er gegangen war, reinigte Phoebe den Behandlungsstuhl. Sie wischte, sprühte und wechselte aus. Herr Eberle hatte angegeben, HIV-negativ zu sein. Es genügte die übliche Routine.
Phoebe arbeitete vormittags gern ohne Helferin. Genoss es, unbeobachtet zu sein. Außerdem war Personal der teuerste Faktor einer Praxis.
Sie setzte sich an ihren Schreibtisch und ergänzte Herrn Eberles Kartei um allerlei Bemerkungen. Notizen zur Hygiene, zum Verlauf und persönlicher Natur. Herr Eberle hatte einen Pudel, dessen Name so unpassend war, dass Phoebe ihn immer wieder vergaß. Sie schlug ihn vor jedem Besuch nach: Pegasus.
Phoebe wusste, wie einfach es war, die Rechnung zu manipulieren. Hier ein Drähtchen mehr ligiert, da ein Zähnchen mehr gereinigt. Es mochte Kollegen geben, die dieser Versuchung erlagen. Phoebe betrog ihre Patienten nie. Es war eine Frage der Ehre.
Der Vormittag verging wie im Fluge. Um kurz nach eins hatte Phoebe sechs erwachsene Patienten versorgt.
Sie rüstete sich für ihre einstündige Mittagspause. Puderte vor dem Spiegel ihr glänzendes Gesicht und zog den Lippenstift nach. Man wusste nie, wem man begegnen würde. Sie hielt sich für den Erzeuger bereit.
Hunger hatte sie keinen. Doch ihr Gehirn brauchte Nahrung. Am besten Sushi. Viel Eiweiß, wenig Kalorien. Sie verabschiedete sich mit einem Nicken und eilte die Treppe hinab.
Den Angestellten verschwieg sie ihren Kinderwunsch. Gab vor, zum Single geboren zu sein. Das verhinderte nicht die Spekulationen über ihr Liebesleben. Oder das Fehlen desselben. Peter, der geschasste Gynäkologe, war auf allgemeine Begeisterung gestoßen. Sein Erfolgsrezept war erprobt. Neben Phoebes Herz und dem seiner Ex-Frau hatte er bereits das seiner Sekretärin und mehrerer Arzthelferinnen gestohlen. Sein Abgang hatte in Phoebes Praxis große Enttäuschung hervorgerufen.
Die Sushibar befand sich im Dachgeschoss des gegenüberliegenden Gebäudes. Ihre Glasfassade kontrastierte zum vorherrschenden Jugendstil der Schlossstraße.
Um einen Tresen standen fünfzehn Hocker. Das winzige japanische Ehepaar knetete und verteilte Kappa-Maki, Shinko-Maki und Inari im Akkord. An Ärzte, Anwälte und Steuerberater.
Phoebe ergatterte den letzten freien Hocker und machte ihre Bestellung. Sie fand sich zwischen zwei Anzugträgern wieder. Der Rechte trug einen neuwertigen Ehering. Phoebe wandte sich nach links. Der Linke blätterte in einer Zeitschrift, sah kurz auf und vertiefte sich wieder.
Fünfundfünfzig, schätzte Phoebe. Und erinnerte sich, dass Anzahl und Qualität der Spermien mit dem Alter nachließen. Von einer Erektion ganz zu schweigen. Andererseits hatte Picasso Tochter Maya mit dreiundfünfzig gezeugt. Mit seiner Geliebten, nicht mit seiner Frau. Als Paloma geboren wurde, war ihr Vater achtundsechzig.
Phoebe schöpfte Hoffnung. Hob das Glas mit einem Chardonnay aus Japan, der Zunge fremd, und prostete. Der Linke suchte nach Worten, räusperte sich und fragte: »Kennen wir uns?« – »Noch nicht«, flüsterte Phoebe und imitierte ein schüchternes Lächeln. Der Linke sah dieses mit Wohlwollen und straffte die Schultern: »Professor Matthäi, Jurist und Junggeselle.« Er brach in fröhliches Gelächter aus. Phoebe schlug eine Wolke säuerlichen Mundgeruchs entgegen, die das Bouquet des eigenartigen Weines überdeckte. Jeden Wunsch nach Fortpflanzung ersterben ließ.
Matthäi hielt seine behaarte Rechte ausgestreckt. Phoebe griff kraftlos zu: »Phoebe, angenehm.« – »Phoebe?«, wieder eine Wolke, »wie apart. Lassen Sie mich raten, in welches Büro Sie nach unserem kleinen Techtelmechtel zurückkehren: Steuerfachgehilfin? Bankkauffrau …?«, sein Blick fiel auf Phoebes Uhr: »… oder etwa Chefsekretärin?« Phoebe atmete durch den Mund, um bei der Ventilation ihrer Lungen den Geruchssinn zu umgehen. Zog ihr Visitenkärtchen aus der Tasche und übergab es: »Sie haben ein Problem. Kommen Sie in meine Sprechstunde.« Sie wandte sich nach rechts und verschlang ihr Sushi. Zahlte eilig die Rechnung und flüchtete mit einem Nicken.
Der Linke hob die Hand zum Gruß, in seinem Gesicht Verwirrung.
Foetor ex ore. Lateinisch für Mundgeruch. Mal süß, mal sauer, gelegentlich faulig. Kaum ein Patient wusste um dessen Ursachen. Man schob es auf den Magen und versuchte ein Mundwasser. Das wirkungslos blieb.
Ein Blick auf die Uhr und sie verfiel in einen Laufschritt.
Gegen acht verabschiedete Phoebe die letzte Patientin. Blickte in den Spiegel und holte tief Luft. Dachte: Eher wie fünfundvierzig, und beschloss, am Wochenende Schlaf nachzuholen. Für den Moment mussten ein Kaffee und eine weitere Schicht Puder genügen.
Sie ging zur Rezeption, wo ihre älteste Mitarbeiterin die Stellung hielt. Obwohl Frau Fittkau auf die Sechzig zuging, hatte sie unter den Patienten eine Reihe von Verehrern. »Mehr als ich«, sagte Phoebe. »Mehr als Sie?« fragte Frau Fittkau. Phoebe gab ihren Gedanken preis. »Ich bin ich selbst«, verriet Frau Fittkau. Und das stimmte: Feuerrotes Haar, unter dem Kittel ein wallender Busen. Vielleicht weckten nur die Brünhildes dieser Welt den Wunsch nach Fortpflanzung. Phoebe strich sich über den winzigen Po.
Sie verabschiedete sich um halb neun, betrat ihr kleines privates Badezimmer und wechselte die Kleidung. Entschied sich für eine Löwenmähne. Jedenfalls am oberen Ende Brünhilde. Verstaute die Hornbrille und verließ das Bad.
In den Räumen der Praxis herrschte Dunkelheit. Phoebe zog die Eingangstür hinter sich zu.
Der gelbe SLK parkte in einer Seitenstraße.
Sie war spät dran. Die enge Parklücke bereitete ihr keine Schwierigkeiten.
»Zu viele männliche Geschlechtshormone«, hatte Peter, der Verflossene, kommentiert. »Eine Frau dürfte so nicht ein- und ausparken können. Weshalb du auch noch nie schwanger geworden bist.« Damals hatte Phoebe noch gelacht; jetzt fürchtete sie, dass ein Körnchen Wahrheit in Peters Worten steckte. Hätte sie nicht wirklich, wie ihre Freundinnen auch, das eine oder andere Mal ungewollt schwanger werden müssen? Die Pille hatte sie nur kurzzeitig genommen. Und wegen der darauf folgenden Gewichtszunahme wieder abgesetzt. Danach hatte sie eine Spirale getragen. Und in einsameren Zeiten noch nicht einmal diese. Tauchte doch einmal ein Bettgenosse auf, trug der die Verantwortung für die Verhütung. Und so manches Mal im Eifer des Gefechtes eben auch nicht.
Als Phoebe die »Weiße Maus« betrat, entdeckte sie Pia an der Bar. Vor ihr stand eine Piña Colada.
Pias Figur hat die Geburt der Zwillinge nicht ganz unbeschadet überstanden. Sie wog fünfzehn Kilo zu viel und hatte kapituliert. Hatte, statt zu hungern, ihre komplette Garderobe ausgetauscht. Und trug statt Größe 36 nun 42.
Die Qualität ihrer Designerkleidung schmeichelte ihrer neuen Fülle allerdings, so dass ihre Attraktivität kaum gelitten hatte. »Jetzt bin ich Frau«, pflegte sie zu sagen, »außerdem haben Dicke weniger Falten.« Was stimmte, wie Phoebe feststellte, als sich Pia zu ihr umwandte. Pias glattes Gesicht strahlte. Ihr schulterlanges Haar, dessen ursprüngliche Farbe Phoebe unbekannt war, glänzte tiefschwarz.
Pia und Phoebe umarmten sich. Sie waren sich vor vier Jahren auf einem Vortrag begegnet. »Der Burnout der Akademikerin (wenn Frauen alles wollen)«. Zwei Jahre später hatte die Geburt der Zwillinge bei Pia zu einem Burnout geführt. Sie gab ihre Stelle auf und hatte trotzdem keine freie Minute. Phoebe und Pia sahen sich seltener. Ihrer Zuneigung tat das keinen Abbruch.
Phoebe bestellte einen Caipirinha. »Raus mit der Sprache, wo brennt es?«, fragte Pia und wippte erwartungsvoll auf ihrem Hocker. Phoebe sog an ihrem Strohhalm: »Ich will ein Kind. Und zwar sofort.« Die Leier kannte Pia. Zuckte die Schultern und sagte: »Nimm meine. Und meine fünfzehn Kilo auf den Hüften. Die schlaflosen Nächte kannst du auch haben. Gib mir dafür deinen SLK und dein Bankkonto, und wir sind quitt.« – »Ich scherze nicht, Pia«, sagte Phoebe, »ich leide. Nicht gelegentlich, sondern in jeder Minute. Mein Leben ist sinnlos, und ich spüre keine Mitte.« Pia kratzte sich unter dem Busen: »Na gut, du scheinst es ernst zu meinen. Aber irgendetwas mit deinem Timing stimmt nicht, meine Süße. Normalerweise kommt zuerst der Mann, dann das Baby.« Sie pausierte. »Und dann die Scheidung.« Sie fing Phoebes überraschten Blick auf. »Nein, nein, Shadan und ich, wir schaffen das schon. Aber leicht ist es nicht mehr, zueinander zu finden. Ich verbringe neunzig Prozent der Nächte bei den Zwillingen. Da läuft nicht mehr viel.« – »Männer«, gab Phoebe zurück und winkte nach dem zweiten Caipirinha, »wer braucht schon Männer. Jetzt bin ich zweiundvierzig. Mit achtzehn hatte ich den ersten Freund. Fünfundzwanzig Jahre Geliebte, und was hat es mir eingebracht? Gelegentlich einen Orgasmus, ansonsten nur Kummer. Ich will keinen Mann, ich will nur sein Sperma.« Pia kicherte: »Phoebe, wie rücksichtslos. Und wohin entsorgen wir den Erzeuger nach dem Akt?« – »Er muss ja nicht wissen, dass dieser Akt zweckgebunden war«, schlug Phoebe vor, »für ihn ist es ein ganz alltäglicher One-Night-Stand. Ich will auch kein Geld, geschweige denn seine Einmischung bei der Erziehung.« – »Aha«, sagte Pia, stieß auf und verzog schuldbewusst das Gesicht, »dann stellt sich die Frage, woher den geeigneten Kandidaten nehmen. Was muss er denn draufhaben?« – »Die richtige Genetik«, antwortete Phoebe und steckte sich eine Limettenscheibe in den Mund. »Damit meine ich Charakter und Intelligenz. Schönheit ist nicht so wichtig. Die kann man sich notfalls kaufen.« Pia strich sich über die Seite: »Wo, zum Beispiel, kauft man seine Wespentaille zurück?« – »Du spinnst«, sagte Phoebe, »du bist immer noch schön.«
Beide schwiegen einige Minuten lang. »Was hältst du von Samenbänken?« fragte Pia. Phoebe legte die zerbissene Limette zurück und schüttelte den Kopf: »Kein Vertrauen. Wer weiß, wie oft dort die Proben verwechselt werden. Dann bezahlst du für das Sperma eines Mathematikgenies und bekommst einen Olympiasieger.« – »Oder nichts von beiden«, ergänzte Pia, »weil die guten Eigenschaften bekanntlich eine Generation überspringen.« Phoebe hob die Augenbrauen: »Dann muss ich also die Großelterngeneration auskundschaften. Gut, dass du mich darauf gestoßen hast.« Pia schüttelte sich: »Meine Großmutter war ein Walross. Bei ihrem Tod wog sie fünfundneunzig Kilo. Und hatte Brüste wie zwei Wassermelonen. Die mein Großvater allerdings liebte. Als er ihr ein Jahr später folgte, fanden wir die schrägsten Dessous in ihrem Nachtschrank. Ich habe ein paar aufgehoben für den Fall, dass es mit mir so weitergeht.« Sie zupfte an ihrem Doppelkinn. »Aber zurück zu dir und deinem Problem. Nächster Punkt: Wo gibt es die prächtigsten Männer?« Phoebe kniff die Lippen zusammen: »Auf dem Flughafen in der VIP-Lounge.« Da ihr Glas schon wieder leer war, griff sie nach der Getränkekarte. Pia rollte mit den Augen. »Nun mal langsam.« Sie schob Phoebe ein Schälchen mit Erdnüssen zu. »VIP-Lounge? Willst du da ein Zelt aufschlagen? Keine Chance.« – »In der Hotelbar«, sagte Phoebe, »fünf Sterne natürlich.« – »Schon besser«, antwortete Pia, »da haben sie es nicht so eilig. Und das Bett ist auch nicht weit.« Phoebe riss die Augen auf: »Meinst du gleich am ersten Abend? Habe ich noch nie gemacht. Skandalös.« – »Augen zu und durch«, sagte Pia und klopfte Phoebe auf die Schulter, »willst du dir tagelang sein Gequatsche anhören, oder willst du sein Sperma?« Sie quiekte lauthals.
Als sich eine Hand auf Phoebes Schulter legte, verstummte Pia. Auf das Schlimmste gefasst, wandte sich Phoebe um. Ein Patient, ein Kollege? Wie viel hatte er gehört?
Hinter ihrem Hocker ein stattlicher Kahlkopf. Einen Meter fünfundachtzig und gut gekleidet. Der zwinkerte und sagte: »Aber, aber, meine Damen, warum so aufgeregt?« Pia hob die Augenbrauen und schwieg abwartend. Dann hatte Phoebe sich gefangen. Auf ihr Personengedächtnis war Verlass, und diesem Herrn war sie noch nie begegnet. »Wir sind nicht aufgeregt«, korrigierte sie, »wir sind nur temperamentvoll. Und im Übrigen: Warum fassen Sie mich an?« Der Glatzkopf lachte: »Nicht nur schön, auch noch schlagfertig.« Er streckte die Hand aus. »Henri Meinrad. Unsere Autos kennen sich.« Pia hob die Augenbrauen: »Eure Autos?« Endlich fiel Phoebe die morgendliche Botschaft hinter dem Scheibenwischer ein. »Saab Cabrio«, schlussfolgerte sie. Und an Pia gewandt: »Sein Parkplatz befindet sich neben meinem.«
»Wie reizend, dass Sie gekommen sind«, fuhr Saab Cabrio fort, »darf ich mich setzen?« Pia fixierte Phoebe misstrauisch und fragte: »Gibt es etwas, das du mir verschwiegen hast?« Sie rückte einen Hocker weiter und deutete auf den freien Platz zwischen Phoebe und sich. »Nehmen Sie Platz, Herr Henri. Darf ich direkt sein? Sie sind mitten in eine Lebenskrise geplatzt. Aber nun, da Sie schon einmal hier sind, können Sie uns vielleicht weiterhelfen.« – »Ich stehe mit Rat und Tat zur Verfügung«, tönte Henri ahnungslos. »Wer war ihr Großvater?«, fragte Pia und bemühte ihre Juristenstimme. Henri zuckte: »Mein Großvater? Habe ich richtig gehört?« Unsicher wanderte sein Blick zwischen Phoebe und Pia hin und her. Dann lockerte er die Krawatte. »Ich bitte um Bedenkzeit«, und zum Barkeeper gewandt: »Einen Wallbanger, bitte, damit ich das hier durchstehe.« Der junge Mann hinter dem Tresen trug einen wippenden Pferdeschwanz. Sagte: »Stets zu Diensten«, und entblößte eine Zahnlücke, wo früher ein mittlerer Schneidezahn gesessen haben musste.
Die »Weiße Maus« füllte sich. Das Durchschnittsalter betrug achtundzwanzig Jahre, das Höchstalter fünfundfünfzig. Man bemühte sich um Skurrilität. Henri ließ seine Blicke schweifen und zuckte die Schultern: »Keine Ahnung, warum Sie fragen. Aber Sie treffen einen wunden Punkt. Mein Großvater väterlicherseits war ein schwarzes Schaf. Er betrieb vor dem Krieg mehrere Friseur- und Kosmetiksalons, unter anderem in der Friedrichstraße und am Ku’damm. Die Immobilien gehörten ihm auch. Er war ein begnadeter Geschäftsmann und leidenschaftlicher Kunstsammler.« Henri streichelte seinen Wallbanger und vergaß zu trinken. »Leider auch ein Spieler. Er verlor alles bis auf ein paar Bilder. Meine Großmutter blieb an seiner Seite und gebar ihm einen Sohn. Das war mein Vater. Er war das Gegenteil meines Großvaters. Ohne jeden Geschäftssinn, aber hochmusikalisch. Als Kriegsgefangener musizierte er für die Russen und traf auf Tatjana, meine Mutter. Dann kam ich. Als mein Vater freigelassen wurde, nahm er meine Mutter und mich mit nach Deutschland. Um seine Familie durchzubringen, gab er Klavierstunden und trat als Entertainer auf. Er starb viel zu früh an einem Hodentumor und hinterließ uns keinen Pfennig. Von da an ging meine Mutter putzen, und ich verbrachte die Tage allein in unserer Zwei-Zimmer-Wohnung im Wedding. Meine Mutter starb, als ich einundzwanzig war und schon studierte. An einem Astrozytom, einem sehr bösartigen Hirntumor.« Henri schwieg betreten. »Sie sehen, ich bin kein Millionenerbe. Habe nichts bis auf ein paar Bilder.« – »Wir lieben Sie trotzdem, Henri«, sagte Pia und hob das Glas: »Worauf trinken wir?« – »Auf die Kinder armer Leute«, schlug Phoebe vor. Vor ihr stand der dritte Caipirinha. Sie stießen an. »Und wieso habe ich Ihnen damit weitergeholfen?« kam Henri auf den Anfang seiner Erzählung zurück. »Sollen wir es ihm verraten?« wandte sich Phoebe an Pia. Pia kicherte: »Einverstanden.« Sie reckte das Kinn. »Meine Freundin Phoebe ist auf der Suche nach einer Samenspende. Wohlgemerkt: nicht nach dem zugehörigen Spender, Herr Henri. Sie will ihrem Leben die Mitte zurückgeben in Person eines schreienden, sabbernden Säuglings. Und damit dieser Schreihals die richtige Genetik bekommt, muss zuvor die Familiengeschichte des Spenders ausgekundschaftet werden.« Die Enttäuschung in Henris Gesicht war unübersehbar: »Meine Damen, da fühle ich mich als Mann nicht ernst genommen. Und außerdem kann ich die Hoffnung auf diese bezaubernde Besitzerin eines Mercedes SLK wohl begraben.« Er legte den Kopf schief und betrachtete Phoebe. Dann wandte er sich an Pia: »Haben Sie auch ein Auto?« Pia hob den Zeigefinger: »Jawohl, und einen Ehemann.« Henri schüttelte den Kopf: »Also Freunde?« Alle drei hoben ihre Gläser: »Auf ewige Freundschaft«, sagte Phoebe, und sie stießen an.
Als Henri sich verabschiedete, war es nach Mitternacht: »Jetzt gehe ich besser, sonst sagen Sie noch: Vor dem müssen wir uns in Zukunft hüten. Den wird man ja gar nicht wieder los.« Er drückte Pia und Phoebe ein Küsschen auf die Wange, bezahlte die Rechnung und trabte davon. Kehrte zurück und legte seine Visitenkarte auf den Tisch: »Ich will Sie beide wiedersehen. Ich habe das Gefühl, das wird noch lustig.«
Als er gegangen war, sahen Phoebe und Pia sich an. »Witziger Kerl«, stellte Pia fest und nahm sein Kärtchen. »Unternehmensberater. Schade, dass ich verheiratet bin. Und du allenfalls sein Sperma wolltest.« – »Apropos«, unterbrach Phoebe, »wir haben uns noch nicht für die passende Hotelbar entschieden.« – »Das ›Ritz‹ in Paris?« begann Pia und gähnte. »Da hängen zu viele Franzosen herum«, wehrte Phoebe ab, »und mein Französisch ist miserabel.« – »Das ›Pierre‹ in New York?« legte Pia nach. »Zu weit weg.« Phoebe schüttelte den Kopf. »Stell dir vor, es klappt nicht gleich beim ersten Mal, und ich muss noch mal hin. Das kostet mich jedes Mal eine halbe Woche.« – »Das ›Baur-au-Lac‹ in Zürich«, sagte Pia und rieb sich die Augen. Sie hinterließ eine schwarze Spur von Mascara. »Das ist es!«, rief Phoebe und bemühte sich, Pias Gesicht mittels einer benutzten Serviette wiederherzustellen. »Eine Stunde mit dem Flieger, und die Typen sprechen deutsch. Oder so ähnlich.« – »Während des Samenklaus«, ergänzte Pia, »und wann fliegst du?« Phoebe dachte nach: »Hängt von meinem Zyklus ab. Aber erst einmal will ich noch zu meinem Gynäkologen und mich durchchecken lassen.« Ihre Gläser waren leer, und sie beschlossen, aufzubrechen. Phoebe erhob sich und schwankte. Pia fasste sie am Ellenbogen. »Nächstes Mal einen weniger, meine Liebe. Ich würde dich an die Haustür bringen, aber ich muss Shadan ablösen. Männer ertragen Kleinkinder nicht viel länger als ein, zwei Stunden. Dann sehnen sie sich zurück nach ihrer Freiheit, ihrem Fernseher und ihrem Bier.« – »Und ich muss morgen früh in die Praxis«, stellte Phoebe fest, »Geld verdienen. Für eine neue Garderobe und einige Nächte in der Grande Suite des ›Baur-au-Lac‹.« Sie verabschiedeten sich. Phoebe versprach, Pia auf dem Laufenden zu halten.
Die Zeit verging wie im Fluge. Phoebe arbeitete von früh bis spät. Sie hatte beschlossen, vor ihrer Reise nach Zürich zwei Kilo abzunehmen. Lief jeden Abend nach der Sprechstunde in den Supermarkt und kaufte Zutaten für einen Salat. Paprikaschoten, Tomaten, Gurke, Zwiebeln. Dazu eine ausgepresste Zitrone und einen Becher Naturjoghurt. Mehr gab es auch tagsüber nicht. Sie litt unter ständigem, nagendem Hunger und betäubte ihn mit schwarzem Kaffee. Konsultierte jeden Morgen ihre Waage und stellte fest, dass das Abnehmen mit zunehmendem Alter schwieriger wurde. Erinnerte sich, gelesen zu haben, dass ab dem dreißigsten Geburtstag der Durchschnittsbürger jährlich ein Kilo zunähme. »Nicht weil er mehr isst, sondern weil sein Stoffwechsel träger wird«, erklärte sie Pia am Telefon, »mit fünfundzwanzig habe ich fünfhundert Gramm pro Tag abgenommen. Jetzt höchstens noch hundert. Deprimierend, diese Aussicht.« Pia lachte Phoebe aus. »Du spinnst. Glaubst du wirklich, dass deine Chancen als Gerippe steigen? Und dann die Falten!« – »Ich bin es mir selbst schuldig«, gab Phoebe zur Antwort, »außerdem will ich das blaue Seidenkleid von Escada anziehen. Ein Traum, aber leider schmal geschnitten.« – »Hat mir auch mal gepasst«, erinnerte sich Pia, »weißt du noch, wie du es mir für meinen ersten Jahrestag mit Shadan geliehen hast?« – »Du bist trotzdem schön«, antwortete Phoebe routinemäßig.
Am selben Abend rief Henri an. »Schon schwanger?« sagte er, bevor er seinen Namen nannte. Phoebe prustete los. »Noch in den Vorbereitungen.« Sie erläuterte ihm den Stand der Dinge. »Ich wünschte, ich wüsste nichts von Ihren Plänen. Ich wollte, ich säße nichts ahnend an der Hotelbar des ›Baur-au-Lac‹ und ginge Ihnen ins Netz«, beschloss Henri das Gespräch.
Am Freitag hatte Phoebe einen Termin bei ihrem Gynäkologen Dr. Metzler. Seine Praxis befand sich schräg gegenüber und wirkte etwas schäbig. Aber er war der Beste. Mitunter saßen die Frauen Stunden im Wartezimmer, bevor sie vorgelassen wurden. Da Phoebe eine ärztliche Kollegin war, machte er für sie eine Ausnahme und bemühte sich um Pünktlichkeit. Als sie um zwölf Uhr Dr. Metzlers Praxis betrat, wurde sie gleich durchgewinkt. »Frau Kollegin«, sagte Metzler und hielt ihr die Pranke entgegen. »Was macht das Geschäft?« Er wedelte mit der Linken, um Phoebe an seinen Schreibtisch zu lotsen. »Danke, gut«, gab Phoebe zurück, setzte sich und begann: »Es ist mir sehr peinlich, aber ich leide unter Torschlusspanik. Ich will schwanger werden. Von wem, weiß ich noch nicht. Und Sie sollen mir sagen, ob ich dazu in der Lage bin.«
Metzler verzog keine Miene. Nie würde er über die Ansinnen seiner Patientinnen spotten. »Kein Problem«, stellte er fest und strich über das schlecht rasierte Kinn, »sollen wir gleich loslegen?« – »Gern«, antwortete Phoebe und stand auf. »Machen Sie sich untenherum frei, bitte«, sagte Metzler, »und kommen Sie hier auf den Stuhl.«
Barfuß und ohne Slip stakste Phoebe zum Untersuchungsstuhl. Erklomm ihn und spreizte die Beine. »Sie sind schlank«, bemerkte Metzler, »übertreiben Sie nicht mit Ihrer Diät. Das erschwert die Empfängnis.« Phoebe nickte. »Da fällt mir ein, Herr Metzler, dass mein Verflossener, der auch Kollege war, andeutete, mein Testosteronspiegel könne zu hoch sein. Ist das möglich?« Metzler musterte sie. »Ihr Gewicht deutet auf das Gegenteil hin. Verdächtig auf Anorexia nervosa. Kommt bei zu tiefem Testosteronspiegel vor. Wie gestaltet sich Ihr Zyklus?« – »Pünktlich alle vierundzwanzig Tage«, antwortete Phoebe. »Vorsichtshalber machen wir einen Hormonspiegel«, ordnete Metzler an, »wir nehmen nachher Blut ab, Frau Kollegin.«
Er schob das Spekulum in Phoebes Scheide. Ein riesiger Penis aus Stahl. Spähte und murmelte zufrieden: »Alles bestens. Ich mache noch einen Abstrich.« Drei Minuten später winkte er sie vom Stuhl und sagte: »Ziehen Sie sich wieder an. Und nehmen Sie noch einmal am Schreibtisch Platz.«
Phoebe war erleichtert, dass es vorbei war. Schlüpfte in ihre Kleidung und setzte sich. Holte tief Luft und suchte nach Worten: »Zwei Anliegen hätte ich noch.« Sie fühlte sich wie ein Schulmädchen. »Erstens, an welchem Tag meines Zyklus soll ich es probieren?« Metzler zögerte. »Ganz schwer zu sagen. Meine persönliche Erfahrung ist diejenige, dass Frauen mit einem kurzen Zyklus an den späten Tagen fruchtbar sind. Versuchen Sie es am achtzehnten Tag nach Beginn der letzten Periode.« – »Zweite Frage«, fuhr Phoebe fort und versuchte, ihrer Stimme Entschiedenheit zu verleihen, »gibt es irgendetwas, das ich tun kann, um dem Spermium seinen Weg zum Ei zu erleichtern?« Metzler kratzte seine Stirnglatze, griff reflektorisch zu einem Fläschchen Sterillium und desinfizierte sich die Hände. »Nachdem es passiert ist: Popo in die Höhe. Machen Sie eine Kerze. Zwei Minuten lang, meinetwegen, während er sich duscht. – Noch mehr Fragen?« Phoebe war beschämt. »Nein. Danke.« – »Aber ich habe noch einen Tipp, wenn Sie erlauben.« Metzler zwinkerte. »Wenn so viel Auswahl zur Verfügung steht: Tun Sie es mit zwei Herren. Nicht immer sind Ihre Schleimhäute und sein Spermium kompatibel, ebenso wenig Ihr Ei und sein Spermium. Bei zwei potenziellen Erzeugern steigt die Erfolgsrate dramatisch.« Phoebe errötete: »Danke für die Offenheit«.
Metzler griff nach der Sprechanlage, und eine Arzthelferin kam geeilt. Er erhob sich und klatschte in die Hände. »Hormonspiegel aus dem Serum, und wenn alle Befunde in Ordnung sind, melde ich mich nicht.« Zum ersten Mal lächelte er. Senkte die Stimme und sagte: »Viel Glück.«
Auf dem Weg nach draußen rekapitulierte Phoebe das Gehörte: »Am achtzehnten Tag, zwei Herren sind besser als einer und hinterher zwei Minuten Kopfstand.«
Sie hatte noch fünfzehn freie Minuten, setzte sich in ein kleines Café, bestellte einen Milchkaffee und rief Pia an.
Im Hintergrund krakeelten die Zwillinge.
»Meins, meins, meins«, glaubte Phoebe zu hören. Dann klappte eine Tür, und Pia war zu verstehen. »Hallo, Phoebe, ich habe die beiden in ihr Zimmer gesperrt. Was gibt’s Neues?« Phoebe berichtete von ihrem Arztbesuch. Pia lachte lauthals. »Du Glückspilz. Ärztlich verordneter Geschlechtsverkehr mit zwei Männern innerhalb von achtundvierzig Stunden. Und ich muss mich mit einem alle acht Wochen begnügen, wenn überhaupt.« – »Innerhalb von achtundvierzig Stunden?«, gab Phoebe überrascht zurück, nippte nachdenklich an ihrer Tasse und lächelte, »darauf wäre ich gar nicht gekommen. Ich dachte, er meinte zwei aufeinanderfolgende Zyklen. Aber die Idee gefällt mir, Pia. Das spart Reisekosten für ein zweites Mal Zürich.« Sie verabschiedeten sich, und Phoebe eilte in die Praxis.
Frau Fittkau thronte an der Rezeption. »Ein Professor Matthäi hat angerufen und um einen Ersttermin gebeten. Er sagt, Sie kennen ihn. Sein Anliegen auch.« Phoebe grübelte. Kam schließlich auf die Sushibar und fragte: »Wann kommt er?« Frau Fittkau betrachtete ihre Fingernägel und schien verlegen. »Heute Nachmittag schon. Ich habe ihn als Letzten reingenommen. Er hat gedrängt, und ich konnte nicht Nein sagen.« Phoebe nickte. »Schon richtig. Der Kunde ist König.« Kein Wunder, dass Ärzte Herzinfarkte bekamen, Alkoholiker waren oder depressiv wurden.
Sie warf einen kurzen Blick ins Wartezimmer und zählte vier Patienten. Diametral platziert, der Abstand zueinander größtmöglich. Das gleiche Verhalten zeigten Bakterien unter dem Mikroskop, Ratten im Käfig und Schweine im Pfuhl. Interindividualdistanz, die nur von gestörten Persönlichkeiten unter- oder überschritten wurde.
Eilig schritt sie ins Badezimmer und erfrischte sich.
Am Freitagnachmittag empfing sie die Neuaufnahmen. Jeder neue Patient beanspruchte dreißig Minuten und die volle Konzentration. Frau Fittkau hatte lückenlos einbestellt.
Gegen halb fünf vernahm sie die Stimme Professor Matthäis. Er witzelte mit Frau Fittkau. Phoebe trat an den Spiegel. Strich sich ihr Haar glatt, puderte die Stirn und eilte zum Empfang.
»Herr Professor!« Sie lächelte. Diesmal waren die Rollen anders verteilt. Hielt ihm die Hand entgegen und die Luft an. »Frau Doktor«, sagte er, »fast hätte ich mich nicht getraut. Entschuldigen Sie mein Machogehabe von neulich. Pure Verlegenheit. Als gäbe es keine studierten Frauen in den Sushibars dieser Welt.« Phoebe lachte: »Ist vergeben und vergessen. Bitte folgen Sie mir.« Sie rief: »Frau Fittkau. Bringen Sie uns bitte zwei Milchkaffee.«
Vorausschauend hatte sie das Fenster geöffnet. Platzierte den Professor auf ein Sesselchen und wartete. Frau Fittkau klopfte. Auf einem Tablett balancierte sie zwei dampfende Becher. Schenkte dem Professor ein Lächeln und fragte: »Zucker oder Süßstoff?« – »Weder noch«, sagte der und griff nach seiner Tasse. »Kann ich gut gebrauchen. War eine harte Woche. Ich bin in einer Kanzlei Partner, wo siebzig Wochenstunden an der Tagesordnung sind. Macht Spaß, lässt aber nicht viel Freiraum für anderes.« Er unterbrach und sah Phoebe neugierig an. »Ich bin es gewohnt, die Dinge beim Namen zu nennen. Sie deuteten neulich ein Problem an, gaben mir Ihr Kärtchen und verschwanden. Als ich sah, dass Sie Kieferorthopädin sind, stand ich vor einem Rätsel. Was haben Sie gegen meine Zähne?« Er entblößte makellose obere Frontzahnkronen. Vielleicht einen Ton zu hell. Alle Patienten wollten A1. Das weißeste Weiß, das die Zahntechnik bot. Und mancher Zahnarzt ließ sich überreden.
»Wunderbar, Ihre Versorgung«, lobte Phoebe, »für ein solches Kunstwerk bedarf es eines großartigen Zahnarztes. Und eines begabten Zahntechnikers.« – »Danke«, Matthäi reckte die Brust, »und …?« Phoebe erhob sich. »Ich möchte Sie untersuchen, bevor ich mich äußere.« Mundgeruch war ein heikles Thema.
Matthäi fühlte sich unwohl. Er war es nicht gewohnt, in der Opferrolle zu stecken. »Das wird ja immer mysteriöser.«
Phoebe trat an das Waschbecken. Wusch die Hände, schlüpfte in ihre Handschuhe und streifte den Mundschutz über. »Volle Montur?«, scherzte Matthäi, hustete und verbreitete eine Wolke Schwefelwasserstoff. »Niemand ist vor Hepatitis gefeit«, antwortete Phoebe, »ich könnte meine aus Afrika mitgebracht haben. Sie Ihre vielleicht aus Asien.« Sie lächelte versöhnlich. »Ich bitte um Verständnis.« Sie bat Matthäi auf den Stuhl. Stellte die Rückenlehne zurück und inspizierte das Cavum oris. Die Mundhöhle, Heimat von fünfhundert Bakterienstämmen.
Der Geruch drang sogar durch ihren Mundschutz. Sie blieb ungerührt und untersuchte Zähne, Zahnfleisch und Zunge. Tastete das Kiefergelenk ab und fühlte nach geschwollenen Lymphknoten. Die Tiefe der Zahnfleischtaschen durfte drei Millimeter betragen. Phoebe maß sieben Millimeter, acht.
Sie stellte die Rückenlehne aufrecht und bat ihren Patienten, sich zu erheben. Beförderte Handschuhe und Mundschutz in den Abfall und den Professor auf seinen Sessel. »Raus mit der Sprache«, scherzte der, nahm einen Schluck kalten Kaffee und wippte mit den Fersen.
»Sie haben eine schwere Parodontose, Herr Matthäi«, erklärte Phoebe. »Eine entzündliche Erkrankung des Zahnhalteapparates, in dessen Folge Zahnfleisch und Knochen schwinden. Ursächlich sind verschiedene, aggressive Bakterien.« Zuhören hatte der Professor gelernt. Er schwieg abwartend.
»Mit der Parodontose vergesellschaftet sind Phänomene, die teils unangenehm, teils gefährlich sind. Am harmlosesten ist noch der unschöne Mundgeruch. Im Endeffekt droht dem Betroffenen der Zahnverlust. Am gefährlichsten aber ist die Tatsache, dass die Bakterien auch das Gefäßsystem besiedeln und zu einer lebensbedrohenden Arteriosklerose führen können.«
Phoebe schonte ihn nicht. Wusste um viel beschäftigte Männer, die nur begriffen, wenn es brannte.
Der Professor wippte heftiger. »Danke für Ihre Offenheit, Frau Weihrauch. Ich habe verstanden. Und was können wir tun?« Phoebe setzte sich dem Professor gegenüber und löste die oberen Knöpfe ihres Kittels. Trotz des geöffneten Fensters war ihr heiß. »Ich überweise Sie an einen Spezialisten. Der wird den Keimen den Garaus machen, lockere Zähne stabilisieren und eine korrekte Mundhygiene trainieren. Das kostet einiges an Zeit und Mühe. Und führt zur vollständigen Heilung.« Matthäi kniff die Lippen zusammen: »Ich habe ja wohl keine Wahl.« Phoebe reichte ihm ein Kärtchen. Etwas, das sie häufig tat. Die Parodontose war eine weit unterschätzte Volkskrankheit.
Sie erhob sich. »Mehr kann ich nicht tun, Herr Professor. Hiermit entlasse ich Sie in Ihr wohlverdientes Wochenende.« – »Ich hoffe auf ein Wiedersehen an der Sushibar«, kam die Antwort, diesmal etwas kleinlaut. Helden hatten keinen Mundgeruch.
Der Professor trat zum Ausgang und nickte Frau Fittkau zu: »Danke für den meisterlichen Kaffee, meine Liebe.« Frau Fittkaus Busen bebte entzückt. Sie hatte nichts gerochen. Der jahrelange Nikotinabusus hatte ihre Schleimhäute zerstört.
Phoebe kehrte in ihr Zimmer zurück. Ließ sich in ihren Lehnstuhl fallen und seufzte. Ihr Blick schweifte über den Stapel auf ihrem Schreibtisch. Für heute würde sie ihn liegen lassen. Morgen Blatt für Blatt durchgehen: Briefe beantworten, Kostenvoranschläge erstellen und Rechnungen prüfen. Vieles selbst erledigen, was andere ihrem Sekretariat überließen. Ihr Wochenende opfern, um die Fäden in der Hand zu behalten.
In den darauffolgenden Tagen verlor Phoebe die angestrebten Kilos. Zupfte misstrauisch an ihren Wangen und nahm befriedigt zur Kenntnis, dass diese der Schwerkraft trotzten. Dass »Dr. Weihrauchs Jungbrunnen« seine Wirkung tat.
Als ihre nächste Regelblutung einsetzte, saß sie beim Frühstück. Die Morgensonne wärmte ihren Rücken. Diesmal war sie vorbereitet und trug seit dem Vortag eine Binde.
Am Vormittag verbarrikadierte sie sich in ihrem Arbeitszimmer. Über die Sprechanlage rief sie Frau Fittkau: »Lassen Sie mich fünfzehn Minuten ungestört, bitte. Ich muss telefonieren.« – »Jawohl, Chef«, gab Frau Fittkau heiser zurück. Die Karzinogene machten vor dem Kehlkopf nicht halt.
Phoebe rief den elektronischen Terminkalender auf. Es war Donnerstag, der 11. März. Der achtzehnte Tag ihres Zyklus würde Montag, der 29. März, sein. Sie könnte am Sonntagabend in Zürich sein. Sich am Montag ein wenig umsehen und abends den ersten Versuch starten.
Plötzlich wurde ihr schwindelig. Sie schauderte angesichts der Kühnheit ihres Planes. Sie setzte ihr verlässliches, arbeitsreiches Leben gegen ein Abenteuer mit unklarem Ausgang. Metzler hatte sich nicht gemeldet. Gynäkologisch betrachtet gab es grünes Licht.
Sie gab sich einen Ruck. Murmelte: »Just do it«, und griff nach dem Telefonhörer. Wurde mit dem »Baur-au-Lac« verbunden und verlangte die Zimmerreservierung. Ihre Gesprächspartner klangen reizend. Wenigstens das. Sollte sie dem Erzeuger nicht begegnen, würde sie im Luxus schwelgen. Drei Tage, fünf Sterne.
»Grüezi, mein Name ist Weihrauch«, erklärte sie, »ich möchte die Grande Suite buchen. Es geht um den 28. bis 31. März. Ist das möglich?« Sie hörte eine Tastatur klappern. Am anderen Ende überschlug man sich vor Eifer. »Wir haben Glück. Ein Stammgast verlässt die Grande Suite am 27. März. Darf ich für Sie reservieren?«
Phoebe entschloss sich, dies als gutes Omen zu deuten. »Wie wäre der Preis?«, erkundigte sie sich, »ich bin Mitglied des ›Leaders’ Club‹.« Was man wurde, wenn man viele, teure Hotels besuchte. Dort Tausende Euros ließ. Phoebe errötete, obwohl es niemand sah. »Normalerweise dreitausendzweihundert Franken die Nacht«, antwortete die höfliche Stimme. »Darf ich Ihnen drei Nächte für neuntausend Franken offerieren?« Phoebe schluckte. Dachte: für mein Baby, und sagte: »Ja, sehr gern.« Nannte ihre Personalien und bat um Buchungsbestätigung per Fax. Über die Sprechanlage rief sie Frau Fittkau: »Bitte nehmen Sie das eintreffende Fax entgegen. Und legen Sie es auf meinen Schreibtisch.« Niemand musste erfahren, dass sie pro Nacht ausgab, was andere monatlich verdienten. Frau Fittkau verstand. Es handelte sich um ein persönliches Schriftstück. Sie bezog Stellung am Faxgerät.
Als Nächstes rief Phoebe die Website der Lufthansa auf. Mit ihrer Kundennummer buchte sie innerhalb von Minuten. Einen Linienflug Berlin–Zürich–Berlin. Die Maschine würde am Sonntagabend um sechs in Zürich-Kloten eintreffen.
Wieder meldete sich Frau Fittkau. »Fax ist soeben eingetroffen, ich komme.« Zehn Sekunden später klopfte es. Sie trat ein und überreichte ein Blatt, ihre Miene regungslos. Sie war von Natur aus frei von Neid. Phoebe rief den Terminkalender auf. Der Mauszeiger zuckte vom 29. zum 31. März. »Ich muss verreisen. Bitte bestellen Sie alle Patienten um, die mich persönlich sehen müssen. Die anderen kann Frau Dr. König übernehmen.« Phoebe würde sich bei anderer Gelegenheit revanchieren. Ihrer Kollegin den Rücken freihalten. Frau Fittkau stöhnte kaum hörbar. »Tut mir leid«, murmelte Phoebe, »ich weiß, dass das viel Mühe bereitet. Aber es ist lebenswichtig.« Im wahrsten Sinne des Wortes, dachte sie. Frau Fittkau verließ schmollend den Raum.
Wenig später erhob sich Phoebe. Trat auf den Flur, eilte über hundertjähriges Eichenholzparkett und passierte eine telefonierende Frau Fittkau. Schritt weiter und klopfte an die letzte Tür. Rief: »Ulla?«, und drückte die Klinke aus Messing herab. Jugendstil.
Ulla König legte den Hörer auf. »Komm herein, Phoebe.«
Ulla war eine schöne Frau Anfang vierzig. Sie trug ihre Haare schulterlang und offen. Bei der Arbeit streifte sie einen Haarreif über. Die Ähnlichkeit mit Grace Kelly war augenfällig.
Phoebe ließ sich fallen und sank in einen schwarzen Sitz aus feinstem Rindsleder. Sie sparten nicht am Mobiliar. »Ich muss verreisen, Ulla. In zwei Wochen für drei Arbeitstage.« Sie legte eine Pause ein und suchte nach der richtigen Formulierung. »Ich treffe jemanden.« Ulla blickte auf. Musterte Phoebe kurz aus klugen, hellblauen Augen. Normalerweise blieb Privates außen vor. Vielleicht funktionierte ihre Partnerschaft daher besser als die meisten anderen. »Verstehe«, kommentierte sie, »natürlich springe ich ein. Und ich weiß auch schon, wie du dich revanchieren kannst. Ich möchte im April nach Rügen. Für ein langes Wochenende von Donnerstag bis Montag.« Phoebe nickte: »Einverstanden. Rügen am Anfang der Saison ist herrlich. Fährst du allein?« Ulla lächelte geheimnisvoll. »Ich habe auch jemanden kennengelernt.« Sie strich eine Strähne aus der Stirn. Unendlich viel weiblicher als Phoebe. »Ich glaube, es ist ernst.« Phoebe freute sich für Ulla. An Verehrern mangelte es nicht, doch kam es selten zu einem Rendezvous. Geschweige denn zum Ernstfall.
So wartete Ulla seit Jahren und hielt Ausschau nach Mr. Wonderful. Sie hob soeben zur Beschreibung an. »Er ist Kardiologe. Schön wie ein Bild und sehr erfolgreich. Lebt getrennt von seiner Frau und den beiden Söhnen.« Bei Phoebe schrillten die Alarmglocken. Dennoch lächelte sie. »Ich drücke dir die Daumen, Ulla.« Sie wollte kein Spielverderber sein. »Du hast lange genug gewartet.« Sie verabschiedeten sich kurz. Man würde sich heute noch oft begegnen. Phoebe war in großartiger Stimmung.
Im Laufe des Nachmittags vereinbarte sie Termine. Reservierte einige Stunden bei der Kosmetikerin, der Pediküre und beim Friseur.
Am Wochenende war Phoebe allein.