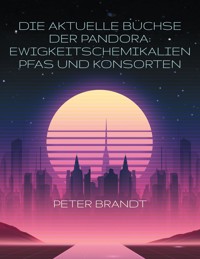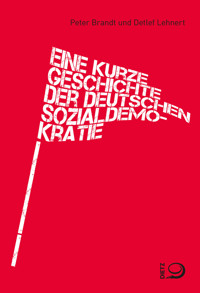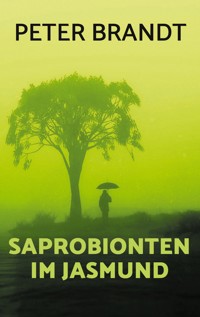
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Zwar erscheint es etwas hergeholt, die zeitlich begrenzte Entstehungsgeschichte eines von Menschen errichteten Bauwerkes mit dem (hoffentlich) auf lange Zeit angelegten Zusammenwirken von Produzenten und Destruenten im Jasmunder Buchenhochwald vergleichen zu wollen. Indes ist es im vorliegenden Fall von lebensnotwendiger Wichtigkeit, nicht nur die (Laub-) Kronen über Ihnen zu bewundern, sondern sich auch der Destruenten bewußt zu sein, die Sie mit Füßen treten. Mögliche Parallelen zur menschlichen Gesellschaft sind rein zufällig.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 54
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Diese Abhandlung beruht auf den Angaben der zitierten Originalliteratur sowie den Angaben von Wikipedia.
Inhaltsverzeichnis
1. Beispiele für Saprobionten
a) Mistkäfer
b) Springschwänze
c) Regenwürmer
d) Schmeißfliegen
e) Pilze
f) Hornmilben
g) Fadenwürmer
h) Bockkäfer
i) Bodenbakterien
j) Orciraptor
k) Krebse
l) Aaskäfer
m) Fleischfliegen
n) Ohrwürmer
o) Asseln
p) Tausendfüßer
q) Neunaugen
r) Milben
s) Zecken
t) Ameisen
u) Hirschkäfer
2. Ökosystem Wald
3. Parabel zum Schluß
4. Glossar
5. Literaturverzeichnis
6. Vom selben Autor bereits erschienene Bücher
1. Beispiele für Saprobionten
Als Touristen (d. h. in diesem Fall soviel wie „Ortsfremde“) brauchen Sie keine Sorge haben, im National-park Jasmund auf einen indigenen Volksstamm namens Saprobionten zu stoßen, obwohl diese allenthalben im Jasmund leben und ohne sie das Überdauern seiner prächtigen Buchenwälder auf natürliche Weise nicht möglich wäre.
Beispiele für Saprobionten gibt es im Tier-(Saprozoen) und im Pflanzenreich (Saprophyten). Es handelt sich um heterotrophe Organismen, das heißt sie ernähren sich vom organischen Material anderer Organismen. Im Ge-gensatz dazu handelt es sich bei den grünen Pflanzen, also auch den Buchen, um autotrophe Organismen, das heißt sie synthetisieren ihre Baustoffe und organischen Reservestoffe ausschließlich aus anorganischen Stoffen. Dieser Stoffaufbau erfordert Energie (z.B. Licht).
Nur durch das harmonische Zusammenwirken von au-totrophen und heterotrophen Organismen können die Buchenwälder des Jasmund gedeihen
Beispielhaft werden Ihnen auf den nächsten Seiten zu-nächst Beispiele für Saprobionten vorgestellt und im Weiteren dann ihre segensreiche Wirkungsweise im Ökosystem näher erläutert.
1.a) Mistkäfer
Fig. 1
Waldmistkäfer
(
Anaplotrupes stercorosus
) ( Quelle: Wikipedia; Stephan Prinz )
Die Mistkäfer (Geotrupidae) sind eine Familie der Kä-fer. Sie leben in Wäldern und auf Feldern. Bekannt sind in Mitteleuropa 11 in sechs Gattungen (Harde und Severa 2000). Sie sind 10 bis 45 mm groß und haben eine dunkelbraune, violette oder schwarze Farbe, häufig metallisch schimmernd. Sie sind tag- und nacht-aktiv, ihr Flug ist schwerfällig. Bei ihnen kann man Brutfürsorge beobachten, Männchen und Weibchen graben unterirdische Gänge bzw. eine Brutkammer und legen dort Nahrungsvorräte für ihre Larven an (Zahradnik 1985). Man unterscheidet drei Ernährungstypen: Die Geotrupidae ernähren sich von Dung bis zu Pilzen und Humus, die Lethrinae sammeln frische Blätter und mazarieren sie, die Taurocerastinae ernähren sich vom Dung pflanzenfressender Säugetiere.
Bei den Lethrinae wurde nachgewiesen, dass sich die Tiere auf dem Weg von ihrer Brutkammer zur Nahrungsquelle unter anderem nach dem Sternenlicht orientieren (Beutel und Leschen 2005 ). 2016 wurde veröffentlicht, dass sich Mistkäfer dafür einen Schnappschuss des Nachthimmels mit seinen Leuchtquellen merken, während sie sich um die Hochachse drehend auf der Mistkugel tanzen (Obermeier 2017).
1. b) Springschwänze
Fig. 2
Springschwanz
(
Isotomurus maculatus
) ( Quelle: Wikipedia; LM Bugallo Sanchez )
Die Springschwänze (Collembola) sind eine Klasse der Sechsfüßler (Hexapoda), erreichen eine Körperlänge zwischen 0,1 mm bis 17 mm und sind in Deutschland mit 522 Arten vertreten (Schulz 2016). Sie leben weniger oberirdisch (epedaphisch), aber überwiegend im Boden (euedaphisch). Entsprechend ihres Lebensraums sind sie kräftig gefärbt und behaart oder fast farblos bis weiß. Sie bevorzugen feuchte Humusschichten, Bodenlöcher von einigen Meter Tiefe sowie oberirdisches organisches Material.
Springschwänze gelten als die häufigsten Sechsfüßer; in einem Quadratmeter Waldboden der gemäßigten Breiten leben in den obersten 30 Zentimetern zwischen 10.000 bis über 100.000 Individuen (Petersen und Luxton 1982; Ponge et al. 1991). Nach den Milben sind sie damit die individuenreichste Tiergruppe der Mesofauna im Boden. Ihre Häufigkeit orientiert sich an Faktoren wie Lichtverhältnissen, Feuchtigkeit, Humusform, pH-Wert des Bodens und Nährstoffverfügbarkeit. Dementsprechend treten sie nicht gleichmäßig verteilt auf, sondern eher konzentriert in „Hotspot“-Mustern überall dort, wo sie optimale Lebensbedingungen vorfinden. Hier können sie kurzfristig Massenbestände aufbauen und etwa an warmen Wintertagen oder im zeitigen Frühjahr ein auffälliges Schwarmverhalten zeigen (Zettel und Zettel 2008).
Die meisten Arten der Springschwänze sind polyphage Detritusfresser. Es gibt neben diesen ‚Allesfressern‘ aber auch Spezialisten, die vorrangig Algen. Pilze, Aas, Exkremente oder Pollen fressen oder Bodenmikroorganismen abweiden (Thibaud 1970).
1. c) Regenwürmer
Fig. 3
Gemeiner Regenwurm
(
Lumbricus terrestris
)(Quelle: Wikipedia; Donald Hobern)
Der Regenwurm (auch Tauwurm oder Aalwurm) er-reicht eine Körperlänge von 9 bis 30 (Christian und Zicsi 1999) oder sogar bis 35 (Blakemore 2014; Sins und Gerard 1985) Zentimeter. Sein Körper ist in bis zu 180, meist 135 bis 150 (Sins und Gerard 1985) Segmente unterteilt. Er lebt in Wiesen, Gärten und Wäldern, gräbt bis zu drei Meter tiefe Gänge und durchwühlt den Boden sehr intensiv. Seine Nahrung besteht zum größten Teil aus noch nicht stark verwesten Pflanzenteilen.
In der Schweiz und in Deutschland leben derzeit 46 Arten, in Österreich 62 (Christian und Zicsi 1999). Nicht alle der in Europa lebenden Arten sind ursprünglich dort heimisch. Ihre durchschnittliche Lebenszeit liegt zwischen drei und acht Jahren. Der 9 bis 30 Zentimeter lange Tauwurm oder Gemeine Regenwurm (Lumbricus terrestris, früher auch als vermis terrae (Zekert 1938) bezeichnet) ist neben dem 6 bis 13 Zentimeter langen Kompostwurm (Eisenia fetida) wohl die bekannteste einheimische Annelidenart.
Ständig fressen sich die Regenwürmer kreuz und quer durch die Bodenschichten ihres Lebensbereiches. Die dabei aufgenommene Erde enthält Detritus-Bestandteile, Bakterien, Pilzsporen und zahlreiche Einzeller, die verdaut und als Nahrung genutzt werden können. Manche Arten verzehren auch Aas. Durch die Beschaffenheit der Erde, die der Regenwurm erzeugt, wenn er die mitgefressenen Bodenbestandteile wieder ausgeschieden hat, werden die für den Boden nützlichen Mikroorganismen gefördert und die bodenfeindlichen eingedämmt, z. T. sogar vernichtet.
Die Biomasse der Regenwürmer in Deutschland übertrifft die der Menschen um mindestens das Doppelte (Jörgensen et al. 2020).
Fig. 3A Rotkehlchen mit Regenwurm (Quelle: Wikipedia; Rasbak)
1. d) Schmeißfliegen
Fig. 4
Blaue Schmeißfliege
(
Calliphora vicina
) ( Quelle: Wikipedia: Alleph)
Weltweit sind etwa 1.000 Arten von Schmeißfliegen bekannt, davon etwa 45 in Deutschland. Sie ernähren sich von Nektar und Pollen, und auch von Honigtau. Daher sind sie meistens an Blütendolden zu finden. Zur Aufnahme von Säften suchen sie häufig zerfallene organische Stoffe und fliegen auf nach Aas riechende Blüten (Aronstab) und Pilze (Stinkmorchel). Ihre Eiablage erfolgt auf oder in der Nähe von proteinreichem Substrat. Je nach der chemischen Zusammensetzung der ausdünstenden Gase bei der Verwesung werden unterschiedliche Arten zur Eiablage angelockt. Die Schmeißfliegenmaden leben auf oder in verwesendem pflanzlichen oder tierischen Material.
D