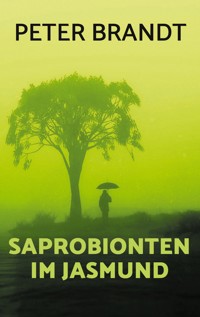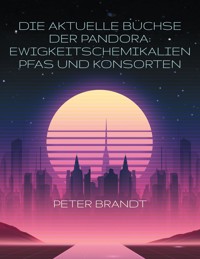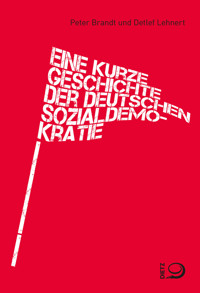22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag J.H.W. Dietz Nachf.
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Willy Brandts ältester Sohn Peter erinnert sich an seinen Vater als Politiker und Privatmann, der noch in den 1980er-Jahren eine der umstrittensten Persönlichkeiten in Deutschland war. Und er schreibt über das "liebevolle, aber nicht ganz einfache Verhältnis zweier sperriger Menschen". Peter Brandt verbindet die familieninterne Sicht mit dem analytischen Blick des Historikers. So entstand zum 100. Geburtstag von Willy Brandt am 18. Dezember 2013 keine Biographie im herkömmlichen Sinne – sondern ein Essay, der Privates und Politisches gemeinsam deutet und bislang weniger bekannte Züge dieser Jahrhundertgestalt mit kritischer Zuneigung herausarbeitet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Peter Brandt
Mit anderen Augen
Versuch über den Politiker und Privatmann Willy Brandt
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN Epub 978-3-8012-7000-14. Auflage 2014
Copyright © 2013 byVerlag J.H.W. Dietz Nachf. GmbHDreizehnmorgenweg 24, 53175 BonnLektorat: Alexander BehrensSatz: Just in Print, BonnE-Book-Konvertierung: Satzweiss.com Print Web Software GmbH Alle Rechte vorbehalten
Besuchen Sie uns im Internet: www.dietz-verlag.de
Nachweis von Zitaten und weiterführende Literatur unter www.dietz-verlag.de/0441 .
Die Rechtschreibung in historischen Zitaten wurde stillschweigend der neuen deutschen Rechtschreibung angepasst.
Vorwort
I
n den vergangenen beiden Jahrzehnten bin ich immer wieder aufgefordert worden, meine Erinnerungen an und Reflexionen über Willy Brandt zu Papier zu bringen. Vielleicht musste erst der 100. Geburtstag nahen, um meinen hinhaltenden Widerstand gegen ein solches Projekt zu überwinden. Selbstverständlich reicht zur Rechtfertigung dieses Buches nicht aus, dass andere mich gebeten haben, es zu schreiben.
Der Titel sagt es schon: Es geht um den spezifischen Blick des ältesten Sohnes, der in eine hochpolitisierte und trotzdem in vieler Hinsicht recht normale Familie hineingeboren wurde. Ich selbst war frühzeitig politisch engagiert; als Fachhistoriker bemühte ich mich später immer, einen professionell-distanzierten Blick gerade auf die Personen einzunehmen, die mir nahe sind beziehungsweise auf jene Ereignisse, an denen Angehörige der Familie Brandt beteiligt waren. Ohne diese Fähigkeit hätte ich auf zeitgeschichtliche Forschungen und Publikationen, die einen Teil meiner beruflichen Aktivitäten ausmachen, verzichten müssen. Dieses Buch lebt also aus der Spannung zweier in meinem Kopf nebeneinander und wechselseitig existierender Perspektiven. Ob dieser Balanceakt gelungen ist, wird der Leser zu entscheiden haben.
Mit allem Nachdruck sei betont: Ich erhebe nicht den Anspruch, endlich die wahren Geschichten über Willy Brandt zu erzählen und die richtigen Deutungen zu liefern. Die Skepsis des Historikers gegenüber dem Schleier der Erinnerung gilt auch für meine eigene Zeitzeugenschaft. An Interpretationen sind fast immer mehr als eine möglich, ohne die Quellen zu vergewaltigen. Insofern bitte ich alles Folgende als Angebot zu verstehen, die Person und Persönlichkeit Willy Brandts »mit anderen Augen« zu betrachten. Und obgleich innerlich von ihnen berührt, bin ich sine ira et studio aufrichtig um Erkenntnis bemüht. Hier und dort werden neue Akzente gesetzt und Details mitgeteilt, die weniger oder nicht bekannt sind. Dabei hatte ich im Entstehungsprozess des Buches stets im Hinterkopf, welche ungeheuren Projektionen auf Willy Brandt gerichtet waren. Man darf teilweise sogar von regelrechten Heilserwartungen sprechen.
Ich war bestrebt, der Versuchung zu widerstehen, das Objekt meiner Bemühungen nach eigenen Wünschen idealisierend zurechtzuhobeln. Dabei sind mir zwei Dinge zugutegekommen: Erstens, dass ich schon im Alter von achtzehn Jahren von zu Hause auszog, und zweitens, dass es eine beträchtliche Periode politischer Differenzen zwischen meinem Vater und mir gab, die ins Grundsätzliche gingen, ohne dass das persönliche Verhältnis ernsthaft beschädigt worden wäre. Ab Mitte der siebziger Jahre näherten Vater und Sohn sich auch politisch wieder an, allerdings ohne je ganz auf eine Linie zu kommen. In den bald vier Jahrzehnten seitdem habe ich mich niemals anheischig gemacht, die Autorität des Vaters Willy Brandt für eigene politische Anliegen ins Feld zu führen. Zuschreibungen von Dritten konnte ich nur zur Kenntnis nehmen. Der Beurteilungsmaßstab dieses Buches für Erfolge oder Fehler soll jedenfalls nicht mein eigener sein, sei er von damals oder heute, sondern die jeweiligen Überzeugungen und Ziele Willy Brandts selbst, sofern ich glaube, sie zu kennen. Das gilt vor allem für das Schlusskapitel.
Ich bin immer wieder gefragt worden, wie es denn sei, der Sohn von Willy Brandt zu sein. Was soll man dazu sagen? Jedem, der auch nur einen Moment darüber nachdenkt, wird sofort klar sein, dass die familiäre Konstellation strukturell problematisch und manche Situation nicht immer vergnüglich war, zumal, wenn man sich entschieden hatte, einen eigenen Weg zu gehen und eventuelle Vorteile, die sich aus dem Amt des Vaters ergeben könnten, bewusst nicht in Anspruch zu nehmen. Für meine Brüder und mich gehörte es zu den Herausforderungen des Lebens, damit zurechtzukommen. In dem Maß, wie man sein Schicksal selbst in die Hand nimmt und gerade beruflich etwas Eigenes zustande bringt (was mit zwanzig naturgemäß noch nicht möglich ist), wird die Last leichter und der Umgang mit der Familie im günstigen Falle souveräner.
Ich will die Klage auch nicht übertreiben. Es gibt wahrlich schlimmere Schicksale auf der Welt, als der Sohn eines deutschen Spitzenpolitikers zu sein – namentlich dieses Spitzenpolitikers. Für meine Kollegen, Mitarbeiter, Freunde pflegte die Verwandtschaft mit Willy Brandt nach meinem Eindruck bald nur noch eine untergeordnete Rolle zu spielen, abgesehen davon, dass nicht jeder oder jede automatisch darauf kam, dass die Namensgleichheit kein Zufall war. So ungewöhnlich ist der Name nicht, und in Hagen, wo ich seit 1989 als Hochschullehrer tätig bin, dachten die Leute bei »Brandt« zunächst an den bekannten Zwieback und den dazugehörigen Basketballverein, erst dann an den Staatsmann. Inzwischen ist die Zwiebackfabrik nach Thüringen verlagert worden und der Name der Hagener Basketballmannschaft futsch.
Frühzeitig mussten meine Brüder und ich lernen, dass der Vater und der Name des Vaters nicht der Familie gehören. Selbst da, wo es juristisch möglich wäre, läge es mir fern, die Verwendung des Namens Willy Brandt zu unterbinden. In aller Regel werde ich nicht vorher gefragt, wenn eine Straße, ein Platz, ein Haus oder ein Flughafen nach ihm benannt werden soll, und das ist auch gut so. Ein einziges Mal habe ich auf Bitten der SPD als Angehöriger geklagt, und zwar als die Deutsche Volksunion des Verlegers der »Nationalzeitung« Dr. Gerhard Frey, der ein notorischer Brandt-Hasser war, im Brandenburger Landtagswahlkampf Friedrich Ebert, Kurt Schumacher und Willy Brandt auf einem Plakat als »Große Sozialisten« und Patrioten vereinnahmte. Tote Indianer sind bekanntlich gute Indianer. Persönlich hätte ich auch hier eher dazu geneigt, mit Spott oder Ironie zu reagieren, aber dass das den Wahlkampf der SPD, speziell unter ostdeutschen Bedingungen, schädigte und gestoppt gehörte, leuchtete mir ein.
Dieses Buch ist weniger eine Biografie, als ein »Versuch« im klassischen Sinne. Trotzdem ist die inzwischen recht umfängliche Forschungsliteratur zur Kenntnis genommen und indirekt berücksichtigt worden, ebenso die in der »Berliner Ausgabe« der Schriften Willy Brandts edierten Quellen und die umfangreiche Memoirenliteratur. Dem Charakter des Buches entsprechend ist auf einen Anmerkungsapparat verzichtet worden. Der Nachweis wörtlicher Zitate ist im Bedarfsfall auf der Internetseite des Verlags zu finden. Da es meine ganz persönlichen Erinnerungen und Wahrnehmungen sind, die den Grundstock des Buches bilden, wird unvermeidlicherweise häufig von mir die Rede sein. Das dient ausschließlich dem Zweck, das Verständnis meiner Äußerungen über Willy Brandt zu erleichtern, sie gewissermaßen durchschaubarer zu machen. Gleiches gilt für andere »Nebendarsteller« dieses Buches, ohne deren Beitrag die Hauptfigur nicht in der beschriebenen Weise hätte agieren können. Je nachdem, welche Rolle gerade im Mittelpunkt steht, wird deshalb mal von »(meinem) Vater« und mal von »(Willy) Brandt« die Rede sein.
Ich danke Alexander Behrens für das Lektorat, Bernd Rother für die kritische Durchsicht des Manuskripts, Andrea Buczek, Miriam Horn und Fiona Schmidt für technische Hilfen bei dessen Erstellung, Götz Schwarzrock außerdem für inhaltliche Ratschläge.
Krankheit und Tod
I
m Oktober 1991 weilte ich mit meiner kleinen Familie für einige Tage im bayerischen Oberaudorf. Meine Schwiegermutter besaß dort eine Ferienwohnung. Eines Tages – es muss der 11. Oktober gewesen sein – starrten mich riesige Zeitungslettern an: Willy Brandt sei im Krankenhaus wegen einer Krebsgeschwulst operiert worden. In BILD-typischer Manier wurde der Vorgang dramatisiert. Die Neuigkeit irritierte mich offenbar so sehr, dass ich unmittelbar nach der Lektüre des Artikels einen Auffahrunfall verursachte – harmlos, aber immerhin. Sehr viel mehr als BILD schon wusste, ließ sich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen, wie ich in einem Telefongespräch mit Brigitte Seebacher-Brandt erfuhr. Sie handelte in meines Vaters ausgesprochenem oder unausgesprochenem Auftrag, als sie die Weitergabe von Informationen steuerte und alles Organisatorische regelte, einschließlich der Krankenbesuche.
Sobald sich die Möglichkeit ergab, fuhr ich in die Chirurgie der Kölner Universitätsklinik, wo Vater lag, um ihn zu besuchen. Er machte einen munteren, zuversichtlichen Eindruck. Es gelang mir, im Anschluss an eine Visite den behandelnden Arzt Professor Pichlmaier beiseite zu nehmen. Er berichtete mir, die Operation als solche sei sehr gut verlaufen. Der Darmtumor sei vollständig entfernt worden. Allerdings habe sich herausgestellt, dass die Krebsart sehr aggressiv sei. Das hätte er aber im Gespräch mit dem Patienten »nicht vertieft«. Die Prognose war also unsicher. Als meine Frau Antonia, der kleine Anton und ich Vater in seinem Unkeler Haus besuchten, schien er beinahe der Alte zu sein, allenfalls noch ein wenig geschwächt vom Eingriff. Das bestätigte sich bei weiteren Zusammenkünften in den folgenden Monaten. Er nahm wieder zahlreiche berufliche Termine wahr, reiste und hielt Reden.
Ich weiß nicht mehr, wo und wie ich von der zweiten Operation am 22. Mai 1992 erfuhr, die nach wenigen Minuten abgebrochen werden musste. Der Krebs hatte sich explosionsartig ausgebreitet und bereits mehrere Organe befallen. Er war schlechterdings nicht mehr operabel. Eine Kontrolluntersuchung Ende März hatte noch keine Hinweise auf den erneuten Ausbruch der Krankheit ergeben. Aber am Ostermontag 1992 kollabierte Vater in seinem französischen Ferienhaus am Südrand der Cevennen. Selbst in den Wochen danach ging er noch in sein Büro, sprach in Luxemburg »Zur Architektur Europas«. Die Krankheit schritt aber rascher fort als erwartet. Seinen letzten Text, die bewegende Grußadresse an die Sozialistische Internationale, die Mitte September in Berlin tagte, konnte Willy Brandt nur noch mit massiver Hilfe seiner Frau produzieren.
Der Stand der Dinge war mir bekannt, als ich meinen Vater nur Tage nach der gescheiterten Operation in der Klinik besuchte. Er wirkte gelassen, beinahe ein wenig heiter, und versuchte nicht, krampfhaft gute Laune zu demonstrieren. Auch wenn keiner das so aussprach, war zwischen uns klar, dass es sich ab jetzt um eine Krankheit zum Tode handelte und wir uns nicht mehr häufig sehen würden. Er erzählte, er habe den Arzt gefragt, ob er denn noch einmal zum Arbeiten in sein Büro zurückkehren könne. Dieser habe geantwortet: »So schwach, wie Sie waren, als Sie hierher kamen, müssen Sie erst einmal Kräfte sammeln.« Niemand machte ihm etwas vor, aber seine positiven Gedanken wollte man ihm auch nicht ausreden.
Brigitte nahm Vater mit nach Hause und pflegte ihn die kommenden gut vier Monate aufopferungsvoll, unterstützt von Hausarzt, Haushälterin und dem geschätzten Gärtner, was ich ihr bis heute hoch anrechne. Auch ohne eine Komplikation mitzuerleben, wurde mir klar, dass dafür Kraft, starke Nerven und viel Liebe nötig waren. Abgesehen vom Morphium, das man ihm in steigender Dosierung verabreichte, wurde die medizinische Versorgung, insbesondere die Apparatemedizin, auf ein Minimum reduziert. Soweit das unter den gegebenen Umständen möglich war, gestaltete er sein Sterben selbstbestimmt. Es war schön zu erleben, wie er die Momente des relativen Wohlbefindens auskosten konnte – etwa bei Junisonne im Garten zu sitzen, ein Stück Kuchen zu verspeisen. Künstliche Ernährung und Astronautenkost, die ursprünglich einmal vorgesehen waren, hatte er mit den meisten medizinischen Gerätschaften zurückgewiesen. Er las nach wie vor viel, Belletristik, Zeitungen, Magazine.
Brigitte ordnete die Besuche, damit sie ihm nicht zu viel wurden. Es kamen Politiker, und nicht nur Sozialdemokraten, persönliche Freunde. Am häufigsten kamen Klaus Harpprecht und Egon Bahr. Und natürlich die Kinder. Ich selbst fuhr von Hagen im Abstand einiger Wochen nach Unkel. Dort blieb ich, bis ich zu spüren meinte, dass es zu anstrengend würde. Zu klären gab es zwischen uns nichts. Wir waren miteinander im Reinen. Die Gesprächsführung überließ ich stets dem Kranken, nach einem kurzen Bericht über meine Frau und die Kinder, eventuell auch über Berufliches, das ihn interessieren könnte. Über den Tod sprachen wir nicht direkt. Das hatten wir in allgemeiner Hinsicht einmal eingehend gemacht, als Vater noch gesund war. Doch saß der Sensenmann unsichtbar stets mit am Tisch oder später am Bettrand. Obwohl Vater und Sohn gleichermaßen nicht dazu neigten, starke Gefühle zu zeigen, konnten wir einmal sogar zusammen weinen. Als ich mich im Juli mit der Familie in den Sommerurlaub verabschiedete, kam mein Vater an das Eingangstor und winkte mir zum Abschied. So eine Geste kannte ich von ihm vorher nicht. Ich überlegte noch, ob wir den Urlaub abblasen sollten. Aber darauf warten, dass er stirbt?
Die gleiche Frage stellte ich mir auch bei einer späteren Gelegenheit: Meine Mutter arbeitete seit den frühen achtziger Jahren immer wieder an ihren episodenhaft angelegten Erinnerungen, die natürlich nicht zuletzt Erinnerungen an Willy Brandt waren. Sie hatte sie auf Norwegisch, in ihrer Muttersprache, verfasst und mich gebeten, eine deutsche Übersetzung anzufertigen, weil sie mir zutraute, den richtigen Ton zu treffen. Die Arbeit war mir relativ angenehm, ich erledigte sie überwiegend im Sommer 1991. Im Pingpongverfahren ging es zwischen meiner Mutter, ihrem langjährigen Lebensgefährten, dem dänischen Journalisten Niels Nørlund, und mir hin und her. Bald kamen wir zu einer für gut befundenen deutschen Version. Ich setzte meinen Vater von der Übersetzertätigkeit in Kenntnis und machte klar, dass das keine Parteinahme bedeutete, sondern dass ich das ebenso selbstverständlich für ihn gemacht hätte. Ich schickte ihm wohl auch das Manuskript.
Die Rezensenten hoben später besonders die Fairness hervor, mit der Rut Brandt ihren früheren Ehemann behandelte. Das fand auch ich. Andernfalls hätte ich sofort interveniert, doch das war an keiner Stelle nötig. Nun ist man als todkranker Mensch sicher extrem empfindlich. Wie ich viel später aus Schilderungen von Brigitte erfuhr, war mein Vater zwischenzeitlich sehr wütend auf mich, als im »Stern« ein Vorabdruck der Rut-Brandt-Erinnerungen erschien. Natürlich hatte ich mit der Vermarktung des Buches überhaupt nichts zu tun. Von einem Vorabdruck wusste ich nichts. Jedem, der die Sache unvoreingenommen betrachtete, musste klar sein, dass das Erscheinen des Buchs von Rut und die Krankheit von Willy ein rein zufälliges Zusammentreffen war. Denn auch ein nicht wissenschaftliches Buch kann man nicht von einem Monat auf den anderen schreiben, wenn man kein Profi ist. Soweit ich weiß, ist auch nirgendwo ein anderslautender Verdacht erhoben worden. Mein Vater grollte trotzdem. Brigitte stellte die Eintracht dann wieder her, ohne dass ich das Ganze damals mitbekam.
Für den 8. Oktober 1992 hatte ich mich wiederum in Unkel angemeldet und traf dort am späten Vormittag ein. Tags zuvor waren nacheinander meine beiden Brüder dagewesen. Mein Vater war nicht mehr ansprechbar. Ich wusste, es konnte der endgültige Abschied sein, und saß etwa eine Stunde an seinem Bett. Dann ging ich hinunter, um noch ein wenig bei Brigitte zu verweilen. Dass das Ende noch am selben Tag kam, ahnte ich nicht. So besuchte ich meine Mutter, die ebenfalls im Rheinland – nördlich von Bonn – wohnte und übernachtete bei ihr. Am frühen Morgen weckte sie mich und sagte: »Willy ist tot. Sie haben es gerade im Radio gemeldet.« Wir hielten einen Moment schweigend inne. Am Vormittag rief ich dann meine Brüder an. Wir verabredeten uns zu einem gemeinsamen Besuch bei Brigitte, die weiterhin alles managte. Was den öffentlichen Teil der Trauerfeierlichkeiten betrifft, stand ihr ein von Bundeskanzler Kohl beauftragter Beamter zur Seite.
Ich fühlte mich wie betäubt, auch durch das allgemeine Aufsehen, und war irgendwie erleichtert, nicht agieren zu müssen. Ich hatte das sichere Gefühl, dass Brigitte die Dinge im Sinne meines Vaters regeln würde. Möglicherweise hatten sie sogar darüber offen gesprochen, so offen, wie er auch mit Helmut Kohl über die Gestaltung des Staatsakts gesprochen hatte – möglicherweise sogar im Hinblick auf ein Detail, das aufmerksam registriert und vielfach kritisiert wurde: dass meine Mutter weder zum staatsoffiziellen noch zum privaten Teil der Beisetzung eingeladen worden war. Ich neige bis heute zu der Auffassung, dass mein Vater das so gewollt hatte oder gewollt hätte. Mutter versicherte glaubwürdig, dass sie ohnehin nicht gekommen wäre, um jeden Anschein von Witwenzank zu vermeiden. Doch fand sie, man hätte wenigstens eine Einladung aussprechen müssen. Viele dachten an sie. Bundespräsident von Weizsäcker erinnerte beim Staatsakt unüberhörbar an Rut Brandt, ebenso Bischof Kruse, der den evangelischen Trauergottesdienst zelebrierte, und der Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen.
In den Tagen und Wochen nach Vaters Tod erreichten mich viele Beileidsbekundungen. Manche berührten mich stark, weil deutlich wurde, was Willy Brandt den Menschen bedeutete. Kollegen, Freunde, auch flüchtige Bekannte, meine politischen Weggefährten, ja selbst Wildfremde ließen mir mündlich oder schriftlich Worte der Anteilnahme zukommen. Am meisten bewegten mich zwei Ereignisse: Ein guter Freund, der mit einem noch stark nationalsozialistisch gesinnten Vater aufgewachsen war und sich als ganz junger Mann in der NPD-Jugend engagiert hatte, besuchte mit seinen Kindern das Grab und legte Blumen nieder. Und als ich in Hagen ein griechisches Imbisslokal aufsuchte, wo ich gelegentlich aß, kam plötzlich der Juniorchef auf mich zu, der mich nur vom Sehen kannte, ohne zu wissen, wie ich heiße, und vergewisserte sich, dass das Foto in der Lokalpresse mich abbildete. Dann unterbrach die gesamte vielköpfige Familie ihre Arbeit, alle stellten sich in einem Spalier auf und gaben mir die Hand: »Er hat so viel für uns getan – herzliches Beileid!«
Der Staatsakt und die Beisetzung fanden am 17. Oktober im Reichstagsgebäude statt. Es war der erste an diesem historischen Ort seit dem Tode Gustav Stresemanns im Jahr 1929. In Anwesenheit hochrangiger Gäste aus aller Welt verlief er würdig und angemessen. Alle Redner, von Helmut Kohl über Richard von Weizsäcker, Björn Engholm und den engen politischen Freund Felipe González, wurden dem Verstorbenen auf ihre Art gerecht. Sie fanden in bemerkenswerter Weise die richtigen Worte, wobei Felipe die emotionalste Ansprache hielt. Unvergessen ist sein »Adios amigo« und seine Charakteristik Willy Brandts: »Deutscher bis ins Mark, Europäer aus Überzeugung und Weltbürger aus Berufung.« Claudio Abbado dirigierte Schuberts Unvollendete, die Berliner Philharmoniker spielten. Dass außer der Witwe kein Familienangehöriger in der ersten Reihe saß, fand ich völlig in Ordnung. Etwas kleinlich war für mein Empfinden jedoch die Empfehlung, die Kinder zu Hause zu lassen. Ninja ignorierte das und nahm ihre Tochter Janina einfach mit. (Zwischen Ninja und Brigitte hatte es schon Wochen vorher eine Unstimmigkeit gegeben, als Ninja verabredungsgemäß aus Norwegen anreiste, aber nicht zu ihrem Vater vorgelassen wurde, weil es ihm sehr schlecht ging.) Vielleicht wäre es angebracht gewesen, die Partei und ihre Anhänger stärker zur Geltung kommen zu lassen, etwa durch eine langsamere Fahrt des Wagens mit dem Leichnam durch die Stadt zum Zehlendorfer Waldfriedhof. Aber vielleicht sollte es auch in diesem Punkt so sein wie geschehen. Am Vortag war der Tote im Rathaus Schöneberg aufgebahrt worden, um den Berlinern Gelegenheit zu geben, sich zu verabschieden. Sie taten es zu Zehntausenden.
Am Vorabend der Beerdigung versammelten sich die Geschwister mit den Ehepartnern in der Berliner Wohnung von meiner Frau und mir. Auch Brigitte folgte der Einladung. Es war ein guter Austausch. Leider kollidierte das Treffen mit einer Gedenkveranstaltung der SPD, zu der ich sonst wohl gegangen wäre. Auch sie war offenbar sehr gelungen und bewegend.
Gefordert war ich im Angesicht des Testaments, das Vater nur wenige Wochen vor seinem Tod zu Papier gebracht hatte. Es sprach den gesamten materiellen und ideellen Nachlass der Witwe Brigitte als »befreiter Vorerbin« zu. Was das Finanzielle betraf, hieß das de facto, dass der Anteil des Vermögens, der den Kindern zugutekam, auf ein Viertel reduziert wurde. Damit hatte ich kein Problem, da ich stets der Meinung war, Menschen hätten kein moralisches Recht, überhaupt etwas zu erben. Außerdem konnte ich nachvollziehen, dass die zurückbleibende Witwe maximal gesichert werden sollte. Meine Aufgabe sah ich, auch aus Eigeninteresse, nun darin, zusammen mit dem beauftragten Anwalt die Geschwister zusammenzuhalten und der Presse kein familiäres Theater darzubieten. Dafür war es aber nötig, auch klar zu wissen, welche Werte dem Ganzen zugrunde lagen.
Komplizierter war allerdings die Regelung der Eigentumsrechte an den nachgelassenen Papieren, die ebenfalls der Witwe zufallen sollten. Sie widersprach der Rechtsauffassung der SPD, die in Amtseigenschaft entstandenes Schriftgut für sich reklamierte. Auch die Bonner Friedrich-Ebert-Stiftung, deren »Archiv der sozialen Demokratie« von Willy Brandt selbst seit den sechziger Jahren den größten Teil seiner Unterlagen erhalten hatte, machte Einwände geltend. Juristisch waren meine Geschwister und ich diesbezüglich zwar gar nicht betroffen. Aber als professioneller Historiker hatte ich durchaus Interesse daran, zu wissen, was mit den Papieren geschehen sollte. Im schlimmsten Fall wäre für jedes Blatt eine gerichtliche Entscheidung nötig gewesen, um zu klären, wem es gehört. Deshalb schlug ich zusammen mit meinem Kollegen und Freund Franz Brüggemeier eine übergreifende Stiftung vor. Mit Gründung der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung als Bundesstiftung, die vom Deutschen Bundestag beschlossen wurde, schuf man eine Lösung, die alle Seiten einbezog, die Eigentümerfrage offen ließ und am Standort der Archivalien in Bonn nicht rüttelte. Dort entstand ein eigenes Willy-Brandt-Archiv, dessen Gut auf hohem professionellem Niveau gepflegt, um Zuflüsse anderen Ursprungs ergänzt und für die Forschung erschlossen wird. Ich denke, das ist eine Regelung, die Willy Brandts Zustimmung gefunden hätte.
Familie und Freunde
A
nders als viele Führer von Parteien der Arbeiterbewegung war Willy Brandt ein echtes Proletarierkind. Das verband ihn mit dem »Arbeiterkaiser« August Bebel, der wenige Monate vor seiner Geburt gestorben war. Am 18. Dezember 1913 kam mein Vater im Lübecker Arbeiterbezirk St. Lorenz zur Welt, ursprünglich als Herbert Ernst Karl Frahm. Die nicht verheiratete neunzehnjährige Mutter Martha Frahm soll eine hübsche Frau mit Anspruch auf ein eigenes Leben gewesen sein. Sie arbeitete als Verkäuferin täglich im Konsum und musste den Knaben zuerst zu Bekannten geben, dann, als er fünf war, ihrem Vater Ludwig zur Aufzucht überlassen. Wie Willy später erfuhr, war Ludwig nicht ihr leiblicher Vater. Die Frahms kamen aus der mecklenburgischen Landarbeiterschaft, einer unteren Schicht der Arbeiterklasse in einem der rückständigsten Territorien Deutschland. Den Großvater Ludwig, der als Kraftfahrer sein Geld verdiente, nannte der Knabe Herbert »Papa«, dessen zweite Frau, die er nicht mochte, »Tante«. Seine echte Großmutter war damals bereits gestorben. Als Martha Frahm 1927 den Maurerpolier Emil Kuhlmann heiratete und im Folgejahr der Halbbruder Günter zur Welt kam, war Herbert schon knapp vierzehn Jahre alt.
Durch die Mutter wie durch den Großvater, der sich 1935 in persönlicher und politischer Verzweiflung das Leben nahm, wuchs Herbert Frahm in die sozialdemokratische Arbeiterbewegung hinein: Kinderturngruppe des Arbeitersports, Arbeiter-Mandolinenklub, Theatergruppe. Dass sich für ihn dort eine neue, größere Familie auftat, liegt nahe – bei aller Unsicherheit und aller Unvollständigkeit der häuslich-familiären Verhältnisse. Hier musste jemand schon sehr früh allein für sich sorgen. Auch beim Lernen für die höhere Schule war er auf sich gestellt. Als Arbeiterkind besuchte er das Johanneum, ein Reform-Realgymnasium, wo ihm das Schulgeld erlassen wurde. Er war dort sozial ein Außenseiter, fügte sich aber problemlos in das fremde Milieu ein. In einer Dachkammer der bescheidenen großelterlichen Wohnung hatte er sich einen Rückzugsraum geschaffen, wo er mit seinen Büchern und seinen Gedanken eine selbstständige geistige Existenz begründete.
Wer sein biologischer Vater war, stand für Willy, der sich aus Trotz bislang nicht dafür interessiert hatte, fest, seitdem er einen Brief seiner Mutter vom 7. Februar 1947 erhalten hatte. Damals, nach der Hitlerzeit, wollte er sich in Deutschland wiedereinbürgern lassen. In der Annahme, dabei nach seinem Erzeuger gefragt zu werden, hatte er seine Mutter um dessen Namen gebeten. Es sei der Buchhalter John Heinrich Möller aus Hamburg gewesen. Ein zweiter Brief, den ein »leibhaftiger Vetter« namens Gerd-André Rank am 7. Juni 1961 schrieb, bestätigte diese Angaben. John Möller, der von 1887 bis 1958 lebte, soll ein ruhiger, besonnener Mensch, überzeugter Sozialdemokrat und Büchernarr gewesen sein.
Eigentlich war damit nach menschlichem Ermessen Klarheit geschaffen. Doch Willy Brandt behielt sein Wissen für sich. Es hatte sogar den Anschein, als würde er Gefallen finden an dem Rätselraten über seine Herkunft väterlicherseits. Noch Mitte der achtziger Jahre präsentierte der »Spiegel« eine Reihe von Kandidaten. Julius Leber, der prominente Lübecker Sozialdemokrat, war einer von denen, auf die man schon länger tippte. Auch ein mecklenburgischer Graf sowie der Kapellmeister Hermann Abendroth wurden nominiert. Mir selbst ging noch vor nicht allzu langer Zeit der keineswegs alberne Brief einer freundlichen Dame zu, die aufgrund frappierender physiognomischer Ähnlichkeiten und weiterer Indizien nahezu sicher war, dass einer ihrer Vorfahren, ein kaiserlicher Diplomat mit dem Spitznamen »Graf Willy«, der Erzeuger meines Vaters gewesen sein müsse.
Als Willy Brandt im April 1933 im Auftrag seiner kleinen Sozialistischen Arbeiterpartei (SAP) fluchtartig nach Oslo übersiedelte, folgte ihm kurz darauf Gertrud Meyer, die ebenfalls in Lübeck geboren und eine Parteiaktivistin war wie er. Beide lebten dort wie Mann und Frau zusammen, bis Gertrud, die Willys Begabung erkannte und förderte, als Assistentin des Psychoanalytikers Wilhelm Reich in die USA emigrierte. Erst später erfuhr sie, dass Willy danach mit Carlota Thorkildsen liiert war, mit der er am 30. Oktober 1940 das Töchterchen Ninja bekam. Im Frühjahr 1941 war die Familie im schwedischen Exil, wo Willy und Carlota heirateten. Carlota, neun Jahre älter als ihr Mann, war eine gebildete Frau aus bürgerlicher Familie, mit eigenem großem Freundes- und Bekanntenkreis. Sie arbeitete bis 1940 als Assistentin am Institut für vergleichende Kulturforschung, während Willy sich mit Zeitungs- und Buchhonoraren eine auskömmliche Existenz erschrieben hatte.
Im Kreis der norwegischen Exilanten Stockholms lernte er Rut Bergaust kennen und lieben, ein Arbeitermädchen aus dem ostnorwegischen Hamar. Rut hatte bald nach ihrer Flucht über die schwedische Grenze ihren Jugendfreund Ole geheiratet, der unheilbar an Tuberkulose erkrankte und 1946 starb. Trotz schwerer Gewissensbisse konnte sie sich von der neuen Verbindung mit Willy nicht frei machen, und auch dieser war ja verheiratet und hing sehr an seiner kleinen Tochter.
Den unermüdlichen Briefeschreiber Willy lernte Rut zwischen Frühjahr 1945 und Frühjahr 1947 kennen, als die beiden räumlich mehr getrennt als zusammen waren. Über Oslo und Nürnberg, wo er als Pressekorrespondent über den Prozess gegen die deutschen Hauptkriegsverbrecher berichtete, führte ihn sein Weg nach Berlin. Dort arbeitete er während des Jahres 1947 als Presseattaché der norwegischen Militärmission im formalen Rang eines Majors. In dieser Zeit erreichten ihn die verschiedensten Angebote, so sollte er unter anderem in Lübeck die Führung der Sozialdemokratie oder das Bürgermeisteramt übernehmen. Er sinnierte darüber nach, wie er sich am besten nützlich machen konnte, und da schien die diplomatische Position im viersektoralen Berlin am besten geeignet, den Wiedereinstieg in die deutsche Politik vorzubereiten, auch wenn er diesen Weg zunächst nicht eindeutig und zielstrebig verfolgte. Klar war nur, dass ein dauerhafter Einsatz in oder für Norwegen nicht in Betracht kam. Seiner Tochter Ninja erklärte er am 4. Dezember 1947 in einem Brief, dass Deutschland dasjenige seiner »beiden Vaterländer« sei, dem es schlecht ging und das seiner Unterstützung am meisten bedurfte.
Die Zerstörungen, die materielle Not und der Hunger bestimmten 1947 das soziale Leben in Berlin. Es war unmenschlich kalt in diesem Winter 1946/47 und Brennholz knapp. Willy schrieb an Rut: »Ich pflege nicht zu beten … Sonst würde ich mich auf die Knie werfen und sagen: Lieber Gott, gib den hungernden Menschen in den zerstörten Häusern wenigstens etwas Wärme.« Das Elend war schwer erträglich. Seine Position, die in vieler Hinsicht privilegiert war, bereitete ihm Unwohlsein. Als Rut Ostern 1947 nach Berlin folgte, kamen sie als Angehörige der Alliierten Streitkräfte in einer beschlagnahmten Villa unter, wo sie zusammen mit anderen Angehörigen der Militärmission wohnten. Die Zeit war reich an Widersprüchen und grotesken Regeln. So verlangte die Hausordnung der Villa, dass Chauffeur und Putzfrau, die in der Villa beschäftigt und verheiratet waren, sich vom Garten fernzuhalten hätten, nachdem die »Herrschaften« nach Hause gekommen seien. Das unwürdige und unnatürliche Kolonialleben, so Rut, gehörte beendet.
Die Hausordnung wurde schnell entfernt, und im Januar 1948 wurde Willy Brandt Vertreter des SPD-Vorstands in Berlin und fungierte als Verbindungsmann zu Partei, Magistrat und den vier Siegermächten. Am 1. Juli 1948 erhielt er die deutsche Staatsbürgerschaft zurück, welche die Nationalsozialisten ihm 1938 genommen hatten. Am 4. September heirateten Willy und Rut Brandt, und genau einen Monat später kam der erste Sohn zur Welt, dessen Geburtsurkunde den kuriosen Eintrag enthält: »Peter Willy Frahm, genannt Brandt«.
Dass ich als »Frahm« geboren bin, wurde mir erst 1983 bei der Vorbereitung meiner ersten Hochzeit klar. Natürlich war der Name nie ein Problem für mich. Noch vor der Flucht aus Deutschland hatte mein Vater den Allerweltsnamen Herbert Frahm gegen den nom de guerre Willy Brandt getauscht und ihn dann bei der Rückkehr nach Deutschland beigehalten. Er verwendete in den ersten Exiljahren unterschiedliche Pseudonyme, aber »Willy Brandt« verfestigte sich so sehr, dass die Lebenspartnerin und spätere Ehefrau Carlota überrascht war zu erfahren, dass sie demnächst Frahm heißen würde. Die Begründung für den Namenswechsel fand ich stets plausibel: Die publizistische und politische Aktivität des Erwachsenen erfolgte fast ausschließlich unter dem Namen Brandt. Zum Geburtsnamen zurückzukehren, hätte etwas Künstliches gehabt. Mit diesem verband ihn »fast nichts als eine schwierige Kindheit«. Mit der gegenteiligen Entscheidung hätte er sich sogar dem Vorwurf aussetzen können, etwas aus den zurückliegenden Jahren verbergen zu wollen. 1949 wurde der Namenswechsel der Familie schließlich legalisiert. Da war Brandt schon Berliner Abgeordneter des Bundestags der neu gegründeten trizonalen Bonner Republik.
Die Kleinfamilie Brandt entstand gewissermaßen durch meine Geburt, mitten in der Blockade West-Berlins. Der Vater konnte, wie das früher so war, mit dem Winzling noch nicht viel anfangen. Bei dessen erstem Anblick soll er gesagt haben: »Na ja, er wird ja wohl mal etwas größer werden.« Mutter erzählte aber auch, dass er nach der Kunde von der geglückten Geburt eines Knaben sehr gerührt gewesen sei und die halbe Nacht gesungen und Mandoline gespielt hätte. Lars kam im Juni 1951 dazu und brachte uns quantitativ in den unteren Normbereich. Bei mir lösten die Ankündigung und das Erscheinen von Lars erheblichen Unwillen aus – ich soll einige Jahre danach ziemlich unausstehlich gewesen sein, ganz im Gegensatz zu den ersten zwei oder zweieinhalb Jahren. Aber ich hatte meinen jüngeren Bruder längst fest ins Herz geschlossen, als noch Matthias zur Welt kam – über zehn Jahre nach Lars und dreizehn Jahre nach mir. Der Abstand zu den älteren Geschwistern war so groß, dass Neid- oder Konkurrenzgefühle nicht mehr entstanden. Ich fühlte mich eher wie ein junger Onkel denn ein Bruder.
Für die Mutter war Matthias ein großes Geschenk. Sie konnte manche Frustration in ihrer Ehe durch die Hinwendung zu dem neuen Erdenbürger kompensieren. Der Vater musste zur Zeit der nicht risikolosen Geburt von Matthias eine USA-Reise absolvieren. Es waren die Monate kurz nach dem Mauerbau. Willy schien in jüngere Jahre zurückversetzt zu sein. Er erlebte einen emotionalen Ausgleich zu seinem fordernden Amt und wurde 1961/62 angesichts der weltpolitischen Turbulenzen mit der Doppelkrise um Berlin und Kuba zu Hause ständig an das Wesentliche im persönlichen Leben wie in der Politik erinnert.
Ninja, meine große Schwester, genauer gesagt: Halbschwester, die Vaters und meinen Geburtsnamen trägt, verbrachte regelmäßig einen Großteil ihrer Sommerferien bei uns in Berlin und verreiste bis in die siebziger Jahre regelmäßig mit Halbbrüdern, Stiefmutter und Vater. Als Ninja noch klein war, schrieb Willy ihr liebevolle Briefe, in denen er kindgerecht seine Tätigkeit erklärte und warum es wichtig sei, dass er in Deutschland arbeite. Auf jeden Fall gehörte Ninja ohne Wenn und Aber zu uns, und daran hatte meine Mutter großen Anteil.
Ansonsten war die väterliche Sippe überschaubar. Sie bestand aus einer Großtante zweiten Grades, einer Cousine der Großmutter, die als Krankenschwester in der Schweiz lebte und uns gelegentlich besuchen kam, Vaters Hamburger Cousine Erika, aus den Großeltern, Willys Halbbruder Günter und dem Pflegekind Waltraud. Auch Waltraud und Günter lebten, bereits erwachsen, in Lübeck zunächst in dem kleinen, sehr einfachen Haus der Großeltern (Außentoilette im Stall). Doch es gab auch einen großen Obst- und Gemüsegarten, mit Hühnern und zeitweise auch ein oder zwei Schweinen – in der frühen Nachkriegszeit ein Schatz. Er gab fast alles her, was zur Ernährung benötigt wurde.
Günter arbeitete bis zu seiner Pensionierung als Vollzugsbeamter in einer Strafanstalt. Die beiden hatten kein enges, aber ein gutes Verhältnis. Onkel Günter erzählte, sie hätten manchmal viel Spaß zusammen gehabt. Willy, der eigentlich nicht mehr rauchen sollte, hat sich mit ihm in seine Wohnung zurückgezogen, und dann wurde stundenlang lustvoll gequalmt, denn Günter frönte demselben Laster. Es war eine Art Rauchverschwörung.
Oma und Opa standen bei Lars und mir in höchstem Ansehen: Sie, Martha, war eine liebe und herzliche, doch unsentimentale Frau, bei der ich 1955 gern meine ersten Schulsommerferien verbrachte. Er, Emil, war ein gütiger und bärenstarker Mann, mit spezifischem Humor. Bis zu seinem 76. Lebensjahr arbeitete er als Maurerpolier auf dem Bau. Selbst danach half er Bekannten und Nachbarn, mauerte ihnen Garagen und mehr. Martha und Emil Kuhlmann waren schon vor 1933 Sozialdemokraten und wurden nach Hitler wie selbstverständlich wieder in der SPD und der Gewerkschaftsbewegung aktiv. Dass Opa nicht der leibliche Großvater war, wusste ich irgendwann irgendwie, aber es interessierte mich nicht.
Einmal im Jahr wurde gefeiert: Opa hatte Geburtstag, und wir reisten an. Das Haus quoll über von Gästen aus der Nachbarschaft und der Arbeiterbewegung, ergänzt um die kleine Verwandtschaft. Lebhaft erinnere ich mich an Opas Achtzigsten. Bei diesen Festen wurde hauptsächlich gesungen: Volks- und jugendbewegte Lieder, Arbeiter- und Spottlieder, und der Ehemann von Vaters Cousine Erika, der Arzt Walter Moritz, der als Student wohl einer schlagenden Verbindung angehört hatte, erweiterte dieses breite Repertoire noch um das Liedgut des »Deutschen Kommersbuchs«. Natürlich gab es reichlich feste und flüssige Nahrung. Bier und Schnaps flossen in Strömen. Vielleicht hat sich mein Vater, wie Mutter in ihrem Erinnerungsbuch berichtet, tatsächlich bei manchen Unterhaltungen mit Oma und Opa gelangweilt, weil ihm die Mitteilungen nichts sagten oder allzu kleinkariert vorkamen. Bei Opas Geburtstagen fühlte er sich jedoch unverkennbar wohl und genoss das fröhliche, unverkrampfte Gemeinschaftserlebnis. Beide Großeltern starben kurz hintereinander im Jahr 1969.
Willy Brandt hielt seine Mutter stets in Ehren und ließ nichts auf sie kommen. Er fand, dass er ihr – trotz der ungünstigen Umstände seiner Kindheit – manches verdankte, so zum Beispiel seine Beharrlichkeit. Auch scheint sie ihm von Anfang an viel zugetraut und ihn so zumindest indirekt bestärkt zu haben. Lübeck blieb er emotional verbunden. Und der vorletzte Auftritt in jedem Wahlkampf fand während der sechziger und frühen siebziger Jahre stets in Lübeck statt – der letzte, rein symbolisch, in Berlin. Willy hielt nicht nur regen Briefkontakt zur Mutter, sondern schickte in den äußerst kargen Nachkriegsjahren regelmäßig Päckchen. An deren Stelle trat dann später eine finanzielle Unterstützung. Als die Großeltern gestorben waren, verzichtete er zugunsten von Günter komplett auf sein Erbteil. (Merkwürdigerweise konnte er das für seine ebenfalls bedachten Söhne gleich mittun, die sicher nichts dagegen gehabt hätten, aber der Einfachheit halber gar nicht erst gefragt wurden.)
Man kann Willy, der für seine Mutter immer »Herbert« blieb, im Verhältnis zu ihr nichts vorwerfen. Dennoch: Auffällig, und für mich schon als Kind erkennbar, war die emotionale Befangenheit zwischen Mutter und Sohn. Der briefliche und mündliche Austausch war ziemlich nüchtern. Martha zeigte Mutterliebe und Mutterstolz auf ihre Art, wenn sie bei Besuchen in Lübeck dem erfolgreichen Spross das größte und beste Stück des Festtagsbratens auftat.
Viel zahlreicher als die väterliche Lübecker Verwandtschaft war die mütterliche norwegische. Willy wurde widerspruchslos eingemeindet. Ruts Vater starb, als sie noch ein kleines Kind war, und auch von der 1955 relativ jung verstorbenen Großmutter habe ich kaum noch ein Bild vor Augen. Drei Schwestern meiner Mutter, daneben etliche Vettern und Cousinen, bildeten mit den jeweiligen Ehepartnern und Kindern eine beachtliche Schar. Bei Urlauben in Norwegen ergaben sich daraus Verpflichtungen, die Vater mit zunehmendem Alter etwas lästig wurden: nicht, dass er die Schwägerinnen und Schwippschwäger nicht gemocht hätte. Aber es war doch ziemlich viel Verwandtschaft. Als Erwachsener konnte ich das nachvollziehen. Gesprächsstoff ergab sich am ehesten mit Arthur Martinsen, dem Mann von Ruts Lieblingsschwester Tulla, die eigentlich Martha hieß. Arthur war außenpolitischer Redakteur der sozialdemokratischen Regionalzeitung Hamar Arbeiderbladet und ein autodidaktisch gebildeter, hilfsbereiter Mann, der allerdings bisweilen ein wenig penetrant sein konnte. Willy und Arthur kannten sich schon aus dem Stockholmer Exil.
Die häusliche Verkehrssprache war die ersten Jahre Norwegisch: Die Eheleute hatten sich in dieser Sprache kennengelernt, und außerdem hatte es Vater, der ungewöhnlich sprachbegabt war, während der dreißiger Jahre zu einer absoluten Perfektion im Norwegischen gebracht, während Mutter sich lange mit dem komplizierteren Deutschen schwertat, insbesondere mit der Grammatik. Während die Eltern untereinander überwiegend bei Norwegisch blieben, setzte sich bei meinem Schulbeginn 1955 Deutsch als Familiensprache durch. Denn aus welchen tiefenpsychologischen Gründen auch immer – von da ab weigerte ich mich, zu Hause Norwegisch zu sprechen, obwohl ich die Sprache meiner Mutter fließend beherrschte, in Norwegen auch künftig gern benutzte und vorher keine Schwierigkeit gehabt hatte, zwischen den beiden germanischen Sprachen hin- und herzuwechseln.
Mir ist verschiedentlich kolportiert worden, Vater hätte sich so gut wie gar nicht um seine Kinder gekümmert. Für die schulischen Angelegenheiten stimmt das weitgehend. Ich bin nicht sicher, ob er jemals einen Elternabend besucht hat. Allerdings kam er, wenn es sich einrichten ließ, zu musikalischen oder schauspielerischen Aufführungen, an denen die Söhne beteiligt waren. Vermutlich hat Mutter ihn gedrängt. Diese Enthaltsamkeit erklärt sich so: Erstens hatte er tatsächlich wenig Zeit, und jedermann verstand das. Zweitens hatte er wohl auch wenig Lust. Drittens hielt ihn zu Recht die Sorge ab, jede seiner Äußerungen und Interventionen könnte falsch verstanden werden. Nur einmal griff er ein, als ein als tyrannisch gefürchteter Lehrer mir wegen eines spontan zum Banknachbarn geflüsterten Kurzkommentars eine Strafarbeit aufbrummte, die mich nach den bis zum frühen Abend dauernden regulären Hausaufgaben noch weitere Stunden beschäftigt hätte. (Die Strafen steigerten sich im Verlauf der Unterrichtsstunde, ungeachtet der Schwere des Vergehens.) Da beschloss Vater, mich von der Strafarbeit zu suspendieren und dem Lehrer einen höflichen und nicht unfreundlichen, aber deutlich kritischen Brief zu schreiben. Während er den von mir übergebenen Brief las, verspannten sich die Gesichtszüge des Pädagogen, und er erklärte, jetzt keine Strafarbeiten, sondern nur noch Rügen, Tadel und schlechte Noten zu vergeben. Von alledem teilte er ohnehin reichlich aus. Nach einigen Wochen war der »gute Vorsatz« aber wieder vergessen.
Wenn ich an unser Familienleben zurückdenke, kann ich das Verdikt der Vernachlässigung durch den Vater nicht bestätigen. Dabei fällt sicher ins Gewicht, dass er in den fünfziger und frühen sechziger Jahren noch recht jung war und die berufliche Tätigkeit ein halbwegs normales Leben ermöglichte. Für Matthias war das in der Bonner Zeit wohl anders. Er erlebte den Vater als »emotional behindert«. Gewiss war Vater vergleichsweise wenig zu Hause. Außer Sonntagmittag fanden die Mahlzeiten ohne ihn statt. Und selbst sonntags mussten wir manchmal stundenlang auf ihn warten. Manchmal wurde das Essen mehrmals aufgewärmt, bis er endlich doch eintraf. Für den Fall, dass er zu einer zivilen Zeit heimkam, hatte er stets Arbeit dabei. Ich war als Kind und Jugendlicher davon fasziniert, dass er, so schien es jedenfalls, gleichzeitig Abendbrot essen, fernsehen, einen Text entwerfen und sich unterhalten konnte.
Er war sicherlich nicht das, was man einen Familienmenschen nennt. Und die Anwesenheitszeiten zu Hause waren in seinem Fall besonders knapp bemessen. Trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, etwas zu vermissen. Vermisst habe ich hauptsächlich die ausschweifenden Erzählungen der anderen Väter vom Krieg, wo sie sich je nach Temperament und Einstellung heldenhaft oder listig durchgeschlagen, dabei nicht selten – wie in Franz Josef Degenhardts Lied – abwechselnd den Iwan das Fürchten gelehrt und den Nazigenerälen in den Arsch getreten hatten. Man erfuhr auch so grundlegende Weisheiten wie die, dass der Amerikaner alles mit Material macht – nicht ganz verkehrt – , der Franzose militärisch nur bedingt und der Italiener gar nicht ernst zu nehmen sei, anders als der Engländer, dem man trotz der Flächenbombardements (die die Frontkämpfer ja nicht direkt mitbekommen hatten), Achtung zollte, auch wegen seines ritterlichen Verhaltens gegenüber den deutschen Soldaten zu Wasser und zu Lande.
Alle damit verbundenen Erzählerlebnisse, die die Phantasie der Knaben anregten, blieben mir natürlich versagt. Nun hätte mein Vater das mehr als kompensieren können durch Schilderungen aus dem Untergrund im »Dritten Reich« und im besetzten Norwegen, von den abenteuerlichen Fluchten 1933 und 1940, auch aus dem Spanischen Bürgerkrieg. Doch es entsprach nicht seiner Persönlichkeit anzugeben, den Kindern gegenüber die eigene Rolle herauszustellen, geschweige denn das eigene Verhalten zu überhöhen. Ich musste ihm fast alles aus der Nase ziehen. Was ich dabei erfuhr, ließ mich im Freundeskreis mithalten, wenn es darum ging, durch Berichte über die Taten der jeweiligen Väter das Prestige in der Gruppe zu festigen.
Ich erhielt im Lauf der Zeit von seinen Reisen viele Ansichtskarten, manchen Brief – knapp, freundlich, informativ und selten persönlich. Besonders in meinen Kindertagen nahm Vater gern Bezug auf die ihm bekannten Faibles beim Sohn. So sollte meine Mutter mir von einer Amerikareise ausrichten – der Brief trägt das Datum 4. März 1954 – , dass Vater »noch keinen Kontakt zu irgendwelchen Büffeln hatte. Neger habe ich hingegen zu Tausenden gesehen und einige wenige Indianer.« Die Political Correctness im Ausdruck war, wie man sieht, noch nicht entdeckt …
Als Kind muss ich den Vater, so wird berichtet, bei allen sich bietenden Gelegenheiten mit Fragen aller Wissensbereiche gelöchert haben. Zugleich wollte ich ihm stets mitteilen, was mich bewegte. Auf Spaziergängen um den Schlachtensee, ein solcher dauerte etwas über eine Stunde, erzählte ich ihm gern die Handlung der soeben zu Ende gelesenen Romane, etwa Jules Vernes »Kurier des Zaren« oder Felix Dahns »Kampf um Rom«. Mit großer Geduld und, wie mir schien, sogar mit Freude hörte er sich diese Schilderungen an.
Zweifellos profitierte ich davon, dass unsere Wohnung, hauptsächlich das väterliche Arbeitszimmer, immer voller Bücher war: Nachschlagewerke, Belletristik, darunter preiswerte Klassikerausgaben verschiedener Ursprungsgebiete und Sprachen, Sachbücher, nicht nur politische und historische, sozialistische Broschüren und Hefte aus vergangenen Jahrzehnten, doch auch Schriftgut ganz anderer ideologischer Ausrichtung, nicht zuletzt aus der NS-Zeit. Ich kann mich nicht erinnern, dass mein Vater mich jemals gebremst oder angeleitet hätte, wenn ich in seinen Schätzen stöberte und schmökerte. Nur Zurückstellen sollte man das Entnommene. Die Vorstellung, dass man durch »falsche« Lektüre infiziert werden könnte wie von einem Bazillus, war ihm fremd. Zumindest bei den Söhnen vertraute er auf die letztendliche Kraft der Vernunft.
Wenn Vater da war und sich Zeit für die Familie, die Söhne oder einen von ihnen nahm, dann war er auch präsent. Ich erinnere mich an Brett- oder Kartenspiele, an Fahrten mit dem Ruderboot auf dem Schlachtensee, an Museums- und Theater-, seltener an Kinobesuche. Auch an Ausflüge in dörfliche Ortsteile und zu den um Berlin reichlich vorhandenen Wäldern und Seen. Gelegentlich ging es in den Ostsektor. Die sowjetisch besetzten Stadtbezirke konnten bis August 1961 problemlos besucht werden. So fuhren wir 1960 zum berühmten Pergamonaltar. Diese privaten Besuche in Ost-Berlin hatten wohl auch etwas Demonstratives. Der Westberliner Senat beanspruchte (wie ursprünglich der Ostberliner Magistrat), die legale und legitime Regierung ganz Berlins zu sein. Und der Viermächtestatus beinhaltete bis zum Mauerbau nach allgemeiner Auffassung eben auch die Freizügigkeit in der ganzen Stadt.